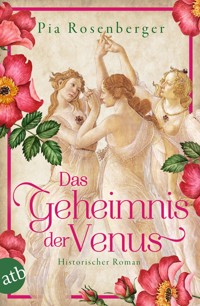10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie die Jeans nach Deutschland kam.
Künzelsau, 1932: Der Holzhandel der Familie Hermann ist bankrott. Luise Hermann steht mit ihren Kindern Erika und Rolf vor dem Nichts. Neue Hoffnung schöpft sie erst, als sie eine Näherei eröffnet. Doch dann kommen die Nazis an die Macht. Erikas Jugendliebe muss fliehen, und ihre beste Freundin Lia zieht es in das kriegsgebeutelte Berlin. Als Erika einen jungen Offizier kennenlernt, ahnt sie weder, dass er ihre große Liebe wird, noch, dass ihnen eines Tages ein blauer Stoff in die Hände fällt, der die Mode in Deutschland revolutionieren wird ...
Inspiriert von wahren Begebenheiten – das Schicksal dreier mutiger Frauen und die Geschichte der ersten deutschen Jeans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Künzelsau, 1932: Nach dem Tod ihres Mannes steht Luise Hermann allein mit ihren Kindern Erika und Rolf und dem bankrotten Holzhandel der Familie da. Doch aufgeben kommt nicht infrage. Luise krempelt die Ärmel hoch und setzt alles auf eine Karte: Im ersten Stock ihres Hauses richtet sie eine Näherei für Berufsbekleidung ein. Nach einem erfolgreichen Start schöpfen die Frauen in der Villa Hermann, zu denen auch Haushälterin Marga und ihre clevere Tochter Lia gehören, neue Hoffnung. Diese wird jedoch von der Machtübernahme der Nazis schnell überschattet. Als Erikas erste große Liebe aus Deutschland fliehen muss, der Krieg über sie hereinbricht und es Lia, eine talentierte junge Schneiderin, nach Berlin verschlägt, geraten all die mühsam erbauten Zukunftspläne ins Wanken. Doch dann lernt Erika einen jungen Offizier kennen, der ihnen eines Tages zu dem Modestück verhelfen wird, das nicht nur Luises Näherei für immer verändert, sondern auch ein neues Lebensgefühl mit sich bringt.
Über Pia Rosenberger
Pia Rosenberger wurde in der Nähe von Osnabrück geboren und studierte nach einer Ausbildung zur Handweberin Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Pädagogik. Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin.Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Die Bildhauerin«, »Die Künstlerin der Frauen« und »Colette« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Pia Rosenberger
Wir Frauen aus der Villa Hermann
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog — Herbst 1948
Teil I
1. — Winter 1932
2.
3.
4.
5.
6.
7. — Sommer 1937
8.
9.
Teil II
10. — Sommer 1938
11.
12. — Herbst 1938
13. — Frühjahr 1939
14.
15.
16.
17. — Herbst 1941
Teil III
18. — Herbst 1941
19. — Winter 1943
20. — Herbst 1944
21. — 3. Februar 1945
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Teil IV
31. — September 1948
32.
33.
34.
35. — Frühjahr 1949
36.
37.
38.
39.
40.
Epilog
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Herbst 1948
Lia stand vor der Tür der Soldatenkneipe im Frankfurter Bahnhofsviertel und zögerte. Laute Jazzmusik drang hinaus auf den Gehweg, wenn hin und wieder ein angetrunkener GI an ihr vorbei ins Freie stolperte. Warum ließ er sie warten? Sollte sie allein hineingehen? Gestern hatten sie die Amihosen ergattert, Levi’s 501. Und heute hatte sie den geschenkten Tag dazu benutzt, sich mit einer der blauen Arbeitshosen, einer weißen Bluse, einem getupften Haarband und ein paar Pumps auszustaffieren. Blue Jeans. Lia spürte dem Klang der Wörter auf ihren Lippen nach. Sie schmeckten nach Freiheit und Verheißung … Aber vielleicht war sie zu mutig gewesen, um sich damit in die Öffentlichkeit zu trauen.
Sie hatte die kleinste gewählt, die von Mister Mickrig persönlich, bei der sie nur die Hosenbeine ein wenig hochkrempeln musste. Ein Gürtel hielt die Blue Jeans auf ihren Hüften.
Sie sah auf, als sich ein deutsches Fräulein und ihr amerikanischer Freund eng umschlungen an ihr vorbeidrängten und die Kneipe betraten. Sollte sie es wagen? Sie atmete tief durch, nahm ihren ganzen Mut zusammen und folgte dem Paar durch die Tür. Sofort dröhnte die Musik in ihren Ohren. Etwas Bläserlastiges, Flottes drang aus der Jukebox. Der Lärm war wie eine Mauer, gegen die sie anrannte, und der Rauch zum Schneiden dick.
Hätte sie besser draußen warten sollen? Zumindest in dieser Aufmachung? Nein. In Sachen Mode verließ sie sich am besten auf sich selbst, und was sie trug, war schick und innovativ. Aber vielleicht trugen ehrenwerte Frauen in den USA ja ebenso wenig Hosen wie hier. Unwillkürlich fragte sich Lia, ob es beim Militär auf der Base auch Luftwaffentechnikerinnen gab.
Sie schaffte es bis zur Theke, hinter der ein junger Typ mit einer aufwendig frisierten Tolle lässig ein Glas polierte, und bestellte eine Cola.
»Du warst gestern schon da«, erinnerte er sich. »Mit dieser Gruppe von Amis und Deutschen. Von wegen Verbrüderung mit dem Feind.« Er hob die Augenbrauen, als ihm ihre Hose auffiel. »Ist das Absicht oder ein ganz übler Irrtum?«
»Absicht.« Lia hoffte, dass er nicht bemerkte, wie sie errötete. Scharlachrot wirkte zu leuchtend roten Haaren nicht besonders kleidsam.
Der Barkeeper füllte ihr Glas. »Ich habe mich schon gestern gefragt, was ihr mit den Ami-Arbeitshosen wollt. Etwa die Damenmode revolutionieren?«
Lia beschloss, den Hohn in seiner Stimme zu überhören. »O nein. Sie sollen uns neue Ideen für Berufsbekleidung liefern. Für den Herrn. Aber ich hatte die Idee, sie einmal selbst anzuprobieren.«
Der Barkeeper lachte lauthals. »Du siehst aus wie ein Cowgirl. Was willst du fangen? Einen Bullen? Da gibt es hier eine ganze Herde.« Er schob die Cola über die Theke. »Soll ich etwas Rum reintun?« Er beugte sich vertraulich vor. »Damit trinken die Fräuleins sich hier Mut an. Vielleicht vergisst du dann deine peinliche Aufmachung.«
Lia lachte, obwohl sein Spott sie verunsicherte. »Nein danke. Ich komme ohne aus.« Mut hatte sie schon ihr ganzes Leben lang beweisen müssen. Und ansprechen würde sie heute ohnehin niemanden, denn sie wartete auf jemand Besonderen.
Sie lenkte den Blick zu den Tanzenden. Die jungen Frauen sahen in den muskulösen Armen ihrer amerikanischen Verehrer viel zu zart aus. Sie trugen löchrige Pullover und fadenscheinige Röcke bis zum Knie, mit Stoffstücken geflickt und mehrfach gewendet. Sicher träumten sie von finanzieller Sicherheit, Schick und Eleganz. Lia nahm sich vor, ihnen dabei behilflich zu sein, das kleine Glück zu erlangen, das aus Kammgarn, Seide und Baumwolle bestand. Und noch nicht aus diesem unverwüstlichen Stoff, aus dem die Träume amerikanischer Mechaniker waren.
Unversehens löste sich ein GI in einer beigen Uniform aus der Menge und forderte Lia zum Tanzen auf. Bulle kam schon hin, seinen breiten Schultern nach zu urteilen. Lia holte tief Luft. »No.« Das war das wichtigste englische Wort überhaupt und eins der wenigen, die sie kannte.
Seine Augen wurden groß. »But why not? You look enchanting.« Er strich sich nervös über seinen ausrasierten Nacken.
Lia lehnte noch einmal ab, obwohl der letzte Satz nach einem Kompliment geklungen hatte. »Ich warte auf jemanden.«
»Why not, cowgirl?« Jetzt klang seine Stimme unangemessen besitzergreifend. Lia runzelte die Stirn. Gehörte er zu den Männern, die es nicht vertrugen, wenn Frauen ihnen einen Korb gaben? Aber wie sollte sie ihm bei ihren mangelnden Englischkenntnissen verklickern, dass sie vergeben war? Lia dachte fieberhaft nach, als sich von hinten eine warme Hand auf ihren Arm legte. Ihr wurde schwindlig vor Erleichterung.
»Because she belongs with me«, sagte der junge Mann, der hinter ihr stand.
Teil I
1.
Winter 1932
Es war ein bitterkalter Sonntag Ende Februar. Luise Hermann saß in ihrer Bank in der Johanneskirche und wartete sehnsüchtig auf das Ende des Gottesdienstes.
Die beiden Engel unter dem Triumphkreuz sahen auf sie herab, als sei nichts geschehen. Normalerweise kam sie zur Ruhe, wenn sie den Blick auf sie lenkte und den Klängen der Orgel lauschte. Heute aber nicht, und das lag weder an der schlaflosen Nacht, die hinter ihr lag, noch an ihren Füßen, die in ihren abgetragenen Stiefeln langsam zu Eisblöcken erstarrten. Nein, es war das Getuschel, das sich wie Pfeilspitzen in ihren Rücken bohrte.
»Hochmut kommt vor dem Fall.«
In der Bank hinter ihr saßen die Frau des Bürgermeisters und die Apothekerin Auweiler, diese Heuchlerinnen, die ihr nach Heinrichs Tod tränenreich ihr Beileid ausgedrückt hatten. O nein, auch wenn sie es darauf anlegten, Luise würde sich nicht dazu herablassen, sich umzudrehen. Stattdessen seufzte sie und knetete ihre schwarze Kappe in den Händen. Aus der respektablen Bürgerin Luise Hermann war über Nacht eine bettelarme Witwe geworden. Hättest du nur besser gewirtschaftet, Heinrich!, durchfuhr es sie. Aber nein, er konnte nichts dafür. Sein einziger Fehler war, dass er nicht mit ihr gesprochen hatte. Die Weltwirtschaftskrise hatte ihrem Holzhandel in Hohenlohe schon vor Jahren das Genick gebrochen. Heinrich hatte es nur nicht wahrhaben wollen.
Der Gottesdienst war noch lange nicht vorbei. Als Pfarrer Peters auf die Kanzel stieg und predigte, versteckte Luise ein Gähnen hinter der geöffneten Hand. Mochte der Heiland ihr nachsehen, dass sie seine Worte über sich hinwegrinnen fühlte wie Wasser. »Und spräche ich: Finsternis breche über mich herein und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht …« Ihre Gedanken verlangsamten sich, und der Kopf sank ihr auf die Brust. Minuten später rissen sie die mächtigen Klänge der Orgel aus dem Halbschlaf. Es folgten das Vaterunser und ein Choral, dann leerten sich die Reihen in Richtung Ausgang. Du meine Güte, war sie wirklich in der Kirche eingeschlafen?
Sie wollte schon in der Menge verschwinden, als sie Pfarrer Peters in Richtung Sakristei gehen sah. Auch wenn es ihr schwerfiel, sie würde das Gespräch mit ihm nicht länger vor sich herschieben. »Herr Pfarrer, hätten Sie einen Moment Zeit für mich?«
»Was gibt es denn, Luise?« Peters ließ seine blauen Augen auf ihr ruhen. Er war ein schwergewichtiger Mann mit einer goldenen Brille, der seine verbliebenen Haarsträhnen hartnäckig über seine Glatze kämmte. Luise richtete sich auf. Mit ihrer Körpergröße von fast 1,80 Metern überragte sie ihn deutlich; ein Umstand, mit dem viele Männer nicht umgehen konnten. »Ich brauche Ihren Rat.«
»Dann komm.« Er ging ihr voran in den Nebenraum, in dem ein großer Tisch und ein paar Stühle standen. »Setz dich doch, Luisle.«
Nicht viele Leute durften sie so nennen, aber bei Peters, der sie getraut und ihre Kinder getauft hatte, mochte die vertrauliche Anrede angehen. Befangen nahm sie Platz.
Warum nur hatte Heinrich sie alleingelassen? Als ihre Wahl vor gut zehn Jahren auf ihn gefallen war, hatten sie beide nicht ahnen können, dass ihm auf Erden nur so wenig Zeit beschieden war.
»Wie geht es dir denn?«, fragte Dekan Peters mitfühlend. »Kommst du zurecht?«
Er goss ihr Wasser aus einer Karaffe ein. Luise trank durstig. »Die Holzhandlung ist bankrott. Was soll ich tun?«
Nichts war ihr je schwerer gefallen, als das zuzugeben. Aber die Wahrheit musste ans Licht.
»Ich habe davon gehört«, sagte der Pfarrer mitfühlend und faltete seine kräftigen Finger.
Luise schnaubte. Anscheinend war ihre missliche Lage schon Stadtgespräch. »Das Geschäft mit dem Holz läuft schon lange schlecht. Die Preise sind am Boden. Aber wie schlimm es wirklich steht, habe ich erst nach der Beerdigung erfahren.«
Über 200 Leute hatten sich auf dem Friedhof rund um das offene Grab versammelt, beim Leichenschmaus ordentlich zugelangt und ihren Weinkeller leer getrunken. Tage später waren die Forderungen der Gläubiger ins Haus geflattert, und Luise hatte das getan, was Heinrich seit Monaten versäumt hatte. Sie hatte die Stapel ungeöffneter Post auf dem Schreibtisch durchgesehen und sich mit jedem Brief elender gefühlt.
Peters sah sie an. »Und wie kann ich dir helfen, Luise?«
»Ich weiß es nicht.« Plötzlich hatte sie Skrupel, seine Zeit in Anspruch zu nehmen. Sicher wartete die Pfarrersfrau daheim schon mit dem Sonntagsbraten auf ihn.
Peters holte tief Luft. »Hör mir zu, Luise. Ich überschreite meine Kompetenzen, wenn ich mich in Geschäftliches einmische, und ich darf auch keines meiner Pfarrkinder vorziehen, aber mein Rat in dieser Sache ist klar. Du solltest verkaufen.«
Luise schüttelte den Kopf. Tränen traten ihr in die Augen. »Aber ich kann doch nicht Heinrichs Lebenswerk verscherbeln, das einmal die Zukunft meines Sohnes werden soll.«
Ihr Mann hatte sich zum Holzhändler hochgearbeitet. Das Geschäft war sein ganzer Stolz gewesen, und seine Kinder sollten es einmal besser haben als er.
Peters nickte langsam. Sie konnte sein Mitgefühl kaum ertragen. Die stolze Luise, die immer den Kopf so hochtrug, war unter die Bittsteller gegangen.
»Und wenn du dich an Johanna und Rupprecht wendest?«, fragte er.
Sie schüttelte vehement den Kopf. Bis sie ihre Schwester und ihren geizigen Mann um Hilfe bitten würde, musste noch viel Wasser den Kocher hinabfließen. Sie stand auf und glättete ihren Mantel. »Ich sollte jetzt gehen.«
Sie stand schon an der Tür, als Peters sie zurückrief.
»Du bist eine Frau, Luise«, sagte er leise. »Zu viel geschäftlicher Einsatz ziemt sich nicht für dein Geschlecht.«
Sie nickte widerwillig und spürte ein Beben in sich aufsteigen. Ob vor Kälte, vor Enttäuschung oder vor Müdigkeit wusste sie nicht.
»Bleib im Vertrauen auf Gott, Luise.« Peters deutete auf das Kruzifix an der weißen Wand. »Und noch etwas. Ich sage es nur, weil du es sowieso bald erfährst. Der Thalheimer ist drauf und dran, dir ein Angebot zu machen. Er will dir den Holzhandel abkaufen.«
Alfred Thalheimer war ihr größter Konkurrent. Natürlich hatte der Pfarrer von seinen Plänen gehört, denn schließlich traf er sich immer mittwochs mit den Künzelsauer Honoratioren zum Stammtisch, dem gleichen, den auch Heinrich besucht hatte.
»Aber dann bleibt uns nichts mehr«, wandte sie ein. Sie hatte keine Bitte äußern wollen, aber jetzt sprang sie über ihren Schatten. »Könnten Sie für mich eintreten, dass man mir einen kleinen Zahlungsaufschub gewährt? Es muss auch keine Stundung sein. Ich brauche nur etwas Zeit, um wieder auf die Beine zu kommen.«
Peters Hände glätteten seinen schwarzen Talar. »Da ist zu viel Stolz in dir, Luisle. Vielleicht will Gott ja, dass du dich der Demut besinnst, die einer Frau gut zu Gesicht steht.«
»Und dass ich zu Kreuze krieche? Besten Dank!«
Sie schlug die Tür hinter sich zu und blieb schwer atmend im Gang stehen. Es war klar, dass der Künzelsauer Klüngel keine Frau unter sich dulden würde, schon gar nicht als Konkurrentin. Sie musste selbst sehen, wie sie zurechtkam.
Draußen wehte ein so kalter Ostwind, dass sie sich den Mantel zuknöpfte und die Kappe über die Ohren zog. Der Himmel war grau. Am Straßenrand türmte sich der Schnee zu schmutzigen Wällen, und auf den Pfützen knackte das Eis.
Eilig lief Luise nach Hause und blieb in der Austraße für einen kurzen Augenblick vor der geräumigen Villa mit dem Walmdach stehen. Heinrich hatte ihr unbedingt etwas bieten wollen. Das schöne Haus, die Urlaubsreisen nach Österreich und Sylt, der Nerzmantel, das Auto, die Käthe-Kruse-Puppe für Erika, und der Märklin-Baukasten für Rolf. Das alles sollte zeigen, dass er es geschafft hatte. Aber dann hatte sich ihr Glück gewendet.
Nach dem Weltkrieg hatte Deutschland sich nicht wieder aufrappeln können. Zuerst hatte der Versailler Vertrag den Grundstein für den wirtschaftlichen Ruin der jungen Weimarer Republik gelegt, dann folgten Inflation, Massenarbeitslosigkeit und schließlich der Börsencrash in New York. Heinrichs Firma hatte der desolaten Lage lange standgehalten, aber irgendwann hatte es auch sie erwischt.
Sie durchquerte den winterlich kahlen Garten, schloss die Tür auf und trat in das holzgetäfelte Foyer. »Ich bin wieder da!«
Aus der Küche duftete es verlockend nach Rinderbraten und Spätzle. Luise knurrte der Magen. Noch war die Vorratskammer gut gefüllt. Und sie würde, koste es, was es wolle, dafür sorgen, dass es so blieb.
Erschöpft hängte sie Mantel und Kappe an die Garderobe und steckte ein Kämmchen in ihrer Hochsteckfrisur fest. Ihr neues Trachtenkleid hatte weinrote und dunkelgrüne Streifen. Das Schwarz der ersten Trauerzeit hatte sie nicht mehr ertragen.
»Da sind Sie ja endlich.« Ihre Haushälterin Marga kam aus der Küche und trocknete sich die Hände an ihrer Schürze ab. Hinter ihrem Rücken lugte dieses Koboldkind Lia mit seinen brandroten Locken hervor. Die Kleine war einer der Gründe dafür, dass Luise Marga als Einziger ihrer Dienstboten nicht gekündigt hatte.
Luise erinnerte sich an den grauen Novembertag vor zwei Jahren, an dem die Frau aus Berlin mit ihrem Koffer in der einen und dem kleinen Mädchen an der anderen Hand vor ihrer Tür gestanden und sich nach der ausgeschriebenen Stelle als Haushälterin erkundigt hatte. Sie hatte Referenzen aus den besten Berliner Häusern vorgelegt und seitdem die Familie niemals enttäuscht. Sie fand sich schnell in die deftige hohenlohische Küche ein und überwachte die Arbeit der Hausmädchen zu Luises Zufriedenheit. Auch Heinrich war gut mit ihr zurechtgekommen. Aber die Gründe, die Marga mit ihrem Kind in die Provinz getrieben hatten, kannte Luise bis heute nicht. Macht nichts, dachte sie. In gewisser Weise teilten sie ihr Schicksal. Marga war mit Lia so allein wie sie nun mit ihren beiden Kindern und damit das, was einer Schicksalsgefährtin am nächsten kam.
»Oben sitzen die Geier und warten sehnsüchtig auf Sie, Frau Hermann. Der Thalheimer, der Huber und der Wagner von der Hohenloher Bank.«
Luise sank das Blut mit einem Schlag in die Beine. »Die haben gut lachen.« Statt in die Kirche zu gehen, drückten die Herren ihre fetten Ärsche in Heinrichs Ledersesseln platt und gierten nach seinem Lebenswerk. »Und wo stecken Erika und Rolf?«
Marga deutete mit der Hand zur Treppe. »Oben. Sie waren sehr brav, haben den Wein geholt und serviert.«
Luise holte tief Luft. »Könnten Sie schon gemeinsam mit den Kindern essen? Ich schicke sie Ihnen runter.« Es gelang ihr nicht ganz, die Panik aus ihrer Stimme zu verbannen.
»Aber sicher.« Marga sah sie eindringlich an. »Und lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen. Schmeißen Sie sie raus, sobald es geht!«
Als Luise die Treppe hinaufstieg, fiel ihr ein weiterer Grund ein, warum sie Marga nicht entlassen konnte. Sie stärkte ihr bei all ihren Kämpfen den Rücken.
Das Haus hatte zwei Etagen mit geräumigen Zimmern voller gediegener Eichenmöbel, persischer Teppiche und schwerer goldglänzender Vorhänge. Im ersten Stock gruppierten sich die Zimmer rund um eine großzügige Diele mit Eichenparkett. Luise brauchte keinen Überfluss in ihrem Leben, aber für Erikas und Rolfs Erbe würde sie kämpfen wie eine Löwin.
»Mama!« Der sechsjährige Rolf, der mit seiner Schwester Erika vor der geschlossenen Tür des Arbeitszimmers gewartet hatte, rannte auf sie zu und vergrub sein Gesicht in ihrem Rock.
»Marga hat mir erzählt, dass ihr die Männer empfangen habt. Wann sind sie denn gekommen?«
»So gegen 11 Uhr.« Erika war eine lang aufgeschossene Neunjährige mit blonden Zöpfen. »Wir haben ihnen Wein und Schnaps gebracht und Salzgebäck.«
»Das habt ihr gut gemacht«, lobte sie Luise.
»Vielleicht sind sie ja schon so besoffen, dass sie vom Stuhl fallen«, hoffte Rolf.
Luise musste grinsen. »Ich mach das schon. Ihr beiden esst schon mal mit Marga und Lia zu Mittag.«
»Und danach?«, fragte Erika hoffnungsvoll. »Dürfen wir dann raus?«
»Meinetwegen.« Das wäre am Sonntagmittag normalerweise nicht infrage gekommen, aber Luise erwischte sich immer wieder dabei, wie sie Ausnahmen machte. Die frische Luft würde den Kindern sicher guttun. Ihre Hausaufgaben und Erikas Fortschritte bei ihren ersten gehäkelten Topflappen konnte sie auch später kontrollieren.
»Danke!« Rolf hüpfte johlend die Treppe hinab, gefolgt von Erika.
Luise wandte sich seufzend der Tür des Arbeitszimmers zu. Seit drei Monaten schon führte sie regelmäßig diese Gespräche, obwohl sie nichts voranbrachten.
Fest entschlossen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, drückte sie die Klinke und trat ein. Die Männer saßen rund um den großen Eichentisch, an dem Heinrich immer seine Geschäfte abgeschlossen hatte. Seine Partner hatten ihn wegen seiner Großzügigkeit geschätzt. Ach, wärst du doch ein schärferer Hund gewesen, Heinrich!
»Da bist du ja endlich, Luisle. Ich hoffe, du hast es mit der Frömmigkeit nicht übertrieben?« Bürgermeister Huber lachte so laut, dass sein dicker Bauch gegen die Tischplatte schwappte. »Weiberleut halt.« Täuschte sich Luise, oder war da mehr als eine Spur Weinseligkeit in seiner Stimme?
Der große, dürre Alfred Thalheimer sah sie mit glasigen Augen an. Er hatte die Trachtenjoppe über seinem Hemd geöffnet. »Wir haben schon ein Weilchen gewartet.«
Aha, dachte Luise. Auch wenn der Wagner stocknüchtern wirkte, schienen zwei ihrer Gäste doch schon tief ins Glas geschaut zu haben. Erika hatte ihnen nicht den heimischen Tropfen, sondern Heinrichs teuren Rheinwein vorgesetzt. Drei der fünf Flaschen waren bereits leer. Luise hatte eine Idee, die nicht nur ihre restlichen Weinflaschen vor der Vernichtung bewahren würde.
Entschlossen trat sie zum Barschrank, holte eine Flasche Hohenloher Getreidebrand heraus und füllte vier Schnapsgläser bis zum Rand. Sie prosteten sich zu und kippten den Schnaps hinunter, woraufhin sie rasch nachfüllte. Sie sollten sie nur nicht unterschätzen. Groß und kräftig, wie sie war, würde sie sich nicht so schnell unter den Tisch trinken lassen.
»Wir haben dir ein Angebot zu machen, Luisle«, sagte der Huber. »Der Thalheimer will dir die Firma abkaufen.«
»Ich weiß.« Sie setzte sich und stellte die Flasche auf den Tisch. Zumindest anhören konnte sie sich ihre Vorschläge ja. Und dann würde sie nach allen Regeln der Kunst feilschen. Schließlich ging es um ihre Existenz.
Sie hob ihr Glas von Neuem. »Zum Wohle, meine Herren.«
2.
Nach dem Tod ihres Vaters fühlte Erika sich oft, als hätte das Leben ihr den Boden unter den Füßen weggezogen.
Zum Glück hatte ihre Mutter ihnen erlaubt, an diesem Sonntagnachmittag rauszugehen und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Also stand sie nach dem Essen vor dem Gartentor, wartete auf Rolf, der seine Winterstiefel nicht finden konnte, und ignorierte so gut sie konnte, dass Lia auf sie zuhüpfte. »Kann ich mitkommen?«
»Wenn’s sein muss«, brummte Erika missgelaunt. Es war schon schlimm genug, dass sie ihren kleinen Bruder überall mithinschleppen musste. Aber diese kleine Kröte, die auf ihrem roten Lockenkopf eine gelb-schwarz gestreifte Mütze trug wie eine Honigbiene, war einfach unmöglich.
Obwohl sie fast gleichaltrig waren, reichte Lia Erika nur bis zur Nasenspitze. Ihr Mantel war schief geknöpft, und ihre grünen Augen blitzten unternehmungslustig. »Wohin gehen wir?«
»Zum Kocher. Rolf will nachsehen, ob die Biberburg noch da ist«, antwortete Erika widerwillig. »Aber vorher holen wir den Martin ab.«
»Da bin ich.« Kaum war Rolf aus der Tür, rannte er ihnen bis zur Kreuzung voran und überquerte die Straße.
»Der hat ja einen eingebauten Motor«, kommentierte Lia.
Erika grinste. »Er kann gar nicht still stehen. Nie.« Die Stadtmitte von Künzelsau war so klein, dass er zumindest nicht verloren gehen konnte.
»Welchen Martin?«, fragte Lia.
Erika zögerte. »Den Martin Rubin vom Schuhgeschäft.«
»Seit wann spielst du mit Jungen?«
Sie errötete. Ihre Freundschaft zu Martin war ein Geheimnis, das sie eifersüchtig hütete. Luise und Martins Mutter Jette waren früher Nachbarinnen gewesen und hatten sich oft besucht, so dass sich die Kinder schon seit dem Sandkasten kannten.
»Deine Mutter ist ja nicht mal zum Essen gekommen«, plapperte Lia weiter, als sie keine Antwort erhielt.
»Unserem Geschäft geht es nicht gut.« Erika legte einen Schritt zu, so dass Lia ihr eilig hinterhertrippeln musste.
»Wird schon wieder, sagt meine Mama immer.«
Erika schnaubte. »Wir kommen ohne dein Mitleid aus.«
»Mein Vater ist auch tot«, flüsterte die Kleine so traurig, dass Erika ihre harschen Worte gleich wieder leidtaten. »Er war Zirkusartist und ist immer durch die Manege geflogen. Und eines Tages …« Lias große Augen standen voller Tränen.
»Du lügst! Zirkusartisten gibt es nur selten.«
»Wer weiß?«
Inzwischen hatten sie den Marktplatz erreicht, der an diesem kalten Sonntagmittag wie ausgestorben dalag. An seiner Schmalseite erhob sich stolz das Alte Rathaus mit seinem Glockenturm. Vom Café Frick her duftete es nach frischem Hefegebäck.
»Die Schwarzwälder Kirschtorte ist da so lecker«, schwärmte Lia. »Aber meine Mama hat für heute Quarksahne gemacht. Die ist mindestens genauso gut.«
Erika nickte. Dass Marga so gut kochen und backen konnte, war ein wahrer Lichtblick.
Rolf wartete vor dem Schuhgeschäft Rubin, in dessen Schaufenster handgenähte Herrenschuhe und hochhackige Damenpumps standen. Das Geschäft mit der Schuhmacherwerkstatt war der mit Abstand schönste Laden im Städtchen. Erika konnte sich nicht entscheiden, was ihr am besten gefiel: die Auslagen oder der Geruch nach sauberem Leder, der einen umgab, sobald man eingetreten war. Es war klar, dass sie nach ihrer Hochzeit mit Martin jeden Tag die herrlichsten Schuhe verkaufen und dabei selbst auf den höchsten Absätzen herumstöckeln würde.
Lia drehte sich einmal um sich selbst. »Und wo steckt er nun, dein Martin?«
»Wart’s ab.« Erika ging ihnen voran in den schmalen Hinterhof und warf einen Kiesel an ein Fenster im ersten Stock.
Einen Moment später streckte Martin seinen braunen Lockenkopf heraus. »Was gibt’s denn?«
Erikas Herz klopfte vor Freude. »Kommst du raus?«
Weil er als Jude seine Sonntagspflichten schon am Sabbat hinter sich gebracht hatte, standen seine Chancen auf ein Stündchen Freiheit an diesem Tag besser als die anderer Kinder.
»Ich frag mal.«
Fünf Minuten später kam er aus der Tür und rückte seine Brille zurecht.
»Was hast du gemacht?«, fragte Erika.
»Karl May gelesen.« Martin vertiefte sich lieber in seine Bücher, als mit den anderen Jungen Fußball zu spielen. »Und was habt ihr vor?«
»Wir wollen zum Kocher.«
Er nickte. »In Ordnung. Ich komme mit.«
Gar nicht gut fand Erika, wie die kleine Kröte mit den Flammenhaaren und der unmöglichen Mütze ihnen im nächsten Moment in den Weg sprang. »Ich bin auch dabei.«
Martin musterte sie amüsiert. »Du bist aber bunt.«
»Ich bin ein buntes Huhn, und ihr seid drei einfarbige. Ich heiße Lia.«
Martin lachte, aber Erika hielt sich wegen des winzigen Stachels der Eifersucht, den sie nicht verleugnen konnte, noch bewusster an seiner Seite.
Die Stadt war menschenleer, bis auf die vier verlorenen Winterkinder, die unter einem Himmel voller Schneewolken zum Fluss liefen.
»Es ist ganz gut, dass ich mal rauskomme, Eri«, sagte Martin nach einer Weile.
Sie errötete vor Freude, weil er sich an ihren alten Spitznamen erinnerte. »Warum?«
»Wenn ich nicht am Schatz im Silbersee festkleben würde, müsste ich zuhören, wie meine Eltern streiten.«
»Worüber streiten sie denn?« Erika mochte Martins Mutter Jette, die immer zuvorkommend und freundlich zu ihr war, und hatte vor seinem Vater Hans und seinem Großvater Samuel einen Heidenrespekt.
Martin sah sie prüfend aus seinen bernsteinbraunen Augen an. »Über Politik. Aber lass es gut sein. Mich interessiert viel mehr, wie es dir geht.«
Natürlich wusste Martin, dass ihr Vater gestorben war. Die Familie Rubin und der alte Großvater Löwenstein hatten Luise ihr Beileid ausgesprochen und stundenlang bei Gebäck, Tee und Wein im Salon gesessen.
Sie senkte den Kopf. »Nicht so toll. Meine Mutter muss wahrscheinlich den Holzhandel verkaufen.«
Martin nickte verständnisvoll.
Sie ließen das Schloss mit der Lehrerbildungsanstalt hinter sich liegen und überquerten die Kocherbrücke. Die Welt war ein Scherenschnitt auf weißem Grund, durch den sich schwarz der Fluss seinen Weg bahnte. Der Ostwind fuhr in die kahlen Bäume. Sie folgten dem Uferweg ein Stück stadtauswärts, in Richtung der Biberburg, die Erika und Rolf im letzten Sommer mit ihrem Vater entdeckt hatten.
»Kalt hier.« Erika blies sich in die Hände und beneidete Lia jetzt doch um ihre Mütze. Auch wenn sie hässlich war.
»Dann tun wir was dagegen.« Lia sprang auf und ab, um sich die Füße zu wärmen, und Martin steckte seine geballten Fäuste in die Jackentaschen. »War eigentlich irgendwann mal Sommer? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.«
»Ist das die Zeit, in der die Sonne immer scheint und man irgendwann in den Fluss springt?«, bibberte Lia.
»Und es gibt Kirschen«, sagte Erika.
»Und Papa hat uns die Biberburg gezeigt.« Rolf sah als Einziger nicht durchgefroren aus.
»Ja, Papa«, sagte Erika abwesend. Er würde nie zurückkommen.
»Ich verrat dir was.« Lia hüpfte noch immer auf und ab wie ein Gummiball. »Wenn du mich heute Abend mit deiner Käthe-Kruse-Puppe spielen lässt?«
»Was?«, fragte Erika missgelaunt.
Lia grinste. »Dein Papa ist jetzt von Beruf Engel, so wie meiner. Das sagt jedenfalls meine Mama immer. Er singt jetzt Halleluja und hat es immer schön.«
»So ein Quatsch.« Wenn Erika an ihren Vater dachte, sah sie immer das offene Grab vor sich, in das sie bei der Beerdigung eine Schaufel Erde geworfen hatte. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Sie schnäuzte sich und bekam verspätet mit, dass Martin eine Handvoll Schnee aufgehoben hatte und sie ihr nun in den Kragen steckte. Eisige Kälte rann ihr den Rücken hinab. »Nicht mit mir! Na warte!«
Im Nu waren sie in eine wilde Schneeballschlacht verstrickt und bewarfen sich mit dem harschigen Zeug, das sich kaum noch zu anständigen Bällen formen ließ. Martin bekam Erikas Matsch auf die Nase, während Rolf vergeblich versuchte, Lia einzuseifen, die kreischend zum Gegenangriff überging. Schließlich waren sie so erhitzt, dass sie die Kälte nicht mehr spürten.
»Pause! Waffenstillstand!« Lia hob lachend die Hände.
»Du bist ganz rot im Gesicht.« Martin strich Erika mit seinen Fingern über die Wange.
»Wo steckt eigentlich Rolf?« Erika sah sich alarmiert um. Panik wallte in ihr auf. »Ist er einfach abgehauen? Der kann was erleben!«
Es hatte zu schneien begonnen, Flocken, fein wie Nadelspitzen. Über den Fluss trieben Eisschollen.
»Wo kann er nur sein?«, fragte Martin.
»Die Biberburg«, entfuhr es Erika. Sie lag etwas flussaufwärts am Ufer, mitten im Dickicht.
Sie rannten ein Stück den Weg entlang und schlugen sich auf der Höhe der Burg ins Gebüsch. Ihre Schuhe und Strümpfe wurden sofort nass. Martin eilte ihnen voran. »Macht schneller!«
»Wir kommen!«, rief Lia. »Er wird schon nicht ins Wasser gefallen sein. Selbst ein Blinder sieht doch, dass das Eis nicht trägt.«
»Da kennst du ihn aber schlecht«, murmelte Erika besorgt. »Ich mach mir solche Vorwürfe.«
»Musst du nicht. Du kannst ihn ja schließlich nicht immer bewachen.«
In diesem Moment hörten sie Martins Stimme. »Ich hab ihn gefunden.«
Die Mädchen brachen durch Dornen und Schilf und erreichten das Ufer, hinter dem der Fluss träge und kalt dahinströmte. Am Rand trug er eine dünne Haut aus Eis, doch in der Mitte verhinderte die Strömung, dass er zufror. Martin kniete neben Rolf im Gebüsch, der mit einem Bein im Wasser stand.
Erika eilte zu ihnen und beugte sich zu ihrem Bruder herunter. »Was hast du nur gemacht?«
»Die Biberburg ist kaputt. Die Biber müssen …« Er schnatterte vor Kälte, und seine Lippen waren blau. »… umgezogen sein.«
Erika hob den Kopf. In der Tat war die Biberburg nur noch eine modrige Ansammlung von Ästen und Zweigen.
»Deine Biber sind mir egal.« Sie zog ihn ans Ufer. »Du musst ganz schnell ins Warme, sonst holst du dir noch den Tod.«
»Es war ein Versehen, ich schwör’s!« Tränen traten in Rolfs Augen. »Ich wollte nur nach den Bibern sehen, aber dann bin ich mit einem Fuß durchs Eis getreten. Mein Gott ist das kalt. Ich kann mich kaum noch bewegen. Ich schaff es nicht mehr heim.«
»Und ob du das schaffst!«, rief Erika gegen ihre Angst an.
Mit vereinten Kräften machten sie sich auf den Heimweg. Martin nahm den zitternden Jungen auf den Rücken. Er keuchte unter seinem Gewicht, wehrte aber Erikas Angebot, ihm zu helfen, ab. Als sie in der Austraße ankamen, war er völlig außer Atem; Rolfs Kopf hing zur Seite herab, seine Füße berührten fast den Boden.
Marga öffnete auf Lias Läuten hin und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »O mein Gott, der Kleine! Was habt ihr denn mit ihm gemacht?«
Erika wollte soeben antworten, aber Marga ließ sie nicht zu Wort kommen. »Ich hätt euch nicht gehen lassen. Aber die Frau Hermann ist zu sehr durch den Wind, um euch was zu verbieten. Komm, du musst ins Bett, Rolf, mit einer Tasse heißer Milch mit Honig und einer Wärmflasche. Lia, mach Wasser heiß!«
Die Haushälterin nahm Martin den am ganzen Leibe zitternden Jungen ab und verschwand mit ihm im Obergeschoss. Lia rannte in die Küche und füllte einen Topf, während Erika mit Martin im Flur stehen blieb.
»Es tut mir so leid, dass ich nicht aufgepasst hab«, flüsterte Erika. »Hoffentlich wird er nicht krank.«
Martin schüttelte den Kopf. »Es war nicht deine Schuld, Eri. Er ist abgehauen.«
»Man darf ihn nicht aus den Augen lassen«, beharrte sie. »Er stellt nur dann keinen Unsinn an, wenn er schläft.«
»Mach dir keine Vorwürfe. Marga und deine Mutter werden sich schon um ihn kümmern.« Er wandte sich zur Tür. »Ich geh dann mal. Meine Eltern fragen sich sicher schon, wo ich bleibe.«
»Warte, ich begleite dich.« Erika griff nach ihrer Mütze. Auf diese Weise konnte sie Luises Donnerwetter hinauszögern.
Sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Auf dem Platz war inzwischen mehr los. Familienväter traten mit Kuchenpaketen aus der Konditorei, und einige Spaziergänger flanierten an den Häusern entlang.
Martins Vater stand vor dem Schaufenster des Schuhhauses Rubin und schrubbte verbissen an einem Schriftzug herum, den jemand ungelenk auf die Glasscheibe gepinselt hatte. Eiskristalle hingen in seinen dunklen Haaren.
»Was steht da?«, fragte Erika verwundert. Martin presste die Lippen zusammen und schwieg.
»Juda verrecke«, antwortete Herr Rubin leise für ihn.
»Sollen wir Ihnen helfen?« Erika wollte Martin unbedingt zeigen, dass sie auf seiner Seite stand.
Herr Rubin, der mit seinen welligen Haaren und der Brille Martins erwachsenes Ebenbild war, musterte sie nachdenklich und nickte. »Danke. Das muss weg, bevor Frau Rubin es sieht. Sie wird dann nur wieder traurig.«
Grimmig griff Martin nach dem Schwamm und begann das »V« wegzurubbeln, während sein Vater sich über das »J« hermachte. Erika polierte mit einem trockenen Tuch nach. »Das ist Wandfarbe. Die kriegt man ab.«
»Ja, aber es gibt hässliche Schlieren«, erwiderte Herr Rubin. »Durch die kann man unsere schöne Ware gar nicht mehr sehen.«
Er drückte den Schwamm im Eimer aus und machte weiter. Sie arbeiteten eine Weile schweigend vor sich hin, bis nur noch ein grauer Schleier auf der Scheibe an den Schriftzug erinnerte.
»Vielleicht geht es ganz weg, wenn das Dienstmädchen morgen noch einmal mit Spiritus nachputzt«, sagte Erika fachmännisch.
Herr Rubin nickte. »Ich werde es ihr sagen. Und Erika, ich danke dir. Du weißt gar nicht, wie viel uns deine Hilfe bedeutet. Wir sind für jede Unterstützung dankbar, die uns zeigt, dass wir nicht ganz allein sind.«
»Aber wer schmiert denn so böse Worte an Ihre Scheibe?«
»Es gibt Leute, die mögen keine Juden«, meldete sich Martin zu Wort, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte.
Sie schüttelte den Kopf. »Aber warum? Jeder kann doch beten, wie und wo er will. Ich meine, wir gehen in die evangelische Johanneskirche und ihr in die Synagoge.«
Martins Großvater, der alte Samuel Löwenstein, war in Letzterer ein hohes Tier und hatte Erika schon so manches Mal Karamellbonbons zugesteckt.
Herr Rubin hob die Augenbrauen. »Dein Herr Luther war da aber anderer Meinung.«
Er ließ sie vor dem Schaufenster stehen und ging ins Haus. »Martin, kommst du?«
»Gleich.« Unvermittelt wandte Martin sich um und rannte über den Platz.
Erika konnte nicht anders, als ihm in Richtung des Alten Rathauses zu folgen. Erst jetzt entdeckte sie Martins Ziel: Zwei Köpfe lugten um die Ecke des Rathauses, der eine blond und der andere braun.
Kaum hatten sie das imposante Gebäude erreicht, kamen die beiden Jungen aus ihrem Versteck und bauten sich mit untergeschlagenen Armen vor ihnen auf. Beide trugen Tweedjacken und Schiebermützen. Es waren Fritz Thalheimer, der Sohn des Holzhändlers, und Erikas Cousin Ludger von Bruch. Sie hatte nicht gewusst, dass sie Martin schikanierten.
»Habt ihr das an unser Schaufenster geschmiert?«, fragte dieser.
Ludger spuckte vor ihm in den schmutzigen Schnee. »Was meinst du? Die Schrift, die ihr gerade so fleißig weggeputzt habt?«
Fritz prustete los. »Das würden wir nie tun, oder, Ludger?«
Sie schüttelten breit grinsend die Köpfe.
»Ihr lügt doch.« Erika stellte sich vor ihnen auf und stemmte die Hände in die Hüften.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Fritz. »Hier laufen viele Leute herum, die sicher alle nichts gesehen haben.«
»Weil die Leut euch Juden nicht mehr unterstützen.« Ludger lachte verächtlich. »Und wer sich mit Mädchen trifft, ist eine Memme, Judenbengel, merk dir das.«
Martin schoss das Blut ins Gesicht, doch Fritz feixte weiter. »Mein Vater luchst deiner Mutter heute ihre Firma ab, Erika. Pass auf!«
Sie blitzte ihn zornig an. »Da sei dir mal nicht so sicher. Und du Ludger, gehst besser nach Hause, wenn du nicht willst, dass ich meiner Mutter erzähle, was du hier so treibst. Die sagt es deinem Vater, und dann setzt’s was.«
Ludger funkelte sie aus seinen blauen Augen an. Er war so ein hübscher Junge, dass einige Mädchen aus ihrer Klasse ihr schon Briefchen für ihn zugesteckt hatten. Doch Erika ließ sich nicht davon beeindrucken. Ludger war ein Feigling, der auf die Schwächsten einprügelte – und jetzt hatte er sich Martin als sein nächstes Opfer ausgesucht.
»Petze!«, schnaubte Erikas Cousin. »Dir zeig ich’s!«
»Na komm, versuch es doch!« Sie ballte ihre Fäuste und hätte ihm fast auf die Nase gehauen. Was die Größe anging, war sie Ludger ebenbürtig, der eigentlich wissen müsste, wie kampferprobt sie dank ihres kleinen Bruders war. In diesem Moment allerdings machte Fritz einen Schritt nach vorn und trat Martin die Beine weg. Er fiel so unglücklich in den Schnee, dass ihm seine Brille von der Nase rutschte. Erika eilte sogleich zu ihm, das Gelächter von Ludger und Fritz versuchte sie auszublenden. Was für Mistkerle!
Während sich die beiden Übeltäter pfeifend davonmachten, stand Martin, Erikas ausgestreckte Hand ignorierend, auf und polierte die Brille mit seinem Jackenärmel. Das rechte Glas war gesprungen.
»Es tut mir leid«, sagte sie.
»Schon gut. Du kannst nichts dafür.«
»Ich wollte dich nicht blamieren. Von wegen du spielst mit Mädchen und so.«
Er humpelte in Richtung seines Elternhauses. Erika folgte ihm.
»Bin ich so blöde wie die? Ich spiele, mit wem ich will.«
»Natürlich bist du nicht blöd«, beteuerte sie. Martin war so klug, dass er sich selbst manchmal das Leben schwer machte.
»Aber das andere, das hat mir was ausgemacht«, stieß er zornig hervor.
»Was meinst du?« Das Schneetreiben wurde so stark, dass die Fachwerkfassaden der Häuser vor ihren Augen verschwammen. Sie kannte seine Antwort, bevor er sie aussprach.
»Dass die Leute keine Juden mögen.« Martin wischte sich den feuchten Schnee aus dem Gesicht.
»Diese Nationalen?« Seit Kurzem traf sich im Gasthaus Rössle eine rauflustige Bande, die sich zuerst besoff und danach pöbelnd durch die Gassen zog. SA nannten sich die. »Meine Mutter sagt, die schlagen alles kurz und klein.«
Martin kickte mit seinem Stiefel einen vereisten Schneeklotz weg. »Für die müssen alle Volksdeutsche sein. Die anderen sind nichts wert. Meine Eltern streiten sich die ganze Zeit, ob wir auswandern sollen oder nicht.«
Daher wehte also der Wind. Das war eine wirklich beängstigende Aussicht.
»Und was sagen sie?«, fragte Erika zaudernd.
Martin rang sich die nächsten Worte ab. »Sie sind sich nicht einig. Mein Vater will so schnell wie möglich in die USA. Aber meine Mutter nicht. Und dann weint sie.«
Erika schlug die Hand vor den Mund. Zwischen Amerika und Europa lag das Meer. Die Vereinigten Staaten waren so weit weg, dass sie es sich nicht einmal vorstellen konnte.
3.
Mit Speck fing man Mäuse und mit Rheinwein und Getreidebrand die reichsten Männer der Stadt. Luise war sehr zufrieden mit sich, als sie sich abends in der Küche an den Tisch setzte. Sie hatte es tatsächlich geschafft, den Männern einen Zahlungsaufschub abzuringen. Das änderte zwar nichts an dem Ruin der Firma, verschaffte ihr aber Zeit, um über die Zukunft nachzudenken.
»Alle Achtung.« Marga stellte Luise einen Teller mit aufgewärmtem Braten hin. Die Kinder lagen bereits in ihren Betten, selbst Rolf war in einen tiefen Schlaf gefallen. Vielleicht würde die Erkältung tatsächlich ausbleiben.
Luise war so ausgehungert, dass sie nur noch nach ihrer Gabel greifen und das Essen in sich hineinschaufeln konnte. »Das Lob geht an den Rheinwein. Es hat fünf Flaschen gebraucht, bis ich sie so weit hatte, und dazu noch eine mit Hohenloher Brand.«
Es war gemütlich in ihrer Küche. Während sich draußen eine frostige Winternacht über das Städtchen senkte, bollerte hier drinnen der Ofen gegen die Kälte an. Darin schmorte ein Backblech mit Bratäpfeln, das seinen intensiven Duft in der Küche verbreitete.
»Aber was meinen Sie? Es ist ja nur ein Aufschub. Wie soll ich geschäftlich weitermachen?«, fragte Luise ihre Haushälterin.
Marga hob den Blick und sah sie mit ihren braunen Augen an, in denen eine Reihe goldener Funken tanzte. »Wovor fürchten Sie sich? Sie sind jung, gesund, tatkräftig und nicht auf den Kopf gefallen. Sie werden schon eine Lösung finden.«
»Ich bin eine Frau«, stellte Luise klar. »Das ist für die Herren Grund genug, mich in die Schranken zu weisen.« Sie wusste selbst nicht, woher ihre plötzliche Bitterkeit kam, denn diesen von Gott gewollten Umstand zu hinterfragen, ziemte sich nicht. »Niemand nimmt mich ernst.«
»Dann kämpfen Sie, und sorgen Sie dafür, dass sich das ändert.«
Eine halbe Stunde später stand Luise vor dem Spiegel in ihrem Schlafzimmer und bürstete ihre taillenlangen dunklen Haare. Was hatte Heinrich in ihr gesehen? Eine landläufige Schönheit war sie mit ihrem flachen Gesicht und der beachtlichen Größe sicher nicht. Aber Heinrich, der damals ein Junggeselle von vierzig Jahren gewesen war, hatte die zwanzigjährige Luise vom Fleck weg geheiratet. Noch heute konnte sie kaum fassen, dass ihr ein solches Glück zuteilgeworden war. Er hatte sie mit teuren Möbeln, Schmuck und Luxus überhäuft. Die Teppiche aus dem Orient waren so dick und flauschig, dass ihre bloßen Füße darin versanken. Doch manches war selbst ihr zu viel gewesen. Wie hatte er sich gewundert, als sie die seidene Pariser Wäsche verschmäht und ihre Frisierkommode mit nur wenigen Fläschchen und Tiegeln ausgestattet hatte. Luise und ihre Schwester Johanna waren in einer streng protestantischen Familie aufgewachsen, in der Luxus als zweifelhaft galt. Frauen hatten tugendsam und bescheiden zu sein. Sie lachte leise. Mit Heinrich, der so viel weltläufiger als sie war, hatte sie einige Dinge erlebt, die sie Johanna besser verschwieg.
Luise öffnete ihren Kleiderschrank und griff nach dem schwarzen Abendkleid, das sie zu Bällen und Festen getragen hatte. Johanna hatte es für sie genäht. Das i-Tüpfelchen war eine schwarze Kappe mit Straußenfedern, der Inbegriff der Verruchtheit.
Sie legte beides aufs Bett und strich über die Spitze und die Jetperlen, die üppig darauf verteilt waren. Obwohl so ein Kleid in christlichen Kreisen als Inbegriff von überflüssigem Tand galt, fragte sie sich plötzlich, wie es wohl gemacht worden war. Im Gegensatz zu Johanna konnte sie überhaupt nicht mit Nadel und Faden umgehen, ganz zu schweigen vom Entwurf eines Kleides.
Sie seufzte, hängte es zurück und schlüpfte unter ihr dickes Federbett. Nein, sie musste nicht frieren, auch wenn sie den Blick auf Heinrichs leere Seite vermied. Am schlimmsten war das Schweigen. Nie wieder würde er ihr sagen, wie sehr er sie liebte. Und niemals mehr würde sie ihm versichern können, dass sie diese Liebe erwiderte. Wieder und wieder ging sie die Ereignisse jener Nacht durch. Hätte sie es verhindern können? Sicher nicht, beruhigte sie sich dann. Und Gott ins Handwerk zu pfuschen … Allein daran zu denken, war vermessen.
Am Abend vor seinem Tod hatte er sich unwohl gefühlt und war früh zu Bett gegangen. Bereits Wochen zuvor war ihr aufgefallen, wie kurzatmig er bei jeder Anstrengung wurde. Doch als sie ihn zum Arzt schicken wollte, hatte er sie nur ausgelacht. Er, der im Weltkrieg als Offizier gedient hatte, würde doch nicht wegen solcher Kinkerlitzchen eine Pause einlegen.
An jenem Abend war Luise ihm erst gegen Mitternacht ins Schlafzimmer gefolgt, weil sie lange bei Rolf gewacht hatte, der mit einer Masernerkrankung im Bett lag. Sie war sofort eingeschlafen und hatte Heinrichs letzten Atemzug nicht gehört. Erst am nächsten Morgen hatte sie bemerkt, dass etwas nicht stimmte. Heinrich hatte mit leicht geöffnetem Mund auf dem Rücken gelegen und mit einem fragenden Ausdruck an die Decke gestarrt, als hätte ihn der Tod selbst am meisten überrascht.
Seither lag Luise jede Nacht wach.
Auch heute klappte es nicht mit dem Einschlafen. Wenn sie den nächsten Tag überstehen wollte, musste sie die Schatten vertreiben, die sie immer wieder heimsuchten.
Entschlossen stand sie auf und ging zum Fenster. Über dem dunklen Garten tanzten Schneeflocken und verwirbelten sich übermütig zu Mustern und Spiralen. Der Anblick tröstete Luise. Sie würde es schon schaffen. Irgendwie. Immerhin hatte sie den Gläubigern heute einen Aufschub abgerungen.
Sie kuschelte sich in ihre warme Decke und schlief zum ersten Mal seit Langem durch. Als sie am nächsten Morgen aufstand, kam ihr ein Spruch in den Sinn. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Stammte er aus der Bibel oder war er die Erfindung eines besonders findigen Menschenkinds? Egal. Der Satz passte zu ihr.
4.
In der Nacht hatte sich das Schneetreiben gelegt und die Welt weiß verschneit im Glanz eines kobaltblauen Himmels zurückgelassen. Das richtige Wetter, um das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, fand Luise. Also packte sie ihre Buchhaltung in eine Kiste und verstaute sie im Kofferraum des schwarzen Mercedes, der seit Heinrichs Tod ungenutzt in der Garage verstaubte. Sie hatte den Entschluss gefasst, ihre Freunde in Nürnberg zu besuchen, die Familie Sefranek. Es wurde Zeit, dass sie jemanden um Rat fragte, der unvoreingenommen war.
Nachdem sie sich von Marga und den Kindern verabschiedet hatte, setzte sie sich hinter das Lenkrad und betätigte nervös den Anlasser. Was, wenn das schwere Ungetüm nicht ansprang? Heinrich hatte ihr aus einer Laune heraus gezeigt, wie man schaltete und lenkte. Aber weit gefahren war sie noch nie, geschweige denn bis nach Nürnberg. Nachdem der Motor spuckend und fauchend zum Leben erwacht war, tat der Wagen einen Hopser, bei dem sie an die Decke flog. Hektisch trat sie auf das Pedal, das sie für die Bremse hielt. Der Wagen stoppte abrupt, und sie landete mit der Brust auf dem Lenkrad.
Sie richtete sich auf, hielt sich die schmerzenden Rippen und hätte fast aufgegeben. Niemand sieht dich, Luise, also reiß sich zusammen und denk nach, wie es geht! Sie atmete durch und versuchte es von Neuem, diesmal langsamer. Und siehe da: Der Motor erwachte schnurrend wie ein Kätzchen zum Leben. Luise lenkte den Wagen vorsichtig auf die Straße und beglückwünschte sich, dass weder das Blech noch die Mauer Schaden genommen hatten. Triumphierend winkte sie ihren Lieben zu, die sich vor der Tür versammelt hatten, bevor der Mercedes majestätisch die Austraße entlangschaukelte und Reifenspuren in den frischen Schnee zeichnete.
Sie ließ die Stadt hinter sich und fuhr in Richtung Nordosten. Die Hügel, Wälder und Wiesen rundum waren von gleißend hellem Schnee bedeckt. Zunächst hielt sie das Lenkrad fest umklammert, dann aber entspannte sie sich zusehends und genoss den ersten freien Tag seit Langem. Fahren war leicht, denn außer ihrem Mercedes gab es kaum motorisierte Fahrzeuge auf der Straße. Mehrmals überholte sie Pferdefuhrwerke, einmal den Planwagen einer Familie von Fahrenden. Aber das war alles.
Geruhsam fuhr sie über Rothenburg ob der Tauber auf Ansbach zu und von dort nach Nürnberg. In den Außenbezirken der Stadt füllten sich die Straßen allmählich mit weiteren Automobilen und Kutschen. Als ein Bauer sein Fuhrwerk mit zwei Ackergäulen partout nicht zur Seite lenken wollte, drückte Luise kräftig auf die Hupe.
Dann lag plötzlich Nürnberg mit seinen Stadtmauern und der hoch gelegenen Kaiserburg vor ihr. Bei ihrem letzten Besuch hatten Heinrich und sie darüber gerätselt, wie oft Künzelsau in die stolze Stadt hineinpassen würde, waren jedoch zu keinem Ergebnis gekommen. Sie hatten hier schon viele schöne Tage verbracht. Luise seufzte. Aber nein, sie würde sich nicht von ihrer Trauer überwältigen lassen. Nicht heute!
Im Stadtzentrum verfuhr sie sich prompt und geriet ins Schwitzen, weil plötzlich Autos aus jeder Seitenstraße hervorgeschossen kamen. Was war sie doch für eine Landpomeranze. Schließlich sah sie sich gezwungen, anzuhalten und den Weg zu der Adresse der Familie Sefranek zu erfragen, die streng genommen nicht mit ihr, sondern mit Heinrich befreundet gewesen war. Er kannte den etwa zehn Jahre jüngeren Ferdinand Sefranek aus dem Weltkrieg. Luise hatte ihn, seine gutmütige Frau Mathilde und die beiden Buben zum letzten Mal bei Heinrichs Beerdigung gesehen.
Umso näher sie ihrem Ziel kam, desto mulmiger wurde ihr. Wie würden sie reagieren, wenn sie einfach so bei ihnen aufschlug? Was, wenn Ferdinand ihr Ansinnen unverschämt finden würde oder keine Zeit hatte, ihre Buchhaltung gründlich und unparteiisch zu prüfen? Doch jetzt gab es kein Zurück mehr.
Sie parkte vor dem Stadthaus aus der Zeit der Jahrhundertwende, nahm den Karton mit den Ordnern und klingelte.
»Ich komm ja schon. Ich komm ja schon.« Mathilde Sefranek öffnete mit einem Geschirrtuch in der Hand. Sie hatte sichtlich Mühe, die Person hinter dem Karton zu erkennen, denn sie war einen Kopf kleiner als Luise.
»Ich bin’s.«
»Luise?« Mathilde spähte verwundert um die Ecke. Mit ihrer rundlichen Figur und den Locken ähnelte sie einer graublonden Taube mit aufgeplustertem Gefieder. »Du bist es wirklich. Komm doch herein.«
Luise folgte ihr die Treppe hinauf in den ersten Stock und legte die Ordner erleichtert auf dem Küchenbüfett ab. Die Wohnung der Sefraneks war mit dunklen Eichenmöbeln und Parkettboden ausgestattet und zeugte von bescheidenem Wohlstand. In der Küche bullerte ein gemütliches Feuer im Herd, dem sie ihre kalten Hände entgegenstreckte.
»Ach, Liebes!« Mathilde schob ihr einen Stuhl zurecht. »Ich hab so ein schlechtes Gewissen, dass wir uns seit der Beerdigung nicht mehr bei dir gemeldet haben. Aber erst einmal mach ich uns Kaffee. Du siehst ganz verfroren aus. Und du weinst ja, meine Güte.«
Entschlossen wischte sich Luise über die Wangen und nahm Platz. »Ich glaub, nur vor Rührung.«
Diese Fahrt war die erste Herausforderung, die sie nach Heinrichs Tod allein bewältigt hatte. Sie schwor sich, dass es nicht die letzte bleiben würde. »Störe ich auch nicht?«
Auf dem Herd simmerte ein Topf mit Sauerkraut vor sich hin und duftete so verlockend, dass ihr der Magen knurrte.
»Aber nicht doch.« Mathilde begann, Kaffee zu mahlen. »Du musst Hunger haben. Wir essen, wenn der Ferdl Mittag macht und die Buben aus der Schule kommen. Und nun erzähl. Was führt dich zu uns?«
Luise holte tief Luft. »Ich brauch jemand Unparteiischen, der sich meine Geschäfte anschaut. Vor allem darf er nicht aus Künzelsau stammen.«
»Damit sie dir nicht den Holzhandel abluchsen.« Mathilde nickte verständnisvoll. »Und da hast du an den Ferdinand gedacht. Eine gute Wahl. Er hat einen klaren Kopf in solchen Dingen. Steht es denn so schlimm?«
Luise blickte auf ihre Hände. »Ich fürchte, wir sind kurz vor dem Bankrott. Und ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll.«
»Ich hab mir schon so etwas gedacht.« Mathilde nickte nachdenklich. »Aber darum kümmern wir uns später. Komm erst mal zur Ruhe.« Sie goss Kaffee ein, legte ein Stück Apfelkuchen auf Luises Teller und fragte sie beim Kartoffelschälen nach Rolf und Erika aus. Klar, Mathilde wollte sie mit ihrem Geplauder ablenken, aber sie gab gern Auskunft.
Kurz darauf kamen der zwölfjährige Albert und der achtjährige Hans aus der Schule und begannen zu streiten, kaum dass sie ihre Ranzen in die Ecke geworfen hatten.
Mathilde ging in den Gang hinaus. »Drinnen sitzt die Tante Luise aus Künzelsau und braucht ihre Ruhe. Also haltet die Gosch.«
»Fährt sie diesen Schlitten da draußen?«, fragte der Ältere eifrig.
Trotz ihrer Sorgen musste Luise schmunzeln. Buben waren doch überall gleich.
Mathilde kam zurück und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Die beiden stellen nur Unfug an. Dabei sind sie im Grunde zwei ganz liebe Kerle. Und der Albert ist manchmal schon überraschend verständig.«
Als auch Ferdinand erschien, der bei der Stadt Nürnberg als Vermessungsingenieur arbeitete, versammelte sich die Familie um den Tisch. Nachdem ihm Luise den Grund ihres Kommens anvertraut hatte, zog Sefranek die Augenbrauen hoch und vertröstete sie auf den Feierabend.
Nach dem Kaffee war es dann so weit. Luise stapelte ihre Ordner auf dem Tisch. »Das ist meine ganze Buchhaltung. Heinrich war leider nicht sehr sortiert in diesen Dingen.«
Es war besser, sie erzählte Ferdinand nicht, dass sie Tage gebraucht hatte, um Ordnung in das Chaos zu bringen und die Rechnungen sauber abzuheften. Leider waren es viel zu viele. Einige hatte er so lange nicht beglichen, dass ihnen Mahnungen ins Haus geflattert waren. »Ich glaube, wir sind pleite. Und ich hab nicht ganz den Überblick.«
Ferdinand klappte den obersten Ordner auf und warf einen nachdenklichen Blick hinein. »Warum hat er denn nicht schon früher gesagt, wie es um die Firma steht?«
»Dazu war er wohl zu stolz.«
Anstatt über ihre Probleme zu sprechen, hatten sich Heinrich und Ferdinand bei ihren Treffen in Nürnberg oder Künzelsau mit den Berichten über ihre Heldentaten aus dem Krieg überboten. Noch heute war Luise schleierhaft, wer wen aus dem eingestürzten Schützengraben bei Ypern gerettet hatte.
»Sie lügen, dass sich die Balken biegen«, hatte ihr Mathilde schon damals einmal anvertraut. »Denn wenn Sie nicht lachen würden, würden sie weinen.«
Und heute war Heinrich tot, im Bett gestorben, aber wenigstens nicht von einer Granate zerrissen.
»Es wäre besser gewesen, er hätte seinen Stolz überwunden und frühzeitig Rat gesucht.« Ferdinand hob den Kopf und rückte seine Brille zurecht. »Das wird ein langer Abend.«
Als die Jungen mit ihren Hausaufgaben fertig waren und aus ihren Zimmern kamen, scheuchte Mathilde sie in den Hof. »Raus mit euch. Wir haben zu arbeiten.«
Während der kleine Hans mit seinen blonden Locken seiner gutmütigen Mutter ähnelte, war der lang aufgeschossene Albert mit den eckigen Schultern das Ebenbild seines dunkelhaarigen Vaters. Neugierig blickten seine braunen Augen auf den Tisch voller Ordner. Doch als sein Bruder maulend abzog, schnappte auch er sich im Flur den Lederfußball und die Torwarthandschuhe.
Danach wurde es in der Stube so still, dass Luise den Ball rhythmisch gegen eine Wand im Hinterhof prallen hörte.
»Nun …« Ferdinand wollte gerade Bilanz ziehen, als von draußen ein Mordsgetöse zu ihnen drang. Es klang, als sei ein Holzstapel zusammengebrochen.
»Was war das?«, fragte Luise.
»Sauhund, blöder!«, schimpfte einer der Jungen.
»Der arme Herbert«, rief der andere betreten.
»Wenn dem was passiert ist, kannst du was erleben!«, schrie der Erste aufgebracht.
Ferdinand sprang auf und lief aus dem Zimmer. Die beiden Frauen folgten ihm über die Kellertreppe hinaus. Im Zwielicht des frühen Abends erkannte Luise einen Schuppen und ein Stück Gartenland voll harschigem Schnee. An der Stallwand türmte sich ein Bretterhaufen, in dem sie die Reste eines Hasenstalls erkannte. Der Fußball lag als Corpus Delicti obenauf, und Sefraneks Buben standen wie zwei arme Sünder neben den Trümmern. Die Hasen schienen nicht zu Schaden gekommen zu sein, wenn man davon absah, dass das schwarz-weiße Prachtexemplar auf Hans’ Schulter wie Espenlaub zitterte.
»Ach herrje, der Herbert.« Mathilde nahm ihm das Kaninchen ab und inspizierte es. »Sieht aus, als hätte er nur einen gewaltigen Schrecken bekommen.«
Ferdinand baute sich vor seinen Söhnen auf. »Wer war das?«
Der kleine Hans biss sich auf die Lippen und warf seinem Bruder einen verstohlenen Blick zu. In seinen Augen glitzerten Tränen. Luise dachte an ihre Auseinandersetzung mit Erika, nachdem Rolf bei der Biberburg halb durchs Eis eingebrochen war, und hatte plötzlich Mitleid mit allen dreien.
»Ich war’s.« Alberts Stimme klang klar und hallte von der Hauswand wider. Er starrte stur geradeaus und mied Ferdinands Blick.
»Soso«, sagte dieser. »Rein mit euch! Vesper gibt’s heute keins. Wir sprechen uns morgen. Und wenn dem Herbert was passiert ist, steht er am Sonntag auf dem Tisch. Als Festessen.«
Den beiden Buben stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Sie drehten sich auf dem Absatz um und verschwanden im Haus. Die Erwachsenen folgten ihnen.
Im Wohnzimmer ließ sich Ferdinand erschöpft auf einen Sessel fallen und streckte seine langen Glieder von sich. »Warum muss er nur immer den Helden spielen?«
»Was wirst du mit Albert machen?« Mathilde setzte den Hasen in einen Karton voller Heu, wo er sich beruhigte und zu mümmeln begann.
»Du musst wissen, Luise, dass der Große die Schuld für den kleinen Tollpatsch auf sich genommen hat. Wir wissen alle, dass Hans nicht zielen kann«, sagte Ferdinand erbittert.
»Aber das ist doch lobenswert.«
Ferdinand nickte. »Aber lügen darf er nicht. Er meint, dass er immer alles regeln muss, auch wenn es ihn gar nichts angeht.«
»Von wem er das wohl hat?«, warf Mathilde ein.
Ferdinand setzte sich aufrecht. »Solche wie Albert überstehen keinen Krieg. Die opfern sich in der ersten Reihe für ihre Kameraden, wenn das Feuer beginnt.«
»Aber wir haben doch Frieden«, warf Luise ein, auch wenn sie wusste, wie brüchig dieser Zustand war. Deutschland ächzte unter den Reparationsleistungen, die der Versailler Vertrag dem Land abverlangte, und immer mehr Menschen waren mit der Politik unzufrieden.
»Wer weiß, wie lange der noch hält?«, fragte Ferdinand zweifelnd. »Wenn dieser Gnom mit dem schmalen Schnauzbart in Berlin an die Macht kommt, wie heißt er gleich?«
»Hitler«, sagte Mathilde.
»Ja, genau.« Ferdinand nickte. »Dann ist Essig damit. Dem geht es um Revanche für den Versailler Vertrag und sonst nichts. Und wenn es Krieg gibt, dann trifft es solche Möchtegernhelden wie Albert zuerst, die den Kopf für die anderen hinhalten. Aber jetzt genug davon.« Er stand auf und ging zum Esstisch, wo noch immer Luises Ordner lagen. »Lasst uns weitermachen, meine Damen, wenn wir bis morgen früh fertig werden wollen.«
Sie arbeiteten weitere zwei Stunden lang, bis sich Ferdinand aufrichtete und seine Brille putzte.
»Und?« Luise unterdrückte ein Gähnen. An eine Heimfahrt war nicht mehr zu denken. Dankbar hatte sie Mathildes Angebot angenommen, bei ihnen zu übernachten. Ferdinands Frau selbst war schon vor einer Stunde im Sessel eingeschlafen und schnarchte leise vor sich hin. Luise hoffte inständig, dass sie bald fertig wären.
»Du hast recht, Luise«, schloss Ferdinand. »Da ist nicht mehr viel zu machen.«
Sie hatte es ja gewusst. Trotzdem tat es weh. »Und was würdest du mir raten?«
Ferdinand setzte seine Brille ab und rieb sich die Augen. »Lass diesen Konkurrenten die Firma übernehmen. Wie heißt er gleich?«
»Thalheimer.«
»Und handle mit ihm aus, dass er deine Arbeiter weiterhin beschäftigt, wenigstens fürs Erste, damit niemand auf der Straße landet.«
»Ich tue, was ich kann.« Sie straffte sich. »Aber was wird aus uns?« Und darin schloss sie auch Marga und Lia ein.
Ferdinand seufzte. »Deine Aussichten sind gar nicht so schlecht. Wenn du es geschickt anstellst, kommst du bei null heraus. Dein Haus ist schuldenfrei, Luise. Und dann verkaufst du dein Auto und ein paar Orientteppiche, nimmst ein überschaubares Darlehen auf und eröffnest ein neues Geschäft.«
»Aber was für eines?«, fragte sie.
Ferdinand zuckte mit den Schultern. »Das ist dir überlassen. Such dir etwas aus, das zu dir passt.«
Etwas Neues, das nichts mit Holz zu tun hatte, dachte sie hoffnungsvoll. Etwas, das nur ihr gehörte und bei dem ihr niemand reinreden konnte.
5.
Eine Woche später stand Luise in Kupferzell vor dem Forsthaus der Familie von Bruch, in die ihre Schwester Johanna eingeheiratet hatte. Sie atmete tief durch und zog den Klingelzug.
Johannas Mann Rupprecht hatte Waldbesitz mit in die Ehe gebracht und einen Adelstitel, auf den er sich einiges einbildete. Freiherr von Bruch. Zunächst hatte er in Kupferzell und Umgebung als Förster gearbeitet, aber dann hatte ihm der Weltkrieg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hatte einen Arm verloren und war nun Pensionär und Holzbauer. Johanna, die einen guten Geschmack und geschickte Hände besaß, besserte mit ihrer Nähwerkstatt das Familieneinkommen auf.
Das Forsthaus stand auf einer verwunschenen Lichtung mitten im Wald, über dem schwer der Nebel hing. Gestern hatte Tauwetter eingesetzt, und es nieselte leicht auf die überfrorene Wiese. Luises Fahrt hatte einer Rutschpartie geglichen, und nun stand der Mercedes dementsprechend schief vor dem Haus.
Es dauerte eine Weile, bis Johanna in ihrer gestärkten Schürze die Tür öffnete. »Luise? Was führt dich zu mir? Ach was, komm erst mal rein.«
Luise trat sich im düsteren Foyer die Stiefel ab und zog ihren Mantel aus. »Bring mir das Nähen bei, Johanna, ich bitte dich!«
Die Idee war ihr in der Nacht nach ihrer Rückkehr aus Nürnberg gekommen. Schlaflos hatte sie sich wieder einmal hin und her gewälzt, bis ihr Blick auf ihren Schrank gefallen war. Kleider machen Leute, sagte man doch. Was, wenn sie eine eigene Nähwerkstatt eröffnen würde, mit der sie ihre Familie ernähren konnte? Nur: Bisher war sie nicht einmal dazu in der Lage, einen Rock zu säumen. Um das zu ändern, war ihre Schwester genau die richtige Ansprechperson.
»Wirklich? Warum?«, fragte Johanna verblüfft. Sie war einen Kopf kleiner und zwei Jahre jünger als Luise. Dessen ungeachtet trug sie ihre Haare zu einem strengen Knoten gebunden und hatte einen verbissenen Zug um den Mund, der von zu vielen Sorgen sprach.
Luise nahm sie spontan in die Arme und spürte, wie ihre Schwester sich versteifte. »Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren wenig Kontakt hatten.« Streng genommen lediglich zu Weihnachten, den Geburtstagen und zuletzt zu Heinrichs Beerdigung. »Aber jetzt bräuchte ich deine Unterstützung. Ich bin pleite.«
Johanna nickte wissend. »Rupprecht und ich haben schon so etwas vermutet. Es wird ja auch geredet, aber …«
»Johanna, wo bleibt das Essen?«, schallte es aus der Küche.
»Oh, Himmel! Ich darf Rupprecht nicht warten lassen.« Johanna eilte Luise voran, die ihr unaufgefordert folgte.