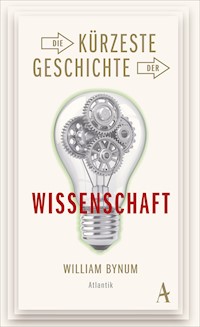
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Von den alten Babyloniern zum World Wide Web Wer fand heraus, dass der Mittelpunkt der Erde nicht gleichzeitig der Mittelpunkt des Universums ist? Wie kommt es, dass ein Pfeil umso weiter fliegt, je stärker man den Bogen spannt? Welche Kräfte walten bei einem Gewitter? Seit Tausenden von Jahren suchen die Menschen nach Erklärungen für das, was sie um sich herum wahrnehmen. In vierzig Kapiteln erzählt William Bynum anschaulich, spannend und anekdotenreich vom Abenteuer Wissenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
William Bynum
Die kürzeste Geschichte der Wissenschaft
Aus dem Englischen von Ines Klöhn und Thomas Pfeiffer
Atlantik
Für Alex und Peter
1Am Anfang
Wissenschaft ist etwas ganz Besonderes. Durch sie erfahren wir mehr über unsere Welt und alles, was darin ist – und somit auch über uns selbst.
Seit Tausenden von Jahren suchen die Menschen nach Erklärungen für das, was sie um sich herum wahrnehmen. Die Ergebnisse, zu denen sie dabei kamen, haben sich im Laufe der Zeit geändert. Genauso die Wissenschaft selbst. Wissenschaft ist dynamisch, sie baut auf Vorstellungen und Erkenntnissen auf, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, und macht andererseits sensationelle Fortschritte, wenn etwas völlig Neues entdeckt wird. Was dagegen unverändert bleibt, sind die Neugier, das Vorstellungsvermögen und die Intelligenz der Wissenschaftler. Unser heutiger Kenntnisstand mag höher sein, doch die Menschen, die vor 3000 Jahren intensiv über ihre Welt nachdachten, waren ebenso klug wie wir.
In diesem Buch geht es nicht nur um Mikroskope und Reagenzgläser, obgleich die meisten Leute wohl an so etwas denken, wenn sie das Wort »Wissenschaft« hören. Während fast der gesamten Menschheitsgeschichte diente die Wissenschaft neben MagieMagie, ReligionReligionsiehe auch Christentum, Islam und TechnikTechnik dazu, die Welt zu verstehen und zu beherrschen. Wissenschaft kann etwas so Simples sein wie das tägliche Beobachten des Sonnenaufgangs oder etwas so Kompliziertes wie der Nachweis eines neuen chemischen Elements. MagieMagie ist im Spiel, wenn jemand versucht, durch das Beobachten der SterneSternesiehe auch AstronomieSterne die Zukunft vorauszusagen, und Aberglaube würden wir es nennen, einer schwarzen Katze aus dem Weg zu gehen. Die Religion veranlasst die Menschen zum Beispiel dazu, ein Tier zu opfern, um die Götter gnädig zu stimmen, oder für den Weltfrieden zu beten, und eine gewisse TechnikTechnik ist vonnöten, um Feuer zu machen oder einen Computer zu bauen.
Wissenschaft, MagieMagie, Religion und TechnikTechnik wurden von den ersten menschlichen Gemeinschaften genutzt, die die Flusstäler IndiensIndien, ChinasChina und des Vorderen Orients besiedelten. Die fruchtbaren Täler lieferten Jahr für Jahr eine so reiche Ernte, dass eine große Gemeinschaft davon ernährt werden konnte. Dadurch konnten sich einige Mitglieder dieser Gemeinschaften auf ein spezielles Wissensgebiet konzentrieren und sich darin zu Experten entwickeln. Zu diesen ersten »Wissenschaftlern« (wenn sie damals auch noch niemand so nannte) gehörten oft PriesterReligionPriesterPriester.
Anfangs war die TechnikTechnik (also das praktische »Tun«) wichtiger als die Wissenschaft (bei der es vor allem um das »Wissen« als solches geht). Wenn man erfolgreich seine Felder bestellen, Kleider nähen oder Essen kochen wollte, reichte es zu wissen, was man zu tun hatte. Man musste nicht unbedingt wissen, warum manche Beeren giftig und andere Pflanzen essbar sind, um die einen zu meiden und die anderen anzupflanzen. Auch war es dafür nicht von Bedeutung, warum die Sonne morgens auf- und abends wieder untergeht. Doch wir Menschen sind nicht nur fähig, etwas über die Welt um uns herum zu lernen, in uns steckt auch eine natürliche Neugier. Und diese Neugier ist die Triebkraft der Wissenschaft.
Dass wir mehr über die Menschen in Babylon (im heutigen Irak) wissen als über andere antike Zivilisationen, hat einen einfachen Grund: Sie schrieben auf Tontafeln. Tausende dieser fast 6000 Jahre alten Tafeln sind erhalten geblieben. Sie erzählen uns, wie die BabylonierBabylonier ihre Welt sahen. Ihre Gesellschaft war streng organisiert, die Menschen führten sorgfältig Protokoll über ihre Ernten, Vorräte und Staatsfinanzen. Die PriesterReligionPriesterPriester verbrachten einen Großteil ihrer Zeit damit, sich mit den Zahlen und Fakten des damaligen Lebens zu befassen. Sie waren auch die wichtigsten »Wissenschaftler«, wenn es darum ging, Land zu vermessen, Entfernungen zu bestimmen, den Himmel zu beobachten und Zählmethoden zu entwickeln. Einige ihrer Entdeckungen nutzen wir noch heute. So führen auch wir Strichlisten, indem wir durch vier vertikale Striche einen fünften diagonalen Strich ziehen (wie in diesen Bilderwitzen, wo Häftlinge an der Wand ihrer Gefängniszelle eine Strichliste führen über die Jahre, die sie bereits abgesessen haben). Eine viel bedeutendere Hinterlassenschaft der BabylonierBabylonier ist aber die Festlegung, dass eine Minute aus sechzig Sekunden und eine Stunde aus sechzig Minuten bestehen soll, oder dass ein Kreis 360 Grad umfasst und eine Woche sieben Tage hat. Es ist schon kurios, wenn man bedenkt, dass es keinen echten Grund dafür gibt, warum eine Minute ausgerechnet aus sechzig Sekunden und eine Woche aus sieben Tagen bestehen sollte. Andere Zahlen hätten ebenso gut funktioniert. Doch das babylonische System wurde auch an anderen Orten übernommen und beibehalten.
Die BabylonierBabylonier waren gute Astronomen – also Beobachter des Sternenhimmels. Über viele Jahre hinweg beobachteten sie am Nachthimmel bestimmte, immer wiederkehrende Anordnungen in der Position von SternenSterne und Planeten. Sie glaubten, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums bildet und zwischen uns und den SternenSterne eine mächtige – magische – Beziehung besteht. Solange die Menschen die Erde für das Zentrum des Universums hielten, zählten sie die Erde selbst nicht zu den Planeten. Sie unterteilten den Nachthimmel in zwölf Teile und benannten diese gemäß der darin enthaltenen Anordnungen (oder »Konstellationen«) von Himmelskörpern. Mit Hilfe eines himmlischen Verbinde-die-Punkte-Spiels sahen die BabylonierBabylonier in einigen Konstellationen Bilder von Objekten und Tieren, wie zum Beispiel eine Waage oder einen Skorpion. Das war das erste Tierkreis-System, die Grundlage der AstrologieAstrologie, die die Einflüsse der SterneSterne auf uns Menschen erforscht. AstronomieAstronomiesiehe auch UrknallAstronomie (die Beobachtung der Sterne) und die AstrologieAstrologie (die »Deutung« der Sterne) waren im alten Babylon und noch viele Jahrhunderte später eng miteinander verbunden. Und auch heute wissen viele Menschen, unter welchem Sternzeichen sie geboren wurden, und lesen ihre Horoskope in Zeitungen und Zeitschriften, um sich dort Ratschläge für ihr Leben zu holen. Doch die »Sterndeutung«, die AstrologieAstrologie, zählt nicht zu den modernen Wissenschaften.
Die BabylonierBabylonier waren nur eine von mehreren mächtigen Gruppierungen des alten Vorderen Orients. Am meisten wissen wir über die Ägypter, die sich bereits 3500 v. Chr. entlang des NilsNil ansiedelten. Keine Zivilisation vor oder nach ihnen war so abhängig von einem einzelnen Naturphänomen. Der NilNil war für die Ägypter von existenzieller Bedeutung, denn bei seinen Hochwassern verteilte der mächtige Strom jedes Jahr fruchtbaren Schlamm über das Land an seinen Ufern und bereitete es so für die Ernte im nächsten Jahr vor. Dank des heißen und trockenen Klimas in ÄgyptenÄgypten blieben viele Zeugnisse der damaligen Zeit erhalten, die wir heute bestaunen können, darunter zahlreiche Wandgemälde und eine Art Bilderschrift, die sogenannten HieroglyphenSchriftHieroglyphen. Nachdem ÄgyptenÄgypten erst von den GriechenGriechen und dann von den RömernRömer erobert wurde, ging die Kunst, HieroglyphenSchriftHieroglyphen zu lesen und zu schreiben, verloren, und so blieb die Bedeutung dieser Schrift für beinahe 2000 Jahre ein Rätsel. Bis im Jahr 1798 ein französischer Soldat in der Nähe der Hafenstadt Rosette (oder Raschid, wie sie auf Arabisch heißt) im Norden ÄgyptensÄgypten in einem Trümmerhaufen einen halbrunden Stein fand, auf dem in drei verschiedenen Schriften eine Inschrift eingemeißelt war: in HieroglyphenSchriftHieroglyphen, in Altgriechisch und in Demotisch, einer anderen historischen Sprache des alten ÄgyptensÄgypten. Der Stein von RosetteStein von Rosette befindet sich heute im Britischen Museum in London. Sein Fund war eine Sensation! Gelehrte konnten den altgriechischen Text lesen, und damit konnten sie jetzt auch die geheimnisvollen ägyptischen HieroglyphenSchriftHieroglyphen entziffern. Nun konnte wirklich damit begonnen werden, die Glaubenswelt und die Bräuche der alten Ägypter zu erforschen.
Die ägyptische Sternkunde ähnelte der babylonischen. Der KalenderKalender war für sie von großer Bedeutung, er sagte ihnen nicht nur, wann sie die Felder bestellen mussten oder das Hochwasser des NilsNil zu erwarten war, auch religiöse Feste planten sie anhand des KalendersKalender. Ihr »natürliches« Jahr umfasste 360 Tage. Das Jahr war eingeteilt in zwölf Monate mit jeweils drei Wochen, die wiederum aus je zehn Tagen bestanden. Und um ein Verschieben der Jahreszeiten zu vermeiden, fügten sie ans Ende des Jahres noch zusätzliche fünf Tage hinzu. Die Ägypter glaubten, das Universum habe die Form einer rechteckigen Schachtel, und am Boden dieser Schachtel befinde sich ihre Welt, die der NilNil genau in der Mitte durchfließt. Der Jahresanfang fiel mit der Nilschwemme zusammen und richtete sich schließlich nach dem Erscheinen des Sirius, des hellsten Sterns am Nachthimmel. Wie in Babylon spielten PriesterPriester auch am Hof der PharaonenPharaonen, der ägyptischen Herrscher, eine bedeutende Rolle. Da die PharaonenPharaonen als göttlich galten, glaubten die Ägypter, sie würden im Jenseits weiterleben. Deshalb bauten sie die Pyramiden, die riesige Grabmäler sind. In diesen kolossalen Bauwerken wurden die PharaonenPharaonen zusammen mit ihren Verwandten und anderen wichtigen Leuten sowie Dienern, Hunden, Katzen, Möbeln und Proviant beigesetzt, um für das Leben im Jenseits gerüstet zu sein. Um die Leichname wichtiger Persönlichkeiten vor dem Verfall zu bewahren (schließlich sollten sie im Jenseits nicht verwest und stinkend auftauchen), entwickelten die Ägypter Techniken zur Einbalsamierung der Toten. Dafür wurden zunächst die inneren Organe entfernt und in spezielle Gefäße gegeben. Das Gehirn etwa wurde mit einem langen Haken durch die Nasenlöcher entnommen. Mit Hilfe von Chemikalien wurde der restliche Körper haltbar gemacht, in Leinen gewickelt und in einem Sarkophag beigesetzt.
Mit Sicherheit hatten die Einbalsamierer ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie Herz, Lunge, Leber und Nieren aussehen. Da es jedoch keine Berichte über die entnommenen Organe gibt, wissen wir leider nicht, welche Funktionen sie ihnen zuordneten. Andere Schriftstücke mit medizinischen Beschreibungen sind jedoch erhalten geblieben und liefern uns Einblicke in die ägyptische MedizinMedizinsiehe auch Anatomie; BlutMedizinim alten ÄgyyptenMedizin und Chirurgie. Die alten Ägypter vertraten die damals übliche Auffassung, Krankheiten entstünden durch eine Mischung aus religiösen, magischen und natürlichen Ursachen. Heiler sagten während der Behandlung ihrer Patienten Zaubersprüche auf, wobei viele ihrer Heilmethoden von einer genauen Beobachtung der Krankheiten zeugen. Einige der Medikamente, mit denen sie Unfall- oder Operationswunden behandelten, hatten möglicherweise eine antibakterielle Wirkung und unterstützten so den Heilungsprozess. Und das, Tausende von Jahren bevor BakterienBakteriensiehe auch Krankheit überhaupt entdeckt wurden.
Die drei wichtigsten »wissenschaftlichen« Tätigkeitsbereiche waren damals das RechnenRechnensiehe auch MathematikRechnen, die AstronomieAstronomie und die MedizinMedizin.
Das RechnenRechnen war notwendig, um zu wissen, wie viele Feldfrüchte man anbauen musste und wie man Handel trieb, oder um einschätzen zu können, ob man genügend Soldaten oder Pyramidenbauer zur Verfügung hatte. Der AstronomieAstronomie kam eine wichtige Rolle zu, weil SonneSonnesiehe auch Astronomie, MondMondsiehe auch Astronomie und SterneSterne so eng mit den Tagen, Monaten und Jahreszeiten verbunden sind, dass es für den KalenderKalender unverzichtbar ist, deren Position sorgfältig zu beobachten. Und natürlich gab es auch damals Kranke und Verletzte, die medizinische Hilfe benötigten. Doch in jedem dieser Bereiche vermischten sich MagieMagie, Religion, TechnikTechnik und Wissenschaft, und so können wir oft nur erahnen, warum die Menschen jener frühen Kulturen des Vorderen Orients bestimmte Dinge taten oder wie der Alltag des einfachen Volkes aussah. Informationen über das einfache Volk zu gewinnen ist generell schwierig, weil in der Regel nur einflussreiche Leute lesen und schreiben konnten und geschichtliche Spuren hinterließen. Dasselbe gilt für zwei andere antike Zivilisationen, die etwa zur gleichen Zeit im fernen Asien, nämlich in ChinaChina und IndienIndien, entstanden.
2Nadeln und Zahlen
Weit entfernt von Babylon und Ägypten, in IndienIndien und ChinaChina, entstanden am Fuße des Himalaya-Gebirges zwei weitere antike Kulturen. Vor ungefähr 5000 Jahren lebten die Menschen dort in Dörfern und Städten entlang der Täler des Indus und des sogenannten Gelben Flusses. Damals waren die Gebiete IndiensIndien und ChinasChina sogar noch größer, als sie es heute sind. Beide Länder waren Teil eines umfangreichen Fernhandelsnetzes, das die Land- und Seewege entlang der Gewürzrouten nutzte. Die SchriftSchrift und die Wissenschaft hatten dort bereits ein beachtliches Niveau erreicht, und das eine förderte dabei das andere: Die Wissenschaft begünstigte den Handel, und der durch den Handel erwirtschaftete Reichtum ermöglichte wiederum den Luxus des wissenschaftlichen Forschens. Tatsächlich war die Wissenschaft jener Zivilisationen bis um das Jahr 1500 mindestens so fortschrittlich wie die in Europa. Aus IndienIndien stammen unsere Zahlen und die Begeisterung für Mathematik. Aus ChinaChina kommen Papier und SchießpulverSchießpulver sowie ein für die Schifffahrt unentbehrliches Instrument: der Kompass.
Heute ist ChinaChina eine bedeutende Wirtschaftsmacht. Dort hergestellte Waren wie Kleidung, Spielzeug und elektronische Güter werden auf der ganzen Welt verkauft. Ein Blick auf das Etikett unserer Sportkleidung genügt, um sich davon zu überzeugen! Jahrhundertelang schaute man im Westen mit Geringschätzung und Misstrauen auf dieses riesige Land. Die Chinesen hatten eine ganz eigene Art, Dinge zu tun, und ihr Land galt als mysteriös und wie erstarrt in uralten Traditionen.
Heute wissen wir, dass ChinaChina überhaupt nicht erstarrt, sondern schon immer ein dynamisches Land und seine Wissenschaft in stetigem Wandel war. Eines jedoch blieb über die Jahrhunderte hinweg tatsächlich unverändert: die SchriftSchrift. Die chinesische SchriftSchriftchinesische Schrift besteht aus sogenannten Ideogrammen, kleinen bildhaften Zeichen, die für ganze Begriffe stehen und auf uns, die wir an das Alphabet gewöhnt sind, befremdlich wirken. Beherrscht man jedoch diese Bilderschrift, fällt einem das Lesen alter – und sehr alter – chinesischer Schriften ebenso leicht wie die Lektüre heutiger Texte. Auch haben wir ChinaChina die Erfindung von Papier zu verdanken, was das Schreiben erheblich erleichterte. Das älteste erhaltene Stück Papier stammt ungefähr aus dem Jahr 150 v. Chr.
Das riesige ChinaChina zu regieren gestaltete sich schon immer schwierig, doch die Wissenschaft konnte dabei zumindest helfen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde mit dem vielleicht größten technischen Bauprojekt aller Zeiten begonnen: der Chinesischen MauerChinesische Mauer. Damals herrschte in ChinaChina die Zhou-Dynastie. (Die chinesische Geschichte ist nach ihren jeweiligen Herrscherhäusern in »Dynastien« unterteilt.) Die MauerChinesische Mauer sollte das Reich einerseits davor schützen, dass die Barbaren aus dem Norden hereinkamen, und andererseits davor, dass die Chinesen hinauskamen! Der Bau der MauerChinesische Mauer zog sich über Jahrhunderte hin, kontinuierlich wurde sie erweitert und repariert und erstreckt sich heute über eine Gesamtlänge von über 20000 Kilometern. (Jahrelang hielt sich das Gerücht, die MauerChinesische Mauer sei sogar vom Weltraum aus zu sehen, was aber inzwischen widerlegt ist: Selbst einem chinesischen Astronauten gelang es nicht, das Bauwerk zu erkennen.) Ein weiteres Meisterwerk der Ingenieurskunst ist der sogenannte Große KanalGroße Kanal (China). Er wurde während des 5. Jahrhunderts v. Chr. unter der Sui-Dynastie begonnen. Unter Einbeziehung einiger natürlicher Wasserstraßen verband der 1800 Kilometer lange KanalGroße Kanal (China) die große Binnenstadt Peking im Norden des Landes mit der im Süden gelegenen Küstenstadt Hangzhou und von dort aus mit dem Rest der Welt. Diese monumentalen Bauwerke sind nicht nur beeindruckende Belege für die Fähigkeiten chinesischer Landvermesser und Ingenieure, sondern auch für die enorme menschliche Arbeitsleistung, die für ihre Realisierung aufgebracht werden musste. Zwar hatten die Chinesen die Schubkarre erfunden, beladen und geschoben werden musste sie jedoch mit Muskelkraft.
Die Chinesen betrachteten das Universum als eine Art lebenden Organismus, in dem bestimmte Kräfte wirkten und alles miteinander verbanden. Die elementare Kraft oder Energie hieß »QiQi« (gesprochen: »Tschi«). Zwei weitere wichtige Kräfte waren »Yin« und »YangYin und Yang«: Yin, das weibliche Prinzip, wurde mit Dunkelheit, Wolken und Feuchtigkeit verbunden. Mit Yang, dem männlichen Prinzip, wurde Sonnenschein, Hitze und Wärme verbunden. Niemals besteht etwas nur aus YinYin und Yangoder Yang – die beiden Kräfte treten stets in Kombination auf, wobei ihre Anteile jeweils unterschiedlich sind. Gemäß der chinesischen Philosophie steckt in jedem von uns sowohl YinYin und Yang als auch Yang, und die individuelle Mischung bestimmt, wer wir sind und wie wir uns verhalten.
Die Chinesen glaubten, das Universum bestünde aus fünf Elementen: Wasser, Metall, Holz, Feuer und Erde. Dabei handelte es sich nicht einfach um gewöhnliches Wasser oder Feuer, wie wir es kennen, sondern um Elemente, die zusammen die Welt und den Himmel erschufen. Natürlich besaßen diese Vier-Elemente-LehreVier-Elemente-Lehre unterschiedliche Eigenschaften, es gab aber auch ineinandergreifende Kräfte. So kann Holz zum Beispiel Erde bezwingen (ein Spaten aus Holz kann Erde umgraben). Metall kann Holz bearbeiten. Feuer kann Metall zum Schmelzen bringen. Wasser kann Feuer löschen, und Erde kann Wasser eindämmen. (Nicht von ungefähr wurde das bekannte Spiel »Schere, Stein, Papier« in ChinaChina erfunden.) In Verbindung mit den Kräften Yin und YangYin und Yangerzeugen diese Elemente den zyklischen Rhythmus der Zeit und der Natur, die Jahreszeiten, den Kreislauf von Geburt und Tod sowie die Bewegungen der Sonne, der Sterne und der Planeten.
Da alles aus diesen Elementen und Kräften zusammengesetzt ist, ist alles in gewisser Weise lebendig und miteinander verbunden. Die Vorstellung eines »Atoms« als Grundeinheit der Materie war den Chinesen daher fremd. Auch hielten es chinesische Naturphilosophen nicht für notwendig, alles in Zahlen auszudrücken, damit es »wissenschaftlichem« Anspruch genügt. Die Zahlenlehre hatte vor allem praktische Funktionen: Sie diente unter anderem der Preisberechnung beim Kauf und Verkauf von Waren oder dem Abwiegen von Waren. Die älteste erhaltene Quelle, die in ChinaChina den Abakus erwähnte – also einen Rechenschieber mit Kugeln, die man auf Stäben hin- und herschiebt –, stammt aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. Das Gerät selbst ist aber wesentlich älter. Ein Abakus beschleunigt nicht nur das Zählen, sondern auch das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.
Zahlen wurden auch dafür benutzt, die Tages- und Jahreslänge zu berechnen. Bereits 1400 v. Chr. wussten die Chinesen, dass das Jahr 365 Tage hat, und wie die meisten frühen Kulturen berechneten sie die Monate anhand des Mondes. Wie für alle antiken Völker entsprach ein Jahr auch für die Chinesen der Zeitspanne, die die Sonne brauchte, um zu ihrem Ausgangspunkt am Himmel zurückzukehren. Die zyklischen Bewegungen von Planeten, wie etwa dem Jupiter, und der SterneSterne passen gut zu der Vorstellung, dass alles in der Natur zyklisch ist. Auf der Suche nach dem absoluten Ursprung sollte eine aufwendige Berechnung zeigen, wie lange es dauert, bis das gesamte Universum einen Zyklus vollendet hat – das Ergebnis: 23639040 Jahre. Das bedeutete, dass das Universum sehr alt war (obwohl wir heute wissen, dass es noch viel älter ist). Auch über die Struktur des UniversumsAstronomiechinesische machten sich die Chinesen Gedanken. Einige der frühen chinesischen Sternkarten zeigen, dass es ihnen gelang, auf zweidimensionalen Karten Himmelskörper im dreidimensionalen Raum abzubilden. Xuan LeXuan Le, der zur Zeit der Späten Han-Dynastie (25–220 n. Chr.) lebte, war der Ansicht, dass Sonne, Monde und Sterne im leeren Raum schweben würden, angetrieben durch die Winde. Das steht in krassem Gegensatz zu der Überzeugung der antiken GriechenGriechen, die meinten, dass die Himmelskörper an festen Sphären (die man sich wie durchsichtige Schalen vorstellte) befestigt seien. Die Vorstellung der antiken Chinesen kommt unserem heutigen Verständnis des Weltraums wesentlich näher. Chinesische Sterngucker hielten ungewöhnliche Ereignisse sehr sorgfältig fest, und weil ihre Aufzeichnungen so weit zurückreichen, sind sie für Astronomen auch heute noch von Nutzen.
Da die Chinesen davon ausgingen, dass die ErdeErdeSiehe Geologie sehr alt ist, fiel es ihnen auch nicht schwer, Fossilien als zu Stein gewordene Überreste einst lebendiger Pflanzen und Tiere zu betrachten. Steine wurden nach Härte und Farbe klassifiziert. Besonders geschätzt wurde Jade, Kunsthandwerker verwandelten Jadesteine in kostbare Statuen. Erdbeben sind in ChinaChina keine Seltenheit. Zwar konnte im 2. Jahrhundert n. Chr. noch niemand erklären, warum es dazu kam, doch ein sehr gelehrter Mann namens Zhang HengZhang Heng verwendete bereits ein Gerät, mit dem er die Erdstöße registrieren konnte. Es handelte sich um ein hängendes Gewicht, das ins Schwingen geriet, wenn die Erde bebte. Das war eine sehr frühe Version dessen, was wir heute einen Seismographen nennen, ein Gerät, das normalerweise eine gerade Linie zeichnet und ausschlägt, wenn die Erde bebt.
Die Chinesen nutzten auch das Phänomen des MagnetismusMagnetismus. Sie fanden heraus, wie man Eisen magnetisierte, indem man es hoch erhitzte und es abkühlen ließ, während es in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet war. In ChinaChina gab es Kompasse, lange bevor sie im Westen bekannt waren, und sie wurden sowohl in der Schifffahrt als auch in der Wahrsagerei eingesetzt. Meist waren es die sogenannten »nassen Kompasse«: eine magnetisierte Nadel, die in einer mit Wasser gefüllten Schüssel schwamm. Wir sind es gewohnt, dass Kompassnadeln nach Norden zeigen, doch für die Chinesen zeigten sie nach Süden. (Natürlich zeigen unsere Kompasse auch nach Süden – nur eben mit dem anderen Ende der Nadel. Es spielt eigentlich keine Rolle, für welche Richtung man sich entscheidet, solange sich alle auf eine Richtung einigen.)
Die ChinesenChemiechinesiche Chemie waren auch gute Chemiker. Die besten unter ihnen waren häufig Taoisten, Anhänger des legendären Philosophen Lao-Tse, der zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert v. Chr. lebte. (Tao bedeutet »Weg«, »Pfad«.) Andere wiederum folgten den Lehren von Konfuzius oder Buddha. Die Weisheiten dieser religiösen Führer beeinflussten die Grundeinstellung ihrer Anhänger im Hinblick auf das Studium des Universums. Religion hatte schon immer einen Einfluss darauf, wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen.
Die chemischen KenntnisseChemiechinesiche Chemie der Chinesen waren für damalige Verhältnisse beachtlich. Sie konnten zum Beispiel Alkohol und andere Substanzen destillieren und Kupfer aus Lösungen extrahieren. Aus einer Mischung aus Kohle, Schwefel und Kalisalpeter stellten sie SchießpulverSchießpulver her. Das war der erste chemische Sprengstoff, das Ausgangsmaterial sowohl für die Entwicklung des Feuerwerks (Pyrotechnik) als auch von Waffen. Man könnte SchießpulverSchießpulver als Beispiel für Yin und YangYin und Yang in der Welt der Chemie betrachten: Es ermöglichte einerseits wunderschöne Feuerwerke bei Hofe und wurde andererseits bereits im 10. Jahrhundert auf östlichen Schlachtfeldern eingesetzt, um Waffen und Kanonen zu zünden. Auf welchem Wege das Rezept für diese zerstörerische Substanz nach Europa gelangte, ist nicht zweifelsfrei geklärt, jedenfalls fand man eine Herstellungsanleitung aus dem Jahr 1280. Kriege wurden dadurch überall verlustreicher.
Unter den Chinesen gab es auch Alchemisten, die nach dem sogenannten »Lebenselixier« suchten – einer Substanz, von der man sich erhoffte, dass sie unser Leben verlängern oder uns gar unsterblich machen. (Mehr zum Thema AlchemieAlchemie findet sich in Kapitel neun.) Ihre Suche blieb erfolglos, und wahrscheinlich hätte so mancher Herrscher sogar länger gelebt, wenn er die vermeintlichen Wundermittel, die die Alchemisten zusammengebraut hatten, nicht ausprobiert hätte. Dennoch stieß man auf der Suche nach jener magischen Substanz auf zahlreiche Arzneimittel, die gegen diverse Krankheiten halfen. Wie in Europa benutzten chinesische Ärzte zur Behandlung von Krankheiten Pflanzenextrakte, doch sie stellten auch Präparate aus Schwefel, Quecksilber und anderen chemischen Stoffen her. Fieberkrankheiten wurden mit einem Extrakt der Beifußpflanze behandelt, den man an bestimmten Punkten auf die Haut auftrug, um den Fluss der »Lebenssäfte« zu unterstützen. Diese Behandlungsmethode wurde vor kurzem in einem circa 1800 Jahre alten Buch über Heilmittel entdeckt. Und neueste Laboruntersuchungen ergaben, dass es sich dabei um ein wirksames Mittel gegen Malaria handelt, einer mit hohem Fieber einhergehenden Krankheit, die in tropischen Ländern heute zu den häufigsten Todesursachen zählt.
In ChinaChina wurden bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. medizinische Bücher verfasst, und die traditionelle chinesische MedizinMedizinim alten ChinaMedizin wird bis heute auf der ganzen Welt angewandt. Akupunktur, bei der an bestimmten Körperstellen Nadeln in die Haut gestochen werden, ist eine weitverbreitete Behandlungsmethode, die sowohl bei verschiedenen Krankheiten als auch zur Bewältigung von Stress und in der Schmerztherapie eingesetzt wird. Die Akupunktur basiert auf der Vorstellung, dass der Körper eine Reihe von Kanälen besitzt, durch die die Lebensenergie QiQi fließt. Und durch die Akupunkturnadeln sollen diese Kanäle stimuliert und mögliche Blockaden gelöst werden. Manchmal werden bei Operationen fast ausschließlich Akupunkturnadeln benutzt, um den Schmerz auszuschalten. Die Arbeit chinesischer Wissenschaftler unterscheidet sich heute nicht mehr von der ihrer westlichen Kollegen, doch die Traditionelle Chinesische Medizin hat immer noch viele Anhänger auf der ganzen Welt.
Dasselbe gilt für die Traditionelle Indische MedizinMedizinindische MedizinMedizin. Sie basiert auf Texten, die circa 200 v. Chr. bis 600 n. Chr. in der antiken Sprache Sanskrit geschrieben und unter dem Namen »Ayurveda« zusammengefasst wurden. Ayurveda zufolge wird der Körper von Lebensenergien, den sogenannten »Doshas«, beeinflusst. Man unterscheidet drei verschiedene Prinzipien: »Vata« ist trocken, kalt und leicht, »Pitta« ist heiß, bitter und scharf, und »Kapha« ist kalt, schwer und süß. Diese Doshas sind für das richtige Funktionieren unseres Körpers unentbehrlich, geraten sie ins Ungleichgewicht zueinander oder befinden sie sich am falschen Ort, wird der Mensch krank. Um herauszufinden, um welche Krankheit es sich handelte, untersuchten indische Ärzte insbesondere die Haut des Patienten und fühlten seinen Puls. Medikamente, Massagen und spezielle Diäten sollten das fehlende Gleichgewicht wiederherstellen. Um ihre Patienten zu beruhigen und ihre Schmerzen zu lindern, benutzten indische Ärzte den Saft von Schlafmohn, aus dem auch die Droge Opium hergestellt wird.
Ein anderes medizinisches Werk des antiken IndienIndien, das Buch Susruta, konzentriert sich auf die Beschreibung von erstaunlich anspruchsvollen Operationen. Litt ein Patient zum Beispiel an einer Katarakt (heute umgangssprachlich auch »grauer Star« genannt, eine Trübung der Augenlinse, die das Sehvermögen einschränkt), stach der Chirurg vorsichtig mit einer Nadel in den Augapfel und schob die Katarakt auf die Seite. Indische Chirurgen transplantierten auch Haut von gesunden Körperstellen der Patienten auf zum Beispiel beschädigte Nasen und waren damit frühe Vorreiter der plastischen Chirurgie.
Die ayurvedische Heilkunst wurde von hinduistischen Ärzten praktiziert. Als sich um 1590 auch Muslime in IndienIndien ansiedelten, brachten sie ihre eigenen medizinischen Vorstellungen mit, die auf der von frühen islamischen Ärzten weiterentwickelten MedizinMedizin der griechischen Antike basierten. Diese sogenannte »Yunani«-Medizin (yunani bedeutet »griechisch«) entwickelte sich parallel zum ayurvedischen System. Beide Heilmethoden werden in IndienIndien, neben der uns vertrauten, traditionellen westlichen MedizinMedizin, bis heute angewandt.
IndienIndien hatte seine eigene wissenschaftliche Tradition. Indische SternguckerAstronomieindische erforschten den Himmel, die Sterne, die Sonne und den Mond, indem sie an das Werk des griechischen AstronomenAstronomieindischePtolemäusPtolemäus und einige wissenschaftliche Arbeiten aus ChinaChina anknüpften, die buddhistische Missionare von ihren Reisen zurückgebracht hatten. In der indischen Stadt Ujjain gab es eine Sternwarte, wo einer der frühesten uns bekannten indischen Wissenschaftler, Varahamihira (ca. 505 n. Chr.), arbeitete. Er sammelte alte astronomische Schriften und fügte ihnen eigene Beobachtungen hinzu. Erst viel später, im 16. Jahrhundert, entstanden Sternwarten auch in Delhi und Jaipur. Der indische KalenderKalender war relativ genau, und wie die Chinesen glaubten auch die Inder, dass die Erde sehr alt ist. Einer ihrer astronomischen ZyklenZyklen erstreckte sich über einen Zeitraum von 4320000 Jahren. Auch in IndienIndien suchte man nach einem Elixier, das ein langes Leben ermöglicht, sowie nach einer Möglichkeit, aus einfachen Metallen Gold zu gewinnen. Ihren wichtigsten Beitrag leistete die indische Wissenschaft jedoch auf dem Gebiet der MathematikMathematik.
Während in IndienIndien und ChinaChina traditionelle Heilmethoden auch heute noch gleichberechtigt neben den Methoden der westlichen MedizinMedizin bestehen, ist das in der Wissenschaft anders. Indische und chinesische Wissenschaftler arbeiten heute mit denselben Theorien, Instrumenten und Zielen wie ihre Kollegen anderswo auf der Welt. Wissenschaft, wie sie im Westen entwickelt wurde, ist mittlerweile universal gültig.
Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass unser Zahlensystem in IndienIndien und die Papierherstellung in ChinaChina erfunden wurden. Wenn wir also eine gewöhnliche Neunerreihe schreiben, gebrauchen wir eine sehr alte Errungenschaft aus dem Fernen Osten.
3Atome und der leere Raum
Im Jahr 454 v. Chr. besuchte der griechische Geschichtsschreiber HerodotHerodot (ca. 485–425 v. Chr.) Ägypten. Genau wie wir war er sehr beeindruckt von den Pyramiden und den riesigen, etwa 18 Meter hohen Statuen bei Theben, einer am NilNil gelegenen Stadt in Oberägypten. Er konnte kaum glauben, wie alt dort alles war. Ägypten war längst von den Persern überrannt worden, und sein Glanz gehörte der Vergangenheit an. HerodotHerodot selbst lebte in einer viel jüngeren, fortschrittlicheren Gesellschaft, in einem Land, das ein Jahrhundert später, unter Alexander dem Großen (356–323 v. Chr.), Ägypten sogar erobern würde.
Zu HerodotsHerodot Zeiten wurden weite Teile des östlichen Mittelmeerraums von einer griechisch sprechenden Bevölkerung geprägt. Dort entstanden die Werke Homers, des blinden Poeten, wie etwa die Geschichte, die davon erzählt, wie die GriechenGriechen die Trojaner besiegten, indem sie ein riesiges hölzernes Pferd bauten und sich darin versteckten, oder die phantastische Heimreise des griechischen Helden Odysseus, eines der führenden Köpfe des Trojanischen Krieges. Die GriechenGriechen waren begabte Schiffbauer, Kaufleute und Denker.
Zu den frühesten Denkern gehörte ThalesThales (ca. 625–545 v. Chr.), ein Kaufmann, Astronom und Mathematiker aus Milet, einer Stadt an der Küste der heutigen Türkei. Zwar sind seine Schriften im Original nicht überliefert, doch spätere Autoren zitieren ihn und erzählen Anekdoten, die ihn beschreiben. Eine dieser Anekdoten berichtet, dass er einmal so sehr darin vertieft war, den Sternenhimmel zu beobachten, dass er dabei aus Versehen in einen Brunnen stürzte. Eine andere Geschichte beschreibt ihn als cleveren Geschäftsmann: Weil er voraussah, dass es eine reiche Olivenernte geben würde, mietete er lange vor der Erntezeit sämtliche Ölpressen, um sie dann bei Beginn der Ernte gewinnträchtig weiterzuvermieten. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, war ThalesThales keineswegs der einzige zerstreute Professor, der mit seiner Wissenschaft Geld gemacht hat.
Es wird behauptet, ThalesThales habe Ägyptenbesucht und die ägyptische MathematikMathematik nach Griechenland gebracht. Doch das ist wohl ebenso eine Legende wie die Behauptung, er habe eine totale Sonnenfinsternis vorhergesagt (für eine solche Vorhersage reichten seine astronomischen Kenntnisse nicht aus). Glaubwürdiger sind dagegen seine Erklärungsversuche für bestimmte Naturerscheinungen wie etwa die Fruchtbarmachung des Ackerlands durch die Nilschwemme oder die Annahme, Erdbeben entstünden aufgrund der Überhitzung von Wasser innerhalb der Erdkruste. Wasser stellte für ThalesThales das Hauptelement dar, denn er stellte sich die Erde als Scheibe vor, die auf einem riesigen Ozean schwimmt. Das hört sich für unsere Ohren zwar komisch an, der Punkt ist aber, dass ThalesThales versuchte, für bestimmte Naturphänomene wissenschaftliche und nicht übernatürliche Erklärungen zu finden. Die Ägypter glaubten noch, es wären die Götter, die den NilNil über die Ufer treten ließen.
Anders als ThalesThales hielt der ebenfalls aus Milet stammende AnaximanderAnaximander (ca. 611–547 v. Chr.) Feuer für das wichtigste Element im Universum. EmpedoklesEmpedokles (ca. 500–430 v. Chr.) aus Sizilien begründete dagegen die Lehre von den vier Elementen Luft, Erde, Feuer und Wasser. Diese Vorstellung ist uns vertraut, denn sie wurde für fast 2000 Jahre bis zum Ende des Mittelalters zur Standardtheorie der Philosophen.
Dieser Umstand bedeutet jedoch nicht, dass ausnahmslos alle der Vier-Elemente-LehreVier-Elemente-Lehre folgten. In Griechenland und später in Rom gab es eine Gruppe von Philosophen, die sogenannten »AtomistenAtomisten«, die davon überzeugt waren, dass sich die Welt in Wirklichkeit aus winzigen Teilchen oder Partikeln, den sogenannten »Atomen«, zusammensetzt. Der berühmteste dieser frühen AtomistenAtomisten war der um 420 v. Chr. lebende DemokritDemokrit. Was wir über seine Vorstellungen wissen, stammt aus einigen Fragmenten seiner Arbeit, die von anderen Autoren zitiert wurden. DemokritDemokrit nahm an, im Universum gebe es eine Vielzahl von Atomen, die schon immer existierten, kleinste Teilchen, die man nicht weiter teilen und auch nicht zerstören kann. Obwohl sie viel zu klein waren, um für das bloße Auge sichtbar zu sein, war er davon überzeugt, dass sie unterschiedliche Form und Größe hatten, was auch erklärte, warum sich aus Atomen zusammengesetzte Dinge in Geschmack, Konsistenz und Farbe unterschieden. Doch diese größeren Dinge existieren nur, weil wir Menschen schmecken, fühlen und sehen. In Wahrheit, so die Auffassung DemokritsDemokrit, existieren nur »Atome und der leere Raum«. Heute sprechen wir von Materie und Raum.
Die Atomlehre war nicht besonders populär, erst recht nicht die Auffassung DemokritsDemokrit und seiner Anhänger, dass sich Lebewesen nach einer Art Versuch-und-Irrtum-Prinzip »entwickelten«. Eine amüsante Version dieser Theorie ging davon aus, dass es einst eine Vielzahl der verschiedenen Teile von Pflanzen und Tieren gab, die sich in allen möglichen Kombinationen miteinander verbinden konnten – ein Elefantenrüssel mit einem Fisch, ein Rosenblatt mit einer Kartoffel und so weiter –, bevor es schließlich zu den Kombinationen kam, wie wir sie heute kennen. In Fällen, bei denen sich etwa ein Hundebein mit einem Katzenkörper verband, ging man davon aus, dass ein solches Tier nicht überlebensfähig war und es deshalb keine Katzen mit Hundebeinen gab. Deshalb landeten mit der Zeit alle Hundebeine an Hunden und – dankenswerterweise – alle Menschenbeine an Menschen. (Eine andere altgriechische Evolutionstheorie erscheint da schon realistischer, wenn auch etwas eklig: Alles Lebendige habe sich demnach aus einem sehr alten Schleim entwickelt.)
Dass der Atomismus nur wenige Befürworter fand, mag auch daran liegen, dass er von keinem tieferen Sinn oder höheren Plan im Universum ausging, sondern die Ansicht vertrat, die Dinge würden rein zufällig und aus Notwendigkeit geschehen. Das ist eben eine ziemlich trostlose Sichtweise, und die meisten griechischen Philosophen waren auf der Suche nach einem tieferen Sinn, nach Wahrheit und Schönheit. Während sich die griechischen Zeitgenossen DemokritsDemokrit und seine Anhänger ein umfassendes Bild von deren Argumenten machen konnten, beschränkt sich unser heutiges Wissen über sie auf Zitate und Diskussionen späterer Philosophen. Von einem AtomistenAtomisten aus römischer Zeit namens LukrezLukrez (ca. 100–ca. 55 v. Chr.) stammt ein schönes wissenschaftliches Lehrgedicht mit dem Titel De rerum natura (»Über die Natur der Dinge«). In diesem Gedicht beschreibt LukrezLukrez den Himmel, die Erde und alles, was es auf der Erde gibt, einschließlich der Entstehung menschlicher Gesellschaften, im Sinne des Atomismus.
Über einen Zeitraum von fast 1000 Jahren kennen wir die Namen und einige Beiträge von Dutzenden von Wissenschaftlern und Mathematikern des antiken Griechenlands. Einer der bedeutendsten unter ihnen war AristotelesAristoteles. Seine Naturauffassung war so überzeugend, dass sie noch lange nach seinem Tod Gültigkeit hatte. (In Kapitel fünf werden wir mehr über ihn erfahren.) Doch es gibt drei Persönlichkeiten nach AristotelesAristoteles, die die Entwicklung der Wissenschaft für lange Zeit entscheidend geprägt haben.
EuklidEuklid (ca. 330–ca. 260 v. Chr.) war längst nicht der Erste, der sich mit GeometrieGeometrie beschäftigte (auch die Babylonier waren ziemlich gut darin). Von ihm stammt jedoch eine Art Lehrbuch, in dem er die grundlegenden Thesen, Regeln und Methoden des Fachs zusammenfasst. GeometrieGeometrie ist ein sehr praktisches Teilgebiet der MathematikMathematik, das sich mit dem Raum und seinen Elementen (Punkten, Geraden, Flächen und Volumen) beschäftigt. EuklidEuklid beschrieb geometrische Phänomene, zum Beispiel die Tatsache, dass sich parallele Geraden nie treffen oder dass die Winkel eines Dreiecks zusammen 180 Grad ergeben. Sein berühmtes Werk, Elemente, fand als Studienbuch in ganz Europa große Anerkennung.
Der zweite der »drei Großen«, EratosthenesEratosthenes (ca. 284–ca. 192 v. Chr.), berechnete anhand geometrischer Methoden auf ganz einfache, aber geschickte Art den Erdumfang. Er wusste, dass am Tag der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres, die Sonne direkt über der Stadt Syene, dem heutigen Assuan, stand. Also maß er an diesem Tag den Einstrahlwinkel der Sonne in Alexandria (wo er eine bedeutende Bibliothek leitete), was auf demselben Längengrad ungefähr 5000 Stadien nördlich von Syene lag. (»Stadion« ist ein antikes griechisches Längenmaß, das etwa 160 Metern entspricht.) Auf der Grundlage dieser Messungen berechnete EratosthenesEratosthenes einen Erdumfang von circa 250000 Stadien, also etwa 40000 Kilometern, was ziemlich exakt dem aktuell am Äquator gemessenen Erdumfang entspricht. Übrigens zeigt das Beispiel EratosthenesEratosthenes auch, dass nicht alle Gelehrten damals die Vorstellung vertraten, die Erde sei eine große flache Scheibe, an deren Rand die Schiffe ins Bodenlose stürzen, wie es viele noch zu Zeiten von Christoph Kolumbus und seiner Reise nach Amerika befürchteten.
Der Letzte der »großen Drei« arbeitete ebenfalls in Alexandria, der von Alexander dem Großen gegründeten Stadt im Norden Ägyptens: Claudius PtolemäusPtolemäus. Wie zahlreiche Wissenschaftler der antiken Welt hatte auch PtolemäusPtolemäus (ca. 100–ca. 178) vielfältige Interessen. Er schrieb über Musik und Geographie sowie über die Eigenschaften und das Verhalten des Lichts. Doch das Werk, das ihm zu bleibendem Ruhm verholfen hat, ist das Buch mit dem aus dem Arabischen stammenden Titel Almagest. Darin wurden von PtolemäusPtolemäus die Beobachtungen zahlreicher griechischer Astronomen zusammengetragen und ergänzt, darunter Sternkarten, Berechnungen über die Bewegungen der Planeten, des Mondes, der Sonne und der Sterne und über die Gestalt des Universums. Wie alle Menschen seiner Zeit ging er von einem geozentrischen Weltbild aus, also von der Vorstellung, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und die Sonne, der Mond, die Sterne und die Planeten sich auf Kreisbahnen um sie herumbewegen. Als hervorragender Mathematiker war PtolemäusPtolemäus davon überzeugt, dass er mit wenigen Korrekturen in der Lage sein würde, die Planetenbewegungen zu erklären, die er und viele Menschen vor ihm beobachtet hatten.
Es ist ganz schön schwierig nachzuweisen, dass die Sonne sich um die Erde dreht, wenn in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. PtolemäusPtolemäus’ Werk galt für Astronomen sowohl in islamischen Ländern als auch im europäischen Mittelalter als unverzichtbare Lektüre. Es erfuhr so große Beachtung, dass es zu den ersten Werken gehörte, die ins Arabische und dann ins Lateinische übersetzt wurden. Tatsächlich wurde PtolemäusPtolemäus von vielen in einem Atemzug genannt mit berühmten Gelehrten wie HippokratesHippokrates, AristotelesAristoteles und GalenosGalenos, obgleich diese drei bei uns ihr jeweils eigenes Kapitel bekommen.
4Der Vater der Medizin: Hippokrates
Wer Lust hat, kann bei Gelegenheit mal seinen Hausarzt fragen, ob er bei Abschluss seines Studiums den hippokratischen Eid abgelegt hat. Nicht alle medizinischen Hochschulen verlangen das von ihren Absolventen, einige jedoch schon, denn dieser über 2000 Jahre alte Eid hat auch heute noch seine Gültigkeit.
Obwohl der berühmte Eid nach HippokratesHippokrates benannt ist, stammen in Wirklichkeit nur die wenigsten der rund 60 Traktate (kurze schriftliche Abhandlungen) von ihm selbst. Über den Menschen HippokratesHippokrates wissen wir nur wenig. Er wurde um 460 v. Chr. auf der Insel Kos, unweit der heutigen Türkei, geboren. Er praktizierte als Arzt, unterrichtete MedizinMedizinund Hippokrates (gegen Bezahlung) und hatte wahrscheinlich zwei Söhne und einen Schwiegersohn, die ebenfalls Ärzte waren. Schon damals war der Beruf des Arztes Familientradition.
Das sogenannte Corpus Hippocraticum (ein Corpus ist eine Textsammlung) wurde von vielen verschiedenen Leuten verfasst, und das womöglich über einen Zeitraum von 250 Jahren hinweg. In den einzelnen Texten des Corpus werden zahlreiche Themen unter verschiedenen Gesichtspunkten erörtert, so zum Beispiel das Diagnostizieren und Behandeln von Krankheiten, der Umgang mit Knochenbrüchen oder Gelenkverletzungen, Epidemien oder wie man gesund bleiben kann, was man zu sich nehmen sollte und welche Auswirkungen das Umfeld auf die Gesundheit hat. Die Traktate beraten Ärzte auch über den Umgang mit Patienten und Kollegen und decken somit fast die gesamte Spannbreite der damals praktizierten MedizinMedizinund Hippokrates ab.
Ebenso beeindruckend wie die enorme Vielzahl an Themenbereichen ist die frühe Entstehungszeit der Traktate. HippokratesHippokrates lebte vor Sokrates, PlatonPlaton und AristotelesAristoteles, noch dazu auf Kos, einer kleinen, abgeschiedenen Insel. Da grenzt es schon fast an ein Wunder, dass seine Texte so lange erhalten geblieben sind. Damals gab es noch keine Druckmaschinen, mit denen Texte beliebig oft vervielfältigt werden konnten, stattdessen mussten sie mühsam von Hand auf Pergament, Schriftrollen, Tontafeln und andere Oberflächen kopiert werden, um von Generation zu Generation weitergegeben zu werden. Tinte verblasst, durch Kriege kommt es zu Zerstörung, und auch Insekten und das Wetter fordern ihren Tribut. Meist liegen uns heute nur Abschriften von Originaltexten vor, die oft viele Generationen später von interessierten Gelehrten angefertigt wurden. Je mehr Abschriften es gab, desto höher war die Chance, dass einige davon erhalten blieben.
Der hippokratische Eid legte den Grundstein für die westliche MedizinMedizinund Hippokrates, weshalb HippokratesHippokrates bis heute bei uns eine besondere Stellung einnimmt. Jahrhundertelang war die medizinische Praxis von drei Grundsätzen geleitet. Der erste Grundsatz bildet auch heute noch die Basis der modernen MedizinMedizin und medizinischen Wissenschaft: die Überzeugung, dass Menschen aus »natürlichen« Gründen krank werden, für die es eine rationale, also vernünftige, logische Erklärung gibt. Vor den Hippokratikern wurden KrankheitenReligionund Krankheit in Griechenland und den angrenzenden Regionen dagegen als übernatürliche Phänomene betrachtet. Die Menschen werden krank, so die damalige Ansicht, weil sie die Götter erzürnt haben oder weil jemand, der übernatürliche Kräfte besitzt, böse auf sie ist und sie mit einem Fluch belegt hat. Und da die Krankheiten von Hexen, Magiern und Göttern verursacht wurden, war es am besten, man überließ es Priestern oder Magiern, herauszufinden, wie es zu der Krankheit kam und wodurch sie geheilt werden konnte. Es gibt bis heute Menschen, die bei Wunderheilern Rat suchen und auf magische Heilmethoden vertrauen.
Die Hippokratiker waren keine Geistheiler, sondern Ärzte, die KrankheitenReligionund KrankheitKrankheit als etwas Normales und Natürliches ansahen. Eine Abhandlung mit dem Titel Über die heilige Krankheit zeigt das sehr eindrücklich. In diesem kurzen Werk geht es um EpilepsieEpilepsie, eine damals wie heute relativ häufige Erkrankung: Es wird vermutet, dass sowohl Alexander der Große als auch Julius Caesar an dieser Krankheit litten.
Menschen mit EpilepsieEpilepsie haben Anfälle, bei denen es zu Absencen (oder Bewusstseinspausen), heftigen unkontrollierten Muskelzuckungen und manchmal auch zum Einnässen kommen kann. Dann lässt der Anfall allmählich nach, und die Betroffenen gewinnen wieder die Kontrolle über ihren Körper und Geist. Solche Krampfanfälle, wie sie auch für heutige Epileptiker noch zum Alltag gehören, können auf Außenstehende durchaus erschreckend wirken. Und weil sich diese Krankheit eben so dramatisch und mysteriös äußerte, vermuteten die alten GriechenGriechen hinter dem Leiden eine göttliche Ursache und nannten es »die heilige Krankheit«.
Ganz anders sah das der Autor des hippokratischen Traktats, der in seiner Einleitung schreibt: »Mit der sogenannten »heiligen KrankheitReligionund Krankheit« hat es folgende Bewandtnis. Sie scheint mir um nichts göttlicher oder heiliger zu sein als die anderen Krankheiten, sondern sie hat den gleichen Ursprung wie die anderen. Doch haben die Menschen infolge ihrer Unwissenheit und ihrer Verwunderung, weil sie in nichts den anderen Krankheiten gleicht, geglaubt, ihr Wesen und ihre Ursache seien etwas Göttliches.« Der Autor vertrat die Theorie, EpilepsieEpilepsie werde durch eine Schleimblockade im Gehirn ausgelöst. Wie die meisten Theorien in Wissenschaft und MedizinMedizin wurde auch diese durch eine bessere ersetzt. Doch die Feststellung, dass eine Krankheit noch lange nicht übernatürlich sein muss, nur weil sie ungewöhnlich und mysteriös erscheint, folgt einem Grundprinzip der Wissenschaft. Dinge, die uns heute noch rätselhaft erscheinen, werden wir eines Tages möglicherweise doch ergründen. Dies gehört sicherlich zu den beständigsten und zeitlosesten Botschaften, die uns von den Hippokratikern überliefert wurden.
Dem zweiten hippokratischen Prinzip zufolge entscheiden unsere »Körpersäfte« darüber, ob wir gesund oder krank sind. In der Abhandlung Über die Natur des Menschen, die wahrscheinlich von HippokratesHippokrates’ Schwiegersohn stammt, wird dieser Gedanke eindrücklich dargelegt. In anderen Werken von HippokratesHippokrates werden die KörpersäfteSäfte (vier Körpersäfte) Schleim und gelbe Galle als die Verursacher von Krankheiten betrachtet. In der Abhandlung Über die Natur des Menschen werden diesen zwei Säften zwei weitere hinzugefügt: Blut und schwarze Galle. Dem Autor zufolge sind diese vier SäfteSäfte (vier Körpersäfte) von entscheidender Bedeutung für unsere Gesundheit, und wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten (wenn es also von dem einen zu viel und von einem anderen zu wenig gibt), wird der Mensch krank. Etwas Ähnliches erleben wir selbst ziemlich häufig: Bei Fieber bekommen wir oft Schweißausbrüche, hat uns eine Erkältung oder eine Bronchitis erwischt, läuft uns die Nase und wir husten Schleim. Bei einer Magenverstimmung müssen wir uns übergeben, und bei Durchfall kommt es an anderer Stelle zu Ausscheidungen. Wenn wir uns schneiden oder aufschürfen, bluten wir. Seltener ist heutzutage die Gelbsucht, bei der sich die Haut gelb verfärbt. Gelbsucht kann durch viele Krankheiten hervorgerufen werden, die für die Bildung von Körperflüssigkeiten zuständige Organe betreffen. Dazu zählt auch die im alten Griechenland weitverbreitete Malaria.
Die Hippokratiker verbanden jede dieser Körperflüssigkeiten mit einem Körperorgan: das Blut mit dem Herzen, die gelbe Galle mit der Leber, die schwarze Galle mit der Milz und den Schleim mit dem Gehirn. Nicht nur im Falle der EpilepsieEpilepsie, bei der eine Schleimverstopfung im Gehirn angenommen wurde, auch bei anderen Krankheiten ging man von einer Veränderung der KörpersäfteSäfte (vier Körpersäfte) aus, auch wenn diese Veränderungen oft nicht so offensichtlich waren wie bei einer Erkältung oder bei Durchfall. Jeder Körperflüssigkeit wurden bestimmte »Qualitäten« zugesprochen: Blut galt als heiß und feucht, Schleim als kalt und feucht, gelbe Galle als heiß und trocken, schwarze Galle hingegen als kalt und trocken. Und tatsächlich können bei Kranken derartige Symptome beobachtet werden: Eine entzündete Wunde ist heiß. Wenn wir erkältet sind, läuft uns die Nase, und wir haben Schüttelfrost. (GalenosGalenos, der ungefähr 600 Jahre später die hippokratischen Vorstellungen weiterentwickelte, übertrug diese Eigenschaften – heiß, kalt, feucht und trocken – auf die Lebensmittel und Medikamente, die wir zu uns nehmen.)
Um Krankheiten heilen zu können, musste das für den jeweiligen Patienten optimale Gleichgewicht der KörpersäfteSäfte (vier Körpersäfte) wiederhergestellt werden. Das heißt, in der hippokratischen MedizinMedizin ging es nicht einfach darum, jeden der KörpersäfteSäfte (vier Körpersäfte) einer bestimmten Anleitung gemäß zu seinem »natürlichen« Zustand zurückzuführen, die Praxis war viel komplizierter. Jeder Patient hatte sein eigenes individuelles Gleichgewicht der KörpersäfteSäfte (vier Körpersäfte), deshalb musste ein Arzt über seine Patienten genauestens Bescheid wissen: Er musste wissen, wo sie lebten, was sie aßen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Nur so konnte er ihnen sagen, was sie zu erwarten hatten, und eine »Prognose« (also Voraussage) über den Krankheitsverlauf wagen. Ein Kranker möchte wissen, woran er leidet und was er tun muss, um wieder gesund zu werden. Hippokratische Ärzte legten deshalb großen Wert auf korrekte Prognosen. Das erhöhte ihr Ansehen und auch die Zahl ihrer Patienten.
Die medizinischen Kenntnisse, die sich die Hippokratiker aneigneten und dann an ihre Schüler (häufig ihre Söhne oder Schwiegersöhne) weitergaben, basierten auf der sorgfältigen Beobachtung von Krankheitsverläufen. Ihre Erkenntnisse hielten sie schriftlich fest, zumeist in Form von kurzen Zusammenfassungen, den sogenannten »AphorismenAphorismen (Hippokrates)« (was so viel heißt wie »Lehrsätze«). Diese AphorismenAphorismen (Hippokrates) gehören zu den hippokratischen Werken, die von späteren Ärzten am häufigsten genutzt wurden.
Den dritten medizinischen Ansatz der Hippokratiker fasst der lateinische Ausdruck vis medicatrix naturae zusammen, was übersetzt »die Heilkraft der Natur« bedeutet. HippokratesHippokrates und seine Anhänger interpretierten die Bewegung von Körpersäften während einer Krankheit als Selbstheilungsversuch des Körpers. So wurden die Schweißbildung, der Auswurf von Schleim, Erbrechen und die Eiterbildung bei Abszessen als die Ausscheidung – oder das »Kochen« (die Hippokratiker verwendeten häufig Küchenmetaphern) – von Körpersäften betrachtet. Der Körper versucht damit, Überschüssiges loszuwerden oder Säfte, die durch die Krankheit verdorben waren, zu erneuern oder zu reinigen. Die Aufgabe des Arztes war es, die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers zu unterstützen. Der Arzt war dabei nicht Herr über die Natur, sondern fungierte gewissermaßen als ihr Diener, der den Krankheitsverlauf und die auftretenden Symptome genau studieren musste. Später wurde für Leiden, die von selbst wieder verschwinden, der Begriff der »selbstlimitierenden Krankheit« eingeführt. Ein beliebter Witz unter Ärzten lautet: Eine Krankheit ist in einer Woche vorüber, wenn sie behandelt wird, und wenn sie nicht behandelt wird, dauert sie sieben Tage. Die Hippokratiker hätten dem sicher zugestimmt.
Neben den zahlreichen Schriften über Heilkunde und Chirurgie, Hygiene und Epidemien hinterließen uns die Hippokratiker den Eid, dem sich auch heute noch die Ärzte verpflichtet fühlen. Ein Teil dieses kurzen Schriftstücks handelt von der Beziehung zwischen jungen Studenten und ihren Lehrmeistern und der Beziehung von Ärzten untereinander. Hauptsächlich geht es darin jedoch um den angemessenen Umgang des Arztes mit seinen Patienten. Vor allem sollten sie niemals das Vertrauen ihrer Patienten missbrauchen, indem sie intime Informationen, die ihnen Kranke anvertrauen, weitererzählen. Sie dürfen ihnen auch kein Gift verabreichen. All diese grundlegenden Werte sind auch heute noch fester Bestandteil der modernen Medizin-Ethik. Als besonders zeitlos erscheint das folgende »Gebot« des Hippokratischen Eides: »Ich werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.« Den Kranken keinen Schaden zuzufügen sollte auch heute noch das oberste Ziel eines jeden Arztes sein.
5Der Meister der Wissenden: Aristoteles
»Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen«, behauptete AristotelesAristoteles. Jeder von uns kennt wohl solche Menschen, die immer darauf aus sind, etwas Neues zu erlernen. Andererseits ist uns natürlich auch schon so mancher Dummkopf über den Weg gelaufen, dem diese für AristotelesAristoteles so wichtige Neugier völlig fremd ist. Aristoteles’Aristoteles Hoffnung war es, dass die Menschen von Natur aus nach Wissen über sich selbst und über die Welt streben. Leider wissen wir, dass nicht jeder Mensch diese Hoffnung erfüllt.
AristotelesAristoteles studierte und lehrte sein ganzes Leben lang. Er wurde 384 v. Chr. in Stageira, im Land Thrakien, auf der heutigen griechischen Halbinsel Chalkidiki, als Sohn eines Arztes geboren. Als er ungefähr zehn Jahre alt war, kam er in die Obhut seines Vormunds Proxenos, der ihn betreute und unterrichtet. Mit siebzehn ging AristotelesAristoteles nach Athen und trat in die berühmte Platonische Akademie ein, wo er 20 Jahre lang forschte und lehrte. Obwohl AristotelesAristoteles eine ganz andere Einstellung zur natürlichen Welt hatte als PlatonPlaton, schätzte er seinen Lehrer sehr und berichtete nach PlatonsPlaton Tod 347 v. Chr. sehr anerkennend über dessen Arbeit. Manchmal wird behauptet, die ganze spätere Geschichte der westlichen PhilosophiePhilosophie sei nichts weiter als eine Reihe von »Fußnoten« (also bloße Anmerkungen) zu PlatonPlaton, was deutlich machen soll, dass PlatonPlaton viele Fragen zum ersten Mal aufgeworfen hat, über die Philosophen heute noch nachdenken: Was ist die Natur der Schönheit? Was ist Wahrheit oder das Wissen? Wie können wir gut sein? Wie sollte unsere Gesellschaft am besten aufgebaut sein? Wer setzt die Regeln fest, nach denen wir leben? Was sagen unsere Erfahrungen mit den Dingen der Welt darüber aus, wie diese Dinge »wirklich« sind?
Mit vielen dieser philosophischen Fragen beschäftigte sich auch AristotelesAristoteles, wobei er zu Antworten neigte, die man eher als »wissenschaftlich« bezeichnen würde und weniger als »philosophisch«. Wie PlatonPlaton war auch AristotelesAristoteles ein Philosoph, aber er war eher ein Naturphilosoph, und das ist in etwa das, was wir heute einen »Wissenschaftler« nennen würden. Das philosophische Teilgebiet, für das er sich am meisten interessierte, war die Logik – die Lehre des vernünftigen Schlussfolgerns. Er beschäftigte sich pausenlos mit der Welt, die ihn umgab – sei es die irdische oder die himmlische –, und damit, wie sich natürliche Dinge veränderten.
Viele von AristotelesAristoteles’ Schriften sind verlorengegangen, doch einige seiner Vorlesungsskripte sind glücklicherweise erhalten geblieben. Nach PlatonsPlaton Tod verließ er Athen, wahrscheinlich weil er sich dort als Fremder nicht sicher fühlte, und lebte einige Jahre in Assos (einer Stadt in der heutigen Türkei). Er gründete dort eine Schule, heiratete Pythias, die Verwandte eines lokalen Herrschers, und lebte nach deren Tod mit einer Sklavin zusammen, mit der er einen Sohn namens Nikomachos hatte. In Assos begann AristotelesAristoteles mit seinen biologischen Forschungen, die er auf der Insel Lesbos fortsetzte. Im Jahr 343 v. Chr. übernahm AristotelesAristoteles eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe: Er wurde der Lehrer von Alexander dem Großen in Makedonien (das heute ein eigenständiges Land nördlich von Griechenland ist). Er hoffte, seinen Schüler zu einem philosophisch sensiblen Herrscher zu erziehen, doch dieses Vorhaben scheiterte – Alexander verließ sich lieber auf militärische Stärke als auf philosophische Weisheit. Aber immerhin: Als Alexander schließlich die Herrschaft über einen Großteil der damals bekannten Welt gewann (Athen eingeschlossen), konnte AristotelesAristoteles in Sicherheit nach Athen zurückkehren. Anstatt an die Platonische Akademie zurückzukehren, gründete AristotelesAristoteles in einem Außenbezirk der Stadt eine neue Schule. Diese verfügte über eine öffentliche Wandelhalle (auf Griechisch peripatos), weshalb Aristoteles’Aristoteles Anhänger auch als Peripatetiker, also die unentwegt Umherwandelnden, bezeichnet wurden – ein durchaus passender Name, wenn man bedenkt, wie oft AristotelesAristoteles selbst von einem Ort zum anderen gezogen war. Mit Alexanders Tod hatte AristotelesAristoteles in Athen seinen Rückhalt verloren, weshalb er noch ein letztes Mal umzog, diesmal nach Chalkis in Griechenland, wo er kurz darauf starb.
AristotelesAristoteles hätte sich darüber gewundert, als Wissenschaftler beschrieben zu werden; er war ganz einfach ein philósophos im wörtlichen Sinne: ein Freund der Weisheit (philos heißt »Freund«, sophia »Weisheit«). Doch er verbrachte sein Leben damit, die Welt um sich herum zu verstehen, und er tat das auf eine Weise, die wir heute als wissenschaftlich bezeichnen würden. Seine Vorstellung von der Welt, ihren Lebewesen und dem sie umgebenden Himmel prägte über 1500 Jahre lang das Denken der Menschen. Zusammen mit GalenosGalenos überragt er alle anderen antiken Denker. Natürlich baute er auf dem auf, was vor ihm war, doch er war kein Schreibtisch-Philosoph. Stattdessen beschäftigte er sich eingehend mit der Sinnenwelt, um sie zu verstehen.
Sein wissenschaftliches Werk gliedert sich in drei Teilbereiche: die lebendige Welt (Tiere, Pflanzen und der Mensch); die Arten der Veränderung oder Bewegung, die er hauptsächlich in seinem Werk PhysikPhysik (Aristoteles) behandelt, und die Struktur des Himmels beziehungsweise die Beziehung zwischen Erde und Sonne sowie dem Mond, den Sternen und anderen Himmelskörpern.
AristotelesAristoteles beschäftigte sich lange Zeit mit der Beschaffenheit und den Funktionen von Tieren und Pflanzen. Er interessierte sich für deren Entwicklung vor der Geburt, dem Schlüpfen beziehungsweise dem Aufkeimen und während der Wachstumsphase. Und offenbar verfügte AristotelesAristoteles über ein ausgezeichnetes Sehvermögen, denn er beschrieb detailliert, wie sich Hühner im Ei entwickelten – und das ohne Mikroskop. Von einer Anzahl von Eiern, die am selben Tag gelegt worden waren, öffnete er täglich eines. Das erste Anzeichen von Leben erkannte er in einem winzigen pulsierenden Blutfleck, dem späteren Herzen des Kükens. Daraus zog er die Schlussfolgerung, dass das zentrale Organ bei Tieren das Herz war. Für ihn war das Herz der Sitz der Gefühle und dessen, was wir heute als Seele bezeichnen würden. PlatonPlaton (und die Hippokratiker) hatten diese psychologischen Funktionen im Gehirn angesiedelt, und sie hatten recht. Ganz abwegig war Aristoteles’Aristoteles Idee jedoch nicht, schließlich schlägt unser Herz schneller, wenn wir Angst haben, aufgeregt oder verliebt sind. Er schrieb das Handeln höherer Tiere, und damit auch das des Menschen, der Tätigkeit einer »Seele« zu, die verschiedene Fähigkeiten oder Funktionen besitzt. Der Seele des Menschen werden sechs verschiedene Fähigkeiten zugeschrieben: Ernährung und Fortpflanzung, Sinneswahrnehmung, Begierde, Bewegung, Vorstellungskraft und Verstand.
Alle Lebewesen besitzen einige dieser Fähigkeiten. Pflanzen zum Beispiel können wachsen und sich fortpflanzen; Insekten wie Ameisen können sich zudem bewegen und fühlen. Bei größeren und intelligenteren Tieren kommen noch andere Fähigkeiten hinzu, der Verstand jedoch, so AristotelesAristoteles, ist allein dem Menschen vorbehalten – das heißt, nur der Mensch besitzt die Fähigkeit, zu denken, etwas zu analysieren und über seine Handlungen zu entscheiden. Auf der höchsten Stufe von Aristoteles’AristotelesScala Naturae(»StufenleiterStufenleiter des Lebendigen (der Natur) der Natur« oder »StufenleiterStufenleiter des Lebendigen (der Natur) des Lebendigen«) steht daher der Mensch. Auf dieser StufenleiterStufenleiter des Lebendigen (der Natur) sind alle Lebewesen nach dem Grad ihrer Entwicklung angeordnet, angefangen bei primitiven Pflanzen bis hin zu höher entwickelten Lebewesen. Dieses Konzept wurde von verschiedenen Naturalisten (das sind Menschen, die sich mit dem Studium der Natur, insbesondere der Pflanzen- und Tierwelt, beschäftigen) immer wieder aufgegriffen. Und auch wir werden in den folgenden Kapiteln erneut darauf stoßen.
AristotelesAristoteles hatte ein Talent dafür, herauszufinden, welche Aufgaben die einzelnen Teile einer Pflanze oder eines Tieres, wie etwa die Blätter, die Flügel, der Magen oder die Nieren, erfüllen. Er nahm an, dass jeder Pflanzen- oder Körperteil unter Berücksichtigung seiner speziellen Funktion entworfen wurde. Folglich wurden Flügel zum Fliegen gemacht, Mägen für die Verdauung von Nahrung und Nieren für das Verarbeiten von Urin. Diese Sichtweise wird als teleologische LehreTeleologische Lehre bezeichnet (von telos: »Zweck«, »Ziel«). Sie beschäftigt sich damit, wie die Dinge sind und welchem Zweck sie dienen. Denken wir beispielsweise an eine Tasse oder ein Paar Schuhe: Beiden Gegenständen wurde eine spezielle Form verliehen, weil sie einen bestimmten Zweck erfüllen sollen, nämlich das Bereithalten von Getränken und den Schutz der Füße beim Gehen. Die teleologische LehreTeleologische Lehre wird uns in diesem Buch erneut begegnen, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit Tieren und Pflanzen, sondern der materiellen Welt im weiteren Sinne.
Pflanzen keimen auf und Tiere werden geboren, sie wachsen und sterben schließlich. Die Jahreszeiten kommen und gehen. Lässt man etwas fallen, so fällt es zu Boden. Für Veränderungen wie diese wollte AristotelesAristoteles Erklärungen finden. Besonders wichtig waren ihm dabei zwei Gedanken: die »Potenzialität« und die »Aktualität«. Wir sagen manchmal, jemand hat sein Potenzial voll ausgeschöpft, ein Sportler zum Beispiel, wenn es um ein Wettrennen geht, bei dem er alles gegeben hat. Das schwingt auch in Aristoteles’Aristoteles Begriff der »Potenzialität« mit, doch er sah in den Dingen noch eine andere Art von Potenzial. Seiner Ansicht nach besitzt ein Haufen Ziegelsteine das Potenzial, ein Haus zu werden, und ein Steinbrocken ist potenziell eine Statue. Durch Bauen und Meißeln werden diese unbeseelten Objekte von einem Zustand der »Potenzialität« (was möglich ist) in einen Zustand der »Aktualität« (wie es schließlich wirklich ist) versetzt und so zu etwas Vollendetem. Aktualität ist das letzte Ergebnis von Potenzialität, wenn das mit Potenzialität Ausgestattete zu seinem »natürlichen Zustand« findet. Wenn zum Beispiel von einem Apfelbaum Äpfel abfallen, dann haben diese Äpfel AristotelesAristoteles zufolge ihren »natürlichen« Zustand gesucht, der sich auf der Erde befindet. Ein Apfel bekommt nicht plötzlich Flügel und fliegt davon, sondern sucht, wie alle Dinge auf unserer Welt, die Erde. Ein fliegender Apfel wäre deshalb etwas Unnatürliches. Mag sein, dass sich dieser heruntergefallene Apfel weiter verändert. Er wird faulen, wenn ihn niemand aufliest und isst, denn auch das gehört zu seinem Kreislauf des Wachsens und Vergehens. Doch allein durch das Herunterfallen hat er eine Art von Aktualität erreicht. Sogar Vögel, die bei ihren Flügen gen Himmel steigen, kehren immer wieder zur Erde zurück.
Wenn der »natürliche« Ruheplatz der Dinge auf dem Erdboden ist, wie verhält es sich dann mit dem Mond, der Sonne, den Planeten und Sternen? Sie hängen zwar dort oben wie ein Apfel am Baum oder ein Felsbrocken an einer Felswand, doch sie stürzen nie zur Erde herab. Zum Glück. AristotelesAristoteles





























