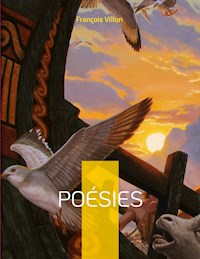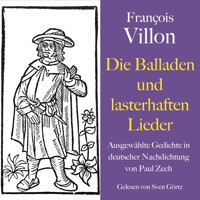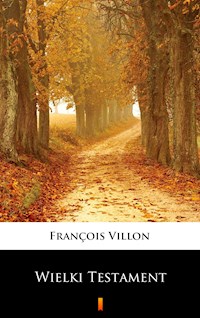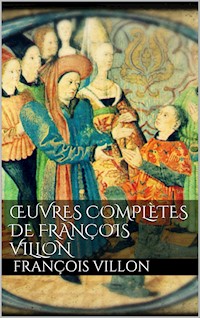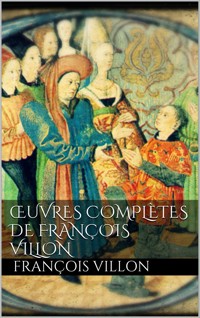9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Weltliteratur über die Ausschweifungen des Lebens Die Balladen und Lieder des François Villon sind ein unvergängliches Zeugnis der Weltliteratur. Derb, humorvoll und erschütternd zeugen sie von Liebe und Hass, Tod und Vergänglichkeit, Hunger und Armut, Laster und Ausschweifung. Mit Villon hielt Volks- und Gaunersprache Einzug in die Literatur – und die kongeniale Nachdichtung des expressionistischen Dichters Paul Zech steht ihm in nichts nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die Balladen und Lieder des François Villon sind ein unvergängliches Zeugnis der Weltliteratur. Nie zuvor (aber auch später nicht mehr) sind in der französischen Dichtung Liebe und Hass, Tod und Vergänglichkeit, Hunger und Armut, Laster und Ausschweifung so unmittelbar und frech, so derb, humorvoll und zugleich so erschütternd Sprache geworden. Villon war der erste, der die Volks- und Gaunersprache in die Literatur einbezog. Musste ein solches Genie nicht gerade auf den deutschen Expressionismus, der sich besonders des leidenden, heruntergekommenen Menschen annahm, Einfluss haben? In dieser Zeit sind denn auch die deutsche Übertragungen Villons entstanden. Paul Zech, dem bekannten expressionistischen Dichter, haben wir die Nachdichtung seiner Balladen und Lieder zu verdanken, die uns bis heute Geist und Stil dieser Verse unverwelkt und aggressiv bewahrt. Er hat auch unermüdlich Material über das halbvergessene Leben Villons gesammelt und eine anschauliche Biografie geschrieben, die den Dichter in seiner Zeit und seiner Umgebung sieht. – Die vorliegende Ausgabe wurde nach Zechs letzter, bisher unveröffentlichter Bearbeitung und Erweiterung aus dem Jahr 1946 gedruckt und ist um ein die Nachdichtung übersetzungshistorisch einordnendes Vorwort sowie Anmerkungen von Alexander Nitzberg ergänzt.
EIN VORWORT DES HERAUSGEBERS
Was ist eine gelungene Gedichtübersetzung? – Eine schlichte Lesehilfe? Ein Gebilde, bei dem auch die jeweilige poetische Form mitberücksichtigt wird? Eine kongeniale Nachdichtung? – All diesen Antworten ist eines gemein: Sie zeigen den Übersetzer in einem Abhängigkeitsverhältnis, als jemanden, dem das ursprüngliche Werk immer einen Schritt voraus ist – wie die Schildkröte dem Achill …
Dabei ließe sich die Qualität einer Übersetzung auch an der Rolle ablesen, die sie in der Zielsprache spielt. Man denke an die Rubaijat des Omar Khayam von Edward FitzGerald – keine Übersetzung im engeren Sinne, eher eine Art Quintessenz, dafür aber eines der meistzitierten Werke der englischen Literatur. Und noch sehr viel freier geht mit der Farsi-Lyrik Goethe im West-östlichen Divan um, indem er Hafis nicht nur anklingen lässt, sondern auch immer wieder in dessen Rolle schlüpft. Manch einem mag hier die Beziehung zwischen Original und Nachdichtung problematisch erscheinen. Doch es gibt ja noch wesentlich heiklere Fälle! Übersetzungen, die gewissermaßen auch ganz ohne Original auskommen, wie etwa die Gesänge des Ossian – von den großen Dichtern des Sturm und Drang eifrig studiert und nachgeahmt, sind sie nichts anderes als Fabrikation des »Übersetzers« James Macpherson. Es wäre zu simpel und ungerecht, sie als Falsifikationen abzutun. Weil Literatur ihren eigenen Gesetzen folgt.
François Villon ist mit seinem Leben und Werk ein Paradebeispiel dafür, wie seltsam die Wege eines literarischen Schicksals mitunter sein können. Denn blinde Flecken im Biografischen erschaffen oft Freiräume für die Fantasie. Und das Bild des Dichters, das aus derlei Fiktionen entsteht, vermag das historische zu überlagern. Paul Zechs Villon-Übertragungen sind der Höhepunkt eines solchen Transformationsprozesses.
Das Hauptproblem ist wohl die Frage, wie es überhaupt passieren konnte, dass ein intellektueller, ja, gelehrter Autor, der in festen Formen und Traditionen arbeitet und darin sehr komplexe und subtile Gedichte verfasst, zum Inbegriff des Ganovenpoeten mutiert ist, zu einem betrunkenen Sänger »lasterhafter Lieder«? Natürlich sind viele Facetten dieses Charakterbilds in Villons Werk und Biografie angelegt – das Gefängnis, die drohende Hinrichtung, die Freundschaft mit Huren, Trinkern und Banditen. Und doch zählen all diese Dinge seit Jahrhunderten zum Arsenal literarischer Verkleidungen und sollten daher nur augenzwinkernd für bare Münze genommen werden. Gedichte, zumal die spätmittelalterlichen, sind kaum der Ort, wo man nach authentischen Lebensberichten Ausschau halten sollte – zu vieles darin ist raffiniertes Spiel mit poetischen Genres und Topoi.
Ein Beispiel für diverse Verschiebungen in der Wahrnehmung des Dichters bezüglich seiner Originalität: François Villon ist uns heute als der Verfasser des Kleinen (Le Lais, 1456) und des Großen Testaments (Le Testament, 1461 – 62) bekannt. Die Form des poetischen Testaments ist in unserer Vorstellung fest mit ihm verbunden. Dabei existiert sie in der volkssprachlichen französischen Literatur schon seit dem zwölften Jahrhundert in unterschiedlicher Diktion, Ausprägung und Länge. Darunter sind echte Meisterwerke, die sich mitnichten auf ein bloßes Vorläufertum Villons reduzieren lassen. Am Beginn steht der zisterziensische Troubadour Hélinand de Froidmont (1160? – 1230?) mit seinem sechshundert Zeilen starken Werk Vers de la Mort. Ihm folgen im dreizehnten Jahrhundert Jean Bodel und Baude Fastoul, die ihre Abschiedslieder (Condé) vor der Einlieferung in ein Leprosorium schreiben. Diese Werke sind eng mit der jeweiligen Biografie verknüpft und von ganz und gar tragischem Charakter.
Die Tradition wird in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts von Adam de la Halle fortgesetzt und um neue Facetten ergänzt. Denn in seinen Abschiedsgedichten sucht er weniger Versöhnung mit Gott als vielmehr Streit mit den Zeitgenossen. Klagen über den Sittenverfall durchziehen das zweitausend Zeilen lange Testament Jean de Meungs, der auch den zweiten Teil des berühmten Rosenromans verfasst hat. Aber für die eigentliche Wende sorgt der möglicherweise bedeutendste Dichter des vierzehnten Jahrhunderts, Eustache Deschamps, der in seinem Testament parodistische Töne anschlägt, was auch von den nachfolgenden Poeten fortgesetzt wird. Diese Entwicklung kulminiert in der groß angelegten Trilogie La confession et testament des Dichterfürsten Pierre de Hauteville aus dem fünfzehnten Jahrhundert, der in seiner Beschreibung der zu vermachenden Gegenstände ein Netz aus feinsinnigen Allegorien spinnt. Neben diesen markantesten Pfeilern des Genres existieren unzählige andere, die zusammen organisch den Hintergrund bilden, vor dem das Werk Villons entstehen und sich entfalten kann.
Villon übernimmt von der Tradition die Methoden, um sein eigenes Leben in literarische Formen zu gießen, wie auch alle dazu notwendigen Redefiguren – die des persönlichen Schmerzes wie auch die der bissigen Satire. Und es ist die souveräne Beherrschung all dieser Elemente, die seinen Versen eine solche Glaubwürdigkeit verleiht, sie für uns aus dem allgemeinen Strom heraushebt. Denn spätestens seit der europäischen Romantik verliert sich zunehmend das Interesse an rhetorischen Gesten und formalen Fingerübungen. Erwartet wird vielmehr die Brechung menschlicher Schicksale im Spiegel der Epoche und der Kunst.
Doch wenn beispielsweise ein Romanist der 1940er-Jahre schreibt: »Lediglich in der Form seiner Dichtungen blieb Villon Vorgängern und Zeitgenossen verpflichtet … während es sich bei diesen um modisch bedingte Gelegenheitsprodukte handelt, nimmt Villon den Stoff aus allpersönlichstem Erleben«, so wäre das gewiss eine sehr einseitige Beurteilung. Denn auch für das »allpersönlichste Erleben« bietet die französische Testament-Literatur genügend prominente Beispiele. Außerdem liegt hier ein Zirkelschluss vor: Denn woran will man das »allpersönlichste Erleben« Villons überhaupt messen, wenn nicht an der Wirkung eines durch und durch literarischen Werks, bei welchem man sich entschieden hat, es, ungeachtet aller poetischen Konventionen, als ein authentisches biografisches aufzufassen?
Ein Wort zu den verwendeten poetischen Formen: Die spätmittelalterlichen Testamente sind fein gedrechselte Sprachartefakte, die auf hochkomplexe Strophik zurückgreifen. So ist es kein Wunder, dass auch Villon sich durchwegs virtuoser Formen bedient. Beide Testamente sind in einer achtzeiligen Strophe geschrieben, die nach jeweils vier gleichen Reimwörtern verlangt: ABAB/BCBC. In den Balladen, die das Große Testament durchziehen, wird dieses Verfahren noch ausgeweitet: Eine Ballade besteht aus drei Strophen und einem Geleit (envoi) an den Adressaten. Dabei müssen die in der ersten Strophe verwendeten Reime in den beiden nachfolgenden und sogar im Geleit fortgesetzt werden, was die Anzahl der erforderlichen Endreime sofort verdreifacht! Sowohl die Strophen als auch die Sendung enden mit einem markanten Refrain, der den Charakter der jeweiligen Ballade auf den Punkt bringt, wie etwa der sprichwörtliche Ausruf: »Mais où sont les neiges d’antan!« (»Doch wo ist der Schnee vom vorigen Jahr?«) Im Übrigen meint die Gattungsbezeichnung hier nicht ein erzählendes Gedicht, sondern nur die oben genannte Form. Es ist auch kein Lied, denn die literarische Tradition jener Tage hat sich schon seit geraumer Zeit vom Gesang gelöst. Dass Villon seine Verse singend vorgetragen hat, wie es sich viele heute vorstellen, ist also eher unwahrscheinlich.
Die Komplexität der erwähnten poetischen Mittel, die der Vorstellung vom »volkstümlichen Charakter« dieser Werke schon ein Stück weit zuwiderläuft, macht die Übersetzung Villons zu einem höchst ambitionierten Unterfangen. Und so wird Villon mit Vorliebe von verfeinerten Meistern der Verskunst übersetzt. In England von dem Präraffaeliten Dante Gabriele Rossetti oder dem Sprachvirtuosen Algernon Charles Swinburne. Von John Payne stammt die erste englische Gesamtübersetzung der Villon’schen Werke (1874). In Russland erscheint die erste größere Villon-Auswahl 1916 in der Übersetzung von Ilja Ehrenburg, der als Lyriker an den französischen Parnassiens und Symbolisten geschult ist. Und diese sind es ja, die sich Villon auf die Fahnen schreiben: Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Tristan Corbière oder Joris-Karl Huysmans.
Was all diese verwöhnten Geister reizt, ist einerseits die sprachliche Verarbeitung, denn sie selbst sind ja auf der Suche nach ungewöhnlichen Ausdrucksmitteln, grellen Bildern und erlesenen poetischen Formen. Andererseits fühlen sie sich von der Vorstellung des gesellschaftlich ausgestoßenen, möglicherweise sogar verbrecherischen Paria mehr als angezogen, denn sie entspricht ihrem eigenen künstlerischen Ideal: der Maske des Bürgerschrecks. Von solch einem »verfemten Dichter« schreibt Rimbaud in seinen Seherbriefen, dass er »unaussprechliche Qual« erleidet, »in der er zum großen Kranken, zum großen Verbrecher, zum großen Verdammten wird – und zum höchsten Wissenden!«
Von dem Punkt aus ergreift dieser Gedanke die gesamte europäische Avantgarde. So schreibt Filippo Tomaso Marinetti 1909 in seinem Futuristischen Manifest: »Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung … die Ohrfeige und den Faustschlag … Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk sein«. Wladimir Majakowski rügt die Schriftsteller für ihre Feigheit und erinnert sie daran, dass ihr Kollege François Villon auf Raubzüge ging. Nikolaj Gumiljow, der Gründer des Akmeismus, zählt Villon zu den Vorbildern des neuen Stils. Und sein Schüler und Mitstreiter Ossip Mandelstam widmet Villon einen Essay, wo er um die Lösung des alten Problems, des Widerspruchs zwischen Genie und Missetat ringt.
Im deutschsprachigen Raum bemächtigt sich dieser neue Impuls vor allem der expressionistischen Dichter. So schreibt Gottfried Benn das Gedicht Räuber-Schiller, das mit den Zeilen beginnt:
Ich bringe Pest. Ich bin Gestank.
Vom Rand der Erde komm ich her …
Oder Verse, wie diese:
… Das Dichterpack, der abgefeimte Pöbel,
das Schleimgeschmeiß, der Menschheitslititi,
ein Stuhlbein her, ein alter Abtrittsmöbel,
ein Schlag – der Rest ist Knochenchirurgie …
Klabund veröffentlicht 1916 im Versband Die Himmelsleiter einen kleinen Zyklus von drei Gedichten auf Villon mit beispielsweise folgenden Zeilen:
Ich bin gefüllt mit giftigen Getränken,
Ich speie Eiter, wenn ich wen besah;
Ich fluche jedem heiligen Hallelujah …
Er ist auch der Autor des Gedichtbands Der himmlische Vagant (1919), der komplett François Villon gewidmet ist.
Die erste größere Auswahl von Villon-Gedichten erscheint auf Deutsch bereits 1907. Der Übersetzer ist der Österreicher K. L. Ammer (Pseudonym von Karl Anton Klammer). Sein einziger Vorläufer ist Richard Dehmel, der 1892 zwei Balladen – Lied der Gehenkten und Lied des vogelfreien Dichters – überträgt. Dehmel arbeitet sehr präzise und hält sich an die Form des Originals (ohne freilich dessen exzessive Verwendung derselben Reime zu berücksichtigen). Doch indem er die Gedichte als »Lieder« bezeichnet, legt er bereits die spätere Lesart Villons im deutschen Sprachraum fest. K. L. Ammer übersetzt nun einen Teil der beiden Testamente und einzelne Balladen. Seine Verse sind freier und mehr am Bänkelsang als an der komplexen französischen Kunstdichtung orientiert. Der liedhafte Effekt kommt nicht zuletzt durch das gelegentlich schwankende Metrum und die Villon eigentlich gänzlich fremden Paarreimhäufungen zustande. Doch in diesem Gewand erlangt Villon eine enorme Popularität. Als fahrender Moritatensänger geistert er durch den Roman Der Judas des Leonardo von Leo Perutz, der 1959 posthum erschien. Bertolt Brecht übernimmt 1928 ganze Passagen der Ammer’schen Übersetzung für die Songs seiner Dreigroschenoper. Der vorläufige Höhepunkt dieses neuen – sich vom englischen und russischen radikal unterscheidenden – Villon-Bilds ist schließlich die 1931 erschienene und 1943 revidierte Ausgabe Die lasterhaften Balladen und Lieder des François Villon in der Nachdichtung von Paul Zech.
★★★
Paul Zech ist ein 1881 in Briesen (Westpreußen) geborener Dichter, der hauptsächlich als Expressionist bekannt ist. Seine literarische Laufbahn beginnt zunächst mit Gedichten, in denen er belgische Kohlewerke und Schiffswerften thematisiert und somit als eine Art »Arbeiterdichter« gesehen wird. Nach einigen Jahren in Elberfeld (dem heutigen Wuppertal) zieht er, ermutigt von Else Lasker-Schüler, 1912 nach Berlin und findet sich dort inmitten der literarischen Bohème wieder. Durch seinen nie erlahmenden Fleiß und eine geradezu außerordentliche Produktivität macht er schon bald von sich reden und publiziert zahllose Gedichte, Erzählungen und Dramen und erhält 1918 den Kleist-Preis. Seine Kanonisierung erlebt er spätestens mit der Aufnahme unter die vierundzwanzig Autoren der wohl bedeutendsten Expressionistenanthologie Menschheitsdämmerung von Kurt Pinthus, wo er mit prominenten Vertretern des Stils wie Georg Trakl, Gottfried Benn, Jakob van Hoddis, Franz Werfel, August Stramm und Alfred Lichtenstein in einer Reihe stehen darf.
Viele seiner Gedichte zeichnen das Leben eines Ausgestoßenen:
… Und als wir erwachten, irgendwo im Bordell,
umklirrte das stumpfe Zorngebell
der zackige Stahl von Zuhältermessern.
(Erstes Erlebnis)
Nun kommt aber beim Phänomen Paul Zech noch etwas hinzu, das erst seit einigen Jahren bekannt ist: Sein gesamtes Leben scheint eine einzige Mystifikation, wenn nicht gar eine glatte Fälschung zu sein. Fast alle Jahreszahlen, Personen und Orte, die er selbst im Zusammenhang mit seiner Biografie nennt, entpuppen sich beim näheren Betrachten als frei erfunden. Dieses Versteckspiel mit teils unlauteren Mitteln ist auch für seine literarische Tätigkeit charakteristisch. So rezensiert er 1913 seinen eigenen Gedichtband Das schwarze Revier unter dem fingierten Namen »Paul Robert« in Franz Pfemferts Aktion. Er publiziert Übersetzungen aus dem Werk des französischen Dichters Léon Deubel, bei denen es sich in Wirklichkeit um Zechs eigene Verse handelt. Er will Deubel wie auch den belgischen Symbolisten Émile Verhaeren in Paris getroffen haben, doch auch dies entspricht nicht der Wahrheit. Er publiziert 1916 einen von »Verhaeren« an ihn gerichteten Brief, den er tatsächlich aber selbst geschrieben hat. Er übersetzt Arthur Rimbaud, François Villon und Louise Labé, benutzt jedoch als Grundlage für seine Nachdichtungen nicht, wie er vorgibt, die französischen Originale, sondern greift auf bereits existierende Übersetzungen zurück – von Richard Dehmel, K. L. Ammer und Rainer Maria Rilke. 1925 und 1927 wird er mit schweren Plagiatsvorwürfen konfrontiert, denn er gibt unter seinem Namen, nur leicht und mit mäßigem Geschick abgewandelt, Werke von Alfred Putzel und seinem Freund Robert Renato Schmidt heraus. Diese an sich vollkommen nutzlosen Vergehen schaden dem gerade erst auf dem Höhepunkt seines Ruhms angelangten Dichter ungemein. Er wird in Folge aus dem Schutzverband deutscher Schriftsteller ausgeschlossen.
Doch als wäre das alles nicht schon genug, erweist sich Zech in dieser Zeit auch noch als waschechter Dieb: Seit 1925 arbeitet er nebenher als Hilfsbibliothekar in der Berliner Stadtbibliothek. Dort gelingt es ihm, über zweitausend noch nicht inventarisierte, teils rare Bücher zu entwenden und zu verkaufen. Die mit dem Diebstahl verbundene polizeiliche Vorladung ist denn auch der Grund, Deutschland und seine Familie 1933 fluchtartig zu verlassen, und nicht etwa, wie er später behauptet, die politische Verfolgung seitens der Nazis. Die SA habe, so will er sich erinnern, ihn für zwei Wochen inhaftiert, seine Wohnung durchsucht und seine gesamte Bibliothek vernichtet oder beschlagnahmt.
Nach der Flucht siedelt sich Zech in Argentinien an, wo er weiterhin zahllose Gedichte, Erzählungen und teils recht umfangreiche Romane schreibt. Er veröffentlicht in vielen Emigrantenzeitungen und -zeitschriften Texte, die in sarkastischer Form den Nationalsozialismus anprangern, und spielt die Rolle eines dissidenten vertriebenen Autors.
Es fällt schwer, diese merkwürdigen Verhaltensweisen zu beurteilen. Ob es sich dabei um bewusste oder unbewusste Verletzungen der schriftstellerischen und auch allgemein menschlichen Integrität handelt, lässt sich heute kaum noch eruieren. Eines scheint aber sicher zu sein: Mit seinem Handeln begibt sich Zech außerhalb der gesellschaftlichen Konvention, stellt sich gewissermaßen selbst ins Abseits, wird zu einem Ausgestoßenen. Das von den Symbolisten und späteren Avantgarden verkündete Prinzip épater le bourgeois! wird hier bedenkenlos angewandt und zwar auf einer Ebene, die uns weniger körperlich, aber in unserem moralischen Empfinden umso stärker angreift und uns möglicherweise mehr tangiert, als wenn wir voller Sympathie von Charles Baudelaires Drogenexzessen lesen oder davon, wie Paul Verlaine aus Leidenschaft auf Arthur Rimbaud abfeuert.
Auch lässt sich an all diesen Handlungen erkennen, dass Zech im Umgang mit fremder Literatur offenbar alle zwischen ihm und dem Anderen liegenden Grenzen gänzlich auflöst. Das ist weit mehr als Brechts »Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums«, es ist dessen komplettes Negieren. Und doch ist auch diese Haltung ein konsequent zu Ende geführtes Credo der Moderne, die Rimbaud auf die bekannte Formel bringt: »Das Ich ist ein Anderer« (»Je est un autre.«) und die Wladimir Majakowski so ausdrückt:
Als Dichter radierte ich aus
die Grenze von Ich und Euch …
Indem Zech seine Poeten übersetzt, begegnet er ihnen quasi in einem höheren Grad von Realität, als wenn er sie in Paris leiblich getroffen hätte. Und Ersteres garantiert gleichsam die Wahrheit des Letzteren, selbst wenn es gar nicht stattgefunden hat. Und wenn er François Villon überträgt, glaubt er ohne den leisesten Hauch eines Zweifels an sein geradezu heiliges Recht, Gedichte zu kürzen, zu verlängern, zu variieren oder komplett umzuschreiben: Eine perfekte Identifikation mit dem Anderen und eine Aneignung von dessen Schaffen. Und was dem Akademiker als ein Akt reinster Willkür erscheint, ist ihm eine schiere Selbstverständlichkeit.
Zechs Auffassung von Villons Kunst, wie sie aus dem Vorwort der ersten Version (1931) hervortritt, ist eine ganz und gar anachronistische, sprich: expressionistische. Das verrät schon sein Vokabular: »Er war, mit aller Heftigkeit eines Hellhörigen im Blut und in der Bewegung des Hirns, ein Erzeugnis der Stunde. In jegliche Stunde, die ihn überkam, passte er sich hinein und füllte sie aus mit heftigen Geschehnissen. Aus solcher Bindung formte sich sein Gedicht …«
In Villons für das Mittelalter nicht untypischen Derbheit erblickt Zech individuellstes Sondergut. Dessen heitere Erotik steigert sich für ihn zu einer nietzscheanischen Apotheose: »Die Weiber spielen in Meister Villons Balladen eine besondere Rolle. Er hat keiner Frau, die er je besaß, einen billigen Schmachtfetzen gesungen. Er griff zu. Er packte sie an der Stelle, wo sie ihrer Veranlagung nach am empfindlichsten waren und in den tollen Dreh der Verzückung gerieten. Sie wurden in seinen Armen trächtige Erde, Blüte und Frucht … Bei ihm ist selbst der pornographische Exzeß eine vom Blut her ins Leben gewachsene Erschütterung vor dem Göttlichen im Tierleib …«
Und natürlich zieht er Villon in seine eigene, auch zeitliche Nähe, indem er ihn erst mit Rimbaud vergleicht und dann auch noch mit seinen expressionistischen Dichterkollegen, mit August Stramm, mit Gottfried Benn: »In ihrem Blut ist zweifellos ein empörerisches Tempo, eine Blutströmung mit Weltgeruch, Abendröten und Karawanen, Börsenkrachs und Barrikaden.« Doch die größte Ähnlichkeit findet er zwischen Villon und – Johannes R. Becher. »Es gibt in Deutschland heute eigentlich nur einen Dichter, der am Rande der Werkleistung Villons bestehen kann als ein selbständiger Kopf. Es gibt nur einen, der sich von den hirnlichen Belastungen, von der Akrobatik des Handgelenks endlich befreit hat und die Wesenheit aller Dinge besingt. Das ist Johannes R. Becher. Ihm fehlt nur noch die polare Sicherheit des Ichgefühls, die Gleichung von Masse und Ich«.
Zechs in seinem Nachwort erzählte Biografie Villons ähnelt stilistisch einem Kurzroman von Klabund, ist ein Glanzstück expressionistischer Prosa und – wie diese – zum großen Teil reinste Fiktion.
Seine, wie er zugibt, »sehr freien Nachdichtungen« verteidigt Zech tapfer gegen »Philologen und mürrische Magister« und will auch weder mit K. L. Ammer noch »gar mit Bert Brecht« in Konkurrenz treten. »Ich wende mich vielmehr mit meiner Arbeit an Menschen, denen es darauf ankommt, den Villon wenigstens annähernd so zu erfahren, als wäre er noch mitten unter uns: jung, abenteuerlich und gegen die philisterhafte Müffigkeit auf Erden«. In seinem später komplett überarbeiteten und etwas weniger emphatisch gehaltenen Nachwort äußert er sich zudem recht abfällig über andere Übersetzungen: »Gelesen habe ich auch deutsche Villon-Ausgaben, die nach meinem ersten Villon-Band erschienen sind und über die Reimereien herzhaft gelacht; zu mehr hat es nicht gelangt«.
Der ungarische Schriftsteller Dezső Kosztolányi hat die Erzählung Der klemptomanische Übersetzer geschrieben, in der ein langfingeriger Übersetzer das Original um zahllose Gegenstände erleichtert. Obwohl Zech im Leben ein amtsbekannter Dieb ist, ist er es als Übersetzer nicht. Denn zwar kürzt er das Villon’sche Werk, wo er nur kann, doch dafür beschenkt er es im Gegenzug reichlich mit selbst geschriebener Lyrik, die nichts mit Villon zu tun hat, es aber mit Leichtigkeit in die Auswahl der bekanntesten und beliebtesten deutschen Gedichte schaffen würde – allen voran Eine verliebte Ballade für ein Mädchen namens Yssabeau, die mit den berühmten Zeilen anhebt: »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund«, in der sexuell aufgeladenen Interpretation von Klaus Kinski längst zu einem Schlagerhit geworden. Verse, wie diese:
Die Bäume standen alle grau und krank
im Wald herum, weil in dem Bach der Tag ertrank.
Du aber warfst die Kleider fort vom Leib
und hast ein weißes Licht
mir angezündet, du, mein Abendweib,
mit Wurzelhaar und Tiergesicht.
(Eine neue Ballade, gedichtet für Mira l’Ydolle)
hätten niemals von François Villon stammen können, dennoch lesen wir hier ein starkes expressionistisches Gedicht.
Der Tonfall, den Zechs Kunstfigur anschlägt, ist die Sprache der Berliner Bohème mit ihrer Vorliebe für das Kosmopolitische, für Provokation und Promiskuität. Er verfällt vom rauhsten Slang in die zärtlichste Poesie, will erstaunen, vor den Kopf stoßen, ist in Paris genauso zu Hause wie in exotischen Strandparadiesen. Er äußert sich in grellen Bildern, deftigen Ausdrücken und Respektlosigkeiten, wie etwa das berühmte »Niggerweib«, kurzum in Masken der schnodderigen Lässigkeit, vergleichbar den Filmen eines Quentin Tarantino.
Zech schätzt die Gattung der französischen Ballade die meiste Zeit über falsch ein – eher im Sinne der deutschen Ballade. Er schreibt: »Villon hat … die Form der Ballade geschaffen. Er nähert sich damit dem Drama an. Er gab der Handlung freien Lauf in das tägliche Leben«. Nur haben Villons Balladen keine »Handlung«, sie sind nicht narrativ, sondern rein lyrisch. Und wenn Zech manch eine Ballade so anheben lässt:
An einem grauen Regentag
hat uns der Hauswirt ausquartiert …
(Eine kleine Räuberballade von den drei Coquillards)
Sie kamen alle drei von Flandern her,
der Jean, der Jacques und Nicola …
(Die Ballade von den drei Landstreichern)
Und als ich in die schöne Stadt reinfuhr,
weil sie so lang und breit am Wasser liegt …
(Die Ballade von der schönen Stadt Morah)
dann lässt sich bereits daran, dass hier tatsächlich eine Geschichte erzählt wird, merken, dass es sich um eigene Sprachschöpfungen handelt.
Wie steht es aber nun um Zechs Nachdichtungen? Sie sind mehr als frei, und doch ist ein Vergleich mit anderen Übersetzungen aufschlussreich. Hier die erste Strophe aus der Ballade des femmes de Paris:
Quoy qu’on tient belles langagières
Florentines, Veniciennes,
Assez pour estre messaigières,
Et mesmement les anciennes;
Mais, soient Lombardes, Rommaines,
Genevoises, à mes perilz,
Piemontoises, Savoysiennes,
Il n’est bon bec que de Paris.
(Villon)
Wohl erfreuen hohen Ruhms
sich die Venetianerinnen
und die Florentinerinnen,
selbst die Fraun des Altertums;
doch ob Genueserinnen,
Savoyarden, Römerinnen,
Neapolitanerinnen,
alle plaudern nicht so süß
wie die Frauen von Paris!
(K. L. Ammer)
Wie sehr als schwatzhaft auch bekannt
Florenzerin, Venezierin,
die selbst im Alter noch gewandt
beim Botendienst als Kupplerin,
Lombardin oder Römerin
samt Genferin noch überdies,
Piemonterin, Savoyerin,
am besten kann’s die aus Paris.
(Carl Fischer)
Schöne Frauen gibt es überall
auf der weit und breiten Erdenwelt,
ob am Tiger oder Senegal,
im Palast und im Zigeunerzelt,
ob sie braun sind oder schwarzverbrannt,
ob in Flandern oder Samarkand,
Japanesin oder Niggerweib,
Ebenholz- und Alabasterleib:
Keine Frau auf Erden küßt so süß,
wie die schönen Frauen von Paris.
(Zech)
Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass Zechs Nachdichtung die wortgewandteste und poetischste ist, auch wenn sie praktisch kein Wort Villons wiedergibt. Mehr noch, beim näheren Hinsehen stellt sich heraus, dass selbst das Thema ein vollkommen anderes ist: Villons Ballade untersucht die Geschwätzigkeit der besagten Frauen, Zech deren Kussfertigkeiten. Aber er bemüht sich ja auch gar nicht erst um eine »korrekte Übersetzung«: Er entzündet sich vielmehr an einem Stoff oder an irgendeinem Element desselben, vielleicht auch nur an einem Formmerkmal oder einem markanten Wort, und lässt seiner Fantasie freien Lauf, schreibt im Grunde ein eigenes Gedicht, das auch stilistisch alle Eigenheiten seiner eigenen Lyrik aufweist. Die Klänge und Rhythmen der Verse ergeben sich nicht, wie in den anderen Beispielen, aus einem emsigen Silbenzählen heraus, sondern auf sehr plastische Weise aus der Dynamik der Sprache selbst.
Auch der Lyriker Klabund behandelt in seinem Himmlischen Vaganten bereits 1919 Villons Gedichte sehr frei und steht möglicherweise für Zechs übersetzerisches Verfahren Pate. Bei ihm beginnt die entsprechende Ballade so:
Soll man denn den Dichtern trauen?
Ihr Geschäft heißt: Lob der Frauen.
Selbst der blinde Dichtervater
Schnurrt gleich einem Frühlingskater,
Harft er von der Helena,
Die sein Auge niemals sah.
Trumpf ist beides: blond und braun.
Doch die Krone aller Fraun,
Wild und mild und bittersüß
Sind die Mädchen von Paris.
(Soll man denn den Dichtern trauen?)
Aber Zech übertrumpft sein vermutliches Vorbild um Meilen. Was Klabund fehlt, ist der starke Impuls und die nötige Portion Chuzpe, um die Grenzen des Erlaubten tatsächlich zu überschreiten. Während wir es bei Zech mit einem jener seltenen Fälle zu tun haben, wo dank einer enormen poetischen Kraft vor unseren Augen ein Dichtermythos – ein neuer Ossian – entsteht, so strahlend, dass er uns an seine Wirklichkeit glauben lässt.
Alexander Nitzberg, Wien 2020
Une fois me dictes ouy,
en foy de noble et gentil femme;
je vous certifie, ma Dame,
Ou’onques ne fuz tant resjouy.
Vueillez le donc dire selong
que vous estes benigne et doulche,
car ce doulx mot n’est pas si long
qu’il vous face mal en la bouche.
Soyez seure, si j’en jouy,
que ma lealle et craintive ame
gardera trop mieulx que nul ame
vostre honneur. Avez-vous ouy?
une fois me dictes: ouy.
DIE GESAMMELTEN FRÜHEN LIEDER UND BALLADEN
DIE BALLADE VON DEN SCHÖNEN FRAUEN IN PARIS
Schöne Frauen gibt es überall
auf der weit und breiten Erdenwelt,
ob am Tiber oder Senegal,
im Palast und im Zigeunerzelt,
ob sie braun sind oder schwarzverbrannt,
ob in Flandern oder Samarkand,
Japanesin oder Niggerweib,
Ebenholz- und Alabasterleib:
Keine Frau auf Erden küßt so süß,
wie die schönen Frauen von Paris.
Auch in Polen und in Wien und Rom,
in der Steppe und vom Kaukasus
bis zum Nil und Amazonenstrom
sind die Frauen wild nach einem Kuß.
Auch in Preußen, Holland und Madrid,
(Eskimo und Lappen zählen mit)
wird von früh bis spät geküßt.
Aber daß ihr auch noch dieses wißt:
Keine Frau auf Erden küßt so süß,
wie die schönen Frauen von Paris.
Selbst die Fraun im grauen Altertum,
Königin von Saba, Niobe,
Dalila, Astarte und der Ruhm
der Lucinde, Sappho, Canadacé,
Helena, Lacmé und Potiphar,
muß verblassen und ins Nichts zergehn
wie der Schnee vom vorigen Jahr;
denn das Wort, das bleibt hier stehn:
Keine Frau auf Erden küßt so süß,
wie die schönen Frauen von Paris.
Zum Geleit:
Drum hab ich mich auch nicht lang bedacht