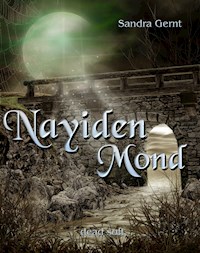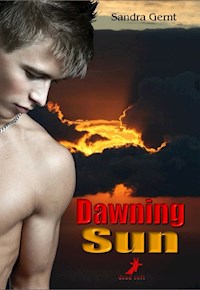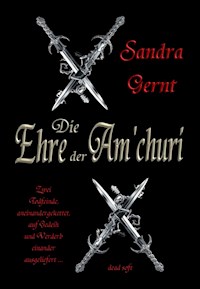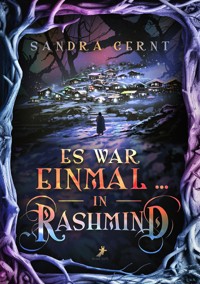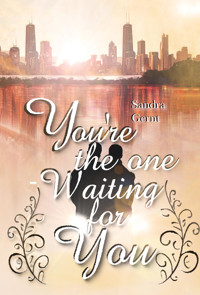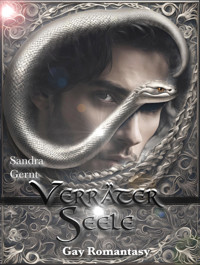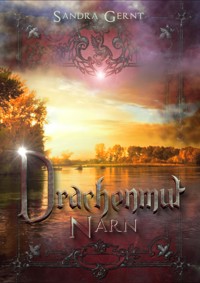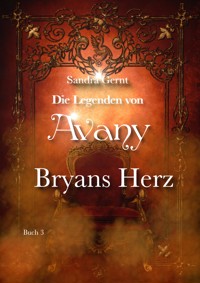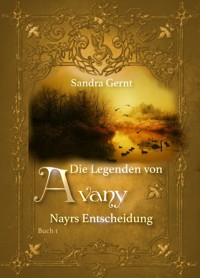
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gay Fantasy Shias opfert sich für seine Familie, als er sich freiwillig für den Krieg einziehen lässt. Was ihm dann widerfährt, als er im Feindesland eintrifft, ist mehr, als ein Mensch allein ertragen kann. Nayr, Bruder von König Bryan, will nichts weiter, als Frieden und Sicherheit für seine Heimat garantieren. Als ihm Shias in die Hände fällt, wird seine Welt, wie er sie kannte, in jeglicher Hinsicht auf den Kopf gestellt. Was wahr erschien, ist falsch, treue Verbündete erweisen sich als Feinde, Feinde als einzige Rettung – und liebenswert dazu … 1. Teil der Legenden von Avany Ca. 77.500 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 378 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gay Fantasy
Shias opfert sich für seine Familie, als er sich freiwillig für den Krieg einziehen lässt. Was ihm dann widerfährt, als er im Feindesland eintrifft, ist mehr, als ein Mensch allein ertragen kann.
Nayr, Bruder von König Bryan, will nichts weiter, als Frieden und Sicherheit für seine Heimat garantieren. Als ihm Shias in die Hände fällt, wird seine Welt, wie er sie kannte, in jeglicher Hinsicht auf den Kopf gestellt. Was wahr erschien, ist falsch, treue Verbündete erweisen sich als Feinde, Feinde als einzige Rettung – und liebenswert dazu …
1. Teil der Legenden von Avany
Ca. 77.500 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 378 Seiten.
Buch 1
von
Sandra Gernt
Sonne und Schatten
n diesem Tag schien zum ersten Mal nach eineinhalb Monden des Sturms und Regens endlich wieder die Sonne.
Shias atmete befreit durch, als er die schweren Holzläden seines Schlafraums aufstieß und von Vogelgezwitscher, Helligkeit und Wärme begrüßt wurde. Selbstverständlich war er dankbar für jeden Tropfen des kostbaren Nasses, das vom Himmel fiel. Wer Felder beackern musste, wie er und seine Familie, der war froh über den Regen. Doch die Wolken hatten es schon zu gut mit ihrem Segen gemeint und gemeinsam mit dem harschen Sturmwind aus dem Norden Mensch und Tier in Häusern und Ställen eingeschlossen. Wie wohl es tat, endlich nicht mehr frieren zu müssen!
Er beeilte sich an der Waschschüssel und mit dem Rasiermesser, schabte sich die lästigen Haare von Wangen, Kinn und Hals. Sein Vater und seine beiden älteren Brüder waren blond, bei ihnen spross praktisch nichts. Er hingegen hatte das dunkle Haar seiner Mutter geerbt und wurde der wuchernden Massen kaum Herr. Ließ er den Bart wachsen, wurde das rasch gefährlich für ihn. Wer zu sehr wie ein Nonnit aussah, wie einer vom Bergvolk, konnte auf offener Straße aufgegriffen und in den Strafturm geworfen werden, um dort in den Verliesen zu darben, oder an den Pranger gestellt, obwohl man kein weiteres Verbrechen begangen hatte, als die Straße zu nutzen wie jeder andere freie Bürger auch.
Also rasierte Shias sich sorgfältig, zur Not auch zweimal am Tag, kämmte und band sein Haupthaar zu einem strengen Zopf und achtete stets darauf, gut gekleidet zu sein.
Sobald er das hinter sich gebracht hatte, stürmte er aus dem Raum und rannte die Treppe hinab, um ins Freie zu gelangen. Sonne! Lachend vor Freude drehte er sich einige Male im Kreis, als wäre er ein kleiner Junge und kein Mann von dreiundzwanzig Jahren. Bisha, die alte Hündin, sprang übermütig bellend an ihm hoch und versuchte, ihm über das Gesicht zu lecken.
„Shias, wer hat dich denn so früh gebissen?“ Tirio, sein ältester Bruder, lehnte sich aus dem Fenster und schüttelte grinsend den Kopf über ihn. Erst jetzt wurde Shias bewusst, wie früh es noch sein musste, wie ruhig es auf dem großen Hof noch war. Kein Klappern aus der Küche, kein quietschendes Brunnengewinde, kein Gesang aus den Stallungen, wenn der Knecht die Arbeit begann. Egal! Heute war ein schöner Tag und er fühlte sich bis zum Bersten gefüllt mit Kraft.
„Kann ja nicht jeder solch ein Schlafbär wie du sein, Bruder!“, rief er, eilte zum Stall, um die Hühner rauszulassen, und verteilte großzügig Körner für sie, bevor er zu den Kühen ging. Normalerweise übernahm seine Mutter zusammen mit der Magd das Melken, aber heute war er vor ihr auf den Beinen, da konnte er diese Arbeit auch gleich wegschaffen.
Sie besaßen das größte Gehöft im östlichen Shemja, ein Fürstentum, das dem Königshaus von Omoy treu ergeben war. Neben seiner Familie lebten noch zwei Knechte und eine Magd im Haus. Seine Schwestern waren bereits lange verheiratet und fortgezogen, er bekam sie kaum je zu Gesicht. Shias war froh, dass sie weitab entfernt von den großen Städten lebten, auf dünn besiedeltem Land, und die Gefahr, mit einem Nonnit verwechselt zu werden, schon fast die größte Bedrohung in seinem Leben darstellte. Fast … Seit rund zwei Jahren befand sich das Reich im Krieg gegen die Nachbarlande. Ein Krieg, bei dem er nicht an die Front gestellt werden wollte. Ein Krieg, der nicht so fern war, wie es sich anfühlte, denn die Grenze nach Avany war kaum ein paar Tagesreisen entfernt.
„Shias, mein Lieber, du bist fleißig heute Morgen.“ Seine Mutter begrüßte ihn mit einem Lächeln und einem flüchtigen Kuss auf die Wange. Jeder wusste, dass sie Nonnit-Blut in den Adern hatte, man sah es in den ungebändigten dunklen Locken, in den schwarzen Augen, man spürte ihr Temperament, denn allzu leicht kochte die Wut in ihr hoch. Das Bergvolk, das waren geheimnisvolle Leute, die strikt unter sich blieben, sich keinem Fürsten und keinem König unterwarfen und ein hartes Leben in der Höhe als Jäger, Sammler und Viehnomaden führten. Selten genug geschah es, dass einer von ihnen verstoßen wurde oder aus Gründen, die niemand außer ihm durchschaute, in die Ebene hinabstieg. Bei einer dieser seltenen Gelegenheiten war Shias‘ Mutter gezeugt worden, und er war sehr dankbar dafür.
„Ruf deine Brüder, wir wollen frühstücken!“, bat sie und wandte sich wieder dem Kessel zu, in dem zu jeder Tages- und Nachtzeit Hafer- und Gerstenbrei gekocht wurde. „Euer Vater will den Zaun bei der großen Weide kontrollieren, sicherlich hat der endlose Sturm dort Schäden angerichtet und vorher können die Schafe nicht hochgetrieben werden.“
Die Schafe waren dabei nicht das eigentliche Problem. Bishas Nachkommen sorgten zuverlässig dafür, dass die Tiere dort blieben, wo sie hingehörten. Wölfe und Bären ließen sich von den Zäunen nicht weiter beeindrucken. Im Gegensatz zu den Stieren der Nachbarn. Sie drangen ständig durch jede Lücke, die sie finden konnten, attackierten die Hunde, verdrängten die Schafe und zeigten sich Menschen gegenüber nicht unbedingt verträglich. Ihre Nachbarn, der Bauer Gippo und dessen Familie, waren uneinsichtig, sahen nicht ein, warum sie selbst für ihre Stiere verantwortlich sein sollten. Als bei einem dieser Vorfälle ein trächtiges Schaf von einem auskeilenden Stier getötet wurde, musste der Richter Gippo mit dem Pranger drohen, bis er endlich zähneknirschend die Strafe gezahlt hatte. Solche Querelen konnten einem leicht den Tag verderben. Darum protestierte Shias auch nicht. Die Zaunkontrolle war wichtig, um die Ruhe zu gewährleisten. Na, und es würde garantieren, dass er viel Zeit an frischer Luft und Sonne verbringen konnte. Gut gelaunt stimmte er ein Lied an, bevor er die Treppe hocheilte, um seine faulen Brüder aus den Betten zu zerren.
Nayr blickte aus dem Fenster. Die Sonne zeigte ihr Gesicht, er hatte beinahe vergessen, wie sich das anfühlte. Hoffentlich blieb sie länger zu Gast. Der mondelange Sturm hatte den Bau der Kriegstürme ins Stocken gebracht, an der Wehrmauer entlang der Ava, dem großen Grenzfluss, dürfte heute zum ersten Mal wieder der Hammer geschwungen werden.
Natürlich hatte das schreckliche Wetter beide Kriegsseiten aufgehalten. Auch die Omoyer hatten sich zurückziehen müssen. Es war so viel Leid entstanden, seit Baruk der Starke, König von Omoy, ihnen ohne jeden Grund den Krieg erklärt hatte! Immer wieder wurden von den Omoyern Gräueltaten verübt, für die es keinen Sinn, keine Worte gab, um sie zu beschreiben und somit verständlich zu machen. Nayr fürchtete mittlerweile den Morgen eines jeden Tages, denn dann erreichten die Sendboten Schloss Wyvernhöhe, um die Frontberichte zu überbringen. Sie waren nie gut.
Nayr hasste den Krieg.
Es war beruhigend, dass er keinen direkten Anteil daran nehmen musste.
Langsam durchquerte er seinen Schlafraum. Das Mobiliar war edel, die Ausstattung erlesen. Die Kleider in seiner Truhe maßgefertigt und kostbar, der Schmuck unbezahlbar. Wie es sich für den Bruder des Königs schickte. Eigene Vorlieben zählten nicht, in keinem einzigen Lebensbereich. Er tat, was seine Pflicht war. Nur in der Nacht konnte er diesen Zwängen entkommen und frei sein, wie er es sich wünschte.
Es klopfte. Arym, sein Leibdiener trat ein, sichtlich verwundert, weil sein Herr heute vor ihm aufgestanden war.
„Geht es Euch gut?“, fragte Arym besorgt, und eilte auf ihn zu.
„Ja, gewiss. Ein seltsamer Traum hat mich geweckt und aus dem Bett getrieben. Mach dir keine Sorgen.“ Nayr lächelte herzlich. Arym war zwölf Jahre älter als er selbst und hatte somit fünfunddreißig Wintersonnenwenden kommen und gehen sehen. Wahrlich noch kein alter Mann, dennoch breitete sich inzwischen der Frost in dem dunklen Bart und Aryms Haar aus, und die Stirn war auch nicht mehr so glatt wie früher, als noch Aryms Vater Nayrs Leibdiener gewesen war. Oft hatte Arym ihn in der Jugend begleitet, wenn Nayr ausgeritten oder auf die Jagd gegangen war. Ihr Verhältnis war auch aus anderen Gründen näher, als es sonst bei Dienern und ihren Adelsherren üblich war, beinahe als wäre Arym ein älterer Vetter.
Diese Nähe hatte auch Nachteile, denn Arym wusste genau, wann Nayr ihn beschwichtigen wollte. Die Sorge in seinem freundlichen Gesicht vertiefte sich, doch er ging zunächst nicht weiter darauf ein. Stattdessen öffnete er die beiden anderen Fensterläden, die Nayr noch nicht bewegt hatte, griff nach der bereits gestern Abend bereitgelegten Kleidung und vollführte eine einladende Geste.
„Euer Bad ist bereit, Herr“, sagte er unterwürfig. Nayr folgte ihm gehorsam. Als jüngerer Bruder des Königs und somit Mitglied des Hochadels war er seinen Bediensteten praktisch hilfs- und willenlos ausgeliefert. Er musste sich ihnen anvertrauen, jeden Tag aufs Neue.
Arym wartete geduldig, bis Nayr in seinem persönlichen Baderaum neben der Schlafkammer die Notdurft auf dem dafür vorgesehenen Nachtstuhl erledigt hatte, nahm ihm das knöchellange Hemd ab, in dem Nayr geschlafen hatte, half ihm dann, in das angenehm warme Wasser in dem hüfthohen Holzzuber zu steigen. Das Wasser war mit Rosenblättern und Jasminblüten parfümiert. Arym schrubbte ihn von Kopf bis Fuß mit einer weichen Bürste ab, wusch ihm das Haar, rasierte ihm die wenigen Stoppeln von den Wangen.
Nayr besaß die kupferbraunen Haare seiner Großeltern väterlicherseits, genau wie die helle, sonnenempfindliche Haut, die zu seinem Leidwesen zu Sommersprossen neigte, und die grünen Augen, die auch seine Großmutter besessen hatte. In ihrer Zeit als Königin war sie für diese Augen gerühmt und mit zahllosen Gedichten bedacht worden. Auch ihm galt viel Aufmerksamkeit seitens der Adelsdamen, und das eben nicht bloß, weil er König Bryans jüngerer Bruder und somit dem Thron nahe war.
Ihm selbst bedeutete seine Attraktivität wenig, schon weil er sie nicht nachvollziehen konnte, wenn er in den Spiegel blickte. Was fanden die Leute bloß so aufregend an seinem nach wie vor eher schlaksigen Körper, dieser fleckigen Gesichtshaut, dieser seltsamen Augenfarbe? In erster Linie genoss er, dass sein Bartwuchs kaum der Rede wert war und sich diese morgendliche Lästigkeit darum schnell erledigen ließ. Es war unbequem, er hasste es, seine Kehle zu entblößen und sich Aryms Fingerfertigkeit auszuliefern.
Sobald das geschafft war, durfte er sich aus dem Wasser erheben, wurde abgetrocknet und in die edle Kleidung gehüllt, die er nicht selbst ausgewählt hatte. Grünes Brokat, schwarzer Samt, weißes Leinentuch. Dazu reichlich Goldschmuck und Zierrat, damit jeder Blinde erkannte, was für ein reicher, wichtiger Mann er war. Nayr wusste, er hatte nicht das geringste Recht zu klagen und doch, er empfand sein Leben als eher mühsam.
„Was für ein Traum war das, der Euch quälte, Herr?“, fragte Arym und riss ihn damit aus den schwarzen Gedanken, die Nayr wie eine Wolke umhüllt hatten. Eine Nebelwolke, in der ein Mann ersticken konnte, wenn er nicht achtgab.
„Ich träumte, ein Fremder wäre erschienen, um sich auf den Thron zu setzen. Hier, in Schloss Wyvernhöhe, in der Mondsilberhalle unseres Königs. Ich träumte, mein Bruder würde am Boden liegen, das Herz von Dolchen durchbohrt und dennoch lebendig. Der Fremde besaß kein Gesicht, seine Gestalt war von einem Mantel mit tiefer Kapuze verhüllt.“ Nayr schauderte noch jetzt, als er sich an die Details seines Albtraumes erinnerte. Sie standen ihm lebendig vor Augen, statt wie sonst üblich zu Gespinsten zu zerfasern und sich aufzulösen, sobald man den Schlaf abgeschüttelt hatte.
„Was für ein schrecklicher Traum, Herr!“, sagte Arym bekümmert und beugte sich vor, um die vielen kleinen Porzellanknöpfchen an Nayrs Hemd zu schließen. „Kein Wunder, dass Ihr vorhin so bleich wart. Sicherlich ist es der Krieg, der Euch aufs Gemüt drückt. Die Sorge, dass der Feind vorrücken und den Sieg erringen könnte.“
„Das wird er nicht!“, stieß Nayr heftig hervor. Heftiger, als er es geplant hatte. „Omoy kann nicht siegen! Baruk ist ein Narr, und wenn er sich tausend Mal als stark bezeichnen lässt.“
„Gewiss, Herr, ich wollte auch nicht sagen, dass uns die Niederlage droht.“ Arym verneigte sich, während er Nayr anhielt, in die Brokathose zu steigen, ihm seidene Strümpfe über seine Füße streifte, ihm in die feinen Wildlederstiefel half. „Im Traum kommen viele Ängste zutage, die man sonst nicht zulassen mag. Wenn Euch diese nächtlichen Gespinste zu sehr quälen, kann ich Eska zu Euch schicken.“
„Ich werde darüber nachdenken“, entgegnete Nayr freundlich. Er wusste, warum Aryms Stimme einen Hauch abgesackt war, als er den Namen seiner Frau ausgesprochen hatte. Eska war eine Zauberkundige, ihre Hände waren gesegnet, wie man es hierzulande nannte. Jeder verehrte und fürchtete sie. Für niemanden galt dies mehr als für Arym.
Dessen Hände zitterten kaum merklich, als er Nayrs schweren Brokatmantel mit goldenen Schnallen verschloss.
„Danke“, sagte Nayr und tat, als hätte er diesen leichten Anflug von Schwäche nicht bemerkt. „Geputzt, entstaubt und gerüstet für einen neuen Tag. Lass uns beten gehen.“
Eine weitere Unumgänglichkeit. Noch vor dem Frühstück traf sich der Hochadel in der Kapelle des Schlosses und ließ sich vom Priester segnen. König Bryan hatte diese Sitte eingeführt, als Omoy ihnen den Krieg erklärt hatte. Außerdem hatte er ausschweifende Feiern, Jagdgesellschaften, die Verschwendung von Bier und Wein und einige andere liebgewonnene Gewohnheiten des Adels untersagt. Es kam beim Volk sehr gut an, dass sich die hochwohlgeborenen Herrschaften mäßigten und götterfürchtig verhielten, während die Grenzstädte attackiert, Bauern zu Soldaten ausgebildet und an die Front geschickt und aufgrund der zusammenbrechenden Handelsrouten mancherorts Not gelitten wurde. Der Adel ertrug diese Maßnahmen darum stillschweigend, auch wenn insgeheim darüber reichlich geschimpft und nicht selten auch die Regeln gebrochen wurden. Nayr wusste jedenfalls, dass die Dienerschaft sich eine Menge Goldmünzen damit verdiente, Rauschmittel, Wein, Pfeifentabak, gebratenes Fleisch, süßes Gebäck und weitere verbotene Waren zu den verwöhnten Grafen, Baronen und Fürsten schmuggelten, die auf den Luxus nicht verzichten wollten. Er selbst wagte es nicht, obwohl er auch so einiges vermisste. Als Königsbruder durfte er sich nicht mit solchen menschlichen Schwächen erwischen lassen, er musste ein Vorbild sein, zu jeder Zeit. Er wusste zudem, wie Bryan reagieren würde, falls er Nayr bei einem derartigen Fehltritt antreffen sollte. Sein Bruder wäre maßlos enttäuscht, und das würde er sich selbst nicht verzeihen.
Nayr marschierte vorneweg, Arym folgte ihm. Sie waren zeitig, als sie die hauseigene Kapelle betraten, waren noch nicht viele der Schlossbewohner anwesend. Würdevoll nickte er ihnen zu. Die meisten dieser arroganten, aufgeblasenen Wichtigtuer, die sein Bruder als Berater in den Kronrat berufen hatte, konnte er nicht leiden. In neun von zehn Fällen saßen sie dort sowieso bloß aufgrund ihrer hohen Geburt, es hatte nichts mit ihrem Verstand, ihrer Bildung oder ihrem ausgezeichneten Charakter zu tun, den sie in zehn von zehn Fällen sowieso nicht besaßen. Bei den Frauen sah es keineswegs besser aus. Sie hielten sich für kostbar und edel, bloß weil sie von hoher Geburt waren. Die wenigsten von ihnen waren erträglich, wenn man länger als ein paar Minuten mit ihnen ein Gespräch führen wollte, das sich um andere Dinge als Essen oder das Wetter drehte.
Nayr war einst wie diese Leute gewesen. Hatte fest daran geglaubt, er wäre von den Göttern dazu auserkoren, wertvoller als alle anderen Menschen zu sein, deren einzige Lebensberechtigung darin bestand, ihm und Seinesgleichen zu dienen. Dann war sein großer Bruder entführt worden und für seine Eltern, das Königspaar, hatte es nichts anderes mehr gegeben als die Sorge um den Thronfolger.
In dieser Zeit hatte Nayr Halt bei Arym gefunden, war mit ihm durch die Wälder gezogen, mit seiner Familie an einem Tisch gesessen, hatte in der Scheune und auf blanker Walderde übernachtet, bei bitterarmen Köhlern gegessen, die sich freuten, das Wenige, das sie besaßen, mit zwei Jungen teilen zu können, die ihnen dafür bei der Arbeit geholfen hatten. Nayr hatte erfahren, wie das Leben aussah, wenn man eben nicht in seidenen Laken geboren wurde. Es hatte sein Weltbild zerstört und ihn gründlich verdorben, denn er konnte es kaum noch ertragen, in seiner Welt leben zu müssen, gehörte aber auf gar keinen Fall in die andere hinein. Wie sollte man da glücklich und zufrieden sein?
Zumal wenn Krieg herrschte, der an sinnloser Grausamkeit kaum zu überbieten war.
Er lächelte und nickte zu allen Seiten, wie es von ihm erwartet wurde. Während Arym in der hintersten Bank Platz nahm, zusammen mit den anderen Bediensteten, schritt er nach vorne, zur Ehrenbank. Hier durften lediglich das Königspaar, deren Kinder und enge Familienangehörige sitzen. Sein Bruder war verwitwet, Allera, seine junge Königin, war während der Geburt des ersten Kindes verstorben. Nicht weiter ungewöhnlich, ein solch tragisches Schicksal, sofern es nichtadlige Frauen traf. Beim Hochadel war normalerweise neben einer Wehenfrau auch eine Zauberkundige im Raum, um genau so etwas zu verhindern. Manchmal half auch die Magie nicht mehr weiter und niemand wusste, was in dieser Nacht vor zwei Jahren geschehen war, als Allera starb. Sicher war bloß, dass Eska, die Zauberkundige von Wyvernhöhe, nicht gerufen worden war. Bryan hatte sich hunderte von Meilen entfernt bei einem wichtigen Treffen befunden, an dem auch Nayr teilgenommen hatte. Er erlaubte sich darum kein Urteil und niemand sprach laut darüber. Ein tragisches Unglück. Jeder wartete nun ungeduldig, wer die neue Königin werden würde. Gerade in Kriegszeiten waren solche politischen Entscheidungen kompliziert und mussten aufwändig verhandelt werden. Wichtig war wie stets, was die Braut an Mitgift zu bieten hatte.
„Guten Morgen, Bruder.“ Bryan nickte ihm zu. Er war sieben Jahre älter als Nayr und damit noch jung für einen König. Jung genug, um zahlreiche starke Nachkommen zeugen zu können, wie es von ihm erwartet wurde. Im Gegensatz zu Nayr hatte er das weißblonde, blauäugige Erbe ihrer Mutter angenommen. Seine äußere Schönheit und sein einnehmendes, charmantes Wesen wurde landauf, landab gerühmt. Dass er zwar beständig lächelte, aber nie von Herzen lachte, fiel lediglich auf, wenn man ihn sehr gut und von nahem kannte. „Du wirkst bedrückt, wie so oft in letzter Zeit. Der Krieg scheint dir jegliche Heiterkeit zu stehlen.“
„Vergib mir, Bryan“, murmelte Nayr. „Ich will deine Stimmung nicht schon am frühen Morgen überschatten.“
„O nein, das kannst du gar nicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Andernfalls hätte ich dich längst an die Front geschickt, wo deine Talente gut gebraucht werden könnten. Vielleicht sollte ich dich aber allmählich verheiraten? Du bist alt genug für eine eigene Familie und es gibt vielversprechende Kandidatinnen, die nicht perfekt genug für den Thron von selbst sind, jedoch zu wichtig, um sie nicht dennoch zu nutzen.“
Glücklicherweise hatte Nayr sich für dieses Gespräch schon vor Monden gerüstet. Es traf ihn dennoch kalt, dass Bryan es in der Kapelle vor dem Morgengebet ansprach, als wäre es bedeutungslos, welche adlige Frau man sich kaufen wollte, als wären es Eier auf dem Halbmondmarkt, um sich die politische Unterstützung ihrer Familie zu sichern.
„Ich weiß, was du meinst, Bruder“, sagte er und lächelte geübt. „Darüber denke ich selbst schon lange nach. Es erscheint mir schwierig, zwischen den besten Angeboten zu entscheiden. Zu leicht beleidigt man gleichwertig wichtige Verbündete, wenn man sie übergeht.“
„Nun, wenn das Angebot wirklich und wahrhaftig gleichwertig ist, darf man ruhig eigene Vorlieben einbringen. Oder vielleicht kannst du schon jemanden ausschließen?“
„Fürstin Rodwana zu Wallenhagen“, entgegnete Nayr ohne zu zögern. „Ich möchte keine Braut, die noch mit ihren Puppen spielt.“
„Baronin Sobraya von Torrent wäre also eher geeignet für dich? Sie ist höchstens ein Jahr jünger als du, gilt als bezaubernde Schönheit und kommt aus einer langlebigen Familie mit großem Kindersegen. Man könnte ihr verzeihen, dass Torrent deutlich weniger Reichtümer besitzt als Wallenhagen und eher wirtschaftlich als politisch bedeutsam ist, denn auch das ist in Kriegs- wie Friedenszeiten ein wichtiger Punkt.“
„Sie hat sich nie von ihrem schweren Reitunfall in ihrer Kindheit erholt, ihr rechtes Bein ist gelähmt. In Wyvernhöhe mit seinen zahllosen Treppen könnte sie kaum am Hofleben teilnehmen.“
„Sie wäre die Frau des Königsbruders und hätte die Ehre, deine Kinder zu gebären. Für die bedeutsamen Gesellschaften könnte ein Diener sie tragen.“
„Eine Frau, die dies aus eigener Kraft bewältigt, wäre mir lieber.“
„Du bist genauso schwierig und wählerisch wie ich, Bruder, vielleicht sogar noch mehr.“ Bryan lächelte schmal. „Zu jung darf sie nicht sein, zu alt auch nicht, gesund und stark und was weiß …“
„Es wäre nicht schlimm, wäre sie ein, zwei Jahre älter als ich“, murmelte Nayr. „Auch bei drei oder vier wäre ich nicht kritisch. Gebärfähig sollte sie noch sein. Auch einer Witwe wäre ich nicht grundsätzlich abgeneigt.“
„Frauen mit Erfahrung sind eine Bereicherung, da stimme ich zu. Nun, lass uns das auf später verschieben. Leichtherzig dürfen diese Entscheidungen nicht getroffen werden.“
Nayr nickte und kämpfte hart, um seine Erleichterung zu verbergen. Er wusste, er würde seine Pflicht erfüllen müssen, es kam nicht infrage, sich vor einer Heirat zu drücken. Dass er Frauen zwar zutiefst respektierte, ihre Schönheit pries, ihnen jedoch nichts abgewinnen konnte, wenn es um körperliche Anziehung ging, das würde er niemals laut aussprechen können.
Der Priester erschien, nachdem der Raum sich gut gefüllt hatte. Nicht alle hochadligen Bewohner des Schlosses nahmen am Morgengebet teil. Es war keine Pflicht, und man berücksichtigte, wenn Schwangerschaft, Krankheit, hohes Alter oder andere Gründe den Nachtschlaf so sehr beeinträchtigten, dass man morgens noch nicht in der Lage war, die Götter zu preisen.
Ihre Heiligkeit, Priester Estin, trug der Jahreszeit entsprechend ein goldenes Gewand. Es symbolisierte den Sommergott Ludarn. Die Farbe von Estal, der Herbstgöttin, war ein kräftiges Rot. Curn, der Wintergott, kleidete sich in Weiß, Nidis, die Frühlingsgöttin hingegen Grün. Auch die Kapelle war entsprechend der Jahreszeiten hergerichtet. Überall standen Ähren, Bildnisse von Ludarn mit seiner Sonnenkrone, der Boden war mit gelbgefärbten Teppichen ausgelegt. Normalerweise war ein Priester oder eine Priesterin lediglich einer der vier Gottheiten geweiht. In hochherrschaftlichen Haushalten angestellte Priester übernahmen dennoch den Dienst für alle Götter.
Estin las aus den heiligen Schriften, die von verschiedenen Priestern und Priesterinnen verfasst wurden. Es waren Gedanken, Erzählungen, Gleichnisse, teilweise auch Tempelchroniken. Seit dem Ausbruch des Krieges wurden ausschließlich erbauliche Passagen gelesen, die von Sieg, Überwindung von Krankheit, Krieg und Not, von der Rückkehr des Lichts nach langer Nacht erzählten. Es folgten rituelle Gebete und Gesänge. Nayr war nicht mit dem Herzen dabei. Das Gespräch mit Bryan hatte ihn aufgewühlt, er wusste, seine Zeit lief ab. Ihm blieb keine Wahl, er musste heiraten. Entweder das, oder er bat darum, an die Front gehen zu dürfen. Es würde ihm Aufschub gewähren. Möglicherweise auch seine Perspektive ändern. Vielleicht sehnte er sich anschließend danach, zu tun, was die Pflicht von ihm forderte. Vielleicht schätzte er dann, was er jetzt verabscheute und verachtete. Vielleicht wusste er danach, wo sein Platz im Leben war?
Immer vorausgesetzt, er überlebte. Auch wenn Adelsmänner besonders geschützt wurden, es gab keine Möglichkeit, sich sicher zu fühlen. Nicht im Krieg, nicht im Kampf. Die Frage war also: Was fürchtete er mehr? Tod, Kampf, Leid und Elend und vielfältiges, vollkommen sinnentleertes Sterben um sich herum? Oder die Umarmung einer Frau und ein Dasein inmitten von Menschen, die zwar beständig lächelten, doch niemals lachten?
Opfer
ie hatten ihr einfaches Morgenmahl beendet. Jeder war satt und zufrieden – sehr zufrieden schon deshalb, weil es Schlehenmus zum Haferbrei gegeben hatte, ein großer Löffel voll für jeden von ihnen. Das Mus wurde mit Honig eingekocht und stellte eine kostbare Ausnahme dar. Luxus, den sie sich bloß sehr, sehr selten gönnten. Heute war ein solcher Ausnahmetag, weil sie damit die Geburt von Shias‘ Vater feierten. Heute vor dreiundfünfzig Wintern war er zur Welt gekommen, und ohne ihn wäre keiner von ihnen heute hier. Er war ein harter, schwieriger Mann, streng und fordernd gegenüber sich selbst und allen anderen. Doch das musste er auch sein, damit sie die langen Winter überlebten. Er war zudem ebenso gerecht wie streng und Shias wusste, er liebte seine Familie über alles. Darum waren sie dankbar für das, was sie hatten, und umso dankbarer, weil ihr Vater noch gesund und stark und bei ihnen war.
Wie es bei ihnen Sitte war, sprachen sie nach dem Essen ihr Dankesgebet an die Götter. Andere taten dies vorher, den Sinn hatte Shias nie verstanden. Vor der Mahlzeit war man hungrig und gierig und wollte sich gar keine Zeit nehmen, innezuhalten und Zwiesprache mit den vier Göttern zu halten. Nach dem Essen hingegen fühlte man sich zufrieden und glücklich und ein bisschen müde. Der bestmögliche Zustand, um den Höchsten zu sagen, wie dankbar man ihnen war. Eine weitere Sitte bei ihnen war, nach den Mahlzeiten im Buch der Heiligen zu lesen.
Es gab zwölf Monde in einem Jahr. Jeder Mond bestand aus achtundzwanzig Tagen, jeder Tag war einem Heiligen geweiht. Einem Priester oder einer Priesterin, die Großes geleistet hatten, oder Helden, deren Taten zur Legende geworden waren.
Sie lasen abwechselnd die Geschichte der Ruana, Schutzheilige der Bienen und Wildkräuter. Sie war eine Wehenfrau gewesen, bevor sie sich berufen fühlte, in den Tempeldienst einzutreten, und hatte ihr großes Wissen über Heilkunst und Kräuterlehre mitgebracht. Ihr war es zu verdanken, dass heutzutage zu jedem Tempel ein Garten gehörte, in dem Heilpflanzen gezogen und Bienenvölker gehalten wurden, denn auch Honig war ein kostbares Heilmittel. Sie hatte Lehrbücher geschrieben, die bis heute Standardwerke für die Heiler waren, und ihr war der heutige Tag geweiht. Shias‘ Vater trug ihr Symbol als Holzschnitt an einer Kette um den Hals: Eine Honigwabe, die von Farngewächsen gerahmt wurde. So sollte ihr Segen sich schützend auf sein Leben auswirken.
Shias war am siebzehnten Tag des Schmelzmondes geboren, dem ersten Frühlingsmond. Dieser Tag war Kiar geweiht, der Schutzheiligen der Quellen. Sie hatte einst ihr Dorf vor dem Verdursten bewahrt, als sie während einer Dürre die Namen aller Götter anrief und einen Stab willkürlich von sich warf. Dort, wo er landete, begann sie zu graben. Nach kaum zwei Spatenstichen sprudelte ihr eine frische Quelle entgegen.
An Shias‘ Geburtskette hing darum eine stilisierte, holzgeschnitzte Wasserfontäne, und sicherlich war das mit ein Grund, warum er sich Zeit seines Lebens von Wasser in jeglicher Form angezogen gefühlt hatte.
Weil das Sonnenjahr etwas länger andauerte als die dreizehn Mondphasen, gab es auch die sogenannten ungeweihten Tage. Beim jeweiligen Wechsel der Jahreszeiten regierten zwei Götter zugleich, und diese Tage waren keinem menschlichen Heiligen zugeschrieben. Die letzten drei Tage, bevor ein Wechsel anstand, verlor der scheidende Gott einen Großteil seiner Kraft, während jene Gottheit, die die Herrschaft übernahm, noch nicht erschienen war. In den alten Zeiten hatte man geglaubt, dass jegliches Lebewesen, dass an den ungeweihten Tagen geboren wurde, gott- und seelenlos sein musste. Haustiere wurden erschlagen, Neugeborene ausgesetzt oder ertränkt.
Von diesen finsteren Zeiten hatte man sich glücklicherweise längst entfernt. Heute glaubte man, dass Kinder, die an diesen Tagen zur Welt kamen, in jedem Fall von mindestens einer, vielleicht sogar von zwei Göttern zugleich gesegnet waren und man dies an der Persönlichkeit und dem Temperament ablesen könne. Sie trugen dementsprechend das Symbol ihrer Gottheit als Geburtskette.
Es blieben vier Sondertage übrig, um das Sonnenjahr voll zu erfassen. Je einer war einem der Götter geweiht. Es waren die Tag- und Nachtgleichen im Frühling und Herbst, sowie die Sommer- und Wintersonnenwende. Die höchstmöglichen Feiertage der Gottheiten, die mit Ritualen und Festen begangen wurden und auf die ein jeder sich schon das gesamte Jahr im Voraus freute. An diesen Tagen durfte nicht gearbeitet werden, selbst Kriege mussten ruhen. Jedes dieser Feste war auf seine Weise etwas ganz Besonderes.
Das Vorlesen der alten Legenden und Mythen diente nicht nur dazu, jeden einzelnen Tag wertzuschätzen, den die Götter ihnen gewährten, sondern war auch wichtige Übung der Lesefähigkeit. Für gewöhnlich blieb das Lesen und Schreiben eine Kunst, die den Adligen und Priestern vorbehalten war. Shias‘ Vater war allerdings nicht als Bauer geboren worden und hatte darauf bestanden, seinen Kindern das außergewöhnliche Wissen und Können zu schenken, das ihnen vom Standesrecht eigentlich verwehrt geblieben wäre. Seiner Meinung nach stand es jedem Menschen zu, Wissen und Bildung zu besitzen, somit ihre Vorfahren zu ehren, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und eine bessere Welt für die eigenen Kinder zu erschaffen.
Da es kein offizielles Verbot gab, als Bauer in heiligen Schriften lesen zu können, wurde es auch nicht unterbunden, denn natürlich ließ es sich bei fünf Kindern nicht geheim halten, welche Fähigkeiten Joabs Familie besaßen. Wobei gerade die örtlichen Priester nicht mit eindringlichen Warnungen sparten, denn Wissen konnte immer auch gefährlich sein. Die Hochadligen mochten es nicht, wenn das niedere Volk sich aneignete, was die Hohen für ihr exklusives Geburtsrecht hielten.
Für gewöhnlich genoss Shias diese zehn, fünfzehn Minuten, die er mit seiner Familie nach dem Morgenmahl gemeinsam zusammensaß und las, bevor sie sich in den Tag mit seinen zahllosen Pflichten stürzten. Heute jedoch war er ungeduldig, weil er raus in die Sonne wollte und er drängte bloß deshalb nicht, die Geschichte abzukürzen, weil es der Geburtstag seines Vaters war.
Er bemühte sich sehr, diese Ungeduld nicht nach außen zu zeigen. Dennoch stieß sein Bruder Lyk ihn unter dem Tisch an, während Shias seinen Abschnitt vortrug – offenkundig las er zu schnell. Beschämt räusperte er sich, mühte sich mit ganzer Kraft, langsam und betont zu lesen, wie es sich gehörte, sich in die Erzählung fallen zu lassen. Sowohl die Geschichte der heiligen Ruana als auch sein Vater verdienten so viel Respekt.
„Dann wollen wir mal langsam los“, sagte sein Vater schließlich, als sie fertig waren. „Shias, da du es offenkundig nicht erwarten kannst, darfst du das Werkzeug holen und tragen.“
„Ja, Vater“, entgegnete er und akzeptierte damit die Strafe für sein schlechtes Benehmen. Er übersah geflissentlich das Feixen seiner Brüder. Sollten sie ruhig lachen!
„Vergesst eure Hüte nicht“, mahnte seine Mutter. „Es gibt keinen Grund, sich einen Sonnenstich einzuhandeln, wir sind schon gar nicht mehr an Hitze gewöhnt. Wenn ihr heute Abend zurückkommt, gibt es Kuchen.“
„Ja!“ Tirio klatschte wie ein kleiner Junge vor Freude in die Hände, dabei war das gar keine Überraschung. Kuchen gehörte zu den kleinen Geburtstagsfreuden dazu. Zusammen mit Yeso und Kyrm, den beiden Knechten, gingen sie hinaus, während Amia, die Magd, mit Mutter daheim blieb. Die drei nahmen bei jeder Mahlzeit an ihrem Tisch teil und sie erfreuten sich ebenfalls sehr an den morgendlichen Lesungen. Ihnen wurde diese Kunst allerdings nicht beigebracht. Shias‘ Vater hätte noch nicht einmal etwas dagegen, auch ihnen den Schlüssel zum Wissen zu schenken, doch er musste die Grenzen der Stände wahren. Wissen war gefährlich.
Shias eilte zu der großen Scheune, in der sie ihr Werkzeug, die Gerätschaften für den Acker, Leitern, Pflug, Zaumzeug, Heu und Futter für die Tiere und vieles andere aufbewahrten, um das Notwendige zu holen, was heute für ihre Arbeit gebraucht wurde. Natürlich würde er nicht alles davon allein tragen können, aber er war bereit, sich den größten Teil aufzubürden, als Folge für seine Respektlosigkeit.
Als er gerade den großen Vorschlaghammer aus dem Regal zerrte, hörte er, wie die Hunde anschlugen. Momente später wurde Hufgetrappel laut. Alarmiert rannte Shias zurück zum Scheunentor und blickte hinaus. Wer konnte das sein? Händler ritten nicht in solcher Eile auf den Hof, ein Nachbar in Not würde nicht mit einem Dutzend Männer oder mehr kommen. Verwirrt sah er den vielen Pferden hingegen, die auf sie zukamen.
Er stellte sich zu seinem Vater und seinen Brüdern, vor die Knechte, die die Hunde zurückhielten. Es war ein Trupp schwer bewaffneter Männer, gerüstet mit Schwertern und Kettenhemden, mit eisernen Helmen auf den Köpfen und Wappenröcken, die die Zeichen des Fürsten von Shemja zeigten – die weiße Linde auf schwarzem Grund.
„Ihr schweigt!“, befahl Vater streng und blickte sie der Reihe nach warnend an. „Yeso, Kyrm, ihr zwei geht ins Haus zu den Frauen. Sie dürfen auf keinen Fall rauskommen, egal was geschieht.“ Die Knechte gehorchten dem Kommando schweigend. Hoffentlich würde Mutter sich an die Weisung halten, sie hatte ihren eigenen Kopf und kannte keine Angst vor der Gefahr. Shias hatte sie schon erlebt, wie sie in einem Winter hungrige Wölfe mit einem Besen vom Schafstall fortgejagt hatte.
Die Männer des Fürsten hielten. Einer von ihnen stieg vom Pferd, nahm den Helm ab, blicke ihnen abschätzig entgegen, bevor er eine Pergamentrolle aus der Satteltasche zog.
„Ist dies der Hof von Joab?“, fragte er streng. Er war jung, kaum älter als Shias selbst. Mit seinen blonden Locken und dem weichen Gesicht wirkte er kindlicher, als es ihm selbst lieb sein konnte. Aus den Erzählungen seines Vaters von seinen Reisen in der Jugend wusste Shias, dass gerade solche Leute sich oft mit gewaltsamer, unnötiger Härte und Arroganz zu beweisen versuchten, um Respekt zu erzwingen, den man ihnen andernfalls verweigern könnte.
„Ihr seid am richtigen Ort, Euer Hochgeboren“, sagte Vater unterwürfig und verneigte sich. Shias und seine Brüder folgten der Geste. Angst nagte an Shias Eingeweiden, ein stechendes, schmerzhaftes Ziehen. Er wollte zurück ins Haus rennen und sich unter seinem Bett verstecken, was natürlich ein sinnloser und dümmlicher Impuls war. Kleine Kinder verbargen sich unter ihren Betten und glaubten, die Monster würden sie dort nicht finden. Er war nun erwachsen und musste herausfinden, ob diese Soldaten Monster waren oder nicht. Darum blieb er still und verneigte sich respektvoll vor ihnen und betete zu Ludarn, dass niemand sein Schwert ziehen würde.
„Im Namen von Fürst Amo, und auf Geheiß von König Baruk dem Starken, wir sind gekommen, um einen deiner Söhne zu fordern, Joab. Es werden junge, starke Männer gebraucht, um die Reihen zu füllen, die sich im Krieg gegen Avany geleert haben. Dank der Weisheit und Güte unserer Herrscher wird aus jeder Familie nur ein erwachsener Mann gefordert, der nicht jünger als zwanzig und nicht älter als dreißig Winter sein darf, damit die Ernte nicht gefährdet wird und die Frauen nicht schutzlos in ihren Häusern zurückbleiben.“
Schockiert standen sie alle still und starrten den Boten an. Fordern? Für den Krieg? Dies war eine Einberufung? Warum hatte es keine Vorwarnung geben? Erst letzten Halbmond hatten die Priester behauptet, der Krieg verliefe langsam, aber gut und es würden keine Bauern gezogen werden, weil die stehenden Heere der Adligen genug Männer besaßen!
Shias‘ Vater ballte die Fäuste, schloss sie, öffnete sie wieder.
„Herr!“, sagte er schließlich. „Meine Söhne sind unerfahren und jung. Ich habe bereits an der Waffe gekämpft, bin ein fähiger Kämpfer, ein guter Ausbilder. Nehmt also mich mit, ich kann dem König wertvollere Dienste leisten, als es meinen Söhnen möglich wäre.“
Während Shias‘ Herz vor Entsetzen krampfte – er konnte, er wollte seinen Vater nicht fortgehen sehen! – musterte der junge Adlige sie mit gefurchter Stirn der Reihe nach von oben bis unten. Insbesondere Shias‘ Vater maß er, das von der Sonne gegerbte Gesicht, das ergrauende Haar, den von entbehrungsreicher Arbeit hager gewordenen Körper.
„Laut meiner Liste bist du zu alt für die Rekrutierung, Joab“, beschied er ihm schließlich und blickte auf seine Pergamentrolle. „Wie ich vorhin sagte, wir suchen junge, gesunde Männer in ihrem zweiten Lebensjahrzehnt, keine Veteranen. Deine Stunde mag noch schlagen, aber nicht heute. Nun, trefft eure Wahl, wer von den Burschen es sein soll. Beeilt euch, ich muss heute noch weiter.“
Mittlerweile begann die Schockstarre nachzulassen. Shias‘ Gedanken waren klar wie kaum je zuvor. Vater würde niemals ihn wählen. Er war der Jüngste und von dunklerer Gestalt. Man würde ihn weniger achtsam behandeln als seine Brüder, die sich bereits wenig Hoffnung auf Respekt machen konnten. Tirio war verlobt, in sechs Monden sollte die Hochzeit stattfinden. Tirio würde einst den Hof übernehmen, mit seiner Frau, seinen Kindern. Er war die Hoffnung auf Fortbestand und Zukunft für die Familie, also durfte er nicht an den Krieg verschwendet werden. Einen Krieg, den einfache Leute wie sie nicht begriffen. Warum kämpften sie überhaupt gegen die Avanyer?
Lyk, ihr Mittelstück, Shias‘ zweitältester Bruder, war wundervoll, wenn es um Tiere ging. Er besaß genau die ruhige Art, die es dafür brauchte. Er konnte Hunden beibringen, auf den Hinterpfoten zu tanzen, wenn er das wollte, ritt zum Spaß auf den Kühen, die Schafe würden ihm bis in die Niederhöllen folgen und die Hofkatzen verehrten ihn wie eine Gottheit. Doch was Kampf, Waffenkunst und das Reiten anbelangte, da war er der Ungeschickteste von ihnen. Vater hatte jeden von ihnen an der Waffe ausgebildet, gerade weil die hohen Herren im Zweifelsfall nicht zögerten, ihre Bauern ganz nach vorne auf das Schlachtfeld zu schicken. Entbehrliche Körper, die im Schlamm sterben durften, um das Leben der Hochgeborenen zu schonen.
Lyk besaß nicht den Willen oder die Kraft, für einen Sieg andere zu verletzen, und wenn es ihn das eigene Leben kosten würde. Er könnte ein krankes Pferd heilen, es in den Kampf zu reiten gefiel ihm nicht. Lyk in den Krieg zu schicken würde bedeuten, ihn zu verlieren.
Shias verdrängte die eisige Furcht, die sich in seinen Adern auszubreiten versuchte, und schob sich nach vorne. Wenn Tirio daheim gebraucht wurde, Lyk keine Überlebenschancen hätte und Vater zu alt war, gab es nur eine einzige Entscheidung, die Sinn ergab. Ihr Götter! Ludarn sei ihm gnädig!
„Ich werde mit Euch kommen, Herr!“, sagte er mit fester Stimme und starrte dabei offen in die wasserblauen Augen dieses hübschen, grausamen Adelsmannes. Er hörte das entsetzte Keuchen seines Vaters. Hörte, wie Tirio schmerzlich aufstöhnte, möglicherweise aus Scham, weil er Shias‘ Opfer nicht verhindert hatte. Hörte, wie Lyk vor Erleichterung beinahe schluchzte.
Der junge Adlige musterte ihn, ähnlich arrogant wie zuvor seinen Vater.
„Du siehst nicht aus, als wärst du bereits alt genug. Stimmt die Angabe auf meiner Rolle? Wie lautet dein Name?“
„Ich bin Shias und selbstverständlich bin ich mündig, Herr. Dreiundzwanzig Winter zähle ich.“
„Fein … Ja, da bist du. Das hat seine Richtigkeit. Nun. Nimm das hier. Du musst unterzeichnen, damit die Rekrutierung vollzogen ist. Mach drei Kreuze auf der Linie, die ich dir zeige.“ Er reichte Shias das Pergament und einen Schreibfederkiel. Der Mann tippte auf die Stelle, wo Shias‘ Name stand. Von seltsamer Wut erfasst wollte er richtig unterschreiben, mit den Buchstaben, die ihm gelehrt wurden. Doch sein Vater hielt ihn plötzlich am Handgelenk fest.
„Drei Kreuze, wie in den Reihen darüber, schau!“, sagte er merkwürdig betont. Shias blickte ihn an, erkannte die Sorge, die Warnung in den dunkelblauen Augen seines Vaters. Er sollte nicht zeigen, was er konnte. Nicht jetzt, nicht hier. Wissen war gefährlich!
Unmerklich nickte er und machte sich los.
„Ich weiß, Vater“, sagte er und malte drei krakelige, unansehnliche Kreuze auf die Linie, als hätte er noch nie eine Schreibfeder in den Händen gehalten, bevor er sie mit dem Pergament zusammen zurückgab.
„Sehr schön, Bursche. Nimm diesen Umschlag.“ Der Adlige gab ihm einen wachsversiegelten Brief. „Damit begibst du dich unverzüglich nach Radinburg und gibst den Umschlag dort unter Nennung deines Namens ab. Man wird dich von dort in das Ausbildungslager bringen. Mitnehmen sollst du einen warmen Mantel, festes Schuhwerk, eine Wolldecke, eine Feldflasche. Jegliche weitere Ausrüstung und Kleidung wird vom Fürsten gestellt. Du darfst persönliche Gegenstände mitnehmen, solltest es damit aber nicht übertreiben – die Ausrüstung ist schwer und du wirst sie auf dem Buckel tragen müssen. Verabschiede dich nun umgehend von deiner Familie. Wenn du bis heute Abend zur sechsten Stunde nicht in Radinburg eingetroffen bist, giltst du als Fahnenflüchtiger und wirst als solcher verfolgt und bestraft werden. Es gibt nichts, was als Ausrede gerechtfertigt wäre.“
Auf Fahnenflucht stand der Tod durch Erhängen. Kein Schicksal, das Shias für sich selbst vorgesehen hatte. Dass er jetzt sofort losziehen musste … Das war ein Schock, auf den er nicht vorbereitet gewesen war.
„Ich werde Euch nicht enttäuschen, Herr“, sagte er durch den betäubenden Nebel, der Besitz von seinem Denken ergriff. Jetzt? Er musste sofort seine Heimat verlassen? Aber sein Vater brauchte doch Hilfe mit den Zäunen … Es war sein Geburtstag … Heute Abend sollte es Kuchen geben …
Nichts von dieser Panik drang nach außen, dem Nebel sei Dank.
Der namenlose Adelsmann beachtete ihn nicht mehr weiter, sondern stülpte sich den Helm über und stieg auf sein Pferd, bevor er seinen Leuten ein Zeichen gab. Einen Moment später jagte die Gruppe vom Hof, als wären sämtliche Dämonenwölfe der Niederhöllen hinter ihnen her.
Wie erschlagen starrte Shias auf den Umschlag in seiner Hand. Auf das rote Siegel, das die fürstliche Linde zeigte. Es ergab gerade keinen Sinn für seinen eingefrorenen Verstand. Er zitterte leicht, wurde ihm bewusst. Musste er wirklich gehen? Jetzt sofort? Es war ein mindestens fünfstündiger Marsch bis Radinburg. Das Gelände dürfte nach dem Dauerregen der letzten Zeit sehr schwierig sein, also würde er eher sechs Stunden benötigen und sollte noch etwas mehr Zeit einplanen, falls er Umwege laufen musste, weil die Stürme eventuell Bäume an ungünstiger Stelle umgerissen hatten. Er hatte also wirklich keine Möglichkeit, noch etwas bei seiner Familie zu verweilen. Sich an die wichtigen Dinge zu erinnern, die er ihnen sagen wollte. Alles das, was jetzt sofort gesagt werden musste, weil es sonst zu spät sein könnte. Menschen starben im Krieg.
Warum musste er dorthin? In den Krieg? Er hatte keinen Grund, die Avanyer zu hassen, er wollte nicht gegen sie kämpfen! Er wollte Kuchen essen. Ja. Das war der Plan für heute gewesen. Arbeiten und Sonne genießen und abends mit seiner Familie Kuchen essen und singen und sich freuen, weil sein Vater stark und gesund war.
Erst als er in eine feste Umarmung gezogen wurde, kam Shias zu sich, wurde aus den kreisenden Gedanken gerissen, die vollkommen sinnlos waren.
„Danke“, flüsterte Tirio ihm ins Ohr. „Danke, dass du es auf dich nimmst. Ich hätte gehen müssen, ich bin der Älteste, es wäre meine Pflicht, meine verdammte Pflicht … Danke, Bruder!“
Wärme kehrte in Shias Leib zurück, sie flutete durch seine Adern, als er Tirios Umarmung erwiderte. Sein Bruder war größer und kräftiger als er, war es immer gewesen. Trotzdem wurde sich Shias in diesem Moment bewusst, dass sie beide erwachsen waren. Dass er kein kleiner Junge mehr war, der sich zu seinem großen Bruder flüchten konnte, wann immer irgendetwas beängstigend war. So viele Nächte, die er zu ihm ins Bett gekrochen war, als er klein war und Albträume ihn geplagt hatten. Tirio hatte ihn immer beschützt. Ihm beigebracht, wie man Wölfe vertrieb, die sich an die Schafherde anpirschen wollten. Wie man mit dem Schnitzmesser umging. Wie man Hundewelpen trainierte. Wie man Staudämme in den Fluss baute. Wie man am besten auf den Pflaumenbaum hinter dem Haus kletterte, um im Herbst die köstlichen Früchte zu ernten. Zeit seines Lebens hatte Shias zu ihm aufgeblickt. Er war der Kleinste gewesen, der Jüngste. Nicht das Sorgenkind der Familie, das war Lyk gewesen, und die Schwestern, die verteidigt werden mussten. Doch eben auch einer derjenigen, für die Tirio jederzeit sein eigenes Leben gegeben hätte. Heute war der Tag, an dem Shias zurückzahlte, was ihm von Herzen gegeben worden war …
„Du musst für Vater und Mutter da sein“, flüsterte er Tirio ins Ohr. „Du musst heiraten und wunderschöne Kinder zeugen, denen du alles das beibringst, was du mich einst gelehrt hast. Halte den Hof. Beschütze Lyk. Ich bete zu den Vieren, dass der Krieg bald endet und die Rekrutierer niemals zurückkehren, um auch euch beide zu holen. Ihr werdet hier gebraucht. Versprich mir, hier alles zusammenzuhalten.“
„Ich schwöre bei Ludarn, wenn du heimkehrst, wirst du nichts als Freude und Frohsinn und blühendes Leben vorfinden. Dafür werde ich kämpfen!“ Tränen standen in Tirios Augen – vielleicht zum ersten Mal, seit Shias sich bewusst erinnern konnte. Tirio war stets der Tapferste von ihnen gewesen. Noch ein letztes Mal wurde er von seinem Bruder fest gedrückt, bevor er an Lyk weitergereicht wurde.
Der hatte keine Worte, sondern schluchzte an Shias‘ Schulter und flehte ihn um Vergebung an.
Lyk war im Gegensatz zu Tirio mit seiner unerschütterlichen Kraft und Stärke stets zarter und anfälliger gewesen. Als Kind hatte es kaum eine Krankheit gegeben, die ihn nicht umgeworfen hatte. Wie oft hatte er mondelang im Bett liegen müssen, von Fieber und Schmerzen geplagt, manchmal zu elend, um noch essen zu können! Mehr als einmal hatten sie befürchtet, ihn zu verlieren und jedes Mal hatte er sich zurück auf die Beine gekämpft. Denn trotz seiner Zartheit war er auch zäh und nie hatte er seinen Lebensmut verloren. Tirio und Shias hatten abwechselnd an Lyks Bett Wache gehalten, ihm vorgelesen, mit ihm geredet, gelacht, sich gezankt, ihn liebevoll gehänselt, wenn es ihm besser ging. Mit Lyk war er durch die Wälder gezogen, hatte wilde Abenteuer erlebt, hatte sich mit ihm gemeinsam gegen Tirio verbündet, um es dem „Großen“ heimzuzahlen, wenn dieser sich über sie lustig gemacht hatte. Sie hatten in lauen Sommernächten draußen auf dem Dach gelegen und Sterne gezählt, hatten Seite an Seite gegen die Jungen von den Nachbarhöfen gekämpft, an den vier Hochfesttagen getanzt, sich ihre Träume und Ängste und Hoffnungen für die Zukunft erzählt. Während Tirio sein Retter, sein Vorbild und eine Art zweiter Vater für ihn darstellte, war Lyk stets sein bester Freund gewesen.
„Lyk, bitte!“, sagte er und kämpfte gegen den Druck in der Kehle an, damit er nicht selbst auch in Tränen ausbrach. „Du musst überleben! Frag endlich Iria, ob sie dich haben will. Und wenn sie ja sagt, was sie tun wird, so sicher wie die Sonne im Osten aufgeht, dann zögere nicht mehr länger herum. Heirate sie, hab Kinder. Zieh zu ihr auf den Hof und lebe glücklich bis ans Ende deiner Tage. Wenn ich zurückkehre, will ich ihren schwangeren Bauch sehen und ich lasse keine Ausrede gelten! Versprich mir, dass du lebst und glücklich bist.“
„Ich schwöre im Namen der Vier, ich frage sie. Noch heute werde ich sie fragen!“ Lyk lachte und schluchzte zugleich, bevor er Shias in die Arme ihres Vaters abschob.
„Erinnere dich an das, was ich dich gelehrt habe, Shias! Du weißt, was notwendig ist, um zu überleben.“
„Ja, das weiß ich. Und ich verdanke es dir, Vater.“ Shias fühlte sich mit einem Mal wieder ruhig. Er konnte das schaffen. Was auch immer die Götter für ihn planten, er würde bestehen. Überleben. Heimkehren.
Sie fuhren gemeinsam zusammen, als Mutters Stimme hinter ihnen ertönte.
„Wie konntest du das zulassen?“, fragte sie vorwurfsvoll, ihr ausgestreckter Finger wies auf Vater, ihr Gesicht war von Kummer verzerrt. „Wieso nehmen sie mir meinen Jüngsten weg?“
„Ich habe mich angeboten, sie wollten mich nicht.“ Er trat rasch zu ihr, umarmte Mutter. Shias hingegen begann verwirrt nachzudenken. Warum genau wollte der Fürst keinen erfahrenen Veteranen, der sowohl mit dem Schwert als auch Pfeil und Bogen ausgebildet war, besser reiten konnte als die meisten Adligen, der an mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen war und diese weitgehend unverletzt überlebt hatte. Der noch immer jung genug war, um an weiteren Kämpfen teilnehmen zu können, mit seiner Erfahrung praktisch unentbehrlich sein musste, als Ausbilder ein noch größerer Gewinn. Warum wollte der Fürst ausdrücklich junge, unerfahrene Männer, von denen kein einziger an einem Kampf beteiligt gewesen sein konnte? Das ergab doch gar keinen Sinn!
„Du denkst nach. Das ist gut.“ Mutter zog ihn an sich, küsste ihn links und rechts auf die Wangen.