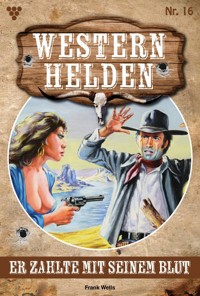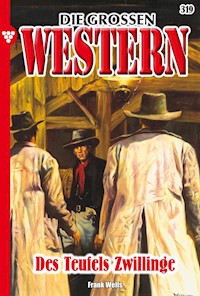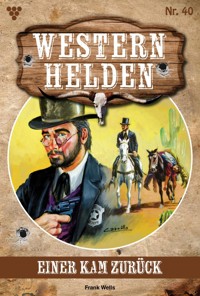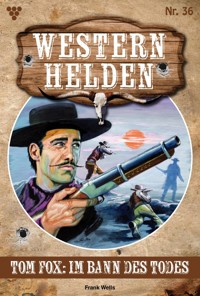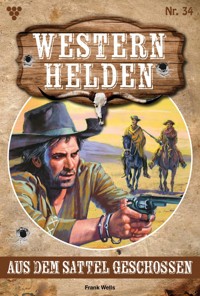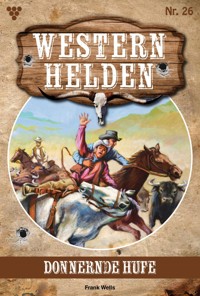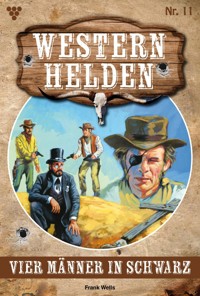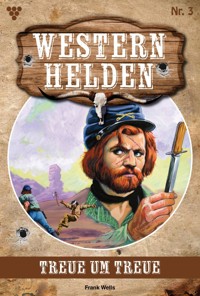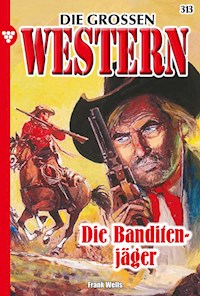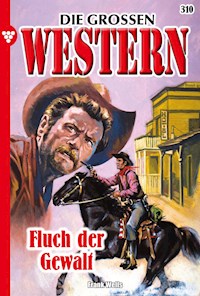Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Zehn Tage war Jerry Holbrook unterwegs, um hinter die Schliche eines Banditen zu kommen. Als er zurückkehrt, wird er selbst als Viehdieb verdächtigt. Wieder hat ihn der Verbrecher, auf dessen Spuren er ritt, hereingelegt. Und dann schlägt der Bandit abermals zu. Joe Braddocks Sohn stirbt von der Hand des Killers, und der alte Joe Braddock selbst begreift zu spät den Sinn von Jerry Holbrooks dringender Warnung. Jerry weiß, wer sein Gegner ist. Dennoch kommt er immer wieder zu spät. Und es ist eine schier endlose Kette von Tricks, die der Verbrecher anwendet. Seit zehn Tagen war Jerry Holbrook unterwegs. Er wusste, dass er jetzt auf den feuerspeienden Schlund eines Vulkans losritt, dass sich in jeder Sekunde die Hölle öffnen konnte. Wenn es auch keiner im Basa-County glauben wollte, er wusste, dass die Katastrophe bevorstand. Der Wallach unter ihm galoppierte in einen Canyon. Da geschah es! Gewohnheitsmäßig überflog Jerry mit scharfem Blick den Arroyo, als er die Krümmung genommen hatte. Ihn warnte nur ein dünner Staubschleier, der über dem Bergsattel hing. Der Wind konnte ihn hochgetrieben haben. Aber es ging kein Wind. Nicht der leiseste Lufthauch bewegte die glühende Luft. Also war dort oben jemand. Eine Antilope?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 420 –Die letzte Karte sticht
Frank Wells
Zehn Tage war Jerry Holbrook unterwegs, um hinter die Schliche eines Banditen zu kommen. Als er zurückkehrt, wird er selbst als Viehdieb verdächtigt. Wieder hat ihn der Verbrecher, auf dessen Spuren er ritt, hereingelegt. Und dann schlägt der Bandit abermals zu. Joe Braddocks Sohn stirbt von der Hand des Killers, und der alte Joe Braddock selbst begreift zu spät den Sinn von Jerry Holbrooks dringender Warnung. Jerry weiß, wer sein Gegner ist. Dennoch kommt er immer wieder zu spät. Und es ist eine schier endlose Kette von Tricks, die der Verbrecher anwendet. Als ihn selbst ein Aufgebot hetzt, kommt Jerrys große Chance …
Seit zehn Tagen war Jerry Holbrook unterwegs. Er wusste, dass er jetzt auf den feuerspeienden Schlund eines Vulkans losritt, dass sich in jeder Sekunde die Hölle öffnen konnte. Wenn es auch keiner im Basa-County glauben wollte, er wusste, dass die Katastrophe bevorstand.
Der Wallach unter ihm galoppierte in einen Canyon. Dann kam ein scharfer Knick und dahinter eine lange Steigung den Geröllhang hinauf …
Da geschah es! Gewohnheitsmäßig überflog Jerry mit scharfem Blick den Arroyo, als er die Krümmung genommen hatte. Ihn warnte nur ein dünner Staubschleier, der über dem Bergsattel hing. Der Wind konnte ihn hochgetrieben haben. Aber es ging kein Wind. Nicht der leiseste Lufthauch bewegte die glühende Luft.
Also war dort oben jemand. Eine Antilope? Eine Bergziege? Nein! Bergziegen hatten weder Gewehre noch Revolver. Was aber neben den reglos verstreuten Felstrümmern auf der rechten Hangseite aufblitzte, war zweifellos Stahl im Sonnenlicht!
Eine Falle. Jerry dachte an die versteckte Warnung des Besitzers der letzten Handelsstation. Quinx hatte von mexikanischen Desperados gesprochen …
Jerry dachte nicht weiter. In solchen Situationen konnte ein Gedanke zu viel das Ende des Lebens bedeuten. Hier, an diesem Platz, gab es noch Deckungsmöglichkeit. Hundert oder nur fünfzig Yards weiter nicht mehr, denn dort weitete sich der Canyon zu einem tischflachen Becken, von dem aus sich das Geröllfeld zur Berglehne hinaufschob. Hier gab es noch Steilwände und einige Sträucher und Felsblöcke, die Schutz boten.
Er riss den Wallach scharf auf der Hinterhand herum, zog mit einer fließenden Bewegung das Gewehr aus dem Scabbard und verließ mitten in der Drehung des Pferdes den Sattel. Er landete drei Schritte neben einem Felsblock, verlor den Hut beim Aufsprung und ließ sich fallen. Er lag noch nicht ganz, als die erste Kugel über ihn hinwegjaulte. Er rollte sich hinter den Felsblock, zog die Beine an den Leib und schaute zu seinem Pferd.
Es war schon fast wieder an der Biegung des Canyons, da traf das Blei. Zwei, drei Treffer gleichzeitig ließen das Tier schrill aufwiehern, dann brach es mit schlagenden Hufen auf dem Fleck zusammen.
Jerry Holbrook lud zähneknirschend die Winchester durch, richtete sich plötzlich auf und warf die Büchse in den Anschlag. Er sah deutlich den weißen Fleck eines Gesichtes oben am Hang und den blinkenden Gewehrlauf. Er ließ das Blei fliegen und war untergetaucht, als seine Gegner dort oben wieder schossen. Jetzt wusste er, dass es mindestens vier Männer waren, das heißt jetzt nur noch drei, denn einen hatte er mit Sicherheit erwischt.
Beim nächsten Mal nahm er den Colt und streute die Kugeln blitzschnell in die ungefähre Richtung, in der die Feinde hockten. Dann ließ er den Revolver fallen, schnellte seitlich hinter dem Felsblock empor und hob das Gewehr. Ganz wie er es erwartet hatte, war keiner der Banditen zu sehen. Die Revolverschüsse hatten sie in Deckung gezwungen.
Plötzlich spähte einer hinter einem Geröllhaufen heraus, zum letzten Mal in seinem Leben. Jerry tauchte unter, lud Revolver und Gewehr nach und wartete. Sein Hut lag zwei Schritte neben ihm.
Als er ihn mit einem Stock angelte, begannen zwei Gewehre wie verrückt zu schießen. Ein Stück Blei durchschlug die Krone des Stetson. Der Mann dort oben schrie nicht mehr.
Jerry drehte eine Zigarette, steckte den Hut auf den Stock und hielt ihn schräg neben sich über den Felsblock. Wieder belferten sofort die Schüsse. Nur einer streifte die Krempe des Stetson.
Er steckte die Zigarette an und tat ein paar Züge. Er saß in der Falle, sein Pferd war tot, und das war das Schlimmste. Die zwanzig Meilen zu Fuß zu Joe Braddocks Ranch bei dieser höllischen Glut konnten einen Mann ins Grab bringen. Zwanzig Meilen Fußmarsch waren gleichbedeutend mit dem Marterpfahl der Apachen.
Dann schon lieber zurück zu Quinx, denn das waren nur etwa fünf Meilen. Oder noch besser die Postkutsche. Sie musste bald in Quinx Handelsstation sein und dann die letzte Etappe nach Basa zurücklegen. Knapp eine Meile von hier kam sie vorbei.
Das wars! Es drehte sich nur noch um die restlichen Desperados im Hinterhalt. Jerry hob das Gewehr über den Felsblock, ließ es eine Sekunde stehen und zog es zurück. Kein Schuss erfolgte. Dafür hörte er ein fernes Geräusch. Es konnte Hufschlag sein, und zwar jenseits der Berglehne, zu dem der Geröllhang aufstieg. Flohen die Burschen, oder sollte das ein Trick sein?
Er sprang auf, jagte über die Sohle des Canyons und tauchte jenseits hinter einem anderen Felsblock unter. Kein Schuss, nichts erfolgte. Das Gewehr des Heckenschützen lag noch am alten Platz. Hinter dem Felsen schaute der Kopf eines Toten hervor.
Er hielt sich nicht länger mit Überlegungen auf, nahm den Hut, schnallte dem toten Pferd den Sattel ab, warf ihn neben das Gewehr über die Schulter und ging den Weg zurück durch den Canyon, hinüber zum Postweg.
Er bekam keinen Banditen zu Gesicht.
*
Dass es kein Vergnügen war, in einer Postkutsche durch den weiten Westen zu fahren, wusste Amy Sheldon seit Beginn dieser Reise. Ihre Bekannten hatten ihr abgeraten und von blutrünstigen Apachen, maskierten Banditen und sonstigen Abenteuern gesprochen. Aber weder ein Apachenhäuptling mit den Farben des Krieges im Gesicht erschien, um sie zu seiner Squaw zu machen, noch hatten Banditen den Kutscher vom Bock geschossen. Es gab keine heulenden Wölfe, sie hatte noch nicht einmal eine Klapperschlange zu Gesicht bekommen.
Am schlimmsten waren die Hitze und die winzigen Staubkörner, die durch jede Ritze krochen. Doch Amy hatte gelernt, dass das Leben nicht nur weiche Kissen für einen Menschen bereithielt, sondern viele Dornen. Nach dem Tode ihrer Eltern hatte sie schon mit vierzehn Jahren arbeiten müssen. Jetzt, wenig älter als achtzehn, konnte sie glücklich sein, dass ihr Onkel Lyndon Bogart sie gefunden und zu sich gerufen hatte.
Der Tag neigte sich, als auf der letzten Station vor Basa die Pferde gewechselt wurden. Der Kutscher stieg gar nicht erst von seinem Bock, denn er hatte Verspätung aufzuholen. Amy hätte zu gern einen Schluck getrunken, aber diese wenigen Meilen bis Basa würde sie schon noch aushalten. Die letzten Meilen auf dem Weg in ein neues Leben …
Es war schön, davon zu träumen. Doch sobald die Postkutsche anruckte und den Palisadenzaun der Handelsstation hinter sich ließ, sank Amys Kopf zur Seite. Es war kein Schlaf, nur ein schläfriges Dösen. Deshalb schreckte sie sofort auf, als die Pferde ihr Tempo verlangsamten. Sie hörte den Kutscher etwas rufen. Eine andere Stimme antwortete, und gleich darauf erschien das Gesicht eines Mannes vor dem Wagenfenster.
Die Tür sprang auf, der Mann stieg ein. Der Kutscher feuerte die Tiere mit rauen Flüchen an und trieb sie zu schärferem Galopp an. Der fremde Mann warf Sattel und Mantelsack auf die freie Sitzbank gegenüber von Amy. Er nahm das Gewehr von der Schulter, blies Sandkörnchen vom Verschluss und schob es in das Lederfutteral, über das blinkende Metall hinweg schoss er einen kurzen Blick auf Amy und sagte: »Schlafen Sie ruhig weiter, Madam.«
Aber sie konnte und wollte nicht schlafen. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen zu schmalen Schlitzen und machte sich daran, den Mann zu studieren. Obwohl sie in ihrer bisherigen Heimat eine Menge großer Männer gesehen hatte, schien dieser noch größer zu sein. Vielleicht lag es nur an dem dämmerigen Licht oder an seinen wuchtigen, breiten Schultern. Auch hatte er große Hände mit langen kräftigen Fingern.
In seinem Gesicht spiegelte sich die Weite dieses Landes. So sahen freie Menschen aus, Reiter und Jäger, die nirgends eine Grenze kannten. Über der tiefen Bräune des Ledergesichts lag der Puder aus Sand und Staub. Vergeblich versuchte Amy in diesem Bronzegesicht etwas zu lesen.
Der Mann zog ein Messer aus dem Stiefelschaft und begann an seinem Sattel zu schaben. Amy konnte erkennen, dass es ein dunkler, rostähnlicher Fleck war.
Plötzlich schaute der Mann sie voll an und sagte in ihre fast geschlossenen Augen hinein: »Das ist Blut von einem Pferd. Haben Sie schon Blut gesehen?«
Unwillkürlich hielt sie den Atem an und schaute groß in seine spöttischen Augen. Verwirrt schüttelte sie den Kopf.
»Also nicht«, brummte der Mann. »Dachte ich mir.«
Es war nicht Amys Art, sich von Männern anreden zu lassen, noch dazu von jungen Männern. Dieser hier war jung. Wenn auch sein Gesicht von Dingen erzählte, die mancher Greis nicht gesehen haben mochte. Von einem harten Leben, von Abenteuern, von einsamen Ritten und wilden Kämpfen. Normalerweise hatte sie jedem Mann die kalte Schulter gezeigt, der sie in dieser nicht gerade höflichen Art angesprochen hätte. Aber bei diesem war das anders.
»Doch, ich habe schon Blut gesehen. Es war der schlimmste Tag meines Lebens, als sie meinen Vater nach Hause brachten. Tot.«
Der Mann richtete sich auf. Es war, als wische eine unsichtbare Hand alle Härte aus seinem Gesicht. Fast sah er gütig aus, als er murmelte: »Verzeihen Sie bitte. Ich wollte nicht an Wunden rühren.«
»Sie konnten es nicht wissen. Die Leute sagten, es wäre ein Unfall gewesen. Der Sheriff meinte sogar, Dad hätte … hätte seinen eigenen Revolver …«
»Selbstmord?«
»Der Sheriff sagte es, aber es war eine Lüge. Dad hätte es nie getan. Auch nicht nach dem Zusammenbruch seiner Bank.«
»Hm. Sie haben eine weite Fahrt hinter sich?«
»Ja. Von Stanton, Texas.«
Der Mann hob überrascht den Kopf: »Nein! Ihr Vater war dort Bankier? Ich kenne nur eine Bank in Stanton, es liegt allerdings schon weit zurück. Sechs oder sieben Jahre. Die Bank gehörte Joyce Sheldon. Es war ein Freund meines Vaters. Vielleicht haben Sie Crack Holbrook gekannt?«
»Natürlich! Sie sind ein Holbrook? Doch nicht Jerry Holbrook?«
»Genau. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie damals ein langbeiniges Füllen von etwa zwölf Jahren. Aber Ihr Name …«
»Amy.«
»Amy Sheldon. Teufel, die Welt ist ein Dorf. Verdammt, dass es Ihren alten Herrn erwischt hat. Die Bank konnte doch gar nicht kaputt gehen!«
»Dad war zu gutmütig. Er hat sehr viel Geld ausgeliehen, ohne genügend Sicherheiten in der Hand zu haben. Und als dann der Bankraub passierte, bei dem wir fünfzigtausend Dollar verloren haben …«
»Das ist hart. Wer war Sheriff? Doch sicher noch der alte Socker?«
»Nein. Er ist schon lange tot. Er wurde vier Wochen vor meinem Vater beerdigt.«
»Der kerngesunde Mann?«
»Es war ein Unfall. Er hat bei einem Sturz das Genick gebrochen. Er soll betrunken gewesen sein.«
»Wer hat nach ihm den Stern getragen?«
»Es war damals alles sehr verworren. Zuerst wurde ein ziemlich junger Mann ernannt, ein Fremder. Er hieß Matt Hyden und ist kaum länger als sechs Wochen im Amt gewesen.«
»War er Sheriff, als das mit Ihrem Vater passierte?«
»Ja. Bald danach verschwand er. Es hieß, er wäre getötet worden, aber niemand hat seine Leiche gefunden.«
Jerry Holbrook pfiff nachdenklich durch die Zähne. Er erinnerte sich noch genau an Joyce Sheldon und Stanton in Texas. Sein Vater hatte dort eine Schmiede besessen. Nach dessen Tode hatte es Jerry nicht mehr nach Stanton zurückgezogen, zumal er in jener Zeit als Scout geritten war und jetzt hier eine kleine Ranch gegründet hatte. Arizona war das Land der Zukunft für einen Mann, der seine Arme regen konnte.
Die Geschichte, die Amy erzählt hatte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Aber was sollte er noch dazu sagen? Es würde nie eine Aufklärung für das Verbrechen geben. Das Geld war geraubt und die Banditen längst spurlos untergetaucht. Zwischen Arizona und Texas lagen Hunderte von Meilen menschenleeres Land.
»Was wollen Sie nun beginnen?«, fragte er. »Fahren Sie noch weit?«
»Nach Basa, zu meinem Onkel. Vielleicht kennen Sie ihn? Er ist Besitzer der Geier-Ranch.«
Über Jerrys Gesicht flog ein Schatten. »Zu Lyndon Bogart? Sind Sie tatsächlich mit ihm verwandt?«
»Was ist daran verwunderlich? Er ist ein Stiefbruder meiner Mutter. Sie kennen ihn?«
»Ja. Natürlich. Hier kennt jeder jeden – im Umkreis von dreihundert Meilen.«
Jerry Holbrook wurde unvermittelt schweigsam. Er holte ein Stück Dörrfleisch aus der Satteltasche und begann mit dem Messer herumzusäbeln. Während er kaute, schien er Amy vergessen zu haben. Doch es schien nur so. Plötzlich schaute er sie wieder voll an und murmelte: »Es wäre besser, wenn Sie Ihrem Onkel nicht sagen würden, dass ich in dieser Kutsche war. Auch nicht, dass Sie mich von früher her kennen.«
Sie schüttelte verblüfft den Kopf. »Aber warum denn? Haben Sie etwas gegen Onkel Lyndon?«
»Das ist unwichtig. Auf jeden Fall hat er einiges gegen mich. Sie werden seine Meinung über mich sehr bald kennenlernen. Ich fürchte, Sie werden sich dann nur noch ungern daran erinnern, dass wir eine gemeinsame Heimat haben …«
»Das … das verstehe ich nicht! Ich sollte Sie verleugnen, Jerry? Wo ich Ihren Vater so gut gekannt habe, der ein Freund meines Vaters war? Nein, nein …«
»Auch das sollten Sie verschweigen. Natürlich kann ich Ihnen keine Befehle oder Verbote erteilen. Aber ich habe immer nach dem Grundsatz gehandelt: Augen auf und Mund zu! Bilden Sie sich selbst Ihr Urteil, Madam!«
Jerry beugte sich zum Fenster und spähte in den dunklen Abend hinaus. Die Berge waren jetzt nahe herangerückt, der Postweg schlängelte sich durch verkarstete Hügel mit staubigen Sträuchern. Er rechnete nicht mit einem zweiten Überfall, aber wenn einer erfolgen sollte, dann war hier die günstigste Gelegenheit dazu. Zwei Meilen weiter öffnete sich das Gelände schon zu einem weiten fruchtbaren Becken, in dem Largas zerstörte Ranch lag.
Vor einem Vierteljahr war es geschehen, durch nichts vorherzusehen. Nur ein Narr konnte glauben, dass es das einzige Unheil bleiben würde, das diesem Land drohte.
Das Unheil war unterwegs. Es schlich sich lautlos heran. Heute hatte es ihn treffen sollen. Wen morgen?
Er ruckte plötzlich zu Amy herum und beugte sich nahe zu ihr. Seine Stimme klang eindringlich, fast bittend, als er sagte: »Sie sollten nicht hierbleiben, Amy. Fahren Sie zurück nach Stanton. Die nächste Kutsche geht morgen früh, bevor die Sonne über den Horizont kommt.«
»Sie sagen das so merkwürdig … Droht Gefahr? Gibt es wieder einen Apachenkrieg?«
»Nein. Sie müssen mir glauben, auch ohne, dass ich Ihnen lange Erklärungen gebe. Beim Andenken an Ihren Vater und an meinen Vater – vertrauen Sie mir! Verlassen Sie das Land!«
»Aber das geht doch gar nicht! Mein Onkel weiß, dass ich komme. Er erwartet mich bestimmt in Basa. Wie soll ich ihm sagen …«
»Steigen Sie vorher aus. Zusammen mit mir. Ihr Onkel wird nichts davon erfahren, dass Sie hier gewesen sind. Ich spreche mit dem Kutscher und seinem Begleiter. Die halten dicht.«
»Und dann? Wohin wollen Sie mich bringen?«
»Zunächst zu meiner kleinen Ranch oben in den Bergen. Sie könnten einige Tage dortbleiben. Sie können auch morgen schon zurückfahren. Ich würde Sie dann zur nächsten Pferdewechselstation bringen. Bitte, fassen Sie Ihren Entschluss schnell!«
Die eindringlichen Worte blieben nicht ohne Eindruck auf Amy Sheldon. Aber wie hätte sie so schnell eine Entscheidung treffen können? Trotz allem war Jerry Holbrook ein Fremder. Wer sagte überhaupt, dass er wirklich Jerry war? Vielleicht hatte er nur ein Interesse daran, ihren Onkel schlecht zu machen. Oder wollte er sie gar entführen?
Sie richtete sich auf und lehnte sich gegen die rüttelnde Rückenlehne des Wagens. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Mr. Holbrook! Sie vergessen, dass ich zu meinem Onkel fahre. Mein Onkel war Offizier! Wenn es eine Gefahr gibt, wird er bestimmt damit fertig. Er hat mir geschrieben, dass fast zwanzig Männer für ihn reiten. Was sollte ich da zu fürchten haben?«
Jerry zuckte die Achseln. »Gut. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Es war mein Fehler. Es ist immer falsch, wenn ein Mann zum Schwätzer wird!«
Sie wollte ihm antworten, wollte ihre ablehnende Haltung begründen und abschwächen, aber er schaute schon wieder zum Fenster hinaus und beachtete sie nicht. Das verletzte sie. Eine Dame hatte schließlich ein Recht darauf, von einem Kavalier höflich behandelt zu werden. Aber sicher war ein Weidereiter nur ein ungehobelter Klotz ohne alle Manieren.
Der Postwagen nahm in rasender Fahrt einige scharfe Kehren des Weges, der steil zum Tal abfiel. Auf dem dunklen Samt des Himmels glitzerten die Sterne, die fahle Mondsichel versteckte sich in einer Bergfalte.
Jetzt war die Talsohle erreicht. Ein Stück voraus, abseits vom Weg, ragten die Pinien empor, die Largas verbrannte Ranch umstanden. Zwischen ihnen stachen die schwarzen Finger verkohlter Balken in den Himmel. Nur eine kleine Hütte abseits der Ranch war stehen geblieben. Sie lag knapp vierhundert Yards vom Postweg entfernt.
In plötzlichem Entschluss sprang Jerry Holbrook auf, warf Sattel und Mantelsack über die Schulter, nahm das Gewehr auf und beugte sich zu Amy hinüber: »Ich muss gehen, Madam. Es sind nur noch zehn Meilen bis Basa. Gute Nacht.«
Ehe sie sich von dieser neuen Überraschung erholt hatte, stieß er die Tür auf und sprang. Er wurde einfach von der Dunkelheit aufgesogen.
Die Tür klappte zu, Amy sprang erschrocken auf und starrte durch das Fenster hinaus. Aber sie sah nichts als die von den Hufen aufgewirbelte Staubwolke – und die ferne Gruppe der Pinien mit den unheimlichen Trümmern der zerstörten Ranch. Ob Jerry Holbrook dort wohnte? In einem verbrannten Haus?
Sie wusste nicht mehr, was sie von all dem denken sollte. Ihre Freude auf eine neue und glückliche Zukunft war vergangen …
*
Jerry Holbrook ging mit weitausgreifenden Schritten auf die Ruine zu. Das Büffelgras stand stellenweise kniehoch, denn jetzt war diese Weide herrenlos. Largas Herde hatte sich in alle vier Winde verlaufen.
Jerrys Schritte machten kaum Geräusche. Er war es gewohnt, wie ein Panther auf leisen Sohlen dahinzugleiten. Es war zu seiner zweiten Natur geworden, überall Gefahr zu wittern.
Obwohl es hier sicher nichts zu befürchten gab, ging er doch nicht direkt auf die heilgebliebene Hütte zu, sondern auf die Baumreihe. Dort unter den Pinien verhielt er einen Augenblick und lauschte.