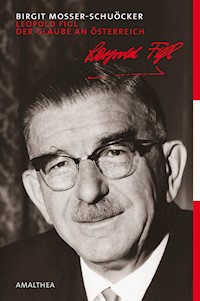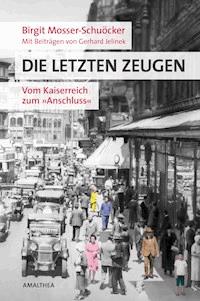
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erlebt, erlitten, erzählt: Eine Zeitreise in die österreichische Vergangenheit "Meine Mutter hat in der Zeitung von der Kriegserklärung gelesen und furchtbar geweint. Sie hat Tod, Not und Elend vorhergesehen." Frieda Jeszenkovitsch, Jahrgang 1909, erinnert sich an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Für die ORF III-Doku "Wie wir wurden. Was wir sind" haben die Autoren berührende Gespräche mit Zeitzeugen geführt, deren Erinnerungen weit zurückreichen: in die untergehende Habsburgermonarchie, in die krisengeschüttelte Erste Republik und schließlich in die Anfänge der Nazi-Herrschaft. "Die letzten Zeugen" sprechen über Ereignisse, die viele Jahrzehnte zurückliegen und doch die Republik Österreich entscheidend geprägt haben. Heinrich Treichl, Fritz Molden oder Eric Pleskow erinnern sich an Meilensteine wie den verlorenen Ersten Weltkrieg, den Justizpalastbrand, den Bürgerkrieg, den Nazi-Juliputsch oder den "Anschluss". Die authentischen Schilderungen werden in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet: persönlich, packend, direkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Mosser-Schuöcker
Mit Beiträgen von
Gerhard Jelinek
DIE LETZTEN ZEUGEN
Birgit Mosser-Schuöcker
Mit Beiträgen von Gerhard Jelinek
DIE LETZTEN ZEUGEN
Vom Kaiserreichzum »Anschluss«
Bildnachweis
Hannah Linhard (S. 29, 36, 39, 45, 123, 161),
Johannes Jelinek (S. 145), Esther Pruckner (S. 179, 231, 262)
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.amalthea.at
© 2014 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Silvia Wahrstätter, vielseitig.co.at
Umschlagfoto (Die Kärntnerstraße, Wien, auf Höhe Hausnr. 15, 1932):
© Imagno/ÖNB
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger & Karl
Schaumann GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 10,75/16 Punkt Cambria
Printed in the EU
ISBN 978-3-902862-84-6
Inhalt
Vorwort
Zu diesem Buch
1. KAPITEL
»Wir haben schon verstanden, was Krieg ist.«
Frieda Jeszenkowitsch, Berta Stimpfl, Felizitas Wester und Marko Feingold über den Ausbruch und das Leid des Ersten Weltkrieges
2. KAPITEL
»Das eigentliche Österreich gibt es nicht mehr.«
Heinrich Treichl, Fritz Molden und Otto von Habsburg über das Ende der Monarchie und die Anfänge der Republik Deutschösterreich
3. KAPITEL
»Alle Opfer waren umsonst.«
Felizitas Wester, Fritz Molden, Fritz Propst, Berta Stimpfl und Marko Feingold über das Ende des Ersten Weltkrieges und die Folgen der österreichischen Niederlage
4. KAPITEL
»Natürlich waren wir dafür, dass wir bei Österreich bleiben.«
Felizitas Wester über den Kärntner Abwehrkampf und die Volksabstimmung von 1920
5. KAPITEL
»Wir haben kaum etwas zu essen gehabt.«
Frieda Jeszenkowitsch, Fritz Propst, Felizitas Wester und Marko Feingold über Hunger und soziales Elend in den Zwanzigerjahren
6. KAPITEL
»Eigentlich waren wir Niemandsland.«
Frieda Jeszenkowitsch und Alois Mayrhofer über Österreichs jüngstes Bundesland und seine ungarischen Wurzeln
7. KAPITEL
»Wir wollten keine Italiener werden.«
Dorothea Haider und Berta Stimpfl über die gewaltsame Italianisierung Südtirols im Faschismus
8. KAPITEL
»Schaut! Da könnt ihr euch jetzt gerade ein paar Semmeln kaufen!«
Fritz Propst, Marko Feingold und Heinrich Treichl über Armut und Inflation
9. KAPITEL
»Das war der erste große Krach zwischen diesen beiden Parteien.«
Theresia Grafl, Fritz Propst, Marko Feingold und Fritz Molden über die Schüsse von Schattendorf und ihre Folgen
10. KAPITEL
»Da kamen an einem Tag 60 Bettler.«
Franz Saxinger, Dorothea Haider und Marko Feingold über Arbeitslosigkeit, Not und Bettler
11. KAPITEL
»Wir hätten bis zum letzten Mann gekämpft!«
Fritz Propst, Dorothea Haider und Fritz Molden über die blutigen Kämpfe im Februar 1934
12. KAPITEL
»Manche waren eiskalte Brüder!«
Marko Feingold, Franz Saxinger, Fritz Molden und Heinrich Treichl über den gescheiterten Juli-Putsch der Nationalsozialisten
13. KAPITEL
»Nieder mit dem Faschismus! Wir kommen wieder!«
Fritz Propst und Heinrich Treichl über Widerstand, Verfolgung und die Regierenden im Ständestaat
14. KAPITEL
»Natürlich gibt es wichtigere Dinge als den Opernball. Aber er hat sehr viel Freude geschenkt!«
Christl Schönfeldt über ihren ersten »Ball der Bälle« in der Frsten Republik
15. KAPITEL
»Jetzt können wir uns alle auf einiges gefasst machen.«
Fritz Molden, Fritz Propst, Franz Saxinger, Walter Stern, Dorothea Haider, Eric Pleskow, Marko Feingold und Heinrich Treichl über den »Anschluss« und seine Folgen
16. KAPITEL
»Brauchen tut man Patriotismus in schwierigen Zeiten, damit man sich festhalten kann.«
Fritz Molden, Walter Stern, Eric Pleskow, Franz Saxinger, Fritz Propst, Marko Feingold und Dorothea Haider über Terror und Propaganda in den ersten Wochen der Nazi-Herrschaft
Die letzten Zeugen
Anmerkungen
Literaturauswahl
Dank
Personenregister
Vorwort
von Gerhard Jelinek
Es gibt sie noch: die letzten Zeugen. Menschen, die aus persönlichem Erleben eine oft dramatische Geschichte ihrer Zeit erzählen können. Sie sind im Wortsinn »Zeitzeugen«. Sie erinnern sich in langen Gesprächen an die Wendepunkte unserer gemeinsamen Geschichte.
Ihr Zeugnis erweckt historische Jahreszahlen zum Leben.
Sie kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten und haben die gemeinsame Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt, vielfach auch erlitten.
Österreichs Vergangenheit fällt in der Rückschau in zwei gegensätzliche Teile auseinander. Nach dem Untergang der Habsburgermonarchie bleibt das – weit überwiegend deutschsprachige – Alpengebiet des k. u. k. Staates als »Republik Deutschösterreich«. Dem französischen Politiker Georges Clemenceau wird das verächtliche Diktum »Der Rest ist Österreich« zugeschrieben. Er soll den Satz bei den Friedensverhandlungen im Pariser Vorort St. Germain gesagt haben. Er trifft jedenfalls den Kern. Von der europäischen Großmacht Österreich-Ungarn verbleiben nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gerade mal ein Achtel des Staatsgebiets und rund 6,4 Millionen Menschen in Österreich. Viele Zeitgenossen empfinden den Spruch des Siegers Clemenceau als schmerzhaft treffend. Er drückt auch die deprimierende Erkenntnis eines überwiegenden Teils der Bevölkerung aus: Was als Republik weiter existieren sollte, ist nur ein vorläufiges Konstrukt. Im Staat »Deutschösterreich« sehen fast alle Bürger der neuen Republik ihr Heil im Anschluss an ein neues, demokratisches Deutsches Reich. Wegen seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von den nun selbstständig gewordenen Kronländern geben nur wenige Österreicher ihrer neuen Heimat Überlebenschancen. Der Anschluss an das Deutsche Reich liegt nahe, er scheint die einzige Perspektive der deutschsprachigen Bevölkerung in der am Boden liegenden einstigen Habsburgermonarchie.
Der Zusammenbruch des Habsburger-Imperiums nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg scheint für die deutschsprachige Bevölkerung auf dem heutigen Staatsgebiet Österreichs das Ende zu bedeuten. Die meisten Nationen der Monarchie, die mehr als vier Jahre lang gemeinsam gegen äußere Feinde gekämpft haben, finden sich nach dem Waffenstillstand im November 1918 auf der Seite der Sieger. Sie sagen sich vom Kaiserhaus los und pochen auf das Postulat von US-Präsident Woodrow Wilson: Dieser hat im Jänner 1918 in einer Rede vor beiden Häusern des US-Kongresses ein politisches Programm für die Zeit nach dem Ende des Krieges formuliert. Das Schicksal der Monarchie wird in eineinhalb Zeilen als »Punkt Zehn« abgehandelt: »Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir geschützt und gesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden.«
Damit hat der amerikanische Präsident das »Selbstbestimmungsrecht der Völker« formuliert und so der übernationalen Monarchie im Zentrum des europäischen Kontinents den Todesstoß versetzt. Die »freieste Gelegenheit zur autonomen Entwicklung« gilt bei den Verhandlungen in St. Germain keineswegs für alle Völker. »Deutschösterreich« wird die Selbstbestimmung verwehrt. Das Land und seine Menschen werden zur Unabhängigkeit gezwungen. Ein Anschluss des Monarchie-Restes an das ebenfalls besiegte Deutschland wird untersagt. Die französischen Sieger wollen eine Gebietsvergrößerung des Deutschen Reichs nach der militärischen Niederlage verhindern. Auch die Beifügung »Deutsch« zum Namen Österreich wird verboten.
Die »letzten Zeugen« in diesem Buch erinnern sich nicht an die staatspolitischen Vorgänge, sie spüren aber noch heute – fast hundert Jahre danach – die Stimmung jener Tage: wenn sich Kaisersohn Otto (von) Habsburg an die Dunkelheit im kaiserlichen Schloss Schönbrunn erinnert, das Machtvakuum der Novembertage 1918 am Verschwinden der Gardesoldaten festmacht, oder wenn er das hoffnungslose Bemühen seines Vaters, des letzten Kaisers Karl I., zumindest ein kleines Stück Macht zu retten, als kindliches Abenteuer in den Auen rund um das kaiserliche Jagdschloss Eckartsau erlebt, ebenso die lange Zugfahrt durch Österreich ins Schweizer Exil. Am Grenzbahnhof kreuzen einander die Lebenswege der kaiserlichen Familie beim Abschied aus dem einstigen Erbland und die des Schriftstellers Stefan Zweig, der in umgekehrter Richtung aus der Schweiz ins heimatliche Wien fährt und ein anderes Land entdecken muss – »einen verstümmelten Rumpf, aus allen Adern blutend«.
Heinrich Treichl, auch er einer der »letzten Zeugen«, spürt den Empfindungen seiner großbürgerlichen Familie nach, die bei aller Kritik an den Unterlassungen des greisen Kaisers Franz Joseph I. doch stets treu zum »Hause Habsburg« stand und die jene neue Republik niemals als Heimat empfinden konnte, obwohl sie dem neuen Staat loyal zu dienen glaubte. »Das eigentliche Österreich gibt es nicht mehr.« So bringt Heinrich Treichl die Empfindungen seiner Eltern im Winter 1918 auf den Punkt.
Die Klagenfurterin Felizitas Wester verbindet den Einmarsch serbischer Freischärler in Klagenfurt mit dem Taubenfutter ihrer Großmutter. Die 102-jährige Kärntnerin hat als Kind den Widerstand der deutschsprachigen Kärntner Bevölkerung gegen die Annexionsversuche von Teilen Kärntens an das neue Königreich der Südslawen erlebt. Auch sie ist eine der letzten Zeuginnen von politischen und militärischen Ereignissen, die nur noch unscharf aus dem Nebel der Geschichte des vorigen Jahrhunderts auftauchen. Dabei hat der »Kärntner Abwehrkampf« und seine politische Instrumentalisierung über Jahrzehnte die Kärntner Politik geprägt und im Streit um die Aufstellung zweisprachiger Ortstafeln bis ins dritte Jahrtausend gewirkt.
Die persönlichen Erlebnisse einer Generation wurden tradiert und immer wieder weitergegeben. Erst heute, fast hundert Jahre nach den Geschehnissen, scheint eine nüchterne Betrachtung der Geschichte möglich.
Doch die von der Zeit verschlossenen Wunden können immer wieder aufbrechen. Tief sitzt der Stachel empfundenen Unrechts. Dorothea Haider, 95-jährige Mutter des verunglückten Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider, wurde 1918 in Südtirol geboren. Sie berichtet vom Schock, als italienische Truppen Südtirol besetzen, erzählt von ihrer Mutter, die im Ersten Weltkrieg beim Roten Kreuz im Lazarett von Bruneck Kriegsopfer gepflegt hat, und erinnert sich an den Vater, der als Regimentsarzt von Belluno nach Südtirol versetzt worden ist.
Das Ende einer Welt, der Verlust der Sicherheit, das Fehlen eines über Generationen erlernten Orientierungsrahmens macht die Generation der »letzten Zeugen« anfällig für radikale Strömungen. Dazu kommt die Umkehrung sozialer Positionen. Die Inflation macht Wohlhabende arm, spült Kriegsgewinnler nach oben. Über Generationen angesparte Vermögen zerrinnen wie Sand. Geld ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Die glänzende Metropole Wien ist verkommen. Seit Kriegsbeginn schon ist nichts neu gebaut worden, nun werden Häuser und Wohnungen nicht renoviert, verfallen private und öffentliche Einrichtungen. Ein Volk lebt von der Substanz. Die Menschen tragen abgeschabte alte Kleider. Wien wird vom Gestank des Mülls und von Fliegenschwärmen geplagt. Es gibt keine Taschentücher. Es wird gehustet, gespuckt und gerotzt.
Die Krise trifft die Proletarier in den Vorstädten, mehr noch aber den einstigen Mittelstand. Denn während die Löhne der Arbeiter, so sie Arbeit haben, an die Teuerung gekoppelt sind, verlieren die Beamtengehälter rasend an Wert. Auch die Mieten bleiben weitgehend auf Kriegsniveau und so können viele bürgerliche Familien nur durch das Untervermieten von Räumen in ihren Wohnungen überleben.
Der Jurist und spätere Bankier Treichl erlebt in der Folge die bittere, auch persönliche Niederlage seines Vaters, dessen von ihm geleitetes Bankhaus Biedermann im Strudel der Finanzkrise 1929 untergeht. Parallelen zu heutigen Krisen möge der Leser nicht ziehen. Doch: Mit der größenwahnsinnigen Expansion der einst biederen – und grundsoliden – Bodencredit-Anstalt und ihrem Scheitern verstärkt sich die schwere Depression der österreichischen Wirtschaft im weltweiten Kontext, die vom Börsenkrach an der Wallstreet ausgegangen ist. Die bankrotte »Bodencredit« muss auf massiven politischen Druck der damaligen Bundesregierung vom Bankverein der Creditanstalt, die im Mehrheitsbesitz der Familie Rothschild steht, aufgefangen werden. Die »Rothschild«-Bank mit ihren weitverzweigten Beteiligungen an den österreichischen Industrieunternehmen und ihrer starken Position in den ehemaligen Kronländern und am Balkan kann die Last nicht tragen und bricht zusammen. 1931 muss die Republik Haftungen für die Einlagen und Anleihen der Creditanstalt übernehmen. Mit einem Volumen von rund einer Milliarde Schilling beträgt diese Haftung damals fast 70 Prozent des Jahresbudgets. Österreichs Regierung ist damit praktisch handlungsunfähig und kann kaum auf die dramatische Arbeitslosigkeit reagieren. Politisch führt dieses Unvermögen zu einer weiteren Radikalisierung und Militarisierung der Gesellschaft.
Die kurzen zwanzig Jahre zwischen dem Kriegsende und dem März 1938 werden durch wenige Jahreszahlen buchstäblich gebrandmarkt.
1927 revoltieren Arbeiter gegen das Urteil im Prozess gegen die Todesschützen von Schattendorf und zünden dabei den Justizpalast an. In der burgenländischen Gemeinde Schattendorf haben sogenannte »Frontkämpfer« auf Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes gefeuert und dabei einen 34-jährigen Eisenbahner und einen achtjährigen Volksschüler getötet. Schattendorf und der Brand des Justizpalastes werden zum ersten gewalttätigen Fanal der jungen Ersten Republik. Der Arbeiterprotest lässt sich von der sozialdemokratischen Parteiführung um Otto Bauer und Karl Seitz nicht mehr kontrollieren und führt zu Gewaltaktionen, die von der Polizei mit scharfer Munition bekämpft werden. Wiens Innenstadt wird am 15. Juli Schauplatz von stundenlangen Straßenschlachten. Mehr als hundert Menschen sterben an diesem Tag. Der Justizpalast-Brand verschärft die Gegensätze zwischen den Bürgerlichen und der »Linken« im Land. Die österreichische Gesellschaft ist bis in die Grundfesten gespalten. Was die eine Seite als »friedliche Demonstration« wertet, sieht die andere Seite als das blindwütige Zerstören des Mobs. Geburt, Sozialisierung entscheiden über den historischen Standpunkt. Gewalt als Mittel der Politik ist zum Alltag geworden. Das Ende der Republik zeichnet sich knapp neun Jahre nach ihrer Gründung bereits ab.
1933 beseitigt die christlichsoziale Regierung unter Bundeskanzler Dollfuß die demokratischen Institutionen und beginnt mit der Ausschaltung der Sozialdemokratie und der Nationalsozialisten, die seit 1932 bei regionalen Wahlen Erfolge verbuchen. Für den jungen sozialdemokratischen Arbeiter Fritz Propst agiert und reagiert seine Partei in jenen Tagen zu vorsichtig, zu lasch. »Meine Freunde und ich waren schon schwer enttäuscht. Es wäre nötig gewesen, schon bei der Auflösung des Parlaments einen Generalstreik auszulösen. Damals waren die Arbeiter noch kampfbereit.« Der junge Sozialdemokrat radikalisiert sich. Er wird zum Kommunisten und will so den Faschismus bekämpfen.
Der unkoordinierte Aufstandsversuch des sozialdemokratischen Schutzbunds endet im »kalten Februar« 1934 schon nach wenigen Tagen mit einer Katastrophe. Im sogenannten »Bürgerkrieg« sterben Hunderte Österreicher: sozialdemokratische Schutzbündler, Soldaten des Bundesheeres, Polizisten und Unbeteiligte. Die Führung der Sozialdemokraten setzt sich kurz nach Beginn des Aufstandsversuchs in die Tschechische Republik ab. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nützt den blutigen Sieg der Regierung über die oppositionellen Sozialdemokraten. Er lässt Hunderte Funktionäre internieren, löst die Sozialdemokratische Partei und alle ihre Vorfeldorganisationen auf. Dollfuß will mit einem straff geführten Staatswesen nach dem Vorbild des faschistischen Italien Österreichs Unabhängigkeit gegen Nazi-Deutschland verteidigen. Das wird eine Illusion bleiben. Schon wenige Monate nach dem Februar 1934 wird Dollfuß Opfer eines nationalsozialistischen Putschversuchs. Er wird im Bundeskanzleramt von SS-Angehörigen überrascht und kaltblütig mit zwei Schüssen niedergestreckt. Die Putschisten lassen den schwer verletzten Kanzler auf einem Sofa am Ballhausplatz verbluten. Der von Deutschland aus gelenkte Umsturzversuch der Nationalsozialisten scheitert nach wenigen Tagen, obwohl von Bayern aus Bewaffnete der von den Nazis finanzierten »Österreichischen Legion« an mehreren Stellen die Grenze nach Österreich überschritten haben. In Kollerschlag kommt es zu einer Schießerei. Als Achtjähriger erlebt Franz Saxinger den Überfall: »Nach Mitternacht war ein Krawall auf der Straße. Der Vater hat die Erdöllampe angezündet und wollte rausleuchten und schauen, was da los ist. Er wurde von draußen angeschrien: ›Licht aus! In den Häusern bleiben!‹ Derweil der Vater rausgeleuchtet hat, hat er das Hakenkreuz auf einer Uniform gesehen.«
Der Umsturzversuch scheitert, auch weil Italiens Diktator Benito Mussolini vier Divisionen an der österreichisch-italienischen Grenze mobilisiert. Hitler will keinen Krieg riskieren, noch nicht. Der Reichskanzler erleidet eine peinliche Niederlage und distanziert sich rasch vom gescheiterten Putsch. Dollfuß wird von der Propaganda des Ständestaats zum »Märtyrerkanzler« stilisiert. Im März 1938 wird sich Hitler für diese Schlappe rächen und »seine Heimat« mit dem Einmarsch von deutschen Truppen an sein Großdeutsches Reich anschließen.
Während am Horizont schon die Blitze aufleuchten und das Grollen nicht zu überhören ist, wiegt sich Wiens bessere Gesellschaft im Walzertakt. Christl Schönfeldt, die spätere langjährige »Opernball-Mutter«, plaudert kurz vor ihrem Tod über seliges Erleben. »1937 war mein erster Opernball. Damals musste ich noch mit jedem Schilling rechnen, an dieses Gefühl kann ich mich noch lebhaft erinnern. Durch besonders gute Verbindungen konnten wir, meine Freunde und ich, Komiteekarten ergattern, obwohl wir gar nicht eröffnet haben. Was für ein Glück: Sie kosteten nur 5 statt 25 Schilling. So ist mir – nach Bezahlung der Garderobefrau – noch genau ein Schilling für den restlichen Abend geblieben. Aber es war wunderbar.«
Die letzten Zeugen: Sie waren dabei. Sie haben es erlebt. Sie erinnern sich.
Zu diesem Buch
»Ich bin eine hoffnungslose Österreicherin. Ich liebe meine Heimat unglaublich«, bekannte Christl Schönfeldt in unserem Gespräch mit einem entwaffnenden Lächeln.
Die Menschen, um die es in diesem Buch geht, haben eine Zeit erlebt, als die Liebe zu diesem Land, genauer gesagt zur Republik Österreich, keineswegs selbstverständlich war. Die Erste Republik, der »Rest« der Donaumonarchie, wurde von ihren Gründervätern mit der Absicht ins Leben gerufen, sie so rasch als möglich durch Vereinigung mit dem Deutschen Reich zu liquidieren. Der übermächtige Wille der Sieger verhinderte den Anschluss: Österreich musste existieren, ob es seine Bürger wollten oder nicht. Hunger, Arbeitslosigkeit, blutige Zusammenstöße und schließlich Unterdrückung der politisch Andersdenkenden prägten die kommenden 20 Jahre. Viele Bürger wandten sich immer mehr von dem ungeliebten Staat ab. Auch das bewusste Forcieren eines Österreich-Bewusstseins durch den autoritären Ständestaat als Gegenentwurf zur Nazi-Ideologie konnte daran nichts ändern. Eine eigene österreichische Identität, die die Eigenstaatlichkeit dieses kleinen Landes zur Selbstverständlichkeit gemacht hätte, konnte sich bis zum jähen Ende der unglücklichen Ersten Republik im März 1938 nicht durchsetzen. Auch damals, in den politisch unsteten Zwanziger- und Dreißigerjahren, liebten die Menschen ihre Heimat, fühlten sich mit ihrer Kultur und Tradition verbunden. Doch sie hatten völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was das Beste für die Zukunft dieses kleinen Landes wäre. Anschluss oder Eigenstaatlichkeit, Monarchie oder Republik, Ständestaat, Sozialismus oder Nationalsozialismus – jedes dieser politischen Modelle hatte seine, oft fanatischen, Anhänger. Sie alle hielten sich für die besseren Patrioten, für die besseren Demokraten, ja für die besseren Menschen. Die Gräben waren tief, wurden schließlich unüberwindlich und mündeten im Untergang eines Staates, den ohnedies – wie Hellmut Andics es formulierte – keiner wollte. All diese Entwicklungen liegen lange, über 90 Jahre, zurück. Umso erstaunter war ich, als ich im Zuge der Recherchen zu verschiedenen ORF-Dokumentationen auf Menschen gestoßen bin, die in Gesprächen die politische Lage und das Lebensgefühl jener bewegten Jahre wieder lebendig werden lassen konnten. Jedes einzelne Interview war wie das Eintauchen in eine andere, längst vergangene Welt. Ich sprach mit Adeligen und Bürgerlichen, mit alten Kommunisten und ehemaligen Nationalsozialisten, mit Großstadtmenschen und Bauern, mit Menschen aus den verschiedensten Teilen Österreichs. Sie alle haben mir ihre Geschichten erzählt und damit die Geschichte der Ersten Republik zum Leben erweckt. Die Gespräche waren so unterschiedlich wie meine Gesprächspartner selbst: heiter oder traurig, sachlich oder emotional, intellektuell oder bodenständig. Immer aber waren sie berührend, weil sie authentisch und unverstellt waren. Ich habe es als Privileg und als große Bereicherung erlebt, diese alten Menschen und ihr Leben kennenlernen zu dürfen.
Ihre Geschichte und ihre Geschichten sind Mosaiksteine, die zusammengesetzt das lebendige Bild einer vergangenen Epoche ergeben. Eingebettet ist das Erlebte und subjektiv Wiedergegebene in, so hoffe ich, objektive Anmerkungen zum jeweiligen Zeitabschnitt. Jeder Abschnitt des vorliegenden Buches beginnt mit einer erzählenden Darstellung, deren Informationen auf Gesprächsprotokollen beruhen. In kleineren Details können diese Erzählungen von den tatsächlichen Begebenheiten abweichen. Abweichende Ortsbezeichnungen in Zusammenhang mit einzelnen Zeitzeugen erklären sich aus den verschiedenen Schauplätzen der erzählenden Passagen.
Keinesfalls handelt es sich bei diesem Buch um eine umfassende zeitgeschichtliche Abhandlung über die Zeit vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zum »Anschluss«. Die Auswahl der aufgegriffenen Themen ist vielmehr den historischen Eckpunkten geschuldet, die meine Gesprächspartner aufgeworfen haben. Man kann also zu Recht einwenden, dass dieses oder jenes Ereignis, diese oder jene Perspektive fehlt. Eine allumfassende Darstellung von Ereignissen, die viele Jahre – im längsten Fall exakt hundert Jahre – zurückliegen, anhand von Zeitzeugeninterviews ist weder beabsichtigt noch möglich.
Die Geschichten, Gespräche und Gedanken dieses Buches sollen eine Epoche lebendig werden lassen, die kaum einer unserer Zeitgenossen erlebt hat: ein Streifzug durch rund 20 Jahre Zeitgeschehen, der bewusst macht, wie gut es sich im heutigen Österreich lebt.
Wien, im März 2014
Birgit Mosser-Schuöcker
1. KAPITEL
»Wir haben schon verstanden, was Krieg ist.«
Frieda Jeszenkowitsch, Berta Stimpfl, Felizitas Wester und Marko Feingold
über den Ausbruch und das Leid des Ersten Weltkrieges
1914
Frieda Jeszenkowitsch,
geboren 1909,Burgenland
»Mama«, ruft die Fünfjährige, »Mama!« Keine Reaktion. Das Mädchen lauscht angestrengt. Es ist still in der großen Wohnung. Wo ist die Mutter? Frieda nimmt ihre Lieblingspuppe, die sie gerade angezogen hat, und betritt den Korridor. Sie fürchtet sich ein wenig vor dem langen, düsteren Gang, aber sie muss die Mutter suchen. Aus dem Wohnzimmer dringt ein seltsames Geräusch, ein Schluchzen. Die hohe, weiße Türe ist geschlossen. Weint die Mutter? Ist etwas Schlimmes passiert? Frieda hat Angst. Das Schluchzen wird lauter, verzweifelter. Das kleine Mädchen muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um die Klinke zu erreichen. Dann stößt sie die Türe auf. Die Mutter sitzt beim Speisezimmertisch, vor sich die aufgeschlagene Zeitung.
»Meine Mama hat geweint und wir Kinder haben nicht verstanden, warum.« Die alte Dame kann sich noch gut an das beklemmende Gefühl von damals erinnern. Heute weiß die Rusterin, warum ihre Mutter verzweifelt war: »Sie hat geweint, weil sie die Mobilmachung in der Zeitung gelesen hat und Angst hatte vor dem, was kommt.«
»Da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen, und man wirft auf einen mit Bomben. Das ist empörend!«, fährt der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand den Bürgermeister von Sarajevo an. Kurz zuvor war eine Bombe in Richtung des Autos der Besucher geschleudert worden, Franz Ferdinand und seine Gattin blieben unverletzt. Doch das Ehepaar kann seinem Schicksal nicht entrinnen. Der Fahrer ihrer Limousine wählt die falsche Route und fährt den Thronfolger und die Herzogin von Hohenberg direkt zu ihrem Mörder. Es ist 11 Uhr vormittags, als der Schüler Gavrilo Princip auf den Mann schießt, den er für einen Tyrannen hält. Die erste Kugel trifft dessen neben ihm sitzende Frau in den Unterleib. »Sopherl, Sopherl […] stirb mir nicht! Bleibe für meine Kinder!« Dann wird auch Franz Ferdinand getroffen. Trotz hilflosen Rettungsversuchen verbluten die dreifachen Eltern.
Der 19-jährige Gavrilo Princip glaubt, für seine Heimat zu töten. »Ich bin ein jugoslawischer Nationalist mit der Vereinigung aller Jugoslawen als Ziel, mir ist es egal, in welcher Staatsform, jedoch muss er [der jugoslawische Staat; Anm.] von Österreich befreit werden«1, bekennt er bei seinem Prozess. Den Serben ereilt nicht das zu erwartende Schicksal. Aufgrund seiner Jugend wird er nicht hingerichtet. Da er zur Tatzeit noch nicht 20 Jahre alt war, kann er nach österreichischem Recht nicht zum Tod verurteilt werden. 20 Jahre Kerker sind sein Los. Angekettet vegetiert er in einer winzigen, feuchten, dunklen Zelle dahin. Am 28. April 1918 stirbt er in Theresienstadt an Knochentuberkulose. Mit einem Löffel hat er folgende Worte in die Wand seiner Gefängniszelle gekratzt: »Unsere Geister schleichen durch Wien und raunen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern.«2
Im heutigen Bosnien sind sieben Straßen nach dem Attentäter von Sarajevo benannt. Zum 100. Jahrestag des Attentats war geplant, in Belgrad zu seinen Ehren ein Denkmal, eine Statue auf der Festung Kalemegdan, zu errichten. Die Terroristen der einen sind die Helden der anderen.
Die Schüsse am 28. Juni 1914 lösen die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« aus. 15 Millionen Menschen werden dem Thronfolgerpaar in den Tod folgen. Unmittelbar nach dem Attentat deutet nichts auf die bevorstehende Apokalypse hin. In Baden bei Wien wird ein Konzert unterbrochen, der Kapellmeister berichtet vom Tod des Thronfolgers und seiner Gattin. Die Gäste sind keineswegs anhaltend irritiert, wie Stefan Zweig, der der Szene beiwohnt, in Die Welt von Gestern beschreibt: »Zwei Stunden später konnte man kein Zeichen wirklicher Trauer mehr bemerken. Die Leute plauderten und lachten, und abends spielte in den Lokalen wieder die Musik. Der Thronfolger war keineswegs beliebt gewesen.«3 Auch nicht bei seinem Onkel. »Eine höhere Macht hat jene Ordnung wieder hergestellt, die ich nicht zu erhalten vermochte«, soll der greise Kaiser das Attentat kommentiert und damit die Ehe seines Neffen mit der den Habsburgern nicht »ebenbürtigen« Gräfin Chotek gemeint haben. In jenen Sommertagen, die zwischen Krieg und Frieden entscheiden, geht es nicht um Beliebtheit oder verwandtschaftliche Zuneigung. Es geht um die Ehre, das Ansehen des Reiches.
Am 23. Juli überreicht der k. u. k. Gesandte in Belgrad das Ultimatum der Monarchie an Serbien. Es enthält Forderungen, die die serbische Regierung nicht ohne Gesichtsverlust annehmen kann. Der österreichische Außenminister hat seinen Gesandten bereits am 7. Juli wissen lassen: »Wie immer die Serben reagieren – Sie müssen die Beziehungen abbrechen und abreisen; es muss zum Krieg kommen.«4 Die Österreicher können auf die Unterstützung des Deutschen Reiches zählen. »Kaiser Franz Joseph könne sich aber darauf verlassen, dass S[eine] M[ajestät] im Einklang […] und seiner alten Freundschaft treu an der Seite Österreich-Ungarns stehen werde«5, hat der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg nach Wien telegrafiert.
Die europäischen Großmächte sind einander durch Beistandspakte verpflichtet, die Heere hochgerüstet und die Monarchen kriegswillig. Am 28. Juli 1914, dem Tag der Kriegserklärung an Serbien, verfasst der Kaiser ein Manifest, in dem er seine Entscheidung rechtfertigt. Es wird am 29. Juli in der Wiener Zeitung veröffentlicht. »An meine Völker! […] Die Umtriebe eines hasserfüllten Gegners zwingen Mich, zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen Jahren des Friedens zum Schwerte zu greifen […] Diesem unerträglichen Treiben muss Einhalt geboten, den unaufhörlichen Herausforderungen Serbiens ein Ende bereitet werden, soll die Ehre und Würde Meiner Monarchie unverletzt erhalten und ihre staatliche, wirtschaftliche und militärische Entwicklung vor beständigen Erschütterungen bewahrt bleiben […]. In dieser ernsten Stunde bin Ich Mir der ganzen Tragweite Meines Entschlusses und Meiner Verantwortung vor dem Allmächtigen voll bewusst. Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit ruhigem Gewissen betrete Ich den Weg, den die Pflicht Mir weist.«
Mit anderen Worten: Der Krieg wurde Österreich von seinen Feinden aufgezwungen. Die meisten Österreicher glauben ihrem Kaiser, der die Geschicke der Monarchie seit über 65 Jahren mit sicherer Hand leitet. Der greise Monarch ist längst zu einer Integrationsfigur Österreich-Ungarns geworden. »Gott erhalte, Gott beschütze, unsern Kaiser, unser Land«, wie es in der Hymne heißt, singen viele Menschen mit aufrichtiger Zuneigung. Für viele ist es undenkbar, dass der 84-jährige Franz Joseph eine falsche Entscheidung trifft.
Trotz des Wissens um die bestehenden Kriegsbündnisse zwischen Österreich, Deutschland und Italien auf der einen Seite und England, Frankreich und Russland auf der anderen Seite sehen an jenem Sommertag auch Intellektuelle den Flächenbrand noch nicht am Horizont.
So schreibt die Neue Freie Presse am Tag der Kriegserklärung an Serbien: »Der Weltkrieg könnte nur durch eine frevelhafte Sünde an der Menschheit entstehen. Der Krieg mit Serbien, dieses Strafurteil, das in einem fernen Winkel von Europa für eine beispiellose Herausforderung […] vollzogen werden soll, ist nichts, was die anderen Großmächte näher berühren, den Wohlstand der Völker zerstören und Jammer über die Erde verbreiten müsste.«
Doch innerhalb weniger Wochen wird aus einer lokalen Auseinandersetzung zwischen Serbien und Österreich ein Krieg, der ganz Europa überzieht. Schon am 14. August titelt die Neue Freie Presse: »Die elfte Kriegserklärung: Kriegszustand zwischen der Monarchie und England und Frankreich.« Die Reichspost weiß von einem »beispiellosen, unbeschreiblichen, dröhnenden Jubelsturm« zu berichten.
Gerade Dichter und Journalisten werden vom nationalen Taumel angesteckt und fördern durch ihre Artikel, Gedichte und Bücher die anfängliche Kriegseuphorie. Der Meraner Lokalpoet Karl Zangerle reimt unter dem Titel »28. Juli 1914!«:
Sie gossen das Maß bis zum Rande voll
Und waren auf Unfried erpicht,
Bis endlich über die Save scholl:
»Bis hierher und weiter nicht!
Stellt ihr die tückische Hetze nicht ein,
Und könnt ihr nicht redliche Nachbarn sein,
Und wenn Euch der Friede nicht frommt,
So zieht vom Leder und kommt!«6
Der Krieg bricht auch in das beschauliche Leben der Familie Jeszenkowitsch ein. Friedas Vater ist Lehrer, die Familie lebt in Rust am Neusiedlersee. Noch liegt die Weinstadt nicht im Burgenland, sondern in Ungarn. »Die Kirchengemeinde hat dem Vater eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das war ein sehr nobles katholisches Haus, ein Gutshaus.« Der Krieg macht auch vor der Kinderwelt der fünfjährigen Frieda nicht halt: »Von den anderen Kindern hat man gewusst, dass der Vater fort ist. Der Vater ist Soldat oder der große Bruder ist Soldat. Viele sind nicht mehr nach Hause gekommen.«
In der Heimat muss das Leben weitergehen. »Der Krieg war für viele Familien sehr tragisch und hat die Familienverhältnisse verändert, weil der Ernährer nicht vorhanden war oder derjenige, der die Wirtschaft geführt hat. In jedem bürgerlichen Haus waren Angestellte. Jeder hat seinen Knecht gehabt, jeder hat sein Dienstmädel gehabt. Auch die Knechte wurden eingezogen.«
Als Ersatz werden Kriegsgefangene auf die Höfe verteilt, auch daran erinnert sich die 101-Jährige noch lebhaft. »Eine Zeit lang waren in Rust russische Gefangene bei den Leuten beschäftigt, als Knechte. Sie haben in der Wirtschaft gearbeitet. Mein Großvater hat auch einen ›Iwan‹ gehabt. Die Wirtschaft ist halt behelfsmäßig geführt worden. Man hat weitergelebt, in bescheidenem Maße. Der Großteil der Menschen auf dem Land war Selbstversorger. Die Bauern haben Mehl und andere Produkte abliefern müssen. Man hat sich schon zu helfen gewusst, hat ein bisschen was zur Seite gelegt. Man hat es so eingerichtet, dass man sich etwas als Vorrat behalten hat.«
1914
Berta Stimpfl,
geboren 1911,Südtirol
Zwölf Kinder drängen sich in der Stube, aber es ist ungewöhnlich ruhig. Nur Berta und die beiden Jüngsten weinen. Auch sie verstehen schon, dass heute ein besonders trauriger Tag ist. Der Vater muss fort, fort in den Krieg. Die älteren Kinder versuchen, nicht zu zeigen, wie ihnen zumute ist. Sie wollen es dem »Tata« nicht noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Wie die Mutter, die immer stark und gefasst ist. Bald schon werden sie allein sein mit ihr und der vielen Arbeit auf dem Hof. Die Geschwister wissen, dass sie jetzt noch stärker werden mitanpacken müssen. Sie werden hart arbeiten. Alles werden sie tun, was getan werden muss. Wenn nur der Vater wieder heimkommt.
Den Abschied von ihrem Vater an einem kalten Herbstmorgen 1914 hat Berta Stimpfl ihr Leben lang nicht vergessen: »Wir waren alle traurig. Sie können sich das vorstellen, der Vater fort von uns und so viele Kinder. Er muss in den Krieg. Wir haben schon verstanden, was Krieg ist. Wir wussten nicht, ob er noch einmal kommt. Diese Sorgen hat man schon als Kind, als Kleinkind. Das wichtigste Ereignis war, dass der Vater fort war und wir alleine mit der Mutter. Die Mama ist traurig gewesen, alleine mit den vielen Kindern. Zwölf Kinder sind wir gewesen und sie musste arbeiten.«
Die Mutter versucht, den Kindern ihre Sorgen nicht zu zeigen. »Geweint hat sie nur im Stillen, nicht vor uns Kindern. Sie wollte es uns ersparen, diesen Verdruss. Aber Sie können sich vorstellen, mit so vielen Kindern, daheim, alleine. Zum Arbeiten hat man niemanden bekommen. Die Männer mussten alle in den Krieg gehen, alle waren weg von daheim.«
Innerhalb weniger Tage wird Ende Juli 1914 die Generalmobilmachung der k. u. k. Armee bis in die entlegensten Weiler spürbar. Die bürokratische Maschinerie ist gut geölt. Schon in den ersten Kriegstagen werden alle wehrfähigen Männer einberufen und in des »Kaisers Rock« gezwungen. Der Wiener Feuilletonist Raoul Auernheimer erlebt den Wandel von der Idylle zur Kriegsgesellschaft im scheinbar unendlich friedlichen Ort Altaussee im Salzkammergut. Er schreibt darüber in der Wiener Neuen Freien Presse. Sein Bericht erscheint am 1. August. Es ist der Tag der Kriegserklärung Deutschlands an das russische Zarenreich. »Viele von uns hat ja die Kriegserklärung in der Sommerfrische überrascht, in irgendeinem stillen, weltabgeschiedenen Tal, wohin sie sich zurückgezogen hatten, zurückgezogen haben glauben. Denn die Ereignisse wussten sie zu finden und machten sie zu Zeugen derselben Szenen, wenn auch in anderer Form. Die Einberufung ist eine wirkliche Einberufung; denn der Gendarm geht herum, von einem Hof zum anderen, und ruft die wehrfähigen Männer im Namen des Kaisers auf: Und wirklich ist auch der Abschied des Einberufenen von den Seinen, wirklich sind die Tränen der Frau, die angstvolle Neugier der kleinen Kinder. Die Ereignisse nehmen eine Gestalt an, und die Neuigkeiten bekommen einen Mund auf dem Lande. Dass der Krieg erklärt wäre, erfuhren wir zuerst von der Erdbeerfrau, die, von Haus zu Haus herumgehend, das weitertrug, was ihr der Gendarm gesagt hatte. Das Milchmädchen bestätigte dann leider das Gerücht … Nicht viel anders als unter den Bauern geht es unter den Sommergästen zu. Auch sie erhalten die Einberufung, auch sie reisen ab, von heute auf morgen sind sie verschwunden, und die Frau, die Kinder, die Eltern wissen in vielen Fällen ebenso wenig, wohin. In dieser Ausnahmslosigkeit liegt zugleich auch ein gewisser Trost, und wenn es etwas ist, was das Opfer der Wehrpflicht erträglicher machen kann, so ist es ihre Allgemeinheit.«
Stefan Zweig kehrt aus Belgien nach Österreich zurück und erkennt seine Heimat kaum wieder: »In jeder Station klebten die Anschläge, welche die allgemeine Mobilisation angekündigt hatten. Die Züge füllten sich mit frisch eingerückten Rekruten, Fahnen wehten. Musik dröhnte, in Wien fand ich die ganze Stadt in einem Taumel. Der erste Schreck über den Krieg […] war umgeschlagen in einen plötzlichen Enthusiasmus. […] Wie nie fühlten Tausende und Hunderttausende Menschen, was sie besser im Frieden hätten fühlen sollen: dass sie zusammengehörten […] Alle Unterschiede der Stände, der Sprachen, der Klassen, der Religionen waren überflutet für diesen einen Augenblick von dem strömenden Gefühl der Brüderlichkeit.«
Es rücken nicht nur die Männer ein, die von einem Tag auf den nächsten verschwinden, nein, auch die Pferde und die Fuhrwerke ziehen in den Krieg. Viele erinnern sich an die Stille, an das Fehlen des Hufgeklappers. Doch es muss weitergehen: Die Felder müssen bestellt, die Ernte eingebracht, die Kinder versorgt werden. Berta Stimpfl erzählt: »Die Mama ist tüchtig gewesen und die Schwestern, die erste ist 1901 geboren, die andere 1902 und der Bub 1903, haben halt schon fest anpacken müssen. Wir haben viel Arbeit gehabt, aber dafür haben wir allerweil zu essen gehabt. Gut und genug, zum Glück. Gut, was heißt gut, heute haben sie es schon viel besser. Aber man ist zufrieden gewesen damals.«
Die kleine Berta wird in eine bäuerliche Welt geboren, in der Leben und Sterben als unabänderlicher Kreislauf hingenommen werden. Die schwere Krankheit ihrer kleinen Tochter ist damals für Bertas Mutter kein Grund, das Feld unbestellt zu lassen. »Ich bin 1911 geboren, da ist ein ganz ein heißer Sommer gewesen und die ›Poppele‹7 sind viel gestorben, weil sie Krankheiten, Brechdurchfall, gekriegt haben. Wegen einem ›Poppele‹ ist auch niemand zu einem Doktor gegangen. Da sind viele gestorben und ich bin auch dem Sterben nahe gewesen. Da haben sie die Mutter gerufen, weil die Mutter ist auf dem Feld gewesen, sie soll schnell heimkommen, weil das Kind stirbt. Da haben sie ein Kerzerl angezunden, weil ein Kerzerl wird angezunden, wenn jemand stirbt. Aber das Kind ist nicht gestorben, ist heuer 102 Jahre alt geworden! Ich werde mich schon gewehrt haben, vorm Sterben.«
Die Familie hört lange Zeit nichts vom Vater. »Ich kann mich nicht erinnern, dass die Mutter Briefe bekommen hätte. Wahrscheinlich hatte er keine Möglichkeit zu schreiben. Er war ja später dann an der Dolomitenfront, hoch oben in Schnee und Eis.«
Trotz seiner Mitgliedschaft im Dreibund hatte sich Italien 1914 geweigert, an der Seite Österreichs und Deutschlands in den Krieg einzutreten. Die Begründung: Es handle sich um einen Defensivpakt, Österreich habe den Krieg aber begonnen. Noch verhielt man sich neutral, während die Entente Italien bereits mit Versprechungen umwarb. Die Westmächte lockten Italien mit Gebietsgewinnen in Südtirol und Istrien, einer alten Forderung der italienischen »Irredenta«8. Am 23. Mai 1915 tritt Italien aufseiten der Entente gegen Österreich-Ungarn in den Ersten Weltkrieg ein. Wieder wendet sich der greise Kaiser an »seine Völker«: »Der König von Italien hat mir den Krieg erklärt. Ein Treubruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt, ist von dem Königreiche Italien an seinen beiden Verbündeten begangen worden.« Eine Welle der Empörung geht durch die Monarchie. »Wut und Ekel über Italien bis zu Tränen«, schreibt Arthur Schnitzler 1915 in sein Tagebuch.9 Die Propaganda gegen »die Katzlmacher« tut ihr Bestes, den Hass zu schüren. Die Forderung nach der Brennergrenze ist, nur drei Jahre bevor sie Realität wird, unvorstellbar.