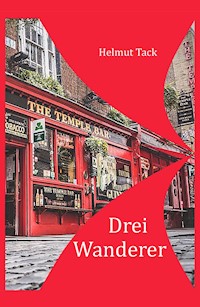Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Wirt Horst betreibt mit seiner Frau Friedel einen Gasthof. Im Laufe der Jahre haben sie sich emotional voneinander entfernt. Erst die Geschichten dreier Wanderer, führt ihnen ihr Elend vor Augen und lässt sie wieder zueinanderfinden. Die drei Wanderer Hannibal, Siegfried und Oliver versuchen, in einem Gasthaus die Zeche zu prellen, und bieten dem Wirt an, mit Geschichten zu bezahlen. Als der Wirt darauf eingeht, kommt es bei dem Wirt zu einer Wandlung und er erkennt, dass die abgekühlte Liebe zu seiner Frau noch eine Chance hat. Die mystischen Geschichten der Wanderer erzählen von Liebe, Glaube und Hoffnung. Sie weisen den Wirtsleuten den Weg zurück in eine liebevolle Beziehung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Tack
Die Liebe des Schankwirts
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Irgendwo
Im Gasthaus
Der Alte und die Bäume
Cécile
Gundula
Die Wiederkehr
Das Handycap
Die Füchsin
Angst vor der Nacht
Wenn ich leben sollte
Marko – Szene einer Jugend
Jedes Tier stirbt allein
Zuversicht
Impressum neobooks
Widmung
Ich widme dieses Buch meiner Frau Janet, die mir die
notwendige Zeit gegeben, geduldig gewartet und meine Nachtarbeit verstanden hat.
Ganz besonders danke ich ihr, dass sie beim Gegenlesen die sehr emotionalen Momente mit mir teilte.
Meinem Hund Tiffy, die als meine Muse mich beim Schreiben geduldig begleitete und mir die Tränen leckte.
Einen besonderen Gedanken widme ich meinen Töchtern Adina und Ilka, sowie meinem Sohn Leonhard.
Irgendwo
In allen Ländern der Erde gibt Orte die wenige Einwohner, jedoch eine Kirche, Friedhof und Gasthaus haben.
Die Orte tragen Namen wie Nomansend, País Tranquilo, Tikhaya Strana oder Kruddentorf.
Oft liegen sie in Distanz zu Nachbargemeinden.
Man kann gut unter sich bleiben. Vermisst nichts. Man versteht sich.
Sollte jemand aus einem anderen Ort hinzuziehen wollen, geht das nur mittels Heirat. In seltenen Fällen können Einwohner Empfehlungen aussprechen. Stammt der Zuzögling aus einer Großstadt, hat er wenig Chancen.
Den Menschen in solchen Orten geht es gut. Gut in ihren Grenzen und Möglichkeiten. Meist mit der Welt durch Radio und Fernsehen verbunden. Manchmal sogar durch Internet.
Sie leben vom Arbeiten und arbeiten am Leben. Gründen, wie überall auf dem Planeten, Familien und sorgen sich.
Die Wände der eigenen Wohnstatt sind die Grenze, an der alles daran gehindert wird, nach außen zu dringen.
Sind sie daheim, tragen sie Hausanzüge aus farbigem Gewebe. Bequem und nur für Haus und Briefkasten geeignet.
Man achtet auf weltliche oder durch den Glauben auferlegte Werte. Achtet die Einheimischen und die Honoratioren.
Sieht man den Bürgermeister, belästigt man ihn nicht mit Geringfügigem. Trifft man den Geistlichen, zieht man den Hut oder senkt das Haupt. Kommt der Arzt in den Ort, dann nur mit Sondersignal und Sirene. So ist er mit seinen Ideen fort, ehe er sie verbreiten kann, und kommt nicht sobald wieder.
Um nicht dem Verfall ausgesetzt zu sein, gehen die Menschen zum Hausarzt der Nachbargemeinde.
In den Warteräumen beteiligen sie sich nicht an Gesprächen. Worüber Interessantes sollten die Leute auch reden? Sie sind Fremde!
Am Sonntag treffen sie sich in der Kirche, beten gemeinsam für ihr Seelenheil und freuen sich über den Gottessegen.
Unter der Woche gehen sie ihrem Tagwerk nach. Die Kinder werden zu guten Menschen erzogen und genießen die unbeschwerte Kindheit.
Abends gehen die Männer ins Gasthaus. Meist für sich, selten mit anderen.
Da es kein Postamt oder Frisör gibt, unterhält man sich mit dem Gastwirt.
Dieser ist das Sprachrohr, der Multiplikator der Gemeinde.
Eine Welt, voller Menschlichkeit und distanzierter Nähe.
Im Gasthaus
Die Luft schmeckte nach einer Mischung aus Tabakrauch und Bierdunst.
Dirnen hatten ein Quartier für die Nacht erlangt.
An der Tür atmete ein Ofen seine letzte Wärme in den Raum. Von Minute zu Minute nahm die Stimmenvielfalt ab.
Der Gastraum glich einer Schwangeren, die ein Kind nach dem anderen aus ihrer Obhut, in die Rauheit der Welt verabschiedete. Sie wusste, wenn der Durst aufkäme, die Trinker überfiele und verschlänge, wären alle Vorsätze vergessen. Der tägliche Ruf ließ sie einen Weg zu ihr finden.
Der Wirt putzte seit einer Stunde dasselbe Glas. Es gelang ihm, jedwede Anstrengung zu vermeiden. Eine Brauerschürze fesselte seine Körperlichkeit. Sein von Eisbein und Wein geformtes Gesicht vermittelte Bedeutung.
›Irgendwann geht der letzte Gast‹, dachte er.
Er suchte den Raum mit den Augen ab, prüfte, ob sich etwas zwischen ihm und der ersehnten Nachtruhe drängen würde.
Er sah Männer in abgerissener und verschmutzter Kleidung, die wankend und mit trunkenem Arm winkend, in die Nacht traten.
Während er den Gastraum prüfte, blieb sein Blick an einem Tisch hängen. Keiner der drei Herren unternahm Anstalten, den Trinkern zu folgen.
In dem Moment als dem Wirt der Gedanke kam, dass es sich um Ubernachtungsgäste handele, winkte einer von ihnen und rief den Wirt an den Tisch. Mit ausladenden Hüftbewegungen seinen Gang stabilisierend, ging er hin.
»Zahlen, meine Herren?«
Die Gäste sahen ihn ungläubig an.
»Nein, wir wollen noch nicht zahlen«, erwiderte einer der drei. »Sie wirken wie jemand, der sich kein Geschäft entgehen lässt.«
Der Wirt presste die Luft in seinem Mund, dass sich die Wangen wölbten. »Ähm!«, brachte er hervor und dachte, ›Kommen die mit Anschreiben oder Abwasch, hole ich die Polizei!‹
Die sahen nicht nach Geld aus. Fleckige Kleidung, an der einen oder anderen Stelle mit groben Stichen reparieret, bedeckte ihre Körper. Schuhe, deren Sohlen längst einen Schuster nötig hatten, schützten die Füße.
Einer trug eine Nickelbrille. Die Beschichtung abgegriffen und mit Klebeband repariert, flehte sie nach ihrer Pensionierung. Ein anderer hatte fettiges Haar und einen zerrupften Bart. Die würden von ihm den Knüppel, aber nicht Kredit bekommen.
»Wenn Ihr nicht zahlen wollt, kann ich es gleich sagen. Da verstehe ich keinen Spaß.« Mit einer Bewegung machte er deutlich, was er meinte. »Erst bekommt Ihr eine Tracht Prügel und dann die Polizei.« Er grinste süffisant.
Die Ankündigung ließ den Gästen Schweiß auf die Stirn treten. Es war deutlich, dass der nicht mit sich reden ließ.
»Herr Wirt, sehen wir aus, als würden wir einen schwer arbeitenden Menschen um seinen wohlverdienten Lohn prellen?«
Der Wirt wurde unsicher. Einerseits sagt keiner einem anderen gerne ins Gesicht, dass er ihn für einen Schwindler und Betrüger hält, andererseits konnte es sein, dass sie zahlungsfähig waren. Außerdem bestand die Möglichkeit, dass sie sich zu Stammgästen entwickeln. Stammgäste bedeuten regelmäßigen Umsatz.
»Worum geht es denn?«, fragte er so desinteressiert, wie nur möglich.
»Wir streiten darüber, wer von uns die schönste Geschichte erzählen, wer die Herzen der anderen am besten rühren kann.«
Der das sagte, machte den Eindruck, als habe er schon viele Geschichten erzählt und erlebt. Das Leben hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Tiefe Furchen zogen von einer Augenbraue zur anderen. Die Augen waren schmal von der Sonne und wurden von der Stirn, mittels wuchtiger Brauen und gegen die Wangenknochen durch faltige Tränensäcke abgegrenzt.
»Und was soll ich da machen?«, wollte der Wirt wissen.
Der Gast ließ ein kaum merkliches Lächeln über sein Gesicht huschen.
»Sie brauchen sich nur zu uns zu setzen und zu urteilen.« Er machte eine umfassende Armbewegung. »Wir erzählen die Geschichten, Sie hören zu.«
Der Wirt überlegte. Eigentlich konnte nichts passieren. Die würden sich anstrengen und er hätte seinen Spaß.
»Und was soll dabei am Ende herauskommen?« Der Wanderer machte eine vielsagende Mine.
»Derjenige, der die ihrer Meinung nach beste Geschichte erzählte, bekommt die Zeche erlassen.«
›Aha!‹, dachte der Wirt. Und: ›Was solls?‹ Wanderer hatten schon zu Urzeiten das Recht, als Berichterstatter und Unterhalter zu fungieren. Dafür erhielten sie freie Kost und Unterkunft. Diesem ehernen Recht wollte er sich nicht widersetzen. Außerdem reicherten die Geschichten seinen Vorrat an und konnten in der Gemeinde kursieren.
»Gut! Falls mir aber keine der Geschichten gefällt. Was, wenn ich sogar über der Erzählung einschlafen sollte?« Der Wirt zog die wenigen Stirnfalten glatt und die Augenbrauen hoch. Sein ohnehin rosafarbener Teint färbte sich dunkler.
»Sollte das geschehen, können Sie gerne die Polizei rufen und wir werden ohne zu murren dem Amtmann folgen.«
Das war deutlich! Der Wirt ging darauf ein.
Der Wanderer mit den buschigen Augenbrauen nannte sich Hannibal. Er richtete den Oberkörper auf und rückte auf dem Stuhl herum, bis er gut saß.
Er nahm sich die Freiheit, in die Tabakdose des Wirtes zu greifen, krümelte Schnupftabak auf seinen Handrücken und sog ihn langsam und genießerisch in die Nase.
»Bestimmt kann sich jeder von Euch an einen Menschen erinnern, der alt, sehr alt war oder ist. Nun ist es bei solch alten Menschen oft so, dass sie mit den Jahren nicht mehr wissen, warum sie noch leben.« Er nieste vernehmlich und wischte die Nase mit dem Jackenärmel ab.
»Sie haben alles Erleidbare erlitten, haben alles Erlebbare erlebt. Sie haben geliebt oder gehasst, haben gelebt und sich am Leben erfreut.
Dann, am Abend ihrer Tage, wenn sich alle und alles zurückgezogen haben, sehen sie im Leben keinen Sinn mehr.«
Hannibal hob den Brustkorb und sog den Dunst des Raumes ein. Er entzündete eine Pfeife.
Der Rauch des schlecht glimmenden Tabaks biss in der Nase. Dicke Schwaden stiegen auf und sanken wie Nebel herab. Lange und ohne ein Wort zu sagen, entfachte er mehrmals die Glut. Das Saugen am Mundstück erzeugte Schmatzen.
Als es ihm gelungen war, dass die Glut hielt, trank er einen Schluck Wein, warf einen Blick auf seinen Becher. Der Wirt verstand und brachte einen gefüllten Krug.
Behäbig füllte Hannibal sein Trinkgefäß. Die Zuhörer rückten auf ihren Stühlen und starrten Hannibal an.
Er kreiste mit den Fingern über den Becherrand und dehnte die aufkommende Spannung ins schier unerträgliche.
»Tja, wie soll ich sagen. So einen Menschen kannte ich lange. Fast mein Leben lang.« Hannibal bewegte mit dem Zeigefinger die Zeiger seiner imaginären Uhr.
»Er war alt und gebrechlich. Doch seine Gebrechlichkeit bezog sich weniger auf den Körper, als auf den Willen zum Leben.
Öfter sprach er davon, dass für ihn das Leben sinnlos geworden sei, dass er sein Leben gelebt, seine Tage und Erfüllungen, seine Ängste und Freuden gehabt habe.
Da ihn die Kinder verlassen hätten, er jeden Tag allein in seinem Haus sei, die Zeit von ihm, wie spröde gewordener Schmutz abbröckelte, wolle er nicht mehr leben.
Er begriff nicht, weshalb er weiterleben sollte und andere, junge Menschen einen oftmals sinnlosen Tod sterben mussten. In tiefer Verzweiflung ging er eines Tages zu seinem Pfarrer.
’Warum Ehrwürden, warum muss ich leben?’, fragte er. ’Wozu soll ich noch da sein, wozu mich Tag um Tag über die Stunden quälen, ohne zu wissen, wofür?’
Der Geistliche war über diese Frage bestürzt. Er sagte etwas von Bestimmung und Gottes Plan. Er sagte auch etwas über das Leben. Das doch zu schön sei, um es wegzuwerfen. Der Alte solle solche Gedanken gar nicht haben. Nicht nach einem erfüllten Leben.
Der Alte hörte nur mit halbem Ohr hin.
Das alles hatte er schon einmal gelesen, es damals in der Schule im Katechismus vorgebetet bekommen. Hatte es sogar seiner sterbenden Mutter als Trost ins Ohr geflüstert, als diese im Todeskampf am Glauben zu verzweifeln drohte. Sie wollte noch leben und durfte nicht.
‘Mutter, wir wissen nicht, wozu es gut ist, aber wir müssen uns fügen’, hatte er ihr gesagt. Es war lange her, zu weit entfernt, als dass er sich seiner Worte und ihrer heilenden Wirkung erinnern konnte. Die Mutter schlief in Frieden ein.
Nun wollte er selbst gehen, für immer schlafen, doch dieses verdammte Herz in seiner Brust hämmerte unablässig. Jeden Morgen trieb es ihn aus dem Bett, rief mit jedem Schlag: ‘Steh auf!’
Er antwortete: ‘Nein!’
Er sagte es immer öfter, doch es blieb ohne Wirkung.
Einmal wollte der Alte das Schicksal zwingen. Er blieb liegen.
Als die Nachbarin an seine Tür klopfte, ihn im Bett liegend fand, sagte er: ‘Ich muss sterben!’ Er nahm es sich fest vor. Wenn er beim Sterben vergessen worden war, dann wolle er an sich erinnern. Denn, er hatte auch gelernt: ‘Gott sieht alles!’
Der würde ihn sehen, hier im Bett.
Wenn er sich anstrengen würde, hätte ER vielleicht ein Einsehen und würde sich sagen, dass er zum Leben viel zu krank und zu alt war. Dann dürfte er gehen.
Der Alte stellte sich das schön vor, wie eine wunderbare, ewig dauernde Wanderung. Wie in seiner Kindheit, als er mit dem Vater durch die sonntäglichen Wälder zog, rechts und links des Weges den Farn mit einer Gerte peitschend.
Am Ende des Weges würde ein Licht sein, so groß, dass es alles zu verschlingen drohte. Er würde hineingehen, würde selbst Licht werden.«
Hannibal machte eine Pause. Seine Pfeife war erkaltet und der Wein warm geworden. Er trank den sauren Rebensaft in einem Zug und fingerte in der Hosentasche nach einem Zündholz.
Beim Saugen am Mundstück entstand wieder das schmatzende Geräusch, das der Schwäche seiner Lippen geschuldet war.
Auch seine Zuhörer nutzten die Pause zu derlei Dingen.
Der eine trank und rülpste wie ein Landsknecht, der andere reinigte seine vergilbten Zähne mit einem abgebrochenen Zündholz. Nur der Wirt saß still und konnte es kaum erwarten, bis es weiterging.
»Und was war nun mit dem Alten?«
Hannibal sagte nichts. Einer seiner Kumpane wandte sich an den Wirt.
»Eine gute Geschichte will überlegt sein, Herr Wirt.
Wie ein guter Wein braucht sie Pausen, um zu reifen.« Er tippte an den Weinbecher. »Und wie bei einem guten Mahl muss man sich zwischendurch den Nachgeschmack wegspülen, um das Aroma der gesprochenen Sätze nicht mit in die weitere Erzählung hineinzunehmen.«
Der Wirt schwieg betreten.
»Entschuldigt bitte die Ungeduld.«
Hannibal hatte sich ausreichend gestärkt und mischte sich ein.
»Warum streitet Ihr? Es ist für mich Lob, wenn sich der Wirt und Schiedsrichter nicht beherrschen kann.«
Seine Freunde wandten sich gegen ihn.
»Was soll das heißen? Du willst den Wirt beeinflussen. Er wird nicht unbefangen urteilen können, wenn Du ihm so um den Bart gehst.«
Hannibal unternahm alles, zu glätten, was sich zur Flut erhob.
»Das liegt mir fern Freunde. Ich will ein gerechtes Urteil. Deshalb werde ich weiter berichten.«
Er sog noch einmal an der Pfeife und verbreitete ihren unangenehmen Dunst.
Der Alte und die Bäume
Wie gesagt, er hatte keine Lust mehr am Leben, hatte den Genuss verloren. Doch er durfte nicht sterben. Irgendetwas hinderte ihn daran, sich aus dem Leben zu stehlen. Was wollte er noch im Sein, wenn es kein Dasein war! In einer dieser Phasen besuchte ich ihn.
Er saß in einem tiefen Sessel vor seinem Haus. Sonne strich über seinen Körper. Eine Pose, so irreal wie tanzende Moorlichter.
Die Haare ungekämmt, die Haut von mangelnder Pflege gegilbt. Auf seinem Gesicht lag eine Anspannung, wie man sie von Schwerstarbeitern kennt, nachdem sie ihr Tagewerk beendet hatten. Alles an ihm war eine Mischung aus Spannung und Entspannung.
Ohne ein Wort zu sagen, setzte ich mich dazu. Während ich dasaß, hatte ich den Eindruck, ich könne seine Gedanken knistern hören.
Er hatte mein Kommen nicht bemerkt. War von seinen Gedankengängen so weit entrückt, dass er die reale Welt nicht wahrnahm.
Nach einer Stunde des Wartens hatte ich den Mut, ihn anzusprechen. Es konnte etwas Ungewöhnliches passiert sein. Er konnte krank geworden, am Verzweifeln sein und Hilfe brauchen. Aber wie kann man einem Menschen helfen, wenn man nicht weiß, was ihn bedrückt.
»Alter, was ist los? Du bist so still?«, fragte ich. Erst da sah er mich an. Sein Blick war voller Fragen. Alles an ihm suchte nach Antworten.
Wenn Ihr jemals einen Menschen so gesehen habt, werdet Ihr wissen, was ich meine. Das vergisst man sein Leben lang nicht!
Der Alte war gebrochen.
Mit einem Zittern, das seinen ganzen Körper schüttelte, lehnte er sich an mich und weinte.
Bittere Tränen rannen über seine Wangen und durchnässten meine Jacke. Ich hatte das Gefühl, als würden sie erst den Stoff, dann meine Haut verbrennen. Als die Nässe meine Haut benetzte, seine Tränen selbst die letzte Stofffaser meiner Jacke durchdrungen hatten, erfasste mich tiefes Mitleid.
Dieser Alte zeugte vier Kinder. Hatte sie mit seiner Hände Arbeit versorgt, sich, wie er sagte, für sie abgeschunden. Trotz dem war er allein, als er sie brauchte.
Seine Frau war schon seit einigen Jahren tot und die Kinder fanden ein leichteres Auskommen. Einmal im Jahr, wenn überhaupt, kamen sie mit ihren Kindern.
Er kannte die kleinen Geister kaum. Sie nannten ihn Onkel. Als er mir das erzählte, wandte ich ein:
»Deine Kinder müssen ihnen doch gesagt haben, wer Du bist.«
Der Alte hatte nur mit den Schultern gezuckt.
»Ach die!«, raunte er, »Die haben andere Sorgen. Zum Beispiel, wie sie das neue Auto bezahlen.«
Die Bitterkeit seiner Worte war nicht zu überhören, obwohl er darüber lachte. Nun weinte er sich aus.
Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, erlebte ich ein offenes Gefühl bei ihm. Als er seine Tränen getrocknet hatte, sah er mich mit leerem Blick an.
»Mein Sohn, der Peter, Du weißt!«, er wies auf das Bild des Sohnes an der Wand. »Mein Sohn ist tot!« Er starrte in die Tiefe des Hofes. Schwieg!
Die erwarteten Tränen blieben aus. Er sah mich seltsam an. Ich wollte ihm irgendetwas sagen. Wollte ihm sagen, wie leid es mir tut, ihm mein Mitgefühl ausdrücken. Es ging nicht. Die Worte blieben mir im Halse stecken, waren dort gleichsam angewachsen.
Dieser Mann hatte vieles erlebt, selbst in seiner Verlassenheit darauf gehofft, den Hof an seinen einzigen Sohn weitergeben zu können. Genau wie er ihn von seinem Vater erhalten hatte. Mit dem Tod des Erben traten Leere und Sinnlosigkeit in sein langes Leben. Das ließ mich schweigen.
Was konnte diesen Mann trösten? Wohl bloß die eigene Erlösung. Was war für ihn Erlösung? Wie sollte seine Seele geheilt, wie Sorgen und Verzweiflung von ihm genommen werden? Ich war hilflos und konnte ihm nur über die Schulter streichen.
»Das ist so schade!«, war alles, was ich noch sagen konnte, »So bedauerlich!«
Er nickte stumm.
Wir saßen den Nachmittag vor dem Haus. Keiner sagte dem anderen etwas Belangloses. Nur sitzen und denken, denken und erinnern, erinnern und in sich hineinreden, war alles, was wir konnten. Worte der Trauer zogen Bahnen in meinem Hirn und ließen keinen Platz für andere.
Unter anderen Umständen hätte ich sie ausgesprochen, in der selbsttrügerischen Hoffnung, etwas Kluges zu sagen. Doch in der allgegenwärtigen Beklommenheit wagte ich es nicht. Alles Tiefgründige verlor an Gewicht. Erfahrungen wurden unsinnig. Jedes Wort entbehrte Kraft, ehe es gedacht war. Es dunkelte früh an diesem Tag. Der Alte kommentierte das mit den Worten: »Gott verhängt seine Fenster vor meinem Leid.«
Die Zweifel des Alten, die Bitternis seiner Tage schwangen in diesen Worten mit. Wir gingen zu Bett.
Ich konnte lange nicht einschlafen. Dachte darüber nach, ob ich, der ungebunden jeden Tag durch das Land zog, tatsächlich freier war als der Alte. Trieb mich nicht die Angst, solches Elend zu erleiden? Oft hatte ich mich nach einem Heim, einer Familie gesehnt. Hatte mein Dasein als Wanderer verflucht. Doch in dieser Nacht bestätigte sich meine Lebensphilosophie.
Zugegebenermaßen war ich in meiner Freiheit Zwängen unterworfen, lief aber wenigstens nicht Gefahr, wie der Alte eines Tages zu zerbrechen. Keine Frau erwartete, kein Kind verlangte. Meine Sorge galt mir und meinen Augenblicken.
Der Alte schlief schlecht. Stundenlang hörte ich sein Bett knarren. Hörte Stöhnen und Rufe nach dem Sohn. Jeder schnitt mir ein Stück aus der Seele. Gegen Morgen schlief er ein. Die Last des Tages hatte ihn eingeholt und gab ihm den notwendigen Schlaf. Als wäre sein Schnarchen für mich das erlösende Signal, schlief ich auch ein.
Am Morgen erwachte ich kurz und vernahm aus der kleinen Küche geschäftiges Treiben.
Er war schon aufgestanden, hatte seinen Rhythmus wiedergefunden. Mit diesem Gedanken schlief ich erneut ein.
Als ich gegen Mittag erwachte, hörte ich nichts mehr. Über dem Haus des Alten lag eine Stille, als hätte man ein Tuch darüber geworfen. Beunruhigt stand ich auf.
Der Alte war weg!
Überall im Haus, auf dem Anwesen suchte ich ihn und fand nur eingedrückte Blecheimer mit Korn und darin pickendes Federvieh. Er war verschwunden, ohne einen Hinweis auf seinen Aufenthalt zu hinterlassen.
Unter solchen Umständen konnte ich nicht weiterziehen.
Es vergingen zwei Abende und zwei Morgen, der Alte blieb aus. Das machte mich unruhig.
War er so verzweifelt, dass ich mit allem rechnen musste? Einen Tag wollte ich noch warten. Einen Tag mir einreden, dass ich das alles nur träumte. Ich nahm mir vor, danach meine Wanderung fortzusetzen. Vier Tage waren genug.
Am letzten Tag erwachte ich und hörte aus der Küche die bekannten Geräusche. Ohne mich lange zu besinnen, stand ich auf und ging zu dem Alten.
Mein erster Gedanke war, seine Abwesenheit war eine Fantasie. Doch ein Blick auf den Kalender belehrte mich eines Besseren.
Im Gegensatz zum Tag seines Verschwindens wirkte er völlig entspannt. Mit Ruhe und Bedacht verrichtete er jeden Handgriff. Der Moment machte sein Gesicht schön. In den Jahren unserer Freundschaft hatte ich ihn nie so erlebt.
Er bereitete das Frühstück, als hätte er das schon immer für uns getan. Deckte den Tisch und wies mit seiner knochigen Hand auf einen Stuhl. Für jede Lampe eine große Aufkleberuhr alles Leben
»Setz Dich, mein Junge, und lass uns essen«, war alles, was er sagte.
Ich setzte mich, obwohl mir die Anrede seltsam vorkam.
In seiner Stimme schwang keine Bitterkeit. Da waren Wärme und Hoffnung, wie sie nur ein winterliches Kaminfeuer verbreiten kann.
Wir aßen und ich bemerkte bei ihm ungewohnten Appetit.
›Was ist mit ihm los?‹, dachte ich. Warum auf einmal dieser Sinneswandel? Hatte ich alles geträumt? Auch die Nachricht vom Tod seines Sohnes?
Er ließ mir meine Zweifel, vielleicht bemerkte er sie nicht einmal.
Als die Sonne sich anschickte, ihren höchsten Punkt zu erreichen, kam für ihn der Moment, mich in sein Geheimnis einzuweihen.
Hannibal machte eine Pause. Nicht ohne vorher die Wurzel gründlich zu reinigen, stopfte sich eine neue Pfeife. Mit tiefen Zügen inhalierte er den ersten Rauch.
Mit jedem Zug wurde sein Gesicht verklärter, als gewinne er Abstand zu der Geschichte, als verarbeite er die Geschehnisse. Sogar die Falten auf seiner Stirn glätteten sich.
Der Rauch verteilte sich über die Zuhörer und hielt sie wie eine wärmende Decke zusammen.
Hannibal rührte mit einem Strohhalm im Glas.
Als würde er im entstehenden Strudel seine Worte wiederfinden, setzte er fort.
Wir saßen vor dem Haus und die Sonne taute die Gedanken des Alten auf.
»Du wirst Dich gefragt haben, wo ich in den letzten Tagen war. Vielleicht hast Du Angst um mich gehabt, Dich vielleicht sogar nach mir gesehnt. Ich weiß es nicht. Aber ich war nicht allein. Ich war, Du wirst über mich lachen oder mich für verrückt halten, ich war bei GOTT.«
Er beobachtete meine Reaktion mit einem Seitenblick. Ich muss zugeben, dass bei mir Sorge um seinen Geisteszustand aufkam.
»Wie? Du warst bei Gott.«
Der Alte setzte ein wissendes Lächeln auf. Wisst ihr, so wie Lehrer es haben, wenn sie eine Frage stellen und die richtige Antwort kennen.
»Du verstehst mich vielleicht nicht. Ich habe es Dir auch nicht richtig gesagt.« Er fuchtelte mit den faltigen Händen.
»Ähm … nicht ich war bei Gott, ER war bei mir.« Ein Lächeln zog seinen Mund glatt.
»Nicht wieder was Falsches denken. Ich hab‘ ihn nicht gesehen, nicht gehört, wie ich Dich höre und sehe. Doch ER hat zu mir gesprochen.«
Ich wollte, dass er sein Wissen mit mir teile. Was hatte der Alte erlebt, was war ihm widerfahren? Ich fragte ihn frei heraus.
Der Alte nahm meine Hand in die seinen und machte ein geheimnisvolles Gesicht.
»Als Du vor ein paar Tagen kamst und ich Dir von meinem neuerlichen Unglück erzählte, konnte ich lange nicht einschlafen. Immer wieder drängte es mich herauszufinden, weshalb ich so geprüft werde.«
Er wies mit dem Finger in den leeren Raum.
»Meine Kinder haben sich von mir zurückgezogen. Meine Frau ist schon lange tot, mein Hof, ja mein ganzes Leben hat an Sinn verloren.
Oft habe ich im Gebet gefragt, warum ich als Einziger weiterleben muss.« Er tupfte sich mit einem verwaschenen Taschentuch die Augen.
»Es gab keine Antwort, sondern neue Prüfungen und Qualen. Jeder Tag, den ich leben musste, war für mich ein weiteres Elend. Oft habe ich mir gewünscht, das Haus breche über mir zusammen.« Dabei machte er eine ausladende Bewegung mit den Armen in Richtung Decke.
»Nichts dergleichen geschah, keine Ruhe, keine Erlösung für mich.
In den vergangenen Jahren war mein Dasein nur darauf gerichtet, für meinen Sohn den Hof zu erhalten. Nun ist alles umsonst. Als ich die Nachricht erhielt, hatte ich den letzten Sinn meines Lebens verloren.«
›Sag es!‹, schrie es in mir.
»Ich gebe zu«, fuhr er fort, »ich hatte vor, mich aus dem Leben zu stehlen. Hatte einen Strick mitgenommen.« Mit einer flinken Bewegung um den Hals unterstrich er seine Worte.
»Doch zuvor wollte ich Antworten, wollte von IHM hören, warum er mich quälte.« Er wies mit der Stirn in Richtung des Kruzifixes über der Tür.
»Ich ging in den Wald. Ging tief hinein, immer in der Absicht, eine Stelle zu finden, an der ich sicher vor Entdeckung wäre.«
Der Alte trank einen Schluck des frisch gebrühten Kaffees.
»Die Zweige hingen zunehmend tiefer, der Weg wurde mühsamer. Nichts hielt mich auf! Der Farn schnitt mir in die Finger, ich ging weiter. Wenn ich Geräusche hörte, hoffte ich, es sei irgendein wildes Tier, das mich anfallen und töten werde.
So gelangte ich an eine Stelle, von der ich keine Ahnung hatte.«
Er blickte mich Antwort heischend an, ohne eine zu verlangen.
»Du weißt doch, dass ich den Wald wie meine Westentasche kenne. Und doch hatte ich noch nie zu dieser Stelle gefunden.«
Der Alte machte ein Gesicht, als würde er über die ewige Belehrbarkeit des Menschen sprechen.
»Die Stelle war wunderschön.« Er strich mit der Hand durch die Luft, als würde er ein Bettdeck glatt streichen.
»Das Gras des Waldbodens schmiegte sich schmeichelnd an meine Füße. Die Stämme der Bäume sahen aus, wie auf einem Zeichenbrett entworfen, so perfekt waren sie. In den Ästen der Tannen hingen Zapfen, dass es jedes Eichkaterherz erfreut. Große, schuppige Gebilde voller Nahrung. In der Luft war ein Flirren, schön wie eine träumerische Melodie.«
Ein zufriedenes Lächeln huschte über sein Gesicht. Er griff nach einer Flasche mit Wasser und trank. Spülte den Rest Not in die Eingeweide.
»Ich ging wie betrunken durch das Waldstück, bis ich eine Lichtung erreichte.
Sie war mit Moos bedeckt, mit einer so satten Farbe, dass sogar mir das Wasser im Mund zusammenlief.
Ja, dachte ich, das ist der richtige Platz, um aus dem Leben zu gehen, an dem wird sogar das Sterben zur Freude.«
Sein Gesicht erhellte sich, als hätte er die Letzte aller Weisheiten erfahren.
»Mitten auf der Lichtung standen zwei Pappeln. Beide gleich groß, doch die eine schien sehr alt zu sein. Ihre Blätter waren dunkler, die Rinde von tiefen Furchen durchzogen.
Als ich zu ihrem Wipfel hinaufblickte, sah ich, dass sie hier und da kahle Stellen zeigte. Sie war alt, doch unendlich schön.«
Wieder erhob er seinen Arm, wies zur Zimmerdecke und darüber hinaus.
»Die kaum zehn Meter davon entfernt stehende Schwester war ebenso schön, jedoch von einem frischen Grün.
Ihre Blätter breiteten sich wie unzählige Fächer über alles Leben unter ihr. Strebte stolz aufgerichtet, mit glatter ebenmäßiger Rinde in die Höhe.
Es stand das junge Leben neben dem alten, verbrauchten. Ich fragte mich, was das bedeuten sollte.« Er runzelte fragend die Stirn.
»Die alte Pappel hatte ihre Aufgabe erfüllt und würde von einem Förster bald zum Fällen freigegeben werden. Welchen Nutzen sollte sie noch haben, alt und gebrechlich, wie sie war? Ich setzte mich zwischen die beiden Bäume. Meine Hände fanden zusammen und ich betete.«
Er faltete tatsächlich die Hände, senkte das Büßerhaupt.
»Ich betete darum, zu erfahren, wozu ich noch da war. Bat darum, zu wissen, warum eine Prüfung nach der anderen mich ereilte. Weshalb ich keine Erlösung von dem Elend fand. So saß ich einen Tag und eine Nacht, saß und schickte meine Fragen zu IHM. Nichts tat sich!«
Enttäuschung machte sich auf seinem Gesicht breit und deckte das Lächeln, wie eine frische Schneedecke zu.
»Als ich lange genug gewartet hatte, ohne eine Antwort zu finden, stand ich auf und ging zu einer der Kiefern am Rande der Lichtung.
Es kostete mich Mühe, den Baum zu erklimmen. Mich mit einer Hand zu halten und das Seil mit der anderen zu befestigen.
Als ich es geschafft hatte und die Schlinge formte, hörte ich ein berstendes Geräusch hinter mir. Dem Bersten folgte ein Pfeifen und im selben Augenblick glaubte ich, ein schmerzerfülltes Stöhnen zu hören. Ich drehte mich um und sah, dass eine der Pappeln umgestürzt war.
Das nahm ich nur nebenher wahr! Dann sah ich, dass nicht der alte, verbrauchte der beiden Bäume zu Boden gestürzt war. Nein! Es war die frische, die junge Pappel.
Das interessierte mich sehr.«
Faszination ließ mich weder den Blick, noch das Ohr von ihm wenden.
»Jeder Mensch weiß wohl, wie hart das Holz dieses Gewächses ist. Warum brach eine junge, grünende Pappel zusammen?
Ich ließ mich von meinem Hochstand heruntergleiten und ging zum gerade gestorbenen Baum.«
Ein Lächeln erhellte sein Gesicht, von dem nur er wusste, was es zu bedeuten hatte.
»An der gestürzten Pappel angekommen, bemerkte ich zunächst nichts Ungewöhnliches. Jedoch, als ich mir den kaum über den Boden hinausragenden Stumpf ansah, stellte ich die Ursache für den frühen Tod fest.
Der Stamm war ausgehöhlt, hatte im Inneren die ungesunde Farbe verschimmelter Pilze angenommen. Von dem fauligen Geruch, der dieser Ruine entströmte, wurde mir übel.« Der Alte rümpfte die Nase. Wedelte vor seinem Gesicht herum.
»Es stank ekelerregend. Ich wusste nicht, dass Holz so riechen kann.
Der Baum war trotz seiner äußerlichen Erscheinung schon lange dem Tode geweiht. Hätte bald seine Blätter verloren. Wäre ein langsames trauriges Ende gestorben.« Er nickte heftig in meine Richtung.
»Ja, ich glaube, dass Bäume sterben. Und wenn schon nicht sie, dann doch die Tiere, die den Baum als Nahrung und Unterschlupf brauchen.
Bei diesem Gedanken blickte ich zu dem alten Baum. Was ich sah, ließ mich alle Antworten finden, die ich Jahre suchte.
Am Fuß der alten Pappel tummelte sich allerlei Getier, suchte Schutz und Nahrung. Dieser Baum hatte seine Daseinsberechtigung, war noch mit Sinn im Leben.«
Das Lächeln des Alten wechselte in den Zustand tiefer Erkenntnis. Solche Erkenntnis, wie sie nur ein im Glauben ruhender Mensch haben kann.
Ihr habt alle schon einmal ein Bild Buddhas gesehen. Ein solches Lächeln meine ich.
»Während der andere nurmehr Hülle war, die über sein Leiden hinwegtäuschte, war dieser ganz auf die bedacht, die ihn brauchten, verschwendete seine Kräfte nicht an eine leere, zerfressene Hülle. Ich stand auf und ging aus dem Wald.« Er sank in sich zusammen, als wäre er bei etwas ertappt worden.
»Ich war keine fünf Minuten gewandert, da fiel mir ein, dass ich meinen Strick hatte hängenlassen. Also ging ich zurück, um ihn zu holen. Ich wollte ihn wiederhaben.
Nicht, weil ich ihn nicht entbehren kann, nein, er sollte mir Erinnerung sein, wenn ich wieder verzweifele. Und hol es der Teufel. Ich fand die Lichtung nicht mehr.“
Erstaunen formte sein Gesicht.
»Obwohl ich meinen Spuren folgte, blieb sie unauffindbar. An der Stelle, wo sie noch zehn Minuten zuvor war, fand ich nur Unterholz und Gestrüpp.
Ich begriff alles und ging leichten Herzens nach Hause.«
Der Alte trank seinen inzwischen kalt gewordenen Kaffee mit einem Zug aus. Wischte sich den Mund mit dem Taschentuch.
»Unterwegs überfiel mich die Sorge um Dich. Ich schämte mich dafür, dass ich Dich geängstigt hatte. Es muss für Dich schlimm gewesen sein und es tut mir aufrichtig leid.«
Ich verstand nicht, was der Alte mir mit der Geschichte sagen wollte.
»Aber was hat denn die Pappel mit Deinem Leben zu tun?«
Der Alte wurde ganz still. Er drehte sein von Falten durchfurchtes Gesicht mir zu und einen Augenblick lang glaubte ich, meinen Vater in ihm wiederzuerkennen.
»Genau das: Ein Leben hat solange Berechtigung, wie es auch nur eine einzige Aufgabe hat. Selbst wenn uns diese nichtig erscheint, für einen anderen hat sie vielleicht allumfassende Bedeutung.«
Er hob belehrend den Zeigefinger.
»Solange ein Mensch auch nur einen Gedanken an ein anderes Wesen hegt, ist diese Aufgabe erfüllt.
Genau das hat ER mir damit gesagt. Nun habe ich Ruhe!«
Ich verstand ihn.
Sein Sohn kümmerte sich seit Jahren um keinen Menschen mehr, hatte jedes Quäntchen Menschlichkeit und Mitgefühl verloren. Seine Krankheit hat dem nur ein Ende bereitet.
Die Frau des Alten war jahrelang auf den Tod krank. Doch sie hatte trotzdem die Sorge um den Hof und die Familie mit dem Alten geteilt. Erst als sie nichts mehr von dem mitbekam, was um sie und mit ihr geschah, starb sie.
Der Alte hatte zumindest durch meine unregelmäßigen Besuche eine Erfüllung seiner Tage. Wenn er den Hof schon nicht mehr für seinen Sohn erhalten konnte, so doch wenigstens dafür, dass wir es gemütlich hatten, wenn ich kam.«