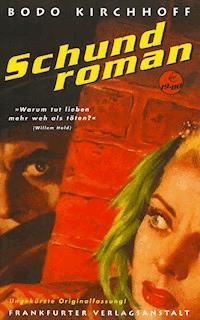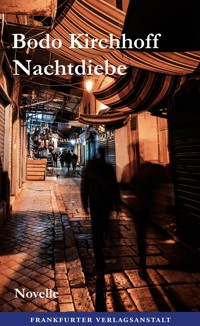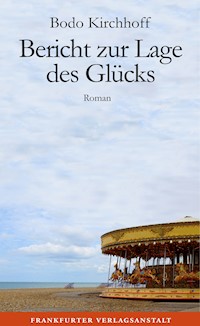Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2012 Ein Eheroman, Ein Sehnsuchtsroman, eine Lebensroman: Vila und Renz, beide fürs Fernsehen tätig, sind ein Paar im Takt der Zeit mit erwachsener Tochter, Wohnung in Frankfurt und Sommerhaus in Italien - alles so weit gut, wäre da nicht die unstillbare Sehnsucht nach Liebe: die einzige schwere Krankheit, mit der man alt werden kann, sogar gemeinsam. Noch aber sind Vila und Renz nicht alt, auch wenn sie erfahren, dass sie Großeltern werden. Sie stehen voll im Leben, nach außen erfolgreich und nach innen ein Paar, das viel voneinander weiß, aber nicht zu viel. Ein ausbalancierter Zustand; bis zu dem Augenblick, in dem Vila mit ungeahnter Intensität einen anderen zu lieben beginnt. Bodo Kirchhoff erzählt in seinem neuen großen Lebensroman von einer langen Ehe als ewiger Glückssuche, von frühem Missbrauch als späterer Weltverengung und einem lebenslänglichen, nur im Stillen erfüllten Verlangen. Im Zentrum aber steht die Liebe zwischen Vila, einer Frau in festen Verhältnissen, und dem Einzelgänger Bühl, Biograph eines Paars aus einer vergangenen, gottesfürchtigen Epoche. Nach seinen beiden erfolgreichen, weltumspannenden Romanen INFANTA (1990) und PARLANDO (2001) erzählt Bodo Kirchhoff von drei welterschließenden Liebesgeschichten und einer weltverengenden enttäuschten Jugendfreundschaft: Die Liebe in groben Zügen ist ein großartiges, souverän und stilsicher erzähltes Panorama einer Ehe als Lebensprojekt in einer Zeit, die den Moment verherrlicht. Und wenn es einen Höhepunkt in der Ehe gibt, erkennt Vila am Ende, dann besteht er in deren Dauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1039
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bodo Kirchhoff
DIE LIEBE INGROBEN ZÜGEN
Roman
für Ulli hinter allen Worten
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Impressum
Über den Autor
O gioia, gioia, gioia …C’era ancora gioiain quest’assurda nottepreparata per noi?
O Freude, Freude, Freude …War da noch Freudein dieser unsinnigen Nacht,die uns bereitet war?
(Pier Paolo Pasolini)
I
SEHNSUCHT nach Liebe ist die einzige schwere Krankheit, mit der man alt werden kann, sogar gemeinsam. Und ihre Erfüllung? Ist alles und nichts, ein Ewig bis auf weiteres; Details pfeifen seit jeher die Spatzen vom Dach. Aber welches Liebesglück ist schon originell, und welches Sehnen hat nicht etwas von einem Gedicht, das die Zeiten überdauert? Es gibt kein modernes Unglück, es gibt nur das alte Lied.
Zwei Paare, getrennt durch ganze Epochen, zweimal das alte Lied: Franz und Klara, das Jahr zwölfhundertsechsundzwanzig, er halbblind und singend, den Spatzen nah, sie sein betender Schatten – Verrückte aus heutiger Sicht, der des anderen Paars: Vila und Renz, erwachsene Tochter, Wohnung in Frankfurt, Haus in Italien, beide im Takt unserer Zeit. Und als Bogen zwischen den Epochen ein Mann auf den Spuren des Franz von Assisi, Vilas unverhoffte Liebe, nach einem Zwischenfall auf und davon; seine erste Nachricht an sie, eine lange Mail ohne Anrede: Die Geschichte von Franz und Klara, vorletzter Akt. Ein Tag im umbrischen Juni, aus den Ölbäumen die Hysterie der Zikaden, an- und abschwellend mit jähen Pausen, in der Stille nur noch Franz’ und Klaras Atem, er mit Blättern auf den Augen gegen die Sonne. Klara hat ihren Arm angeboten, aber er will den Arm nicht. Wie lange kennen wir einander? Eine Frage, die ihn selbst überrascht auf dem Weg zu einer Hütte, die seine Brüder für ihn vorbereitet haben, zwischen dem Geäst Erde und Laub, damit kein Licht eindringt. Viele Jahre, antwortet sie und nimmt jetzt seinen Arm. Es geht steil abwärts durch Eichenwald, und Franz läßt sich führen, zum ersten Mal auf all seinen Wegen von Schwesterhand – er könnte kaum sagen, wie oft er über den Apennin ist, wie oft durch die Ebene um Mantua oder die Sümpfe vor Rom. Er schaute die Dämmerungen und schwarzen Nächte, er war Hüter der schlafenden Vögel und seines Leibs: den rieb er sich winters mit Schnee ab und tauchte ihn sommers in Schmelzwasser, daß ihm die Hitze darin in Wellen verging. Der Sommer ist schön, aber eine Frau. Und noch immer Klaras Hand, die ihn hält, bis sie die Hütte im Topino-Tal erreichen. Franz legt sich auf ein Lager am Boden, Haut und Knochen zu Blättern und Zweigen. Geh jetzt, sagt er, aber die Schwester der Schwestern bleibt, kniend in ihrer Kutte, die Hände vor dem Hals gefaltet. Keine betet so anmutig, Altissimu onnipotente bon Signore, seine Worte aus ihrem Mund. Er ahnt das helle Gesicht, hell wie das Haar, das er ihr vor langer Zeit abnahm. Was du einem Bruder gestattet hast, gestatte auch mir, hält sie ihm vor. Und was habe ich einem Bruder gestattet? Franz bedeckt das Gesicht mit den Händen, jeder Lichtstrahl ein Splitter in den Augen. Erst vorigen Monat haben Ärzte in Siena mit heißer Klinge das Narbige darin aufzulösen versucht, vier Brüder mußten ihn halten, am Ende schrie er zum Höchsten. Klara nimmt seine Hand, nur gehen sie jetzt keinen steilen Weg mehr, und er sagt, es sei ihm arg, wie sie ihn halte. Sie sei wie die Ärzte, nur mit heißer Hand! Aber das läßt sie nicht gelten. Erinnere dich, was du in Siena einem der Brüder gesagt hast: Ich will, daß du heimlich eine Zither besorgst, um meinen Bruder Leib, der voller Schmerzen ist, zu trösten. Das vermag ich ohne Zither! Klara reibt seine Finger. Um ihn ist Sommer, und er friert. Als sie sich zuletzt im Sommer sahen, bei Peschiera, da war sie die Kranke, geschwächt vom Fasten, er der mahnende Besucher: auch der Leib sei ein Geschöpf. Und dann erzählte er von einer Wanderung um das Kleine Meer, wie der Benacus-See bei den Römern hieß, von jungen Frauen, die sich dem Orden anschließen wollten, bereit, ihm ihr Haar zu geben, sich vor ihn zu werfen, damit er es abschneide, und Klara konnte nicht weghören, wie er die Hand nicht wegziehen kann. Wie lange kennen wir einander, fragt er erneut, obwohl er es weiß: Palmsonntag vor fünfzehn Jahren, er half ihr, aus einem der Adelstürme in der Oberstadt zu fliehen, sie beide verkleidet, Magd und Knecht, nachts die Feier für die Neue im Kreis der Brüder. Und zwei Jahre später schon ihr Streit um die Leitung von San Damiano. Klara war zwanzig und wollte noch keine Oberin sein, aber ihr Wille war nie sein Himmelreich. Sie will ja auch, daß er sich an die eigenen Worte erinnert, wie Pica, die Mutter, als sie ihn gepflegt hat nach seiner Kerkerhaft: Erinnere dich deiner Ritterträume, deiner Reden! Alle Frauen wünschen das Horchen nach innen, aber keine wie Klara. Kniend im Dunkel der Hütte, lenkt sie ihn auf den Tag, an dem er, auf ihren Wunsch, ihr Verlangen, Karren und Esel besorgt hat, nur für sie beide: damit sie hinfahren könnten, wo niemand sie stört. Kein Wort mehr von früher, sagt Franz, nichts von uns! Er fährt ihr über den Mund; es reicht, daß sie die Dunkelheit mit ihm teilt. Sie beide sind ein Kästlein, das besser zubleibt.
Das Gold des Schweigens, ein alter Männerglauben (in einer Mail nach alter Rechtschreibung); ganz anders dagegen Vila, wenn sie zu Renz sagt: Stell dir vor, wir beide wüssten plötzlich alles vom anderen, wir könnten uns nur auf der Stelle trennen! Einer ihrer Lieblingssätze nach einem Essen für Freunde beim Aufräumen der Küche und dem Glas zu viel; sie mit ihren zweiundfünfzig zieht die Wahrheitskarte, er, der um einiges Ältere, kommt ihr mit Gedankenspielen: Wenn wir alles voneinander wüssten, und nichts würde einen treffen, wie langweilig wäre der andere dann! Renz spricht sich für den Schrecken ohne Ende aus, kann sich aber im Schrecken einrichten. Sie vertritt das Radikale: alles auf den Tisch und aus, hängt nur am Tisch selbst. Beide kennen sich seit Ewigkeiten, ihre eigenen Worte. Vila wurde schwanger, und man blieb zusammen, gleich um Geld bemüht. Er, anfangs Filmkritiker, geht zu Drehbüchern für Vorabendserien über, sie, irgendwie beim Fernsehen, PR-Arbeit, schafft den Sprung in ein Kulturmagazin, Mitternachtstipps. Da ist Katrin, die Tochter, schon in der Schule, ein Haus am größten See Italiens (dem Kleinen Meer) zur Hälfte bezahlt, und sie wohnen in der häuslichsten Ecke Frankfurts, ruhige Straßen, nach Malern benannt, schöne Altbauten, hohe Bäume, das nahe Mainufer und seine Museen; nah auch die lebhafte Schweizer Straße, ihre Lokale, ihre Läden. Dazu ein Kreis von Freunden wie komponiert, besonnene Paare mit ein, zwei Kindern, Ärzte, Therapeutinnen, Medienleute, Gründer kleiner innovativer Firmen – gemeinsame Abende, gemeinsame Urlaube, ein Leben, für das es kein Ende zu geben scheint.
Alles, was uns zerstören kann, existiert bereits, sagt Renz gern, wenn er beim Aufräumen der Küche weitertrinkt. Der Mensch, den wir mehr lieben werden, als er uns liebt, die Wahrheit, die einen fertigmacht, das Messer, in das wir rennen – Sprüche, die erst ins Gewicht fallen, nachdem Renz die Geschichte von Franz und Klara gehört hat. Der Verfasser: ein beurlaubter Lehrer, Latein und Ethik, von Vila in ihr Leben geholt, als sie und Renz längst ein erfahrenes Paar waren, aber noch nicht das Paar, das zu viel voneinander weiß.
*
II
VILA und Renz, das Paar, das noch nicht zu viel voneinander weiß, die beiden nachts auf ihrem Boot, einer alten Sea Ray mit Kabine unter dem Bug und Polstern im offenen Rückteil. Eine Fahrt bei leichtem Regen, die letzte in dem Jahr, Ende ihres Sommers am Kleinen Meer zwischen Trentiner Alpen und Veroneser Land mit dem Haus an der Ostseite über der Ortschaft Torri; schräg gegenüber, an der Bucht von Salò, haben sie zu Abend gegessen, jetzt sind sie auf dem Heimweg. Noch einmal ihr weiter See, den sie selten beim Namen nennen, seine Uferlichter im Süden kaum zu erkennen, nur ein Flimmern. Und auch noch einmal beide allein auf ihrem Boot, ja allein auf dem Wasser, kein anderes Blinken weit und breit in der feuchtkühlen Nacht Ende September, sie schon mit Pullover, er noch im Hemd. Und dann bricht jäher Wind den See auf, aus herangedrückter Front ein stürzender Regen, Sterne und Lichter, eben noch funkelnd, verschwinden. Vila presst die Fäuste in den Sitz, während Renz mit aller Motorkraft, einem Acht-Zylinder-Mercury, den Kurs hält, mal mit den Böen, mal dagegen. Wellen heben das Boot und lassen es fallen, hart über den Untiefen an der einstigen Gletscherkante, die vor der Insel verläuft, der See dort an manchen Stellen nur knietief. Renz durchfährt die schmale Passage, irgendwann hat er hier nicht aufgepasst, sich eine Schraube ruiniert, ein Tag im Juli, aber welches Jahr? Seit Katrin aus dem Haus ist, kaum noch auftaucht, verschwimmt alles: wie oft schon diese Überquerung nach Abenden auf der anderen Seite, in Gargnano, in Gardone, in Salò. In warmen Nächten, wenn der See ganz ruhig ist, halten sie in der Mitte – die weite Fläche, ihr nahes All, sommersüchtig lassen sie sich treiben. Es gibt kein festgelegtes Alter für solche Stunden. Und der Schlaf in den warmen Nächten, traumzerfurcht; bei Renz oft das Bild des entleerten Sees, eines tiefen moosdunklen Spalts, bei ihr das Bild, darin als Liebende zu ertrinken. Morgens fühlen sich dann beide erledigt, alt, auch wenn sie Föten sind, verglichen mit dem See, seinen Jahren, seiner Größe – bei Dunst im Süden uferlos, im Norden dagegen die Berge eng, ein Fjord, urzeitlich schroffe Wände, senkrecht über jadegrünem Wasser, atemlos still in der Mittagszeit. Und abends die Angler, die auf Sardinen aus sind, klein, silbrig, schmackhaft, Beweis, dass hier früher ein Meer war, lange vor den Menschen, vor ihrer Sehnsucht.
Renz zeigt in Fahrtrichtung, man sieht schon wieder Lichter, das gewohnte Ufer, die Kirche von Torri, der Hafen, das Kastell; der Regen endet einfach, der Wind flaut ab. Wir werden zu schwach für das Boot, ruft Vila und lacht, ein kleines unbefreites Lachen, die immer noch prahlerisch schönen Lippen kaum geöffnet. Noch taucht sie alle zwei Wochen, immer am späten Sonntagabend, mit ihren Mitternachtstipps auf, und vor jedem Beitrag, den sie anmoderiert, auch ihrem eigenen, das kleine unbefreite Lachen, als genierte sie sich, zu so vorgerückter Stunde noch in alle möglichen Schlafzimmer mit Fernseher zu platzen. Jede Moderation ein Schleier aus Worten, über sich selbst geworfen, und in den Sommerwochen dazwischen, zu zweit an ihrem See, wenn die Freunde ausbleiben und auch die Tochter sonst wo ist, sagt sie oft nur das Nötigste, Bring eine Zeitung mit, wenn du Brot holst, Mach das Gartentor zu, Wir hören gar nichts mehr von Katrin, wieso nicht, Renz? Schon immer hat sie ihn beim Nachnamen genannt, zärtlich rau – sein Bernhard klang ihr zu bieder, zu dumm –, und im Gegenzug schuf er aus ihrem ganzen Namen, Verena Wieland, die Vila, die sie von da an war. Bis auf weiteres, Vila und Renz!, Schlussformel ihrer Mails an Bekannte und Freunde; Paare, die zu viel unter sich sind, bekommen etwas von alten Indianern – Großer Mund und Graues Auge, so könnte sie heißen, könnte er heißen. Erste Bojen tauchen auf, dunkle Köpfe über dem Wasser, der See ist in Ufernähe schon wieder ruhig, das Boot gleitet im Leerlauf, ab und zu ein Klatschen, wenn Fische nach Mücken geschnappt haben und ins Wasser zurückfallen; die besten Seefische sind die Aale, man fängt sie mit lebenden Stichlingen, den Haken durch den Leib gezogen. Die spüren das, soll Katrin als Kind gesagt haben – ein Vilasatz, den Renz nicht bestätigen will. Seine Boje ist schwer zu sehen im Dunkeln, nur durch das gelbe Schlauchboot, das an ihr hängt. An den Nachbarbojen die Jollen der Einheimischen, die alte Heureka, die Agnese, die Carmen, ihre Besitzer wohnen auf demselben Hang mit Blick über den See bis zur Insel vor der Bucht von Salò, zur Hälfte noch Olivenhang, früher von armen Bauern bewohnt, noch früher von verdienten römischen Legionären, denen etwas Land am Lacus Benacus zugeteilt worden war. Irgendwann wird alles hier den Chinesen gehören, meint Vila, nichts wird mehr an uns erinnern. In der Dunkelheit das Klacken des Karabiners, die gute alte Sea Ray ist festgemacht, man muss sie nur noch abdecken. Ein stummes Arbeiten, sie kennen die Griffe. Die Polster in der Kabine sind nass, sagt Vila, in ihrer Stimme ein leiser Triumph, die Fahrt war Renz’ Idee, obwohl es nach Regen aussah. Sie wischt die Polster mit einem Handtuch ab, dem großen blauen Edelhandtuch von Elfi und Lutz, ein Geschenk zu ihrem Fünfzigsten: besser als alle Polster. Wann hatten sie sich zuletzt in der Kabine geliebt, in der Mittagsstille vor San Vigilio, im zitternden Licht bei einer von Katrins CDs, für Renz heruntergeladen, damit er seine alten Songs an Bord hätte. Ein paar der Selbstgebrannten haben schon Schäden, Lieder verflüchtigen sich, ganze Refrains fehlen; die funkelnden Scheiben hängen jetzt über der Plane und schrecken die Möwen ab. Vila wirft Renz den Zündschlüssel zu, Du hast ihn schon neulich vergessen!, noch ein kleiner Triumph: Er hätte ihn auch wieder fast vergessen. Danach das Lösen des Schlauchboots von der Boje – das wäre besser gleich beim Festmachen getan worden, so muss Renz noch einmal an der Bootskante entlang, es wird immer schwerer, die Balance zu halten. Zuletzt das Abstellen des Stroms, das Schließen der Persenning, durch einen Stab in der Mitte erhöht, damit sich kein Regenwasser sammelt. Vila steigt in das kleine Boot, ihr Hintern wird nass, sie schimpft, während Renz zum Ufer übersetzt; am Wasser ein Pärchen, nur zwei glimmende Zigaretten. Zwischen den Glutpunkten ein Flüstern, das sie aufhorchen lässt – Liebende setzen ihr zu, ob im Film oder im Leben, immer. Renz trägt schon das Schlauchboot zur Straße, wo ihr alter Jeep steht, sie vertäuen es wie eh und je auf dem Dach. Dann die Fahrt in den Ort und hinter der Ampel den Hang hinauf in den steilen gewundenen Hohlweg; aus der Dunkelheit das Zirpen einer Zikade wie ein vergeblicher Notruf. Und als sie auf das Haus zufahren, nichts als Stille, nun schon seit vierzehn, fünfzehn Jahren, Vila hat längst aufgehört, die Jahre zu zählen, sie weiß auch, wann: nach Kaspers Tod – er könnte immer noch dem Jeep entgegenstürmen, jaulend vor Glück, als seien sie tagelang fort gewesen, ihr aller Geschöpf ohne Nachfolger. Das Gartentor steht halb offen, Du hast es nicht zugemacht, sagt sie. Renz hält auf dem Rasen, der gemäht werden müsste, sie heben das Boot vom Dach; früher hätte der Bewegungsmelder das Außenlicht angeschaltet, irgendwann ist er kaputtgegangen. Renz schließt das Tor, sie geht schon ins Haus, im unteren Wohnraum brennt Licht, sie hatte es angelassen, sie will nicht ins Dunkle treten, es reicht, wenn unter den Sohlen die Fliesen knacken, wo sie gebrochen sind. Sie öffnet die Terrassentür; über dem Pool eine späte Fledermaus, ihre lautlosen Stürze. Es ist warm auf der Terrasse, der Sommer sitzt noch im Stein. Vila streift sich die Kleidung herunter, sie geht nackt ins Bad, an der Wand eine Springspinne, die schlüpfen im August, sie ruft nach Renz, knapp und laut sein Name, er kennt das: ein Schreckenstierchen, und Vilas Ruf, als hätte er es ins Haus gebeten – überall an den Wänden die kleinen Kammerjägerspuren; er macht das nicht gern, aber er macht es. Nach dem Erschlagen der Spinne das Sitzen auf der Terrasse, zwischen ihnen die Flasche vom Vorabend. Nachts trinken sie nur Rotwein, eher süß als herb, im Moment einen Amarone, schwer und betäubend; Weißwein dagegen wie ein Wasser auf den Mühlen alter Wunden. Willst du Musik? Vila, nur ein Handtuch um die Schultern, geht in den Wohnraum, sie bückt sich zur Anlage, Renz, in Pyjamahosen, sieht ihr zu; beide haben sich bequemere Formen gegönnt, bei ihr schmiegen sie sich um die Knochen – ihr helles Becken, immer noch anziehend, die lichten Kniekehlen, die Fesseln. Wären wir lieber hiergeblieben, ruft sie. Es war abzusehen mit dem Regen! Noch ein Nachtreten, das gehört dazu. Renz hebt nur eine Hand und lässt sie fallen, er nimmt sein Glas, Vila legt Scarlatti auf, ebenfalls absehbar, sie setzt sich wieder, das Glas in der Hand. Auf der anderen Seeseite die vertrauten Lichter, der Blick, seit sie das Haus haben. Vila trinkt in kleinen Schlucken, im Schoß jetzt das Telefon; Katrin lässt seit zwei Wochen nichts von sich hören, ihr letzter Anruf aus Yucatán, Mexiko, immer ist sie woanders, schon als Kind rief sie plötzlich aus Hanau an, war bei Freunden. Jetzt also Yucatán, Mexiko. Und was machst du da?, die normale Frage. Antwort: Ich sehe mich um! Eine Doktorandin, die gern reist, so weit normal bei Ethnologie, wenn sie nicht immer Geld nachschießen müssten, um Katrins Reisen abzufedern, Geld, das sie beide beim Fernsehen verdienen, Renz mit Vorabendzeug: sein eigenes Wort dafür. Vila leert ihr Glas, eine Hand auf der Brust über dem Herzen, den Daumen in Bewegung. Sie streichelt sich, in den Augen etwas, das Renz beunruhigt – bis heute weiß er nicht, warum sie weint, wenn in einem Film die Dinge zwischen zwei Leuten das erhoffte Ende nehmen. Katrin wird es schon gutgehen, sagt er, und Vila hebt die leere Flasche, Holst du noch eine von oben? Sie trinken zu viel, wenn sie allein sind, es gibt immer Gründe.
Die Treppe zum ersten Stock hat kein Geländer, da hatten sie damals gesagt, wozu, und nun tastet er manchmal schon nach der Wand, darin filigrane Risse wie Greisenfalten: eine tektonisch unruhige Gegend, nichts Beängstigendes – nichts gegen das Beben von Assisi, das sie miterlebt haben –, nur immer wieder kleine Erschütterungen, die ihre Spuren hinterlassen, auch durch abgeplatzte Mosaike im Pool. Mit einem weißen cremigen Gips kann man sie neu verfugen, wenn das Becken leer ist, ein mühsames Verfahren, er hat es aufgegeben, und beide schwimmen sie über immer abstrakteren Mustern, wo der Estrich zum Vorschein kommt; nur Oliven und Regenwürmer fischt er noch vom Grund. In den ersten Jahren hatte Vila die Oliven geerntet, jeden November lieferte sie acht Säcke in einer Genossenschaft ab, und am Ende hatten sie zwei Flaschen eigenes Öl, sämig und hell. Renz bringt einen Terre Brune nach unten. Jeder noch ein Glas, sagt Vila, in ihrem Schoß jetzt ein Buch. Die letzten Tage am See sind ruhig, sie liest und schreibt Mails, er feilt an seinen Vorabendhelden oder streicht etwas nach; die alten Malereimer stehen noch im Schuppen, in jedem ein Rest unter staubiger Haut. Die Hausfarbe, ein erschöpftes Sienarot, bläht sich an vielen Stellen, stößt man dagegen, fällt sie ab. Die Wände in den Bädern sind feucht, unter den Fliesen im Wohnraum nisten die Ameisen, zwei, drei Grissini-Krümel, und schon sind sie da. Man gewöhnt sich daran, sagt Renz zu Besuchern, man gewöhnt sich an alles Getier, sogar Vila an die Springspinnen! Das Haus lebt und sie beide mit; wenn es im Winter verlassen war, fallen an Ostern poröse Käfer aus den Vorhängen, nur Räuber überstehen die düsteren Monate: Vor der warmen Jahreszeit siedeln sie die Skorpione um, die unter Türrahmen ausgeharrt haben. Auf einem Blech tragen sie die gekrümmten, wie toten Wesen an den Rand des Gartens. Das Grundstück ist terrassiert, es gibt einen unteren, ungenutzten wilden Bereich voller Geraschel; im Vorjahr defilierten allabendlich zwei Ratten auf der Brüstung über dem Unkrautwäldchen, in diesem Sommer hat sich eine schwarze Schlange hervorgewagt und auf dem Rasen plötzlich aufgerichtet, ein kaum zu glaubendes Bild. Nur Renz hat die Schlange gesehen, nicht Vila: Sie hält die Geschichte für eine Erfindung, ein Märchen. Dafür hat sie einen Molch am Poolrand entdeckt, erschreckend wie eine Fledermaus, die starr auf dem Boden liegt. Als Katrin noch harmlos war, noch nicht das elterliche Leben kommentierend, hatte sich eine Fledermaus in ihr Zimmer verirrt, bei dem Versuch, sie nach draußen zu jagen, traf Renz sie mit dem Besen, sie fiel zu Boden und überschlug sich, die geäderten Flügel gespreizt, ein langsamer Tod, keiner konnte das zuckende Etwas erlösen. Und noch im selben Jahr der erste Einbruch, Katrins neue Halskette war morgens weg, seltene Tränen, die Renz trocknen durfte. Albaner, hieß es im Ort, aber es waren zwei hungrige Einheimische, Tage später gefasst, leider ohne Kette; sie hatten sogar den Kühlschrank geöffnet und sämtlichen Käse, den Parmaschinken und eine Trüffelsalami gegessen, während die drei Bewohner, Vater, Mutter, Kind, in den oberen Räumen schliefen. Danach die Anschaffung der Bewegungsmelder, die jetzt kaputt sind. Renz hätte sie ausgetauscht, aber in diesem Winter werden sie einen Hausbewohner und also auch Bewacher haben, zum ersten Mal in all den Jahren, einen alleinstehenden Mann aus Frankfurt, beurlaubter Lehrer nach Brandreden gegen die Dummheit seiner Schüler und Kollegen, einer, der das Haus mieten will, um an einem Buch über Franz von Assisi zu schreiben. Er war in Vilas Sendung, so hatte es sich ergeben – für die Mitternachtstipps ein Lichtblick, aber auch nicht ihre Rettung tief in der Nacht zum Montag. Und für ihn, Renz, ein kurioser Mensch, wenn nicht komischer Heiliger; sie hatten bisher nur telefoniert. Machen wir Schluss, sagt Vila, und sie leeren die Gläser, ein guter Wein, flüssige Erde. Sie gehen ins Haus mit all den brennenden Lampen, schließen die Türen; Stromkosten werden abgebucht, auch die für Wasser und Gas, Telefon und Internet. Der Gärtner wird bar bezahlt, schwarz wie die Handwerker, es gibt keine Rechnungen, keine Belege, es gibt nur Ausgaben. Das Haus frisst uns, sagt Renz, und dabei hängt er an jedem Stein und heißt alles gut, auch wenn es schädlich ist oder stört. Er mag den Efeu um die Bäume, den Telefonmast am Nachbarzaun, den erstickenden August, das Gartenchaos nach Gewittern, sogar die Ameisen auf der Treppe, ihre Straße in den oberen Stock. Er weicht ihnen aus beim Hinaufgehen, seine Hände suchen das Geländer, das es nicht gibt. Renz geht ins Bad und macht kein Licht, er mag sich nicht sehen, Bootsfahrten machen alt, bleigrau um die Augen, der Rest krankhaft gebräunt, die Lippen wie die Haut auf trockenen Trauben. Er klappt den Klodeckel hoch und danach wieder herunter, er will keinen Unfrieden; nachts benützt Vila das obere Bad, sonst geht sie ins größere unten. Er hat auch das kleinere Schlafzimmer und will dort nur weg sein, wie sie in ihren Kissen. Gute Nacht! Den ganzen Sommer über rufen sie es fast gleichzeitig, Parole ihrer Verflüchtigung, danach das Abtauchen. Von seinem Bett aus, bei geöffneten Läden, der Blick auf den nächtlichen Ort, die Kirche, den alten Uhrturm, die Zypressen im Straßenlicht; an der Wand längs des Bettes eine Tischbein-Zeichnung, einsames Land, hingeworfen mit ein paar Strichen. Die übrigen Bilder im Haus aus der Gegend, immer wieder der See, seine Weite, sein Glanz; am Morgen hängt manchmal eins schief, wenn nachts unmerklich die Erde gebebt hat, und Vila betrachtet es als Ausdruck von Leben, an den man nicht rühren darf, wie an den wuchernden Jasmin, der schon die Laube erdrückt mit seinen Trieben. Renz ruft ihren Namen, sie hat nicht geantwortet auf sein Gutenacht, sie ist noch unten im alten Kinderzimmer, wo sie ihre Mails liest, immer die letzte Tagestat mit Lesebrille, in der Hoffnung, dass sich Katrin gemeldet hätte. Und rascher als sonst das Löschen aller Lichter, der Widerschein auf den Olivenblättchen vor seinem Balkon verschwindet. Dann Vilas Schritt die Treppe hinauf, auch rascher als sonst, und ihre sonst so ruhige, moderierende Stimme seltsam hastig, Renz? Sie tritt ins Zimmer, barfuß, nackt: die Gestalt, die ihm am vertrautesten ist, seine Frau. Was denn, fragt er, als sie sich schon herunterbeugt, die Arme schützend über den Brüsten. Eine Nachricht von Katrin – die Worte fast geflüstert, während sie sich zu ihm legt –, unsere Tochter ist schwanger, hörst du?
Und Renz hörte es mit jeder Faser, es drang in ihn ein, als Schnitt durch die Zeit: auf der einen Seite die Jahre davor, sein Leben als Vater, auf der anderen alles, was jetzt noch käme, wie damals, als Vila Wir bekommen ein Kind! rief. Und sie hatte auch etwas von damals, als sie seinen Kopf an sich zog, die Hände in sein Haar grub, als sei es noch dicht, von der Frau, die in allem jünger war als er selbst, nicht so sehr an Jahren, an Wünschen – vor ihm ihr blasser Bauch, darin die Narbe eines Kaiserschnitts. Wie schön, sagte er nur, den Mund schon an ihrem mythischen Spalt.
JETZT noch ein Kind, ist dir klar, was das heißt? Renz’ erste Worte, als Vila vor Jahren, acht oder neun, und da musste sie schon nachdenken, beim Frühstück fast verlegen nach seiner Hand griff, nachdem sie gesagt hatte, es sei ein Wunder passiert. Und ihr war klar, was das hieß: noch einmal solche Erschöpfung, auch ein so erschöpfendes Glück, dass alles andere keinen Platz mehr hätte, einschließlich der Mitternachtstipps, die in Planung waren. Stattdessen das Beruhigen nachts, das Auf-und-ab-Gehen, der geteilte Halbschlaf, ja die geteilte Milch aus der Flasche und das geschwächte Verlangen nach Wein, nach Fisch, nach allem Gewohnten; nur noch das Kind und sein Geruch, sein Klammern, der kleine warme Leib wie ein Gewächs an ihrer Brust: auch für sie zu viel. Sie war dreiundvierzig und wies das Geschenk zurück, ein eisiger Märztag, Bagdad wurde gerade mit Bomben belegt, Beginn der Rache für nine/eleven, eine doppelte Kerbe in den Jahren, den Sommern, die schon verschwammen, und im Herbst hatte sie ihre erste Sendung – der Grad des Glücks oder Unglücks bestimmt den Lauf der Erinnerungen unbestechlicher als die Zeit: Das war die Nacht, in der ich gefeiert wurde, das der Tag, an dem ich ein Leben geopfert habe. Mit Erinnerungen ist nicht zu handeln, man kann ihnen nur den Rücken kehren, vor dem Umriss des eigenen Lebens die Augen zumachen, sich ganz dem Jetzt hingeben.
Vila – im Dauerpräsens ihres Sommerlebens am See, bis zu der Mail, dass sie und Renz Großeltern würden – saß am anderen Morgen allein auf der Terrasse, ein milder später Septembertag; sie schrieb an einer Liste der zu beachtenden Dinge in Haus und Garten, einer schriftlichen Hilfe für den künftigen Mieter, Für Kristian Bühl, wie über den einzelnen Punkten in kursiver Schrift stand. Er hatte angerufen, als sie sich Tee machte, gefragt, ob er etwas mitbringen sollte aus Frankfurt, er sei gerade im Woolworth auf der Schweizer Straße, Druckerpapier oder eine bestimmte Zahnpasta?, und sie nur: Nein, sehr lieb. Keine besonders gelungene Antwort, aber das ging ihr erst auf, als sie das Telefon weglegte. Sie schrieb weiter an der Liste, bis Renz von oben kam, sich Tee einschenkte, ihn mit Honig süßte, nicht mit Zucker, so hielten sie es. Wer hat angerufen? Seine übliche Frage, und sie sagte es ihm, er rührte den Honig um. Was macht der im Woolworth, oder ist er unten bei den Lebensmitteln? Aber was muss er noch einkaufen, wenn er morgen hier ist. Also hängt er nur herum, blättert in Zeitschriften, ja? Renz trank einen Schluck. Weiß Katrin schon, was es wird? Er setzte die Tasse ab, Vila stand auf – Das ist keiner, der in Zeitschriften blättert, der kauft sich eine Zahnbürste, Stifte, Papier –, sie nahm die Liste und ging damit zur Heizungstherme, wo es am meisten zu beachten gab. Es wird ein Junge, rief sie, was genauso eine Vermutung war wie die Vermutungen über den Mieter. Vila und Renz also bei Spekulationen, Renz auch bei eigenen. Er erwartete Besuch von einer Producerin, die er seit Jahren flüchtig kannte, erst als Redakteurin im Bayerischen Fernsehen, da war sie noch verheiratet, dann als Producerin bei Hermes Film, wo er schon das eine und andere untergebracht hatte. Inzwischen war sie selbstständig und wollte ihn als Co-Autor für eine Serie. Oder wollte überhaupt Kontakt mit ihm, seine Nähe. Renz machte sich Gedanken um eine Frau: zu anziehend, um seit Jahren allein zu sein; Vila machte sich Gedanken um einen Mann, viel zu sehr in seiner Welt, um in einem Kaufhaus in Zeitschriften zu blättern.
Was er auch nicht tat – der künftige Mieter war auf der Suche nach einem Koffer, um die Schulter eine Notebooktasche und in den Händen je eine große gefüllte Plastiktasche mit Kleidung und Schuhen für die Zeit in Italien, zusammengestellt aus seiner eingelagerten Habe. Er sah sich jeden Koffer an, ob die Dinge ihren Platz hätten, und den ersten geeigneten kaufte er und verstaute Kleidung und Schuhe darin. Ein Allerweltskoffer mit Rollen, den er über die Schweizer Straße zog, zum U-Bahn-Zugang vor seinem langjährigen Wohnhaus, unten eine Parfümerie, die ihre Gerüche nach oben schickte, bis zu den zweieinhalb Zimmern, die er am Morgen endgültig geräumt hatte. Bühl nahm die U-Bahn zum Bahnhof und bestieg einen Zug nach Freiburg, Breisgau, um das Grab seiner Eltern zu besuchen, beide im Frühjahr durch einen Autounfall ums Leben gekommen; erst am nächsten Tag die Weiterreise über Mailand nach Verona und von dort an den großen See.
Eine schnelle Fahrt Richtung Süden, Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg, die Landschaft zusehends weicher, fließende Höhenzüge, Waldpolster, Wiesen – Abbild der Erinnerungen an seine Jugendsommer, das Verfließen der Tage, der Wochen in einem Schwarzwaldtal, er und ein Freund, der ihn oft im Sommer besucht hatte, einen anderen Freund gab es nicht, außerhalb der Ferien teilten sie ein Internatszimmer – keine Fahrt in diese Gegend ohne das Bild eines Jungen mit runder Brille und glatt zurückgekämmtem Haar, auf jedem Hemd seine Initialen, CKS, Cornelius Kilian-Siedenburg, ein Name wie ein furchtbares Versprechen, immer der Erste zu sein, niemals der Zweite. In der Mittelstufe organisierte er die Feste der Oberstufe und verdiente daran, über Nacht wurde er Schulsprecher; seine geheimen Mängel: Latein und Deutsch. Der Zug bremste ab, der neue Koffer kam ins Rollen – Freiburg, das Münster, ewig mit Gerüst, ein behindertes Bauwerk. Bühl nahm sich ein Taxi und ließ sich ins Dreisamtal fahren, bis vor die Kirche von Zartenbach, Ort seiner Kindheit, auf dem Friedhof Rauchverbot. Er zog den Koffer bis zum Elterngrab, um auf dem Stein die Namen zu sehen, ihre Vereintheit, Rita Bühl, geb. Steiert, Rupert Bühl, Kaufmann, eher separiert als vereint, wenig bewegend, und er verließ den Friedhof wieder, die Kofferrädchen knirschend im Kies. Bühl ging zum einstigen Vorhanggeschäft des Vaters, heute Bistro, und auch dort wenig Bewegendes, aber ein innerer Friedensschluss: die nachgeholte Verbeugung am Grab. Rupert Bühl hatte immerhin die Thai-Seide in die Gegend geholt, ein Kaufmannsfuchs, der häufig nach Bangkok geflogen war. Und Rita Bühl, vom Leben mit Vorhangstoffen nicht ausgefüllt, war eine Größe im regionalen Kulturleben gewesen, dazu in den Ferien nett zu seinem Freund, der auch im Laden ein und aus ging, sogar geschäftlichen Rat erteilte; der eine durchschaute schon Steuerdinge, ganz Kilian-Siedenburg, und er durchschaute die lateinische Grammatik. Sie hatten sich gegenseitig bewundert, er das Geschmeidige an dem Freund, Cornelius das Strikte an ihm, eine Art Liebe, die Art, die nach außen verblasst, wenn Lebenswege auseinandergehen, aber unter dem Blassen noch glüht wie das Innere der Erde unter der Kruste. Bühl rief sich ein Taxi, eines vom Taxidienst Wunderle, den gab es noch immer in Zartenbach, als sei dort alles totzukriegen, nur nicht die Namen, ihr alter Klang. Er ließ sich nach Freiburg zurückfahren und nahm im Intercity-Hotel am Bahnhof ein Einzelzimmer, letzte Enge vor der Weite des Südens, dem anderen Licht: die alte arkadische Hoffnung, noch weit von sich gewiesen, als ihm Vila, vor seiner Zusage, sich in dem Haus einzumieten, damit kam: Sie werden dort aufblühen, so, wie schon viele vor Ihnen! Und er nur: Was erzählen Sie da.
Ein Vorgespräch im Museumspark, wo auch gedreht werden sollte, so waren sie über Franz von Assisi und dessen Aufenthalte in Norditalien auf das Haus am See gekommen, und auf einmal (aus Vilas Instinkt für Leute, aus denen etwas herauszuholen war) das Angebot: Wenn er dort in Ruhe arbeiten wollte, dann könne er es im Winter gerne haben, für wenig Geld und etwas Gartenpflege. Wollen Sie? Und er wollte; es war der Reisegutschein, der ihn aus Frankfurt wegbrachte, weg von seinen gelangweilten Schülern und stumpfsinnigen Kollegen am Hölderlin, wo er ohnehin keine große Zukunft hatte nach seinen sonntäglichen Brandreden im Park.
Vila hatte von den Auftritten gehört, sie kannte Frauen mit Kindern am Hölderlin, und gleich am folgenden Sonntag war sie in den Park gegangen und sah ihn dort auf einer Bank stehen, einen Kerl mit klingender Stimme und breiter Stirn, Wangen und Mund unter einem überflüssigen Bart. Er sprach vor einem Dutzend Leuten über das Gelangweilte seiner Schüler mit Polohemden und über Franz von Assisi, als junger Mann allem Modewahn entkommen, und sie legte ihm ihre Karte hin. Noch am Abend rief er an, und sie malte ihm aus, wie es wäre, demnächst einer von drei Mitternachtstipps zu sein und so eine halbe Million Leute zu erreichen. Und in der neuen Woche schon das Vorgespräch mit der Hausofferte und zwei Tage später die Aufzeichnung im Park – Moderatorin und Prediger auf einer Bank zwischen alten Bäumen, eine Unterhaltung, als seien sie allein, geradezu intim, Vilas Stärke in der Sendung; und am Schluss sogar ein doppelter Tipp von ihr: In den Frankfurter Museumspark gehen, dem Mann mit dem Bart bei seinen Reden zuhören und sich mit Franz von Assisi befassen. Das Ganze in der Nachbearbeitung auf vier Minuten dreißig gekürzt und am Sonntag darauf schon ausgestrahlt, die letzte Sendung vor der Sommerpause. Das Echo war erstaunlich, viele Mails, die dem Lehrer den Rücken stärkten, aber auch empörte Anrufe im Kultusministerium und dort die Erwägung eines Disziplinarverfahrens, aber da hatte sich Bühl schon selbst beurlaubt. Er begann, seine Wohnung aufzulösen, und verließ sie nur noch, um im nahen Textorbad Schwimmrunden zu drehen – ein Schwimmer schon im Internat am Bodensee – oder im Woolworth-Tiefgeschoss ein paar Lebensmittel zu kaufen; sein Kontakt zur Welt bestand aus dem Lesen und Schreiben von Mails. Er bekam Mengen von Post in diesen Tagen seines vorübergehenden Ruhms, aber nur ein einziger Eingang interessierte ihn: Die Moderatorin der Mitternachtstipps hatte sich gemeldet, etwas besorgt über die Folgen des Beitrags für sein berufliches Leben, und sie erwähnte noch einmal die Haussache, befürwortet auch von ihrem Mann. Ab Ende September, wenn wir dort unten genug haben, können Sie bis Ostern in unser Haus, alles Nähere bei der Übergabe, wäre das in Ordnung? Eine von Bühl ausführlich beantwortete Mail, auch wenn er kaum auf den Inhalt einging. Das meiste galt seiner Beschäftigung mit dem unerschöpflichen Francesco, wie er ihn nannte – jemand, den alle Fragen der Liebe gequält hätten, die einen auch heute quälten. Franz von Assisi, der könnte genauso gut Franz von Frankfurt heißen, geboren im Jahr der Wende; es gebe kein modernes Glück oder Unglück. Und so weiter.
Vila hatte die Antwort in ihrer großen Altbauwohnung in der Schadowstraße gelesen (drei Minuten von der Schweizer, keine zehn vom Museumspark), der Abend vor dem Aufbruch zum See, Renz im Nebenraum vor seiner alten Filmbibliothek aus der Kritikerzeit, er sah sich Folgen der Serie an, in die er einsteigen sollte, im Mittelpunkt eine Pathologin; seine Producerin-Bekannte hatte eine ganze Staffel geschickt und einen Arbeitsbesuch am See vorgeschlagen. Ganz nette Frau: Renz’ prophylaktische Worte zu Vila, etwas fern der Realität. Sie war eine Dunkelblonde Anfang vierzig, meistens die Hand mit Zigarette am weichen Mund, dazu ein verrätselter Blick unter japanischen Lidern, die Figur mädchenhaft. Marlies Mattrainer. Und nun stand ihr Besuch bevor, fast eine Überschneidung mit der Ankunft des künftigen Mieters.
ZWEI Tage nachdem Vila und Renz erfahren hatten, dass sie Großeltern würden, erschien Kristian Bühl in ihrem Sommerort. Er hatte von unterwegs noch einmal angerufen, ihm war der Name des Hotels entfallen, in dem er wohnen sollte, solange das Haus noch belegt war, am anderen Ende Renz und gleich mit einem Kompliment: Gut rübergekommen in dem Interview, auf den Punkt! Und das Hotel war das Gardesana am kleinen Hafen von Torri, Bühl hatte dort das Eckzimmer zum See mit altem Holzbalkon, am Abend wurde er zum Essen erwartet; auf seinem Bett ein Umschlag, darin ein Wegeplan, wie er zum Haus käme, narrensicher, unter der Zeichnung eine Frage, Vilas fließende Schrift – Sie mögen doch Fisch, einen Branzino? (Alles Umwerbende geschah bei Vila und Renz im Rahmen italienischer Gerichte und Weine, für Tochter Katrin nur eine Sitte derer, die an den Seitenarmen der Schweizer Straße als isoliertes Völkchen der Gourmets und Besitzer von Audi- und BMW-Kolossen lebten, auch wenn Renz einen kolossalen, nicht mehr ganz taufrischen Jaguar fuhr, Super V 8, Langversion, schwarz.)
Vila zog sich noch um für den Besuch, Leinenhose und einen Pullover wie aus Watte, beides in Verona gekauft. Die Tage waren immer noch mild, von schleirigem Blau, abends konnte es schon frisch werden, die letzten guten Tage am See und für sie der Abschluss, morgen um die Zeit wäre sie schon im Flugzeug nach Orlando, Florida, zu ihrem Kind mit dem neuen Leben im Bauch. Wenn du willst, dann komm, hatte Katrin etwas vage geschrieben, ich weiß nicht, was ich tun soll, wie löst man sich in Luft auf? Eine Panik, die sie damals, schwanger mit Katrin, auch erlebt hatte, also wollte sie bei ihr sein, ihr Mut machen. Und wenn das Kind zur Welt käme, wäre sie immer noch zweiundfünfzig, nur für Eingeweihte eine Großmutter. Vila strich ihr dunkles Haar hinter die Ohren und schlang es zu einem losen Knoten über dem Nacken; die grauen Streifen darin sah man kaum, und Helge, Visagist vom Mitternachts-Team, konnte sie ganz verschwinden lassen vor einem Dreh. An diesem Abend gefiel sie sich mit dem Hauch von Silber, passend zum Anlass, dem letzten Essen im Freien, auf dem Tisch drei Windlichter, für jeden eins. Der Branzino war frisch, sie hatte ihn vormittags eingekauft und später noch das eine und andere entdeckt, für Katrin eine CD, Paolo Conte, den mochten sie beide, für sich selbst ein paar offene Schuhe, schmal und gläsern wie Libellen, und auch etwas für Renz, einen Gürtel, nicht der erste. Er trug am liebsten gar keinen Gürtel und nahm Ziehharmonikafalten im Kauf – ein weiterer Versuch, und erfolgreich, die Gürtelschnalle glänzte an ihm. Sie verbesserte Renz, seit sie sich kannten, besonders vor Besuchen; früher bedeutete jedes neue Gesicht ein Risiko, man wusste nie, wen er ignorieren würde, und inzwischen hatten sie einen Freundeskreis, auf den andere schon neidisch waren. Jedes Paar, das bis an den See fuhr, um sie beide zu sehen: ihr Verdienst. Anne und Edgar, Elfi und Lutz, Heide und Jörg, die beiden Schaubs, das Hollmann-Gespann und die Wilfingers. Und seit einiger Zeit, vielleicht auch sein Verdienst, die Englers aus Mainz, Thomas und Marion, Marion nur etwas jünger als sie, aber mit demselben Frisör in Frankfurt; an manchen Tagen kam sie kaum nach mit dem Schreiben und dem Beantworten von Mails, um irgendein Samstagabendessen abzustimmen.
Ist der Wein schon auf? Eine ihrer alarmierenden Fragen vor jedem Essen, laut nach unten gerufen, und von Renz nur ein Ja, so knapp wie das bei ihrer Heirat, als sie im sechsten Monat war. Vila zog die Libellenschuhe an und trat vor den Spiegel in dem Bad neben ihrem Schlafzimmer. Der Pullover erschien ihr zu herbstlich, sie wählte ein Hemd, transparent wie die abgestreiften Häute von Schlangen gegen Ende des Sommers unter der alten Steinmauer am Gartentor, von der Hitze gewellt. Drei, vier windstille Tage im September genügten, um zwischen den Bergen noch einmal die Hitze zu stauen, eine Hitze, die sich dann bis in die Nacht hielt, dazu der Mond groß und rötlich über dem See. Beide liebten und fürchteten sie dieses finale Lodern, ihre Gnadentage vor der Abfahrt, die ersten wilden Weinblätter schon mit dem Rot von getrocknetem Blut; wer nicht bei Regen abreisen wollte, musste es vorher mit Wehmut tun. Vila zog die Schuhe wieder aus und ging barfuß durch die oberen Räume, der Boden aus Schweizer Lärche warm und glatt, sie hatte ihn selbst versiegelt, ihr warmer Boden, auf dem sie ging. Im Grunde gab es zwei Häuser in einem, das von Renz und ihr ganz eigenes; der Mieter würde unten schlafen, im alten Kinderzimmer. Sie mochte das Septembertrödeln in ihrem Reich, das Musikhören oder Lesen im Bett, und ohne die Sorge um Katrin – ihr war alles Mögliche zuzutrauen – wäre sie noch bis zum Auftauchen der ganz netten Frau oder Producerin geblieben, von Renz schon beim Vornamen genannt: Marlies, Sie können auch die Fähre nehmen, wenn Sie von Brescia kommen! Vorige Woche hatte sie die Nette selbst kurz am Telefon gehabt, eine Heimatfilm-Stimme und Raucherhusten.
Es klingelte zweimal, eher ein verunglückter Einzeldruck auf den Knopf am Tor, und immer noch die seltsame Ruhe danach, das ausbleibende Gebell von Kasper. Kommst du?, rief Renz, und sie drückte die grünen Läden vor der Balkontür auseinander, die Schulter am splittrigen Holz, sein Grün gebleicht von zu viel Sonne. In zwei Minuten, rief sie zurück. Eine ihrer Zeitangaben, die nie stimmten, bis auf den Trost darin oder den Wunsch dahinter. Zwei Minuten waren zehn Minuten, und zehn Minuten konnten schon eine halbe Stunde sein, Renz hatte Jahre gebraucht, um ihr anderes Maß zu verstehen. Selbst zu dem Interview im Park war sie zu spät gekommen, fast erstaunt, dass man auf sie gewartet hat, Kamera, Ton und Helge, ihr Zauberer mit dem Koffer voller Stifte und Pinsel, dazu die Hauptperson des Beitrags; sie hätte nie live moderieren können. Und natürlich dachte sie auch nicht daran, in zwei Minuten herunterzukommen, sie hörte sogar noch Musik, Best of Aida, eine CD von de Beni für treues Einkaufen, ihr Stückchen Oper, während Renz den Hausmieter, sie sah es vom Balkon aus, durch den Garten führte.
Er ging neben ihm her, mit Gesten und Erläuterungen, als hätte er alles selbst erschaffen und es wäre gutgetan. Renz Schöpfer der Zitronenbäume im Eingangsbereich, der hohen Bananenstauden neben einem runden Granittisch und zweier Palmen links und rechts des Pools; Schöpfer eines prächtigen Feigenbaums, die Äste fakirhaft verschlungen, und der alten knöchrigen Olivenbäume, manche höher als das Haus, einer Laube unter Jasmin und Wein sowie allem, was Anfang Oktober noch blühte. Sogar zu dem Chaos unterhalb des angelegten Gartens bekannte er sich, dem Unkrautwäldchen zwischen einer Mauer aus Natursteinen und einem rostigen Zaun, dahinter die Gemüsebeete des unteren Nachbarn und einige marode Hühner. Es gab auch einen Hahn, den hat irgendwer kaltgemacht, sagte er, als Vila auf die Terrasse trat, nochmals umgezogen, statt Leinenhose jetzt eine Jeans, eng an den Schenkeln. Die Stirn leicht gerunzelt – ihr Ausdruck vor einem heiklen Beitrag – kam sie auf den Gast zu, schon die Hand ausgestreckt, und er griff um ihre Finger, ohne an den Daumen zu stoßen, als hätte sie viel kleinere Hände als er. Wie geht’s, sagte sie nur, und danach gleich eine richtige Frage, ob er für all die Winterabende gewappnet sei. Sie sah zu Renz, ein Blick, der ihn ins Haus schickte, die Vorspeisen samt Bruschetta waren seine Domäne, der Salat war ihre, und den Fisch würde er wieder machen. Bühl, in einem Pullover, der über den Schwimmerschultern zu knapp war, sah in das Unkraut, als gäbe es keinen Pool, kein Haus und auch keine Frau des Hauses. Ich bin hier nicht allein, sagte er, ich habe meine Arbeit. Und für einige Zeit werde ich auch in Assisi sein. Kennen Sie’s? Er drehte sich um, und Vila fiel auf, dass sein Bart anders war, der Mund freigeschnitten. Assisi? Ja. Aber wozu diese Arbeit? Gehen Sie ins Internet: es wimmelt von Franziskus-Büchern. Was glauben Sie, wie viele auf ein weiteres Buch über einen warten, der seit achthundert Jahren tot ist, fünf vielleicht, wenn ich mich dazuzähle.
Dann würde mir das reichen.
Das würde Ihnen reichen? Ich zeig Ihnen jetzt das Haus! Und sie zeigte ihm alles, jeden Winkel, jeden Griff, jeden Schalter, mehr eine Gebrauchsanleitung als eine Führung, immer ein Stück vor ihm hergehend, um dann, wenn er selbst einen Griff oder Schalter probierte, halb hinter ihm zu stehen, bis er über die Schulter sah und ihr zunickte, mit einem Blick aus gereizten Augen (er war schon im See geschwommen, gleich nach der Ankunft). Und das anschließende Essen ein kleines Examen, Renz stellte Fragen zur Person und den Auftritten im Museumspark, zu Bühls Lehrermisere; die Antworten knapp, aber höflich, moderiert von Vila. Über den Unfalltod der Eltern nur zwei, drei Sätze, Ausgangspunkt für einen Sprung von dem See, auf den sie schauten, zum Bodensee, seinem matten unteren Arm, an dem er die Schulzeit verbracht hatte, zehn Jahre Internat Aarlingen. Bühl sprach leise, die Blicke gerecht verteilt; er trank nur Wasser zum Essen, erst später einen Grappa – schon der Schlusspunkt, sein Aufbruch. Vila ging noch bis zum Hohlweg mit, das Übliche bei neuen Gästen. Jetzt immer abwärtslaufen, sagte sie, wir sehen uns morgen noch einmal. Und ich beneide Sie um Ihr Zimmer, es hat den besten Blick im Hotel, ich habe es schon vor Wochen reserviert. Außerdem ist es ein historisches Zimmer: Der Schriftsteller Gide hat dort einen ganzen Spätsommer verbracht. Oder machen Sie sich nichts aus solchen Dingen? Sie gab ihm die Hand, und wieder sein Griff um ihre Finger, als hätte sie keinen Daumen. Für heute reicht es mir, dort nur zu schlafen – ruhige Worte im Weggehen.
Renz saß noch auf der Terrasse, als Vila zurückkam, er hatte Wein von oben geholt, ihr letzter gemeinsamer Abend in dem Sommer, aber ein anderer letzter Abend als in all den Jahren zuvor; sie würde morgen abreisen, weit weg, er noch bleiben, Besuch empfangen. Und gefällt er dir? Vila nahm das Glas, das Renz ihr hinhielt, sie stieß mit ihm an, auf das Leben in Katrins Bauch, auf den Abschied. Seltsamer Mensch, sagte er, wahrscheinlich zwei linke Hände. Ich lade ihn morgen zum Essen ein. Übermorgen ist ja diese Frau schon da.
Und kommt sie nun mit der Fähre? Vila sah über den Glasrand auf Renz’ faltige Stirn: die einer Vierzigjährigen, oder wie alt Die Nette war, interessant erscheinen mochte, lebensgeprägt, und dabei waren es nur Folgen von zu viel Sonne und den Zigaretten bis zu Katrins Geburt. Falls sie raucht, sagte Vila, und am Telefon hat es so geklungen, soll sie das nur im Garten tun. Oder hat sie gerade aufgehört, aber muss noch husten, du kennst sie doch. Also was? Vila trank einen Schluck, wieder mit Blick über den Glasrand: Renz schenkte sich nach, auch seine Antwort eine Art Nachschenken. Was weiß ich, ich kenne sie nur etwas. Ja, sie raucht, in dem Geschäft für eine Frau normal. Wann geht dein Flug? Warum will Kati überhaupt, dass du kommst, ist alles in Ordnung?
Kati ist zum ersten Mal schwanger, da ist nichts mehr in Ordnung, das kennst du doch auch etwas – Vila leerte ihr Glas und ging ins Haus. Ich hab hier noch den halben Vormittag, rief sie, dabei schon ihre Schritte auf der Treppe, fast eine Flucht. Renz hörte sie noch ins Bad gehen, die Tür hinter sich abschließen, das tat sie, seit er häuslicher geworden war, fixierter auf sie, ohne Dinge hinter ihrem Rücken, zuletzt mit der Gegenspielerin in einer Restaurantserie; deren Rolle war durch ihn gewachsen, das macht dankbar, und er hatte sie auch nur etwas gekannt, aber anders etwas als die Mattrainer, mit der er keine Sekunde im Bett war. Dafür hatten sie schon auf Raucherbalkonen zusammengestanden, in München, in Köln, in Berlin, er hatte sie hinausbegleitet, um irgendein Gespräch über Filme fortzusetzen, und einmal hatten sie in Frankfurt Mittag gegessen, bei einem Italiener an der Messe, nicht seine Gegend, was auch einiges hieß. Sie hatten über die Fernsehlandschaft gesprochen, wie es immer schwieriger werde, etwas Neues zu platzieren, und am Ende, beim Espresso, war es ein Gespräch über die Landschaft der Ehe, wie schwierig es war, dort die sicheren Pfade zu verlassen. Wenn er das überhaupt wollte, er hatte doch alles: das Glück einer junggebliebenen Frau, die ihn nicht einengte, die Genugtuung des Geldes, das ihm durch seine Arbeit zufloss, eine komplizierte, aber schöne Tochter, dazu bald ein Enkelkind. Und auch erstmals einen Mieter, offenbar sogar gescheit und, wie er fand, für diese Nacht angemessen untergebracht.
DAS Eckbalkonzimmer im Hotel Gardesana am kleinen Hafen von Torri oder Torri del Benaco, nach dem alten Namen des Sees, Lacus Benacus, war von dem Schriftsteller André Gide im Spätsommer achtundvierzig (Renz’ Geburtsjahr) in der vergeblichen Hoffnung bewohnt worden, dort für immer einzuschlafen, während Bühl nicht einmal die Hoffnung hatte, überhaupt einzuschlafen. Also machte er Licht und griff zu seinen Franziskus-Notizen, einem Blätterberg aus Versuchen über den Anfang des Buchs, der eigentlich klar war. Die erste Seite müsste vom Weinen handeln – Franz war ein Meister darin –, denn was erzählt stillschweigend mehr als das Weinen, ob vor Kummer, Glück oder Wut, aus Berechnung oder, heutzutage seltener Fall, wenn ein Romantiker aus uns weint? Und ob die Tränen nun befreien oder andere erpressen, immer fließen sie aus einem alten Kinderkörper, als würde man nie erwachsen. Oder sie fließen gar nicht, wie an dem Tag, an dem er zwei Schaufeln Erde auf zwei Särge gestreut hatte, die seiner Eltern, noch kurz davor voller Stolz auf einen Neuwagen, 6er-BMW, Cabrio, während das Fahrzeug, das auf ihres prallen sollte, schon unterwegs war (alles, was uns zerstören kann, existiert bereits). Keine Träne also am offenen Grab, wie ein Kindheitsabschluss, in Wahrheit das Gegenteil: Nach seiner Heimat gefragt, würde er immer noch das Tal südlich von Freiburg nennen, die umgebenden Berge im Sommer von rauchigem Grün. Das ganze Klingen dieser Gegend war in ihm, so, wie es aus dem Mund seiner Kinderfrau kam, die nie ein hartes Deshalb kannte, nur ein weiches und oft dunkles Vuudämmhäär. Eine Welt, die Bühls handelsreisendem Vater für den Sohn zu gering war, also schickte er ihn, trotz ein paar Tränen der Mutter, ins Internat Aarlingen an dem Bodenseearm, der sachte zum Rhein wird – im Oktober süßer Fäulnisduft, wenn die Sonne das Fallobst erhitzt, kaum dass die Nebel aufreißen, darüber ein Himmel von rasendem Blau, oft Auslöser absurder Glücksgefühle; für Kristian Bühl Jahre der Freundschaft und anderer, dunkler Dinge, die ganz plötzlich in ihm aufschnellen konnten – das Gedächtnis, es ist taktlos, dazu ohne Sinn für Ästhetik, es haut nur rein.
Nach Abitur und Ersatzdienst dann Studium in Tübingen, alte Sprachen und etwas Philosophie, dazu noch das Nötige, um an Gymnasien unterrichten zu können, und die erste Stelle gleich am Hölderlin in Frankfurt, für ihn die Stadt mit den unbeherzten Hochhäusern, nicht hoch genug, den Atem anzuhalten, aber schon zu hoch, um nur mit der Achsel zu zucken, am Ende aber als Wahlheimat angenommen, bis hin zur Sorge um die Frankfurter Eintracht mit ihrem schwankenden Stand. Er wohnte von Anfang an im Süden der Stadt, jenseits des Mains, in der Wohnung mit den Parfümeriegerüchen, die zweieinhalb Zimmer jahrelang verstopft mit Büchern, Zeitschriften, Ordnern, Kartons, in den Kartons Kleidung und Kleinkram, es gab keinen Schrank, keine Kommode, und am Ende ein radikales Ausmisten, sogar alter Briefe oder Zeug aus der Schulzeit, Mäppchen, Hefte, Material, und dabei auch das Finden von schon verloren Geglaubtem, etwa einer grünen Dose mit Diabolo-Luftgewehrkugeln oder einer Postkarte aus New York, nach ein paar Grüßen die komplette Unterschrift seines Freundes, Cornelius Kilian-Siedenburg, Beweis einer New-York-Eroberung schon als Schüler. Und dann fand sich auch noch ein altes Schwarzweißfoto, sechs mal sechs, von ihm gleich beiseitegelegt. Auf dem Foto ein blondes Mädchen in einem Ruderboot, dunkler Badeanzug, helles Gesicht, weiche Wangen, und unter den geraden, fast japanischen Lidern ein sogenannter tiefer Blick, dazu eine Hand mit Zigarette am breiten Mund: die kleine Pause zwischen zwei Zügen, die er im letzten Urlaub mit den Eltern – er war achtzehn – für den Schnappschuss genutzt hatte. Die junge Raucherin zu Besuch bei ihrer Tante, der am Ossiacher See das Strandhotel Mattrainer gehörte, und am letzten Abend ging er mit ihr am See entlang, obwohl ein Gewitter aufzog; beim Rückweg, eine Abkürzung neben dem Bahndamm, auf einmal strömender Regen, und unter einem überhängenden Busch, kaum geschützt vor dem Prasseln, der Kuss seines Lebens.
Trotz einer schlechten Nacht – wenig Schlaf, viele Gedanken, keine Ergebnisse – war Bühl am Morgen hellwach, das Frühstück auf der Balkonterrasse über den Hotelarkaden. In dem Bereich zwischen Hotel und Hafenbecken jetzt lauter Stände, aufgebaut in der Morgendämmerung, Stände mit allen möglichen Waren und Gedränge davor. Es war der Montagsmarkt von Torri, und obwohl er das Haus noch gar nicht übernommen hatte, kaufte er nach dem Frühstück schon ein paar Lebensmittel, Brot, Schinken, Käse, eingelegte Sardinen und Eier. Das Brot war spröde, es zerfiel, sobald man davon etwas abbrach, und die Spatzen kamen den Möwen zuvor; überhaupt war es ein Ort der Spatzen, furchtlos flogen sie ihm vor die Füße und pickten die Krümel, ja flatterten ihm über Arm und Hand, während die Möwen feige abdrehten, sich mit dem weißgrauen Himmel mischten, einem Sommerende wie zum Greifen – der See so glatt, als ließe sich darauf schreiben, und auf dem Markt der große Ausverkauf. Billige Schuhe, Hüte und Spielzeug, Wäsche für alle Gelegenheiten, Stickereien auf kleinem Dreieck, eine Rose, eine Zunge, ein Fragezeichen; darüber halbe Zelte aus hängenden Unterröcken, schwarz oder fleischfarben, und die Verkäuferinnen faltige Schönheiten, heiser lachend, immer ihr Telefonino und eine dünne Frauenzigarette zwischen den Fingern. Bühl ging von Stand zu Stand, und ein verblasstes Bild des Weiblichen nahm wieder Farbe an. Jemand tippte ihm an die Schulter, zweimal leicht, wie ein sachtes Anklopfen.
Vilas Flug nach Frankfurt mit Anschluss Orlando ging erst gegen Mittag, eine Stunde blieb ihr noch, Zeit genug für den Markt. Unser Ort, sagte sie – keine Camper, also auch keine Holländer, dafür umso mehr Melancholie, wenn der Sommer vorbei ist. Bald kommen die Busse mit den Alten, das Publikum für die Schwäne, Scharen in Beige, die Capes, die Schirme, die Schuhe. Soll ich Sie nach oben fahren? Der Jeep steht vor der Farmacìa, der Apotheker ist unser Komplize, er weiß genau, woran Renz und ich leiden, wenn wir zu lange hier sind, er macht die Cremes mit Cortison alle selbst! Vila nahm die Tüte mit den Einkäufen, sie führte Bühl zu dem Jeep, einem alten Suzuki, und fuhr durch den Hohlweg zum Haus, sechzig Höhenmeter über dem Ort und dem See.
Das Gartentor stand auf, ebenso die Haustür. Vilas Gepäck war schon im Eingang, ein Koffer, eine Tasche; am Garderobenspiegel mit Tesafilm befestigt ihre Liste der zu beachtenden Dinge in Haus und Garten. Gehen wir’s gleich durch? Sie löste das Blatt und reichte es Bühl, ohne es loszulassen, er überflog die hervorgehobenen Punkte. Entnommene Bücher wieder zurückstellen. Die Bilder nicht der Sonne aussetzen. Täglich Ameisen bekämpfen. Topfpflanzen ins Haus, wenn es friert, die Zitronenbäume einpacken, Folie im Schuppen. Den Heizungsdruck kontrollieren (nicht höher als eins fünf!), jede Woche die Wasseruhr ablesen. Beim Verlassen des Hauses alle Läden schließen, Gas abdrehen, Gartentor zuziehen. Streunende Katzen gelegentlich füttern (nichts Gesalzenes), auch für Vogelfutter sorgen. Auf Mülltrennung achten, die Tonne für Umido (Speiseabfall) gut geschlossen halten. Den Briefkasten leeren, nichts wegwerfen, auch keine Werbung. Und nie den Hausschlüssel von innen stecken lassen, nie!
Renz kam von der Terrasse in den Wohnraum, ein Telefon am Ohr; er winkte Bühl zu, und Bühl winkte zurück, dazwischen Vila, die Hände unterm Kinn. Mein Mann spricht mit seiner neuen Producerin, die taucht morgen hier zum Arbeiten auf. Sie bleibt eine Nacht, dann bringt er sie nach München, und das Haus gehört Ihnen. Oder wollen Sie gern heute schon einziehen? Fast eine suggestive Frage, und die Antwort nur Kopfschütteln; Bühl stand jetzt vor einem der Bilder, einem Venedig-Motiv, Tusche und Bleistift, die Lagune wie eine intime Haut. Renz ging an ihm vorbei, in der Hand den Schiffsfahrplan für den See, er ging wieder nach draußen. Vila schloss die Terrassentür – letzte Nacht war Renz noch in ihr Zimmer gekommen, der Wintermieter beschäftigte ihn, sein Haar, sein Bart, die melodische Stimme. Der werde hier auffallen im Ort, sagte er und hätte ihn am liebsten zum Friseur geschickt; ohne Bart wäre er zwar immer noch ein komischer Heiliger, nur kein Typ mehr, nach dem sich die Leute umdrehten. Renz störte sich an etwas, das sie mit Schwung übersah. Sie sah mehr die Augen, den Mund, den Gang und fand ihn weder heilig noch komisch, eher etwas unheilig.
Producerin, was heißt das, fragte Bühl, und sie warf einen Blick auf ihre Uhr, eine kleine Reverso, die sie locker gebunden trug, das erste größere Geschenk von Renz: zu ihrem Vierzigsten, als Katrin in den schrecklichsten Jahren war, ein fluguntauglicher Vogel, und sie in den besten, eine Falkin. Producerin heißt eigentlich gar nichts, sagte sie und riss die Terrassentür auf, Wir müssen los! Und unser Mieter möchte gern wissen, was eine Producerin hier am See zu tun hat! Vila lief in die Garderobe, sie zog ihre Reisejacke an, als Renz wieder hereinkam, das Telefon in der hängenden Hand.
Die Mattrainer, rief er, will mir die Pathologinnenserie erklären, und sie kommt freundlicherweise mit einer Liste der schon angewandten Tötungsarten, damit die schöne Pathologin ja nicht zweimal vor demselben Rätsel steht! Er sah zu Bühl, als sollte der ihm zustimmen, und Vila, während sie ihr Gepäck vors Haus stellte: Es gibt keine schönen Pathologinnen, sie sind alle hager und blass, es gibt höchstens schöne Producerinnen, auch wenn sie qualmen! Ein Wort, das noch nachschwang, als sie auf Bühl zutrat, ihm alles Gute für den Winter wünschte, und diesmal war ihre Hand schneller als seine. Behalten Sie meinen Garten im Auge, sagte sie noch, da ging die Hand schon auf, und seine Hand zog sich zurück – er winkte damit, wie Leute von ablegenden Schiffen winken, in einem Bogen, dann lief er Richtung Hohlweg, und sie lud ihre Sachen in den übergroßen Wagen.
RENZ brachte Vila zum Flughafen, eine wortlose Fahrt, jeder bei sich, immer dicht davor, etwas zu sagen, sich Luft zu machen, aber dann blieb es beim Atmen, stur durch die Nasen, ein Aufpassen, als drohte mit der Luft aus den letzten Tagen auch gleich das Erstickte aus Jahren mit nach oben zu kommen: Renz kannte das und hielt den Mund – alte Paare sind Archive, weh dem, der sie öffnet. Erst an der Sperre vor der Sicherheitsschleuse von ihm ein Passaufdichauf, hastig und leise, danach eine Pause, ein Atemholen, für ein noch leiseres, fast schon verschämtes Undküsskatrinvonmir, dazu eine Hand an Vilas Bauch, als sei das neue Leben auch in ihr, und von Vila am Ende eine Fingerkuppe an seinem Mund, ihre Art zu sagen, sei geküsst, jetzt und in den kommenden Tagen, den Tagen mit deiner ganz netten Begleitung. Renz sah ihr hinterher, bis sie zwischen Fremden verschwunden war, dann fuhr er zurück in seinem zu großen, zu schnellen Auto.
Und abends das Essen mit dem Mieter, die Einladung bei Da Carlo, einer Pizzeria am Wasser mit Tischen im Freien, dem Wind ausgesetzt, für ihn, Renz, ein Nachteil, sein Haar schien davonzufliegen, während sich Bühl dem Wind sogar zudrehte, oft eine ganze Strähne im Gesicht. Franz von Assisi, sagte Renz nach dem ersten Wein, war hier mehrfach am See, auch eine Zeitlang auf der Insel, wussten Sie das? Er saß Bühl gegenüber, wie er sonst Vila gegenübersaß, aber angespannter, vorgebeugt, froh, als die Pasta gebracht wurde. Natürlich wissen Sie das, sagte er, man weiß über seine Helden immer alles, besonders, wenn sie tot sind. Mit lebenden Helden hat man es schwerer. Kennen Sie Bradley Manning, den jungen US-Soldaten? Renz schenkte Wein nach und erzählte von Manning, der ein Geheimvideo von einem Massaker der Amerikaner in Bagdad weitergegeben hat, das Hasenschießen aus einem Hubschrauber auf Unbewaffnete samt Witzen über die Sterbenden auf der Straße, er hatte das Video im Internet gesehen, Bradley Manning war ein Held für ihn, ein Fernsohn, um den er bangte. Und mein Jugendheld, sagte er, war Buddy Holly. Ich hörte stundenlang die Hymne auf seinen Tod bei einem Flugzeugabsturz. Zuerst ein Wolfsgeheul des Sängers, bevor die Welt, begleitet von zarten Gitarren, Abschied von Buddy nimmt, umgekommen, als es schneite und Wind blies. Snow was snowing, wind was blowing, eine Tautologie, die mich auf Anhieb berührt hat. Und immer, wenn der Name Buddy Holly fiel, im Grunde auch eine Tautologie, wollte ich mich so leicht wie er zwischen Liebe und Sex bewegen, der Spagat der frühen Sechziger, zu dem seine Brille gepasst hat, ihr schwarzer, weiblich geschwungener Rahmen! Renz winkte einem Kellner mit Pferdeschwanz, er ließ sich die Rechnung bringen und zahlte. Und Ihr erster Held?