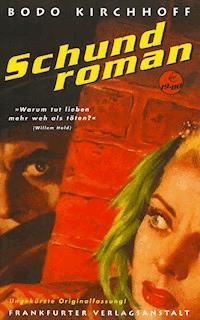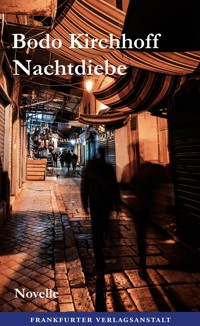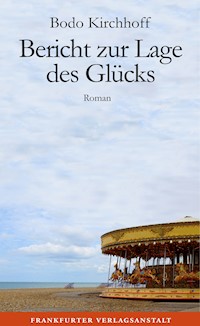10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Meistererzähler.« Richard Kämmerlings Vier Tage vor dem Höhepunkt des Sommers, dort, wo sich Louis Arthur Schongauer, einst düsterer Deutscher in Hollywood-Filmen, nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen hat. Jetzt will er nur noch mit seiner Hündin leben, inmitten alter Oliven oberhalb des Gardasees. Doch dann strandet eine Reisebloggerin beim Wenden in seiner Zufahrt, und am nächsten Tag erwartet er eine Autorin, die ihn mit einem Porträt aus der Vergessenheit holen will: zwei Frauen mit Gespür für die Wunden in seinem Leben. Umso wichtiger wird ihm nun sein Tier, für das es nur ein Hier und Jetzt gibt … In Bodo Kirchhoffs neuem Roman geht es um die Sehnsucht nach dem Menschen, der uns erkennt, und die Abgründe, die sich auftun, wenn wir dieser Sehnsucht folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Die Tage vor dem Höhepunkt des Sommers: Seit dem Tod seiner Frau teilt Louis Arthur Schongauer, einst der Deutsche in düsteren Hollywood-Nebenrollen, sein Leben oberhalb des Gardasees mit einer Hündin. Es ist ein ruhiges Dasein inmitten alter Oliven, allein mit den eigenen Dämonen: doch dann strandet in der Augusthitze eine junge Reisebloggerin beim Wenden in seiner steilen Zufahrt, und am nächsten Tag erwartet er eine Autorin, die ihn mit einem Porträt aus der Vergessenheit holen will – zwei Frauen mit Gespür für die Wunden in Schongauers Leben. Umso mehr hält er sich jetzt an sein Tier, für das nur die Gegenwart zählt, nur das Hier und Jetzt …
In Bodo Kirchhoffs neuem Roman geht es um die Sehnsucht nach dem Menschen, der uns erkennt, um die Erschütterung, wenn wir auf diesen Menschen treffen; genau und dennoch diskret wird von dem erzählt, was durch das Auge ins Herz dringt und dort wächst, als erstaunlichster Teil des eigenen Seins: unsere Fähigkeit zu lieben.
Bodo Kirchhoff
Seit er sein Leben mit einem Tier teilt
Roman
für Sophia, der es liegen könnte – und natürlich für die Eine, die wieder alles auf ihre ganz eigene Waage gelegt hat
Che cosa è questo, Amore,
c’al core entra per gli occhi,
per poco spazio dentro per che cresca?
E s’avvien che trabocchi?
Michelangelo
Was ist dies, Amor,
das durch die Augen ins Herz dringt
und dort auf kleinem Raum zu wachsen scheint?
Und sich anschickt, alles zu überschwemmen?
1
Ein Abend im August kurz vor Mariä Himmelfahrt, oder dort, wo sich alles Folgende abspielt, Ferragosto. Ein Hanggrundstück mit geducktem Steinhaus, ehedem Stall, und Blick über den größten See am südlichen Alpenrand, zu der Stunde wie aus altem Glas, das andere Ufer kaum erkennbar, die Berge darüber im Dunst: ein Panorama des Friedens, gestört durch das Geräusch durchdrehender Reifen und Hundegebell.
Der Besitzer des Grundstücks und Halter des Hundes hat das erregte, nicht nur bellende, auch jaulende Tier an kurzer Leine; er kennt dieses scharrende Reifengeräusch, und wie er es kennt, und an dem Abend verliert er die Geduld. Schon in der Hose für die Nacht, aber mit bloßem Oberkörper – ein knochiger Mann, eher älter als alt –, greift er im Haus nach einer seit Jahr und Tag verwahrten Waffe, einem Revolver, Kaliber .357 Magnum, mit kurzem Lauf, einst Bestandteil polizeilicher Ermittlungen gegen ihn, Louis Arthur Schongauer, zu der Zeit als L. A. Schongauer in Hollywood beschäftigt. Er holt die von damals noch übrigen Patronen aus der Trommel, damit nicht noch einmal ein Unglück geschieht, dann eilt er vors Haus, während der Hund, der eine Hündin ist, nun sogar mehr jault als bellt, ganz auf das konzentriert, was sie wahrnimmt, statt sich nur einem Gefühl hinzugeben – die Gabe, um die er sie am meisten beneidet.
Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, denkt Schongauer in schlaflosen Nächten sogar manchmal daran, dass er gern als dieses Tier auf die Welt gekommen wäre, nur mit dem Gedächtnis für Gut und Ungut, Freund oder Feind, und ohne Wissen um die Zeit. Sich aus der Zeit und der Erinnerung zu stehlen, war aber schon sein Wunsch beim Umzug auf das Hanggrundstück, ein freilich frommer Wunsch bis zu dem Abend, an dem er mit einer Waffe aus seinen amerikanischen Jahren bereit ist, jemanden für immer davon abzuhalten, noch einmal eine Grundstücksgrenze zu verletzen. Die Waffe in der einen Hand, in der anderen die Hündin an ihrer Leine, läuft er längs einer Mauer aus geschichteten Feldsteinen in Richtung einer steilen Zufahrt, keuchend und mit einem Ausdruck von Zorn, wobei er eigenen Gefühlsausdrücken nie recht getraut hat: eine nicht losgewordene Schauspielerkrankheit.
Bei zwei Zypressen, über die halbe Höhe wie aus einem Stamm, zu den Spitzen hin aber jede für sich, zögert er: Noch könnte er zurück ins Haus, in ein Unsichtbarsein. Nur drehen da immer noch die Reifen eines Fahrzeugs durch, immer noch versucht da wieder einmal wer, in seiner steilen Zufahrt auf Teufel komm raus zu wenden, und verwüstet den Boden, nun schon mit ächzender Kupplung. Den ganzen Sommer geht das schon so, dass sich Leute ohne Ortskenntnis in den Hohlwegen auf dem Olivenhang verfahren, aber erstmals ist er zu allem entschlossen, und jemand müsste ihm sagen Lass das, beruhige dich, steck die Waffe weg, aber die Einzige, die ihm das hätte sagen können, ist seit fünf Jahren tot, und er kann wiederum ihr nicht sagen, dass es überhandgenommen hat mit dem Wenden bei ihm. Genarrt von kleinen Pfeilen auf ihren Schirmen, folgen alle ewigen Schlauberger einer Abkürzungsempfehlung von Google Maps für den Hang mit lauter verzweigten Wegen und nur einer ausgewiesenen Straße zu der Ortschaft T. am östlichen Seeufer. Gleich hinter seiner Zufahrt aber kommen sie an eine Engstelle und können nur noch rückwärtsfahren, bis sie auf der abschüssigen Zufahrt wenden wollen, oft schon im Dunkeln, und mit durchdrehenden Reifen scheitern und aus ihren panzergroßen Autos steigen, wenn er schließlich auftaucht, um ihnen mit Kinostimme zu sagen, dass guter Rat jetzt wohl teuer sei.
Schongauer scheut sich, diese Stimme zu erheben, und er würde sich auch am liebsten nicht zeigen – erst vor kurzem kam unten im Ort eine ältere Urlauberin auf ihn zu, sie nahm seine Hände und rief Ich kenne Sie, ich habe Sie in einem Film gesehen, nur eine kleine Rolle, aber was für ein Deutscher Sie da waren! Leben Sie hier? Und bei der Frage hat sie ihn so angeschaut, als könnte er ihr im Urlaub Gesellschaft leisten, und er hat Nein gesagt. Nein, meine Dame, tut mir leid, und überhaupt, Sie müssen mich verwechseln! Mit diesen Worten ist er geradezu geflüchtet vor dem Hall der eigenen Stimme in einer der schmalen Quergassen des Orts – der Stimme, die immer noch die ist, die zu seinen Rollen gepasst hat und aus einem noch immer jungen, wie an der Zeit vorbeigeschleustem Mund kommt, Teil eines Gesichts, das einst für alles ungut Deutsche gut war, jedenfalls nach amerikanischer Vorstellung, um Leute zu spielen, die nie das Ende eines Films lebend erreichten. Und immer noch versucht da wer, in seiner Zufahrt zu wenden, schon stinkt es nach verbranntem Gummi.
Sich zurückziehen oder erscheinen, Schongauer überlegt, was er tun soll; in der Zufahrt könnte sich auch jemand festgefahren haben, den er erst morgen erwartet, eine Frau, die ihn mit einem Porträt noch einmal ans Licht der Welt holen will. Und da ist noch etwas, das ihn zögern lässt: Die Hündin, ihrem Wesen nach ein Hütehund, aufgelesen in Rumänien, jault jetzt, als wäre da wer, den sie zu kennen glaubt, also lässt er sie von der Leine, und sofort rennt sie dorthin, wo eben noch ein Motor zu hören war. Nun gibt es kein Zögern mehr, nun muss er sich zeigen und folgt der Hündin, vorbei an einem Schuppen bis zu seiner steilen Zufahrt. Und dort steht erstens ein Wohnmobil hoffnungslos quer, und zweitens kniet eine junge Frau vor seinem Tier und hält ihm die Hände zum Riechen hin – das sieht er noch, bevor er sich wegdreht und auf das schaut, was die Reifen angerichtet haben, besser aber gar nicht da wäre mit bloßem Oberkörper, dazu unrasiert und in der Hand die Waffe gegen eine – falls er das richtig erfasst hat – in schwarzen Fetzenshorts und flattrigem Unterhemd, das Haar jungenhaft kurz und zwischen den Brauen zwei Furchen, die aber zu weichen Wangen, ein Mädchengesicht. Eigentlich hat er schon zu viel gesehen und muss sich einen Ruck geben, um zu sagen, was er in solchen Fällen immer sagt: So, und jetzt ist guter Rat wohl teuer – Worte, die er gern auf der Stelle zurücknehmen würde, aber gesagt ist gesagt.
Ich war auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und hab mich verfahren, erwidert die Besitzerin des Wohnmobils, dabei schon eine Hand im Fell der Hündin. Ich wollte hier nur wenden, und Sie tauchen mit einer Waffe auf.
Schongauer weiß nicht, was er dazu sagen soll; er weiß auch nicht, wohin mit der Waffe, die Nachthose hat keine Taschen; er könnte sie höchstens hinter den Rücken nehmen, was aber etwas von Heimtücke hätte. Er weiß nur, dass diese trügerisch mädchenhafte und vielleicht auch trügerisch tierliebe Wohnmobilfahrerin samt ihrem Gefährt schnellstens von seinem Grundstück soll. Ich will Ihnen nichts tun, sagt er, ich will bloß helfen, dass Sie von hier wegkommen.
Und wozu die Waffe, weil mich Ihr Hund mag?
Hündin, sagt Schongauer. Und wenn sie nicht bellt, ist das kein Zeichen für Sympathie.
Und wofür dann?
Eine Entgegnung mit ruhiger Stimme, gleichzeitig zieht sie das Gerät, das sie in die Irre geführt hat, aus der Gesäßtasche und macht ein Bild vom Scheitern ihres Wendemanövers: das Wohnmobil quer auf der Zufahrt. Und ist es erlaubt, auch ein Foto von dem Hund beziehungsweise Ihrer Hündin zu machen?, fragt sie, eine fast ironische Formulierung, wie er findet, aber der Gipfel ist, dass sie die Hündin nach deren Namen fragt, statt sich an ihn zu wenden. He, wie heißt du?
Ihr Name ist Ascha, sagt er, und im Zuge dieser Antwort geht die Sprache, die er hier auf dem Hang und unten am See in den letzten Jahren immer weniger gebraucht hat, mit ihm durch. Und Sie, haben Sie auch einen Namen?
Frida. Nur mit i. Wie alt ist Ascha?
Noch eine Neugierfrage, die er übergehen sollte; besser, er macht sich Gedanken, wen er um die Zeit noch anrufen könnte wegen des Wohnmobils, damit sie nicht die Nacht bei ihm zubringt – ein schier unlösbares Problem kurz vor Ferragosto, wo auch die Fleißigsten schon dem Sommerhöhepunkt entgegenfeiern. Nur Luan der Albaner fällt ihm ein, zwar kein Mechaniker, aber ein Alleskönner und einer der wenigen im Ort, die nicht viel reden, der dafür ständig raucht und vor sich hinschaut, dass man schwach wird: von einem Filmgesicht, auf dem er sitzen geblieben ist, ohne dass er es wirklich weiß, und er, Schongauer, hütet sich auch zu sagen: Luan, du siehst aus wie der junge Franco Nero! Ihn könnte er anrufen, um Hilfe bitten. Aber vorerst nennt er doch das Alter der Hündin, fünf, etwas heruntergemogelt wie die eigenen Jahre.
Und vielleicht von dieser Zahl ermuntert, nennt die Neugierige gleich auch ihr Alter. Vierundzwanzig.
Vierundzwanzig? Kaum zu fassen ist das für Schongauer, wie jemand dieses Alter für sich beanspruchen kann, aber das Ganze ist kaum zu fassen, höchstens zu glauben; die also Vierundzwanzigjährige, jetzt auf den Beinen, Staub an den Knien, sieht ihn an, mit ihren Furchen zwischen den Brauen wie eine Schwester von Caravaggios Judith, die Holofernes den Kopf abschneidet, das hat er voriges Jahr in einer Ausstellung gesehen, das Bild. Und wieder wäre er am liebsten nicht da, ohne die Versuchung, etwas zu sagen, das die Dinge nicht im Geringsten verbessert, und der er auch glatt erliegt – Wissen Sie, was mal eine zu mir gesagt hat, als ich in dem Alter war und es ihr dummerweise genannt hatte: Nobody is twentyfour!
Wer sagt denn so was? Sowas sagt kein Mensch.
Schongauer kann dem nur summend zustimmen. Er hatte diesen Vorfall fast vergessen – ein Grund mehr, das Ganze hier schnell zu beenden, er hat schon genug Erinnerungen am Hals. Eine berühmte Schauspielerin war das, erklärt er.
Und welche?
Die werden Sie nicht kennen, sagt Schongauer, sie ist auch schon tot.
Aber Sie kannten sie. Und woher?
Das spielt keine Rolle – Frida wie Frida Kahlo?
Schongauer kann auch nicht anders, als das zu fragen, und sie darauf: Nicht Frida wie, nur Frida ohne e. Gibt es unten im Ort eine Autowerkstatt? Eine von ihrer Seite berechtigte Frage, und er vermag nur den Kopf zu schütteln, auch über sich – der nicht den Mund hält wie sonst. Ja, die gibt es, sagt er. Aber nicht um Ferragosto herum, der höchste Feiertag hier, im Sommer. Und Sie sind allein unterwegs? Worte, die er schon bereut, als sie mit nur kurzem Heben und Fallenlassen einer Hand antwortet. Schongauer zieht die Hündin jetzt zu sich, als hätte sie keinen eigenen Willen; er sieht zu dem Wohnmobil, immer noch mit Gequalme aus dem Motorbereich, nur um die Fahrerin nicht länger anzusehen, als es ihm und vielleicht auch ihr guttut. Ich nehme an, die Kupplung ist am Ende.
Kennen Sie sich aus?
Man riecht es, sagt er.
Gerochen hat sie von Anfang an. Und noch zu meinem Namen: Ich weiß, dass es eine junge Mexikanerin gab, die vor eine Straßenbahn gelaufen ist und später ein Leben lang einem bekannten Fassadenmaler gefallen wollte mit ihren Bildern von sich als Opfer. So war es doch? Sie lächelt, und Schongauer sagt: Diego Rivera, so hieß der Maler.
Danke. Und Sie heißen?
Noch was, das sie eigentlich nichts angeht, und er macht ein paar Schritte und hebt die Hände, die Bitte um etwas Geduld – ab wann ahnt man, dass jemand zum Prüfstein des eigenen Lebens werden könnte, doch nicht schon nach zehn Minuten. Die auf seinem Grundstück Gestrandete schließt zu ihm auf, inzwischen barfuß, Flipflops in der Hand, und da nennt er, als hätte er getrunken oder sich sonstwie vergessen, seinen vollständigen Namen. Louis Arthur Schongauer.
Was nun, Louis oder Arthur?
Meine Mutter hat immer Louis gesagt, mein Vater nur L. A., er war Amerikaner. Sergeant bei der Army. Und Sie sind allein unterwegs, darf ich das fragen?
Das haben Sie schon gerade. Ja, allein. Und jetzt darf ich auch noch was fragen: Sie sind hier ganz für sich?
Meistens, sagt Schongauer und redet dann einfach weiter, gegen jede Gewohnheit – aber morgen erwarte ich jemanden. Ich dachte schon, als hier die Reifen durchdrehten, die Betreffende hätte sich im Datum geirrt. Zum Glück nicht.
Und was hätten Sie da gemacht? Wären Sie auch mit der Waffe gekommen? Hätten Sie gerufen: Sie sind zu früh!
Schongauer weiß nicht, was er dazu sagen soll, weil es irgendwie stimmt, auch wenn er das nie rufen würde. Aber er kann so schauen. Und muss morgen sehr aufpassen, dass er nicht so schaut, auch mit Furchen zwischen den Brauen, aber hohlwangig. Am besten wäre es, diese freie Autorin, wie sie sich nennt, würde gar nicht kommen. Ihre Anfrage in Form eines Briefs mit Ja beantwortet zu haben, war ein Fehler, sein erster, seit er sich zurückgezogen hat, geschehen aus Schwäche für eine leicht nach rechts geneigte Schrift, tiefblaue Tinte, am Ende ein, zwei Spritzer bei ihrem Namen, Almut Stein, durch zu viel Druck auf dem S, kleine Tropfen, die sie mit Tipp-Ex etwas verdeckt hat, statt die Seite neu zu schreiben; und diese Blöße, die hat ihn leichtsinnig gemacht. Er hat dann auch gar nicht erst nach Fotos von ihr gesucht, um sich das Bild einer nervösen Briefeschreiberin zu erhalten.
Die bei ihm Gestrandete – ihren Namen wagt er noch kaum zu denken – lehnt sich an das Wohnmobil, und er zeigt ihr die leere Trommel der Waffe.
Nichts drin, sagt er.
Und wozu dann?
Um mich zu beruhigen. In letzter Zeit gab es zu viele, die hier gewendet haben. Oder es versuchten und stecken blieben, wie Sie. Und? Was geschieht jetzt? Schongauer schaut an sich herunter, auf zu lange Fußnägel. Er überlegt, was am besten wäre, aber das Denken fällt nicht mehr so leicht, wenn man plötzlich zu zweit ist. Die Gedanken machen, was sie wollen, ebenso die Augen, die schon wieder zu ihr sehen – auch mit ihrer Figur erinnert sie an eine Gestalt, die es nicht gibt, den Bacchus von Michelangelo in seinem so Weichen und doch Stabilen, wie sie da an ihr alles andere als neues Wohnmobil gelehnt steht, halb zurückgeneigt, als wollte sie es in seiner Schrägstellung quer auf der Zufahrt abstützen. Und dann klingelt auch noch ihr Telefon nach einer Melodie, die kaum zu ihr passt, oder höchstens passt, wenn man sie näher kennt, einem sommerlich beschwingten Kirchenlied, das glaubt er herauszuhören, nur fehlt ihm der Name, aber überhaupt fehlt ihm im Augenblick alles Mögliche, nicht nur eine Lösung für das Ganze, auch das dicke Fell für ein Machtwort und als Ersatz ein Glas Wein. Ich hol uns mal etwas zu trinken, sagt er. Und telefoniere gleich, damit Sie heute noch weiterkommen.
Schongauer geht ins Haus, während die Hündin, und er wüsste zu gern, warum, bei dem Wohnmobil bleibt – wegkommen hat er eigentlich sagen wollen, aber nach dem Wörtchen Uns ist das nicht mehr gelungen. In seinem Kühlschrank gibt es außer Butter, Käse und Eiern nur eine Dose mit Makrelenfilets, ein Bier und zwei Flaschen Wein, den Wein schon im Hinblick auf die Frau, die ihn besuchen will, einen einfachen Custoza aus der Gegend, den wird er jetzt anbieten. Der Albaner ist auch später noch erreichbar, wobei er kaum sagen könnte, wie spät es im Moment ist, von der Dunkelheit her wohl schon nach neun. Seine klarste Zeitvorstellung ist die von dem Besuch am morgigen Vormittag, und bis dahin sollte das Wohnmobil weg sein, das heißt, vor allem die junge Fahrerin, die nur Fragen aufwirft.
Er bringt noch die Waffe dorthin, wo sie ihren Platz hat, in der Nachttischlade bei den letzten Patronen, dann geht er, die Flasche und zwei Gläser in der Hand, wieder ins Freie, mit einem Gang ganz aus der Hüfte, auch wenn die auf ihre Art knirscht. Er ist so gut wie fünfundsiebzig, und bis auf diesen Gang, seinen Mund und die auch verwirrende Stimme passt alles an ihm dazu; sein Haar ist grau bis weiß, das Grauweiß einer Asche wie der, in der er die Hündin gefunden hat, halbtot als Welpe, gewärmt von der Asche, daher ihr Name. Seine Augen, früher leinwandtauglich, inzwischen durch Falten verengt, haben die Farbe von altem Laub mit einer Spur Rot darin – great burning eyes, so hieß es vor langer Zeit im Variety Magazine, Augen für Blicke, an denen man hängen bleibt, wenn man selbst in der Luft hängt. Schongauer kennt diese Wirkung, nur glaubt er nicht mehr an sie; eher glaubt er, dass seine Augen eintrüben, oder warum verschwimmt das Geäst der Oliven, unter dem Frida – probeweise denkt er jetzt schon ihren Namen – telefonierend hin und her läuft, wie um der Person am anderen Ende damit auszuweichen, einer, der sie halblaut erklärt, wo sie festsitzt und sogar bei wem: So einem, sagt sie, stell dir das vor, der was mit berühmten Schauspielerinnen zu tun hatte, Louis Arthur Schongauer sein Name.
Da hat er nun gar nicht aufgepasst, da hat ihn die eigene Sprache überrannt, auch weil er aus der Übung ist, mit Frauen zu reden, einer so jungen erst recht. Er geht auf sie zu, und als sie ihn sieht, beendet sie das Telefonat auf nicht besonders freundliche Weise: Schluss, ich komm hier ohne dich zurecht, ruft sie und kappt die Verbindung und schiebt das Gerät wieder in die Gesäßtasche, mit der anderen Hand zeigt sie auf ihr Wohnmobil: Ob das über Nacht hier stehen bleiben könne.
Wegzaubern lässt es sich nicht, sagt er.
Also kann ich hier auch schlafen?
Dazu steht es zu schräg. Möchten Sie ein Glas Wein?
Und Frida wiegt den Kopf, aber nickt dabei, also füllt er ein Glas und reicht es ihr – eigentlich beruhigt es ihn, wenn eine Frau mit ihm trinkt, nur waren die immer älter, manche kaum jünger als er, mit nur einer Ausnahme, an die er nicht denken will. Prost, sagt er, um eins der kaum noch gebrauchten Wörter seiner Sprache zu verwenden, und sie nippt an dem Wein; noch mit dem Glas am Mund fragt sie ihn, wen er da morgen erwarte, und ob sie bis dahin wegsein müsse – ich kann mich unsichtbar machen, okay? Sie schaut ihn über den Glasrand an, mit einem Blick wie aus alten Filmen, etwa To Have And Have Not, nur ist er nicht der Mann, der erweicht werden muss, um Leute nachts in einem Kahn von einer gefährlichen Insel wegzubringen; er muss und will zu gar nichts erweicht werden und hat auch hier nur ein Boot an einer Boje, um über den See zu fahren und in der Stille vor einer Felswand zu schwimmen. Dort ist das Schöne sogar das Gute, und er muss aufpassen, dass ihn die Trägheit seiner Augen nicht auf allzu Schönes lenkt, was sich dann ausdehnt, ihn überschwemmt. Wir werden sehen, wie Sie hier wegkommen, erklärt er. Hauptsache, Sie kommen weg. Oder was denken Sie? Eine noch angehängte, fast schon bange Frage mehr an sich selbst – was er eigentlich will oder nicht will, aber vielleicht doch will: dass sie nicht gleich wieder weg ist.
Ich denke, Sie können Du sagen, antwortet die Gestrandete, jetzt eine Hand an der Wange, den kleinen Finger so am Mund, dass es schon zu viel wird für das Auge und er zu dem Zypressenpaar sieht. Up to you, erwidert er und würde gern in der Sprache bleiben, die ihn mit ernährt hat und Teil seiner Kindheit war mit einem GI als Vater, bis der eines Tages verschwand und eine Mutter zurückblieb, die aus dem Weinen kaum mehr herauskam. Meinetwegen übernachte hier, sagt er. Morgen sehen wir weiter, es gibt hier einen, der kann deine Karre unter Umständen wieder flottmachen.
Schongauer nimmt noch einen Schluck Wein. Sein Blick geht von dem Zypressenpaar zu der, die schon mit ihm trinkt, und von ihrem Mund zu ihren Füßen und zu den eigenen Füßen: Die Zehennägel sollte er noch in dieser Nacht kürzen. Er nippt am Wein und sieht jetzt zu den Bergen auf der anderen Seeseite, ihrer dunklen Masse über den Uferlichtern. Schon seit ein paar Nächten gibt es dort Wetterleuchten bei zunehmender Schwüle; noch in der Woche, vielleicht schon übermorgen, wird das große Augustunwetter niedergehen, er kennt das, seit er auf dem Hang wohnt.
Ob das ein wichtiger Besuch sei, den er erwarte, fragt Frida, und er sagt, es sei nur eine Autorin, die etwas über ihn schreiben wolle. Mehr sagt er dazu nicht, was das wenige nur noch vergrößert. Und Sie oder du, was tust du im Leben?
Was ich tue? Sie lächelt für einen Moment, in ihren Fetzen von Kleidung auf einmal wie herausgeputzt. Auch schreiben, sagt sie. Aber über meine Reise. Und warum schreibt eine Autorin über Sie, sind Sie wer, sind Sie bekannt? Mit einem zweiten Lächeln kommt das, einem von der Sorte Erzähl-mir-nichts, und da ist er versucht, ihr erst recht etwas zu erzählen, eben dass er mal in Hollywoodfilmen mitgespielt hat, aber immer nur Kurzrollen als Nazi-Deutscher, ein supporting character für die Stars. Nein, sagt er, nein, ich war nie bekannt, ich war nur L. A. Schongauer für ein paar Jahre. Gehört das alte Wohnmobil deinen Eltern?
Das gehört mir. Mein Vater findet es schrecklich, meine Mutter noch schrecklicher. Normalerweise sind sie sich nur einmal im Jahr bei den Bayreuther Festspielen so einig.
Schongauer sieht über den nunmehr nächtlichen See mit Lichtpunkten von den Bojen der Fischer. Die letzte unter dreißig, die bei ihm nicht lockergelassen hat, war die, an die er nicht denken will, noch vor seiner Ehe. Und du schreibst also über deine Reise, sagt er und riskiert erneut einen Blick: Sie jetzt im weißbläulichen Licht ihres kleinen Schirms, ohne dadurch zu verlieren und im Begriff, etwas zu schreiben, nur mit den Daumen auf noch kleinerem Raum, als wären Daumen in der Menschheitsgeschichte noch bis vor kurzem an ihrer wahren Bestimmung vorbeigegangen; offenbar sucht sie etwas und findet es auch schnell. Sie betrachtet ein, zwei Bilder und nickt vor sich hin, womöglich Bilder von ihm, falls sie seinen Namen eingegeben hat – da hält sich noch manches im Netz, das für ihn längst gestorben ist. Ob sie ihn gesucht habe, fragt er, und sie wischt sanft mit dem kleinen Finger über den Schirm, damit die Bilder verschwinden. Nein, nur nach etwas, was ich bei Ihnen gesehen habe, erklärt sie. Ich schreibe einen Reiseblog, da muss man genau sein.
Und verdient man damit auch was?
Kommt darauf an, wie viele ihn lesen. Aber bei mir gibt es keine Hotelwerbung, nur Landschaften, schöne Orte und schöne Dinge. Ich schreib auch noch, was heute war.
Erst muss dein Fahrzeug mal gerade stehen, sagt Schongauer – wie wär’s, wenn ich das mache? Er tritt etwas zurück und plant sein Rangieren, eins fast ohne Motor, mehr mithilfe von Schwerkraft und Bremse; auch wenn er selbst kein Auto mehr hat, kennt er jede Ecke der Zufahrt. Geh besser zur Seite, ruft er beim Einsteigen. Falls das Ding umkippt.
Aber das knochenfarbene Wohnmobil bleibt auf seinen vier Rädern bei dem Manöver mit nur wenig Unterstützung durch den Motor, damit nicht noch mehr kaputtgeht, aber umso mehr Geschicklichkeit am Steuer und Gefühl auf der Fußbremse. Schongauer lenkt es in eine horizontale Position, mit der Front zu einem Brunnen zwischen Haus und Schuppen. Für eine größere Reparatur müsste es abgeschleppt werden, möglich erst nach Ferragosto, kleinere Schäden könnte sein Bekannter hier beheben, Freund wäre etwas zu viel gesagt – der Albaner hat ihm gezeigt, wie man ein altes Haus innen erneuert, aber Luan zeigt ihm auch, wie man auf einem Filmgesicht ohne Verbitterung sitzen bleiben kann.
Er steigt wieder aus, und sein Tier springt ihm entgegen, gefolgt von Frida. Ob sie schon gegessen habe, fragt er, und ob sie sein Bad benützen möchte, fragt er auch, um nicht unhöflich zu sein, während sie nicht besonders höflich abwinkt. Für eine Nacht habe ich alles selbst, erklärt sie, und wie zum Beweis steigt sie in ihr Gefährt und macht darin Licht – ein Licht, das aber alles eher verdunkelt, was sie betrifft, so rötlich wie es scheint. Und er will schon fragen, was es auf sich hat mit diesem Licht, da klingelt im Haus sein Telefon, gerade noch hörbar mit einem Ohr, das andere ist seit Langem taub – ein Klingelton nach dem Refrain eines Uraltschlagers, den seine verlassene Mutter oft vor sich hin gesummt hat. Dann bis morgen, ruft er in die offene Wohnmobiltür, und da erscheint die junge Fahrerin noch einmal, in der Hand ein Stück Käse, das sie Ascha hinhält, ohne gefragt zu haben, was sein Tier verträgt und was nicht. Ich weiß, dass ich nur störe, sagt sie. Aber morgen bin ich weg.
Das hat er schon mal gehört, vor vielen Jahren, nur in anderer Sprache, und dann war jemand so weg, dass es für ihn nichts mehr zu retten gab, er nur noch hoffen konnte, dass alles irgendwie gut würde, was er da angerichtet hat aus einem Leichtsinn, eine Erklärung, an die er sich nachts manchmal noch klammert, wenn ihm das alles nach einem bösen Traum wieder einfällt – Schongauer geht auf die Hündin zu, vorbei an Myrtensträuchern, die er gepflanzt hat, an Rosmarin- und Kapernbüschen und einem Oleanderbaum, den es schon vor ihm gab, die Blüten wie rot lackiert. Eigentlich sollte er müde sein um die Zeit, aber er ist so wach wie seit Jahren nicht mehr. Etwas ist passiert, das ihn auf den Beinen hält, die Erosion in ihm aufhebt, sich über das Verwüstete legt – er kennt sich ganz gut, aber nicht gut genug. Amateur, hatte ihn seine Frau genannt, wenn es ums Innere ging – diese Wachheit, das spürt er, hat etwas Tückisches, wie bei dem Esel, dem es zu wohl ist. Ruhe bewahren ist jetzt das Gebot, ein Fernseher wäre im Augenblick hilfreich, aber im Haus gibt es nicht mal die Buchse dafür. Frida die Gestrandete schaut ihn an, sie lächelt, und er fragt sich, warum. Irgendwie überrennt sie ihn, ohne viel zu tun, wie ihn auch Almut Stein still überrannt hat mit ihrem handgeschriebenen Brief, am Ende die Blöße der überdeckten Tintenspritzer, mit der sie offenbar leben kann. Hör mal, eins will ich noch wissen, sagt er, ein Anlauf gegen den Esel in sich – diese Autopanne bei mir, landet die auch in deinem Blog?
Pannen gehören zu einer Reise.
Nur lass mich dabei raus.
Eine Bitte höchstens dem Ton nach, und die Vierundzwanzigjährige – er kann das nur einfach glauben, dass eine so jung sein kann – fährt sich mit beiden Händen durchs Haar, geschnitten nach rüder Jungsart, die Ohren frei. Wie Sie wollen, Sie können gern alles lesen, sagt sie – Hashtag Reiseblogs, Frida Slash, Geh aus mein Herz und suche. Und Ihre Waffe ist, wenn ich das eben richtig gesehen habe, ein Revolver. Smith & Wesson, Kaliber .357 Magnum, kurzer Lauf. Gute Nacht.
2
Schongauer spürt sein Herz, wie es arbeitet, um ihn auf den Beinen zu halten und dabei noch denken zu lassen, statt sich nur zu fragen, woher Frida die Ruhe genommen hat, so genau hinzusehen bei dem Gegenstand in seiner Hand. Und am Telefon ist auch noch die, die ihn morgen besuchen will – vorgesehen war, dass sie schon an diesem Abend in ihrem Hotel am kleinen Hafen von T. eintrifft, aber es hat sich etwas geändert bei ihr, das im Unklaren bleibt, das nur in der Stimme mitschwingt. Sie kann erst morgen ganz früh von ihrem Wohnort am Taunusrand losfahren und will im Laufe des Nachmittags eintreffen: um dann schon mal bei ihm vorbeizuschauen für ein erstes Kennenlernen. Ihre Stimme hat etwas wie von Leuten, die vorgeben, auf beiden Beinen zu stehen, obwohl sie am Boden liegen; er hat Kollegen mit solchen Rollen gelegentlich synchronisiert und dieses versteckt Niedergeschlagene anklingen lassen.
Nehmen Sie sich Zeit, sagt er in dem Gedanken, dass dann kein halbes Mädchen bei ihm vielleicht noch ihre Wäsche trocknet, und am anderen Ende entsteht eine Stille, die ihn beunruhigt; letztlich weiß er nicht recht, was die Autorin Stein von ihm will. Noch kennt er sie nur durch ihren Brief, darin zwar etwas zum Werdegang – Masterstudium, Schwerpunkt Medien, Arbeit im Filmmuseum, tätig für Zeitschriften und das Radio, Gespräche, Features, Kritiken –, aber das sagt ihm höchstens, dass er aufpassen muss. Sollte es aus irgendeinem Grund später werden, melde ich mich von unterwegs, erklärt sie in die Stille hinein, und es ist auch ihre Stimme, die ihn alarmiert und dabei hinhören lässt, nicht weil sie etwa hell oder auf andere Art auffallend wäre, sondern weil in ihr etwas Schleppendes liegt, wie durch ein abwägendes Denken vor jedem Wort. Nehmen Sie sich Zeit, sagt er noch einmal, und sie sagt, wieder nach einer Pause: Wir beide sollten uns dann Zeit nehmen, um über alles zu reden, auch über Ihre Ehe. Also rechnen Sie mit mir am Nachmittag.
Von seiner Ehe ist in dem Brief nicht die Rede gewesen, aber bevor er noch etwas einwenden kann, hat die Stein – im Moment sieht er sie so: als Kategorie – aufgelegt, und er ist wieder für sich mit einem Tier, das außer Futter nur eins von ihm will: seine Anwesenheit und Begleitung, auch auf langen Gängen den Hang ganz hinauf, wenigstens einmal am Tag. Schongauer sitzt auf einem schwärzlichen Ledersofa, neben ihm liegt die Hündin, eingerollt; es ist das Sofa, das ihn seit Jahrzehnten begleitet, das einzige gute Stück schon in seiner gemieteten Bleibe am Rande von West Covina, damals eine noch bezahlbare Vorstadt der Filmmetropole, einem einstöckigen Holzhaus mit Tausendernummer in einer Gegend der schier endlosen geraden Wohnstraßen ohne Zäune, im Hintergrund die San Gabriel Mountains.
Die Töne zweier Zikaden dringen durch die offene Haustür, ein zwiegesprächhaftes Zirpern, kein hysterisches wie das in der Nachmittagshitze, wenn es aus jedem Baum schrillt. Er hat sich Wein nachgeschenkt, von dem Custoza für drei Euro die Flasche, aber hält das Glas nur an den Mund – eben hätte er alles noch absagen können, warum eigentlich nicht? Ausgemacht war nur ein Gespräch über seine Filmjahre, nicht über seine Ehe mit Magdalena Reinhart, als Tierfotografin bekannter, als er es je war. Es gibt keinen Tag, an dem er nicht an sie denkt; das kann so weit gehen, dass er manchmal ihre Stimme zu hören glaubt, wenn er vergessen hat, das kleine Radio in seinem Bad abzustellen. Und ihre letzte Arbeit hängt als großer gerahmter Abzug an der Wand hinter dem Sofa, ein totes Pferd an einem öden Strand bei Dakar, zu sehen auch eine gewaltige Brandung, in der sie unbedingt schwimmen wollte und darin umkam, während er ihre Ausrüstung bewacht hat. Die Zikaden verstummen, eins der Rätsel dieser unscheinbaren, kaum zu entdeckenden Tiere – von Magda so ins Bild gebracht, schwarzweiß mit feinen Schattenstufen, als wären es musikalische Wesen aus einer anderen Galaxie.
Schongauer kommt vom Sofa hoch, gleichzeitig mit der Hündin, die ins Freie läuft, während er in die Küchenecke des Wohnraums geht. Er stellt die Weißweinflasche in den Kühlschrank und überschlägt, was er einkaufen müsste, um sich irgendwie gastlich zu zeigen, frischen Käse, ein Brot und vielleicht auch Salami, dazu Trauben und besseren Wein, Hafermilch und auch ein Zusatzpäckchen Kaffee. Vom Küchenbereich geht er in das angrenzende Schlafzimmer, eher eine Kammer für die Nacht, und das schon, als dort noch Erntehelfer schliefen und neben dem Brunnen ein Esel stand, zu sehen auf alten Fotos, der Esel, um Körbe voll Oliven in den Ort zu tragen. Er holt sich ein Hemd und öffnet das Fenster für eine nicht mehr ganz so stickige Luft, danach geht er ins Bad.
Dort hat er die Wände geweißt, was den Raum größer erscheinen lässt, und an prägnantester Stelle einen gerahmten Kunstdruck aufgehängt, nach einem Kupferstich von Martin Schongauer, den er gern als Vorfahren hätte, wobei eine Linie zu ihm nicht ganz abwegig ist. Der Stich zeigt die Versuchung des Heiligen Antonius durch weibliche Schauderwesen und ist so gehängt, dass man ihn, auf dem Klo sitzend, vor sich hat; dazu griffbereit das gleichnamige Buch von Flaubert, wie andere dieses Örtchen mit einem Comic bereichern. Er holt sich seine tägliche Tablette gegen Bluthochdruck, und für morgen sollte er wohl die Dosis erhöhen; das letzte Gespräch mit einer so erwachsenen Frau liegt schon Jahre zurück, und er weiß nicht, ob er noch den Wunsch und auch den Schwung hat, von sich so abzusehen, dass er bei ihr hinhören kann, vorsorglich nimmt er eine Zusatztablette. Dann tritt er noch einmal vors Haus, um nach der Hündin zu schauen.
Sie sitzt vor dem Wohnmobil, und auf der Stufe in das rötlich erleuchtete Innere sitzt die gestrandete Fahrerin, im Gesicht und im Haar den Schein eines Notebookschirms; sie hat das Gerät auf den Schenkeln, und zwischen ihren Knien ist die Schnauze von Ascha, etwas, das sein Tier eigentlich nur bei ihm macht, wenn es bettelt, aber was heißt schon eigentlich bei einem Tier, das nichts von Treue und Untreue weiß und auch nichts von der eigenen Schönheit. Schongauer schließt zwei Knöpfe an seinem Hemd. Haben Sie alles für die Nacht, fragt er. Brauchen Sie noch etwas Wasser?
Wollten Sie nicht Du sagen?
Brauchst du noch Wasser?
Danke, das hab ich selbst.
Schongauer spürt, dass er sich zurückziehen sollte, ohne ein weiteres Wort. Aber etwas hält ihn noch, sogar auf den müden Beinen, etwas, von dem er geglaubt hat, es sei schon so geschrumpft in ihm wie außerhalb von ihm ein Gutteil seiner Rücklagen – Neugier wäre zu viel gesagt, Interesse zu wenig, und im Grunde ist es auch nur Sache der Augen, die alles aufnehmen, alles schlucken und die er jetzt besser auf das Wohnmobil richtet als auf die junge Fahrerin. Möchten Sie vielleicht wissen, wie es bezahlt wurde?, fragt sie, als hätte er etwas in der Richtung geäußert. Ich habe abends bedient, Leuten Bier und Spritz gebracht und ihnen Chips hingestellt, immer wieder frische, dazu gelächelt und Trinkgeld bekommen. Darf ich was zu Ihren Filmrollen fragen – wieso haben Sie immer nur Nazis gespielt? Kann man nachlesen unter L. A. Schongauer, der sind Sie doch.
Der war ich mal. Und von irgendwas muss man in Hollywood leben. Als Deutscher.
Trotzdem.
Trotzdem was? Ich war ja kein sympathischer Nazi, bei mir sahen sie einfach aus, wie sie waren. Fragst du immer so viel?
Nur wenn was unklar ist. Aber morgen bin ich weg.
Hoffen wir’s mal, sagt Schongauer, auch wenn er das gar nicht sagen will oder wollte, ihm da schon wieder etwas entschlüpft ist, und dabei bleibt es nicht – Nun darf ich auch noch eine Frage stellen: Was soll das Licht in deinem Wohnmobil, das einen auf alle möglichen Gedanken bringt?
Nicht auf alle möglichen, nur auf einen, entgegnet ihm Frida und schließt ihr Gerät, so lächelnd, wie sie vielleicht bei den Extrachips gelächelt hat, mit einem Hauch von Verachtung. Unten im Ort schlagen die Kirchenglocken, und nach dem letzten Ton ziehen die Glocken von Albisano nach, als gäbe es eine kleine Zeitverschiebung zwischen dem See und dem Ort auf dem Hang. Schongauer spielt ein Gähnen, was ihm leichtfällt, aber seine Mitbewohnerin für diese Nacht sagt zu der Sache mit dem roten Licht noch etwas mehr, und er erfährt, dass sie aus Heidelberg kommt und während der Pandemie am Stadtrand ein Stellplatz für Wohnmobile, in denen Frauen von sonstwo angeschafft hätten, geschlossen worden sei und einige der fahrbaren Nester billig zu haben waren. Sie streichelt sein Tier, während sie spricht, und er hört fast mehr auf ihre Stimme als auf die Worte und schaut dabei über den See, zu der Stunde so glatt, als könnte man darauf gehen. Alles schön und gut, sagt er, als ihre Erklärung beendet ist. Aber ich könnte morgen, wenn du von hier nicht wegkommst, ein anderes, normales Licht besorgen. Das schraub ich rein.
Nein, sagt Frida. Das rote Licht bleibt.
Schongauer sieht sie Momente lang an, ihr Mädchenhaftes mit dem so anderen, vor sich selbst erschrockenen Ausdruck darin. Dann endgültig gute Nacht, sagt er und geht, gefolgt von der Hündin, wieder ins Haus; er geht in sein Bad, wo er einen Fuß auf den Klodeckel stellt, um sich die Nägel zu schneiden, eine Prozedur im Bücken, bei der er den Atem anhält und sich nach jedem Zeh etwas aufrichtet und nach Luft schnappt, den gerahmten Druck auf Augenhöhe, eins der wenigen Geschenke an sich selbst, genauer als jeder Spiegel: ein Eremit, verzweifelt bemüht, den Kopf und mehr noch die Seele aus der weiblichen Schlinge zu ziehen, um eher in Einsamkeit zu verglühen, als sich der Versuchung zu ergeben und dahinzuschmelzen. Aber so würde er das auf Nachfragen der morgigen Besucherin, die irgendwann das Bad benutzen wird, nicht beantworten. Er würde nur sagen, es sei ein Druck nach einem Kupferstich seines denkbaren Vorfahren, angebracht an der Stelle, um sich einmal am Tag darin zu vertiefen.
Schongauer löscht das Licht über dem Spiegel und pfeift auf den paar Schritten zum Bett einen Doppelton, auf den Ascha so hört wie auf einen zweiten, geheimen Namen.
Und schon kommt sie krallentippelnd von ihrem Platz auf dem kühlen Steinboden im Wohnraum, springt zu ihm aufs Bett und reibt den Kopf an seiner Schulter. Lange hatte er gedacht, Mensch und Tier seien zweierlei, unvereinbar, aber so ist es nicht, sie gleichen sich in vielem. Erst kürzlich hat er gelesen, dass Einsiedlerkrebse, die beim Betreten ihrer Höhle einen Stromschlag erhielten, dort nicht mehr hineinkrabbeln; zwingt man sie aber dazu, wägen sie später offenbar ab, wie viel an Schmerz sie zu ertragen bereit sind, um ihre Behausung für die Nahrungssuche wieder zu verlassen. Und gleichwohl ist immer noch strittig, ob Tiere Gefühle haben; unstrittig ist dagegen, dass sie Schmerzen empfinden, weil sie sich merken können, wann und wo ihnen etwas Schmerzhaftes zugestoßen ist. Ascha, geboren im glimmenden Müll einer rumänischen Vorstadt, muss in den ersten Wochen ihres Lebens viel ertragen haben, was sie noch in sich trägt. Nähern sich Kinder mit ihren jähen Bewegungen, knurrt sie; hört sie hinter sich Schritte, dreht sie sich immer wieder um; kommt ihr ein fremder Hund entgegen, macht sie sich flach, zu allem bereit. Und war sie für Stunden allein, weil er etwa eine Ausstellung besucht hat, tanzt sie bei seiner Rückkehr förmlich um ihn herum, springt sein Gesicht an und jault in Babytönen. Für Magda, die es nicht mehr gibt, nur noch in ihm, hatte sie eine Seele, nicht die der Bibel oder der Psychiatrie, sondern eine, die rätselhaft bleibt – und dem kann er sich einmal mehr anschließen, als Ascha bei ihm liegt, er eine Hand auf ihrem weich befellten Ohr hat, um mit dem Wesen in den Schlaf zu finden, das in der Sprache, in der er vor der Kamera stand und oft noch träumt, animal heißt. Es reicht, den letzten Buchstaben wegzulassen, schon ahnt man sein Geheimnis.
Schongauer schläft in dieser Nacht ruhiger als sonst, mit nur zwei Unterbrechungen, jeweils ein Taumeln ins Bad, dazu auch mit Träumen, an die er sich beim Erwachen kaum noch erinnert; und als er in der ersten Sonne, die über dem Hang aufgeht, vors Haus tritt, sitzt seine Gestrandete schon wieder auf der Stufe zu ihrem Wohngefährt, auf den Knien das Notebook und zu ihren Füßen sein Tier – das nie die Nacht mit ihm verbringt, immer vom Bett springt, wenn er schläft.
Er begrüßt sie mit ihrem Namen, was so nicht geplant war, und sie unterbricht ihr Tippen und grüßt zurück, auch mit Namen und einem Herr davor, eine Szene wie aus einem jener Filme, in denen es auch nicht die allerkleinste Rolle für ihn gegeben hätte, etwa in To Kill a Mockingbird mit Gregory Peck, der als edler Anwalt Atticus Finch auf seine Tochter trifft. Und darum geht er auch gleich wieder ins Haus und macht Frühstück mit dem, was noch da ist, Toastbrot, Eier und ein Stück Pecorino, Tomaten und ein Rest an Butter und etwas Tee. Er bereitet ein Omelette, ohne zu fragen, ob sie so etwas isst; er deckt einen großen Holztisch vor dem Haus, geschützt durch ein Vordach aus gespannten Drähten, auf dem Schilfmatten liegen. Für zwei Personen hat er noch gleiches Geschirr und Besteck, ausgestattet ist er höchstens für fünf am Tisch, jede weitere Person wäre zu viel. Nach Magdas Tod hat er fast alles an Inventar verschenkt, Dinge, die ihm nur wehtun würden, wenn er sie noch sieht. Wir können frühstücken, ruft er, und auch solche Sätze hätte er verschenkt, wenn das möglich wäre, damit sie ihn nie mehr einholen.
Frida kommt an den Tisch, ihr Haar ist feucht, als hätte sie geduscht, aber wo, wenn nicht im Haus; sie trägt jetzt eine Nietenhose, wie seine Mutter dazu gesagt hätte, und ein weites T-Shirt mit dem Aufdruck Help yourself – Worte, die ihn bewegen, ihm wie Reste eines zerstörten Daseins erscheinen. Sein Omelett scheint ihr zu schmecken, und er würde gern fragen, was sie studiert und welche Vorstellungen sie von der Zukunft hat, nur fehlt ihm die Väterlichkeit für solche Fragen, folglich redet er lieber vom Wetter – Spätestens übermorgen kracht es hier, sagt er, und da setzt Frida die Teetasse ab und fragt, ob es in seinem Leben eine Frau gegeben habe, eine Familie, ein Kind, ein Zuhause.
Vom Ort am See, einer Kirche mit Zwiebelturm, dringt hell das Neunuhrläuten herauf und gibt ihm etwas Zeit zum Nachdenken, während sein junger weiblicher Gast – er versucht sich jetzt in der neutralen Sicht – ihn anschaut, als hätte er ein Gebrechen, das des Alleinseins. Nach dem letzten Glockenton schenkt er ihr Tee nach. Mehr als nur eine Frau, sagt er. Aber keine Familie. Ich bin kein Inhaber von Verwandtschaftsgraden, abgesehen von toten Eltern. Schlimm?
Frida tunkt ein Stück Toast in den flüssigen Rest des Omeletts, dann sieht sie ihn an, als wäre er im Rahmen ihrer Reise eine echte Entdeckung, einer der Letzten aus der Spezies Einsiedler. Nein, nicht schlimm, erwidert sie. Aber will nicht jeder eine Familie, eine mit Geschwistern und Cousinen, mit Tanten und Onkeln, Großeltern und einem Hund? Ich hab nur zwei, die mir vorschlagen, was ich studieren soll.
Und was schlagen sie vor?
Die Hündin kommt an den Tisch, anders als sonst, zögernd, an wen sie sich wenden soll, bis sie unter den Tisch geht und den Kopf auf seine Knie legt, so wie jeden Morgen, wenn er frühstückt, und er gibt ihr den Rest von seinem Omelett, noch bevor sie vielleicht von Frida mit etwas gelockt wird. Könnten wir später darüber reden, nicht gleich morgens, sagt sie und schiebt das getunkte Brot in den Mund und kaut es langsam, offenbar ihre Art, ein Gespräch zu beenden oder das Thema zu wechseln, und Schongauer fragt, welche Rolle Fotos oder Videos in ihrem Reiseblog spielten.
Kaum eine, antwortet sie. Alle machen heute die gleichen Bilder, die gleichen Clips. Ihre Frau war Tierfotografin, hab ich gelesen. Ziemlich bekannt sogar.
Ja, sagt Schongauer. Willst du ihr letztes Foto sehen?
Und das will sie natürlich, alles andere hätte ihn gewundert, also bittet er sie ins Haus und zeigt ihr den großformatigen Abzug mit dem toten Pferd am Strand, nur mit den nötigsten Erklärungen, wann und wo die Aufnahme entstanden sei, und wo die Brandung seine Frau erfasst und geradezu verschluckt habe. Frida sagt dazu nichts. Sie betrachtet das grauweiße Pferd, das mit dem Bauch nach vorn auf der Seite liegt, das Geschlecht in den glasigen Ausläufern der Wellen, ein Bild des Grauens wie auch der Anmut. Und sein Eindruck ist, dass sie das alles gar nicht sehen will und gerade deshalb hinsieht, jetzt wieder die Judith von Caravaggio, die entsetzt einen Kopf abtrennt. Und du bist ein Einzelkind, sagt er, als Frida genug gesehen hat, sich ausatmend abwendet. Sie tritt wieder vors Haus, aber setzt sich nicht mehr an den Tisch; sie geht zu dem Zypressenpaar, an ihrer Seite die Hündin, und Schongauer folgt den beiden. Ja, sagt sie über die Schulter. Einzelkind. Meine Eltern sind Berufsidioten.
Das erschreckt ihn, dieses Wort, auch die Ruhe, mit der sie es gesagt hat, als hätte sie nur erklärt, ihre Eltern seien beruflich zu gebunden für mehr als ein Kind. Er wiederholt das Wort in fragendem Ton, während sie an den Gräsern längs der alten Grundstücksmauer riecht, an Glatthafer und Rispengras, an Brunnenkresse, Thymian und Engelshaar. Was die zwei in meiner Gegenwart eint, ist die Angst, dass ich es zu nichts bringe und ihrem Ruf schade, sagt sie. Mein Vater ist Partner in einer Großkanzlei, meine Mutter hat ihre eigene TV-Plauderrunde, zurzeit ist Sommerpause, das bringt sie fast um. Warum hat sich Ihre Frau in diese Brandung gestürzt?
Sie hat sich nicht gestürzt, sie wollte darin schwimmen, sagt Schongauer. Nur denke ich, das geht dich nichts an. Ich kümmer mich jetzt darum, dass du hier wegkommst. Und es geht mich zwar auch nichts an: Aber studierst du was?
Jura. Hab ich angefangen.
Und dann?
War’s genug. Darf ich mir Ihren Garten ansehen?
Das ist nur ein Grundstück mit alten Oliven.
Fridas Telefon klingelt, jetzt mit anderem Ton, walkürenrittartig – Meine Mutter, sagt sie und lässt das Gerät in der Hosentasche weiterklingeln, wie um die Mutter darin zu erschöpfen. Soll ich den Tisch abräumen?
Bist du mein Hausmädchen? Das mach ich selbst. Das mach ich jeden Tag. Abräumen, spülen, fegen. Wie alt ist deine Mutter?
Sie könnten ihr Vater sein. Haben Sie kein Fernsehen?
Nein, wozu.
Schongauer stellt sich eine Frau um die fünfzig vor, irgendwie gut aussehend, aber von der Sorte, die beim Film nie wirklich nach oben kommt, nur ein Gesicht hat, keinen Namen. Wolltest du nicht einen Rundgang machen? Er kehrt an den Tisch zurück, während Frida, vorbei an einem kleinen Tümpel, seinem Wasserspeicher, wenn der Regen ausbleibt, zum unteren Teil des Grundstücks geht und das Klingeln in ihrer Tasche, wenn er das richtig hört, endet. Und schon ist er wieder für sich, räumt wie gewohnt den Tisch ab und spült die Tassen und Teller, um dann auf einen Zettel zu schreiben, was er einkaufen sollte, damit ihn die Autorin Stein für gastlich hält. Bis zu ihrem Eintreffen hat er sonst keinen Plan. Zu erledigen ist noch der Anruf bei dem Albaner; Luans Ähnlichkeit mit dem jungen Franco Nero ist besonders im Sommer so verblüffend, dass Frauen, bei denen er arbeitet, heimlich Fotos machen, auch wenn sie die Ähnlichkeit gar nicht erkennen, weil sie Franco Nero nie in einem Western gesehen haben, aber das Kinogesicht erfassen, das man auch bei ihm erfasst hatte, nur für andere Rollen. Er geht wieder vors Haus und sieht seine Gestrandete bei einem großen Feigenbaum, der ihm bloß Ärger bereitet, weil man so viele Feigen gar nicht essen kann und sie dann abfallen und am Boden gären, mit Gerüchen wie aus einer Schänke. Du kannst sie alle haben, ruft er, als Frida um den Baum herumgeht, gefolgt von seinem Tier. Sie pflückt sich eine Feige, und Ascha springt an ihr hoch, um zu sehen, was sie da hat, und ihm kommt eine Idee, wie er mit der erwarteten Besucherin erst einmal allein wäre, auch ohne das Wesen, vor dem sie vielleicht Angst hätte, und wie sich zudem noch der Kühlschrank wieder auffüllen ließe. Du könntest dir mal den Ort am See anschauen, sagt er. Und Ascha vielleicht mitnehmen. Wie es aussieht, mag sie dich und würde an der Leine mitgehen, das gab’s noch bei keinem so schnell.
Kann ich machen, sagt Frida. Und soll ich auch gleich was einkaufen? Sie schaut ihn an, als wäre er ein altes offenes Buch, darin seine Anliegen, sich um die Hündin zu kümmern, aber auch etwas um den Haushalt, als Gegenleistung für Frühstück und Stellplatz. Du könntest aber auch einen längeren Spaziergang machen, sagt er. Ich kann das nicht mehr, und Ascha vermisst es. Geh erst ganz den Hang hinauf, von dort führt ein Höhenweg zum Monte Luppio oberhalb der Landzunge von San Vigilio, der schönsten Stelle am See mit einem Herrenhaus aus dem fünfzehnten Jahrhundert, bewohnt von nur einem einzelnen Mann, der es ganz selten samt der Pracht drum herum für mondäne Hochzeiten vermietet, dann umso teurer. Es gibt zu der Landzunge auch einen Weg, sehr steil, da musst du sie kurzhalten. Du kannst am See entlang zurückgehen und im Ort einkaufen, nach vier, wenn die Läden wieder auf sind. Ich geb dir eine Liste und Geld.
Ich weiß, was bei Ihnen fehlt, sagt Frida, ich brauch keine Liste. Und auch kein Geld, der Einkauf geht auf mich. Fürs Parken.
Worte, die noch in ihm wirken, als die beiden später davongehen, gleich bergan, bis sein Tier stehen bleibt und sich umschaut, ob er nicht mitkommt, dann ein Stück weitergeht, um erneut nach ihm zu schauen, nun aber erfasst, dass es ein Ausflug ohne ihn wird, und mit wippendem Schwanz neben Frida herläuft – deren Gang ihm sagt, dass sie gern tanzt, ohne eine Tanzschule besucht zu haben. Schongauer kehrt ins Haus zurück und macht dort endlich den Anruf. Er erreicht den Albaner vor einer Bar neben der Tankstelle im Ort, der Bar, an der sich um Ferragosto herum schon vormittags die letztlich Verwaisten, von keiner festen Hand Gehaltenen für ein paar Gläser treffen; er erklärt ihm, worum es geht, ohne es wirklich dringend zu machen, und Luan verspricht vorbeizukommen, nur eben nicht heute, heute sei er beschäftigt, was bei ihm auch heißen kann, dass er nur raucht und trinkt und den späten Mädchen im Ort Bären aus Albanien aufbindet.
Schongauer, jetzt ohne weiteren Programmpunkt außer einer Rasur für die Autorin, die unterwegs zu ihm ist, legt sich auf das alte Ledersofa – in all den Jahren mit Magda immer wieder auch der Platz, um sich zu umarmen, das letzte Mal kurz vor der Reise nach Dakar, wo sie todgeweihte oder schon verendete Tiere aufnehmen wollte für einen Band mit dem Titel Kreaturen. Damals stand das Sofa in der leeren Wohnung ihrer Eltern, beide frühe Opfer der Pandemie; zuvor war es lange in einem Kellerraum im selben Haus, tief in seinem Polster noch die Waffe, die er aus den Staaten mitgebracht hatte. Magdas Vater war Arzt und ein Liebhaber des mild Mediterranen um einen See, der sich erst mit seiner Südhälfte aus den Alpen löst; noch zu Lire-Zeiten, als dort alles irgendwie bezahlbar war, hatte der Arzt aus Karlsruhe das Hanggrundstück mit kleinem Rustico gekauft, um dort die Ferien zu verbringen; später hat er sich auch noch ein Motorboot zugelegt, und nach Magdas Tod ist das alles an ihn gefallen, und Jahr für Jahr überlegt er sich, ob er dieses Boot, das vor allem an seinem Ersparten nagt, noch behalten soll.
Im Grunde reicht ihm das Sofa und alles, was sich damit verbindet – vor dem letzten Mal auf dem schon rissigen Leder hatte ihn Magda mit einer Handbewegung aufgefordert, zu ihr zu kommen. Und er sieht noch diese nie von Ringen oder einem Kettchen oder gar von Nagellack gleichsam nervös gemachte Hand, wie sie zuerst ein teures Objektiv vom Sofa auf den Boden legt, um dann ihren Gürtel zu öffnen; unvergessen auch, wie später ihr Blut in seinem pochte, so war ihm das vorgekommen, als Magda nur noch Schuhe anhatte, feste Schuhe, die sich nicht im Handumdrehen ausziehen ließen und am Ende auf den Sofarand trommelten.
Aus und vorbei – Schongauer geht ins Bad und rasiert sich. Eigentlich braucht er dazu keinen Spiegel, er kennt sein Gesicht, jeden Zug, der ihn zum supporting German character gemacht hat, bis ihn Magdalena Reinhart, die Tierfotografin, aus diesem Zirkus, in dem er für sie nur der Nazi-Clown war, mit leisem Spott herausgeholt hat. Er kämmt noch sein Haar, das er seit Jahren selbst schneidet, dann tritt er aus dem Haus in die Mittagsglut und geht die tausendfünfhundert Quadratmeter ab, die ihm in den Schoß gefallen sind, ein Gang, um zu sehen, was es noch zu tun gibt vor dem Auguststurm.
Ein Stück der alten Mauer aus Feldsteinen ist beim letzten Unwetter Ende Juni derart unterspült worden, dass einzelne Steine herausfielen, die Mauer dort einbrach; die Steine sollte er aber nicht nur neu schichten, sondern auch Zement dazwischengeben. Ohne solche Arbeiten verkommt der Besitz – den Magda schon im Begriff war zu verkaufen, um ihr Reiseleben zu finanzieren. Er schaut im Schuppen nach, was noch an Zement da ist; eine Tüte mit fünf Kilo, angebrochen, die nimmt er und dazu einen Eimer, eine Kelle und eins seiner alten Poolparty-Hemden, die dort als Putzlappen liegen. So ausgerüstet, tritt er an den Brunnen, gespeist aus einem Wasserablauf neben dem Grundstück, bei Unwettern ein reißender Bach. Den Zement will er eigentlich gleich anrühren, nur sollte er erst die Steine wieder so legen, dass einer dem anderen Halt gibt, ehe die Füllmasse schon bröckelig wird. Er hat sich einiges abgeschaut bei Luan; zum Maurer ist er damit nicht geworden, nur zum besseren Nachahmer, wie er früher auch als Nebenfigur ein besserer Nachahmer der Stars war, damit aber mehr aus seinen Rollen gemacht hat als vorgesehen.
Schongauer geht ins Haus zurück, er legt sich wieder auf das Sofa. Die Mauer lässt sich auch später noch ausbessern, wenn etwas Wind vom See das Reglose aus der Luft nimmt, er freier atmen kann. Und er ruht ja sonst auch immer in den Stunden, bis das Leben im Ort gegen vier Uhr wieder anfängt, dann macht er sich mit Ascha auf den Weg hinunter, um einzukaufen und sie in der Bucht mit den Bojen und seinem Boot ins Wasser zu lassen, damit sie sich abkühlt. Das Boot ist eine alte Chris Craft Corsair 28, und er hat es übernommen, um im Sommer darauf zu dösen, nur hat sich gezeigt, dass ihn die Sonne auf dem See um den Verstand bringt und auch nichts für eine Hundenase ist, und inzwischen fährt er nur einmal in der Woche gegen Abend schräg über den See, zu den steil abfallenden Felswänden, wo es still ist bis auf ein Lecken des Wassers am Gestein und wo der See zum Spiegel wird, in den er eintaucht. Mit dem Boot im Rücken, oft dem einzigen weit und breit, sieht dort noch alles so aus, ehe mythische Vorfahren den See entdeckt hatten. Es ist die Stelle, die auch Magda gefallen hätte, schon deshalb fährt er zum Schwimmen dorthin, um sie sich herbeizuträumen – als die, die sein letzter Agent einmal tall, dark and handsome genannt hatte, das aber, bevor sie ihn – den zuletzt fast gefragten Kleindarsteller alles bösartig Deutschen, an dem der Agent ja verdient hat – zu einem Filmabtrünnigen in Hollywood machte.
Hat er geschlafen? Schon möglich; in letzter Zeit weiß er nicht so recht, wann sein Geist abschaltet und der Schlaf beginnt oder der Traum sich des Geistes bemächtigt. Jedenfalls fällt inzwischen etwas Sonne ins Haus – das erfasst er samt einem Klingeln des Telefons. Er stemmt sich aus dem Sofa und geht dorthin, wo das Telefon liegt, in seinem Bad – almut stein steht auf dem Schirm, klein geschrieben; um ihrer schon irgendwie habhaft zu werden, wenn auch nur orthographisch, hat er den Namen so gespeichert. Wie immer meldet er sich mit einem Ja, das wie ein halbes Nein klingt, und mit der Stimme, die ihn schon verwirrt hat, sagt die Anruferin Gut, dass ich Sie erreiche.
3
Gut, das kann heißen, dass sie im Stau steht, vielleicht vor der Mautstelle bei Sterzing, und erst später eintrifft, dann gleich ins Hotel geht und erst morgen mit ihren Fragen kommt. Aber gut kann auch heißen, dass ihr schon wieder etwas dazwischengekommen ist, privat, wie er sie einschätzt, und sich das Ganze noch einmal verschoben hat, der Besuch bei ihm für das Porträt über einen Vergessenen – der es gern dabei belassen würde und schon überlegt, wie er das Ganze noch absagen könnte, bevor er hört, dass sie zwar angekommen sei, sich aber auf dem Hang bei der Suche nach seiner Adresse mithilfe von Google Maps verfahren habe, jetzt fast am Ende eines Hohlwegs stehe mit Blick auf eine Kirche weiter oben.