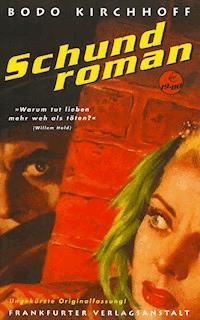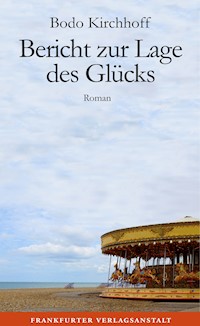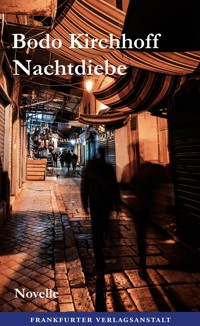
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzähl vom Ungeheuer, bittet das Kind am Abend den Vater. Zum ersten Mal sind Quint und sein Sohn Julian allein auf Reisen; die Mutter, eine Übersetzerin, hat beruflich in Paris zu tun. Das Ziel ist Tunis, aber für Quint ist es keine Urlaubsreise: Er sucht Helen, die junge Frau, die ein Jahr auf Julian aufgepasst hat und dann plötzlich verschwand. Einziges Lebenszeichen ist eine Postkarte aus Tunis, wo sie in einem kleinen Hotel an der Medina wohnte und ein Heft mit Aufzeichnungen hinterließ. Quint bezieht mit seinem Sohn im selben Hotel ein Zimmer. Und während er Julian vom Ungeheuer erzählt, dringt mehr und mehr das Ungeheure in seine Welt: Da ist die Wirtin des Hotels, Madame Melrose, der Quint in einem unbedachten Moment erliegt, und ein unheimlicher Hotelgast, Dr. Branzger, nach eigener Aussage Exilant aus der nicht mehr existierenden DDR. Aber vor allem ist da das Heft von Helen, eine einzige Abrechnung mit Quint. Als immer wieder beschriebene Seiten unter der Tür von Quints Zimmer durchgeschoben werden, muss er das Schlimmste befürchten. Bodo Kirchhoff erzählt in seiner auf einem früheren Roman basierenden Novelle Nachtdiebe von einem Mann, der innerhalb weniger Tage und Nächte, in einem Schrecken ohne Ende, aus lebenslangem Kindertraum erwacht. Eine aberwitzige Hoffnung treibt ihn in die Medina von Tunis, wo er gespenstischen Menschen und einer unerwarteten Liebe begegnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erzähl vom Ungeheuer, bittet das Kind am Abend den Vater.
Zum ersten Mal sind Quint und sein Sohn Julian allein auf Reisen; die Mutter, eine Übersetzerin, hat beruflich in Paris zu tun. Das Ziel ist Tunis, aber für Quint ist es keine Urlaubsreise: Er sucht Helen, die junge Frau, die ein Jahr auf Julian aufgepasst hat und dann plötzlich verschwand. Einziges Lebenszeichen ist eine Postkarte aus Tunis, wo sie in einem kleinen Hotel an der Medina wohnte und ein Heft mit Aufzeichnungen hinterließ. Quint bezieht mit seinem Sohn im selben Hotel ein Zimmer. Und während er Julian vom Ungeheuer erzählt, dringt mehr und mehr das Ungeheure in seine Welt: Da ist die Wirtin des Hotels, Madame Melrose, der Quint in einem unbedachten Moment erliegt, und ein unheimlicher Hotelgast, Dr. Branzger, nach eigener Aussage Exilant aus der nicht mehr existierenden DDR. Aber vor allem ist da das Heft von Helen, eine einzige Abrechnung mit Quint. Als immer wieder beschriebene Seiten unter der Tür von Quints Zimmer durchgeschoben werden, muss er das Schlimmste befürchten.
Bodo Kirchhoff erzählt in seiner auf einem früheren Roman basierenden Novelle Nachtdiebe von einem Mann, der innerhalb weniger Tage und Nächte, in einem Schrecken ohne Ende, aus lebenslangem Kindertraum erwacht. Eine aberwitzige Hoffnung treibt ihn in die Medina von Tunis, wo er gespenstischen Menschen und einer unerwarteten Liebe begegnet.
Inhalt
I
Erzählen ist immer auch der Versuch …
II
Unser Tag begann anstrengend …
III
Den nächsten Tag verbrachten wir also …
IV
Julian und ich aßen dann …
V
Von wahren Gymnasiastengefühlen beflügelt …
VI
Die folgende Geschichte ist wahr …
VII
Julian hatte mich schon beim Lesen …
VIII
Ende September sagte Quint …
IX
Quint, da klopft es …
X
Mein nächtlicher Gang war ein Ausweichen …
XI
Und Stunden später, als das Morgenlicht …
XII
Letzten Montag kam Quint an …
XIII
Mit der ersten Abendbrise, als die Sonne …
XIV
Diese Phase der Stille endete damit …
XV
Seit heute ist Christine hier …
XVI
Und in die Rufe zum Zwölfuhrgebet …
XVII
Barfuß, aber in seinem Mantel …
XVIII
Körperliche Liebe kann wie ein warmes Moor sein …
IXX
Dort war das Zelt leer …
XX
Tawfik das Köpfchen, sein Transistorradio am Ohr …
XXI
Habe ich schon gesagt, wie sehr ich Julian liebe …
XXII
Wenn ein Gefühl tief genug ist …
Nachwort des Verfassers
Für Claudius
I
Erzählen ist immer auch der Versuch, etwas Verlorenes zurückzugewinnen, mehr zu sein als nur ein Tagedieb, der alten Träumen nachhängt. Ich hatte das Glück einer guten Arbeit, die noch dazu viel Freiraum ließ, Radiosprecher in Goethes Geburtsstadt; ich hatte auch das Glück einer guten Wohnlage bei bezahlbarer Miete. Aber vor allem ist mir das Glück eines gesunden Kindes zuteilgeworden, eines Sohns, auf den, als er schon reden konnte, abends oft eine Studentin aufgepasst hat. Und damals hätte ich sogar noch einmal mit der Liebe in Berührung kommen können, weil meine Frau an Trennung dachte. Damals, das hieß während des osteuropäischen Umbruchs, der mich als Sprecher der Nachrichten täglich beschäftigte. Seitdem ist es Herbst und Winter geworden, Frühling und Sommer, und ich war angebunden in der Stadt am Main, die bis vor kurzem noch in der Mitte des Landes lag. Der erste Jahrestag der überraschenden Einheit fiel dann in meine Urlaubszeit; ich mag den letzten Atemzug des Sommers, wenn schon ein anderer Wind weht, selbst im Süden, am Rand der Wüste.
An diesem Tag flog ich nach Tunis. Neben mir am Fenster saß Julian, klein, rundbäckig, hell; er schlief. Alles an ihm erschien mir hell, sein Haar, seine Stimme, die Haut, besonders natürlich sein Verstand, und selbst seine braunen Augen leuchteten auf, wenn er lachte. Aber nun schlief er ja, worüber ich froh war. Julian schwitzte im Schlaf. Auf seiner Nase glänzten Tröpfchen, mit einer Ansichtskarte fächelte ich Luft hinüber; ohne diese Karte – sie hatte mich Ende September erreicht – wären wir zwei nie verreist. Auf ihrer Rückseite stand Folgendes: Du irrst Dich nicht, das ist meine Schrift, ich lebe. Tunis ist angenehm, in der Medina fand ich ein kleines Hotel mit viel Ruhe. Was macht Julian? Wie geht es Christine? Und wie geht es Dir? Hoffen wir das Beste für jeden, Helen.
Längst konnte ich ihre Worte aufsagen wie einen Vers. Helen hatte sie mit Bleistift geschrieben, bei dem Wort Ruhe war ihr offenbar die Spitze abgebrochen. Ich beugte mich an Julian vorbei und sah aus dem Fenster. Noch immer das Meer, blau und gekräuselt; über Korsika war er eingeschlafen. Wange auf der Schulter, Hände im Schoß, so saß er da und schnaufte. Die Stewardessen ließen ihn kaum aus den Augen. Wenn Julian schlief, kam seine sanfte Macht zum Vorschein, auch Helen hatte diese Macht gespürt. Oft hatte sie ganz gebannt an Julians Bett gesessen, wenn Christine und ich von einem Konzert heimkehrten; erst das Geld, das ich ihr zuschob, brachte sie wieder zu sich. Helen kam zwei- bis dreimal in der Woche. Sie trank und rauchte nicht, und nie trafen wir sie vor dem Fernseher an. Christine hatte sie eingestellt, sie mochte Helen. Genaugenommen mochte sie, dass Helen sie mochte, was ich wiederum gar nicht mochte, weil es Christine Auftrieb gab, auch ihren Scheidungsgedanken, die mich beunruhigten. Ich war einfach sehr an Christine gewöhnt, außerdem bewunderte ich ihre Klugheit; sie übersetzte schwierige Bücher und hatte dafür schon Preise bekommen. Während ich das Mittelmeer überflog, besuchte sie in Paris einen russischen Autor, und selbstverständlich habe ich ihr eine Nachricht hinterlassen: Hatte die Idee, mit Julian nach Tunis zu fliegen, rufe dich an! Christine, das wusste ich, hatte Verständnis für verrückte Ideen, aber das Ganze war sehr durchdacht.
Erst als das Flugzeug zur Landung ansetzte, weckte ich Julian, Schau, da, die Wüste, rief ich und zeigte auf ein Ödland längs der Piste, das natürlich nicht die Wüste war, aber woher sollte er das wissen? Julian nahm meine Hand. Er fragte nach Kamelen, und ich erzählte ihm, die Kamele seien unterwegs. Und auch das glaubte er; mir nicht zu glauben, ist auch kein Kinderspiel bei meiner Stimme.
Die Fahrt ins Zentrum zog sich hin. Tausende waren an diesem Oktobertag auf der Straße und verlangten die Rückkehr zu alten Gesetzen, ein Gewirr aus braunen Kutten und weißen Gewändern in einer Sonne, die immer noch brannte. Da ich dem Fahrer nur Medina! gesagt hatte, hielt er vor einem wuchtigen Tor, hinter dem die Altstadt begann. Sofort kamen Händler und Bettler zum Wagen, und ich wollte schon in ein besseres Viertel ausweichen, da fiel mir Helens Karte wieder ein, diese Spur von Nachdruck auf dem Wort Ruhe. Julian im Arm und in der Hand einen für die Gegend zu feinen Koffer, betrat ich also die Medina von Tunis, ohne jedes Interesse für Leben und Treiben um uns herum; während mich Julian am Haar zog, Zeichen dafür, dass er Christine entbehrte, hielt ich nach Hotelschildern Ausschau. Und so sicher ich mir bei einem Dutzend kleiner und kleinster Herbergen war, vor der falschen Adresse zu stehen, so sicher war ich mir, am Ziel zu sein, als ich an einem schmalen Gebäude mit trocknender Wäsche auf dem Dach die Schrift Petit Hôtel de la Tranquillité las.
Wenig später führte mich die Besitzerin, eine auffallend blasshäutige Frau mit einem schönen Gesicht voller Fältchen, in das Zimmer, das Helen bis vor kurzem bewohnt hatte. Vorletzte Woche, sagte sie in meiner Sprache, die auch ihre war, sei Mademoiselle Helen auf einmal verschwunden, ohne ein Wort und ohne ihr Depot im Safe aufzulösen. Hier am Fenster hat sie immer gesessen, wenn ich ihr morgens grünen Tee gebracht habe, können Sie sich das vorstellen? Und sie nahm Helens Sitzhaltung ein, als gelte es, ein Verbrechen zu rekonstruieren, und nannte bei der Gelegenheit einen Namen, der mir zu märchenhaft klang, um ganz echt zu sein, Madame Melrose. Daraufhin stellte ich mich als Helens Onkel vor und das offenbar sehr überzeugend; die Besitzerin des Kleinen Hotels zur Ruhe bot mir eine Einsicht in Helens Depot an.
Kaum waren wir wieder unten, bat sie um unsere Pässe und verglich besonders Julian mit dem Lichtbild. Dann erst schloss sie das Depot auf und entnahm ihm ein hölzernes Kästchen. Es war flach und schwarz und hatte ein Schlüsselloch zwischen arabischen Zeichen; es passte zu Helen. Madame Melrose – innerlich war ich schon bereit, sie so zu nennen – übergab mir den kleinen Schlüssel, und ich öffnete das Kästchen etwa vom Format einer Pralinenschachtel. Eine Mappe aus billigem Karton lag darin, darauf Helens Initialen und darunter, in Druckbuchstaben, eine Art Titel: Mein Jahr mit Quint. Ich sah das und erschrak wie jemand, der auf ein vergessenes Kinderbild von sich stößt – das bin ja ich dort, hätte ich fast gesagt, als Madame Melrose schon ihre Hand aufhielt, damit ich ihr den Schlüssel zurückreichte. In der Mappe befinden sich lose Seiten, alle mit Maschine getippt, erklärte sie und tat dann, was sie tun musste. Sie schloss das Kästchen und schob es wieder in Helens Depot. Angenehme Tage in meinem Haus, Monsieur. Sie können hier grünen Tee bekommen, aber auch frische Milch – die letzten Worte hatte sie mit Blick auf Julian gesagt; jeder Weg zu Helens Mappe führte über diese Frau, so viel war sicher.
In dieser Nacht schlief ich an Julians Seite, ganz exklusiv und wie beschützt von ihm. Aber als mich der erste Sonnenstrahl und Rufe aus der Medina weckten, erschrak ich über die kleine Gestalt neben mir – als wäre Christine geschrumpft. Beunruhigt, ohne zu wissen wovon, stand ich auf, um mich an Helens Platz für den Morgentee zu setzen, in einen Stuhl wie noch erwärmt von ihr. Erst jetzt hatte ich einen Blick für das Zimmer, es enthielt nur das Nötigste: Bett, Schrank, Tisch und Stuhl, ein Waschbecken mit Spiegel, eine Ablage mit kleiner Lampe. Und es stand ein Telefon zur Verfügung, um Christine wie versprochen anzurufen. Ich beugte mich aus dem Fenster. Schwarze Rinnsale flossen über die Gasse, Geruch von schwelendem Abfall lag in der Luft. Was hatte Helen hier gehalten? Vielleicht die behütende Art von Madame Melrose; etwas an dieser nicht mehr jungen Frau mit der blassen Haut und dem unecht klingenden Namen sprach mich an – überraschende Tatsache, denn Christine war zehn Jahre jünger als ich, und Helen hätte gut meine Tochter sein können.
Julian räkelte sich, und ich lief zu ihm. Wie er so dalag und langsam wach wurde, hatte etwas. Ich streichelte ihn, und Helens Mappe in dem Kästchen fiel mir ein. Wenn sie maschinengeschriebene Seiten enthielt, waren die Seiten wohl zum Lesen bestimmt. Julian griff mir ins Haar und zupfte daran. Wäre Christine da, wäre das schön, sagte er, schon erstaunlich sicher im Konjunktiv – Worte wie Mama, Mutter und dergleichen mehr hatten wir gar nicht erst an ihn herankommen lassen, wir hatten ihn mit unseren Eigennamen förmlich immun gemacht dagegen. Aber Christine ist nicht da. Willst du Milch?
Nicht von dir.
Er sagte das in einem Ton, der nicht verletzend war, und ich fragte, ob er Heimweh habe.
Könnte sein.
Und wo tut es weh?
Julian fasste sich an den Bauch, und ich holte aus meiner Reiseapotheke ein Pflaster. Von Anfang an hatte ich seine Kümmernisse auf diese trickhafte Art behandelt; kaum war die Stelle versorgt, schien Christine vergessen zu sein. Julian griff wieder nach meinem Kopf, Erzähl vom Ungeheuer, bat er, und ich erzählte von einem Wesen, das nur wir beide kannten, in jeder Gestalt konnte es überall auftauchen, nie war es endgültig besiegt. In dem Fall ließ ich unser Ungeheuer nach Tunis fliegen, wo es sich in ein Kätzchen verwandelte. Ich beschrieb das kleine weiche Tier, das alle zu täuschen wusste, bis Julian mich unterbrach: Wenn du mehr Haare hättest, das wäre auch schön.
Ich gab ihm recht, und wir standen auf.
II
Unser Tag begann anstrengend; schon beim ersten Gang durch die verzweigten Systeme der Souks wollte Julian im Gedränge der Käufer und Händler getragen werden, und so trug ich ihn, in Gedanken bei Helen, auf den Schultern. Bestimmt war sie noch in Tunis, am ehesten in der Altstadt, und wäre dort kaum zu erkennen. Helen zählte zu denen, die in der Fremde zum Chamäleon werden, gleich Sitten und Gebräuche übernehmen, ja, Tempo und Tonfall wechseln. Julian kniff mich in die Backe – Steigen wir da mal hinauf und schmeißen einen Flieger hinunter, tun wir das? Er zeigte auf ein Minarett, das schlank aus dem Gewirr der Dächer ragte, und ich erklärte ihm dessen Bedeutung, sie verbiete das Besteigen durch Ungläubige. Natürlich wollte er trotzdem hinauf, und ich sagte ihm, wir würden auf unser Hoteldach gehen und von dort einen Papierflieger starten; seit Helen ihn nicht mehr betreute, hatte Julian diese kindliche Leidenschaft entwickelt: Mit meiner Hilfe Papierflieger zu falten, die nach langem Flug, das war seine Idee, zu dem zurückkehrten, der sie geworfen hatte. Ich machte ihm noch weitere Versprechungen, von einem Modell, das wir falten würden, und unterdessen kamen wir in die Gasse der Wasserpfeifenraucher. Dort gefiel es Julian, und wir setzten uns vor eins der Cafés nur mit Männern.
Die Raucher saßen auf Stühlen, die mir wie Kinderstühle vorkamen, jeder für sich, ganz mit der murmelnden Pfeife beschäftigt. Die Stühlchen standen entlang der Fassade, die Teil eines mit Planen vor der Sonne geschützten Souks war. In den Geschäften sah man nur Stoffe, in mattem Blau und blassem Rosa; die Händler sprachen in schnurlose Telefone, was ein schönes, schiefes Bild war. Der Wirt des Cafés fragte nach unseren Wünschen, und Julian wollte unbedingt ein Glas Milch, die es in dem Café aber nicht gab; und umso heftiger wollte er die Milch, je öfter ich sagte, man bekomme hier keine. Und als er sich plötzlich am Boden wälzte und die Raucher von ihren Pfeifen aufsahen, bat ich den Wirt, mir eines jener märchenhaften Geräte zu bringen, und Julian beruhigte sich. Er betastete die Wasserpfeife wie ein Lebewesen, während ich am Mundstück saugte, ohne ein Ergebnis. Meine Unbeholfenheit war so offensichtlich, dass der Stuhlnachbar einsprang. Wortlos stopfte er einen an verklebte Rosinen erinnernden Tabak in das Silberkrönchen auf dem Flaschenkopf, schob dann mithilfe einer Zange einen nur fingerhutgroßen glühenden Scheit dazu und fächelte mit einer kleinen steifen Fahne, bevor er zu saugen begann. Mit wahrer Hingabe betrieb er dieses Anheizen des Tabaks, wobei in der bauchigen Flasche das Wasser aufschäumte. Endlich reichte er mir den Schlauch, und ich zog einen kühl zu Kopf steigenden Rauch ein. Julian sah mir zu und wollte ebenfalls rauchen, er wollte seine eigene Pfeife, mir blieb nur ein Ablenkungsmittel. Ich zeigte auf eine kleine Katze, die im Hin und Her der Käufer und Händler in der Gasse ihren Weg zwischen all den Beinen suchte, und schon sprang Julian auf und stürzte sich in das Gedränge. Bleib, wo du bist, rühr dich nicht weg, rief ich und warf Geld auf den Tisch, genug für die Pfeife, und eilte ihm nach, meinem Sohn, der verschwunden war, wie von all den Männern in langen Gewändern und mit spitzer Kopfbedeckung verschluckt. Ich rief seinen Namen, zweimal, dreimal, ich rief, die Katze sei nicht das Ungeheuer, und auf einmal war da eine Hand, die nach meiner griff. Doch, sagte Julian, doch. Sie hat sich nur wieder verwandelt, in einen Mann mit brauner Kapuze, den müssen wir suchen.
Julian ließ nicht locker, also suchte ich mit ihm diesen Kapuzenmann, wir streiften durch verschiedene Souks und suchten ihn auch in einem Lokal. Dort aßen wir gleich etwas und einigten uns, dass es für heute verschwunden sei, unser Ungeheuer. Mit Hilfe eines Stadtplans und etlicher Passanten, die uns den Weg zeigten, fanden wir am frühen Nachmittag zurück zum Hotel. Madame Melrose öffnete uns die Tür, als hätte sie auf diesen Augenblick gewartet, machte aber nur eine leise Bemerkung – ein Mann, der ohne seine Frau mit einem Kleinkind verreise, sei recht mutig.
Ich hatte mich nie für mutig gehalten, ich war es auch nicht. Ich war nur mit eigenen Wassern gewaschen. Neben Julian liegend, wartete ich die Dämmerung ab. Ich hoffte, er würde einschlafen, aber er starrte an die Zimmerdecke mit allerlei Rissen, die wie Zeichen waren, die Pläne verzweigter Wege, und schließlich kam er auf das Ungeheuer zurück. Es könnte jetzt auch ein Hund sein, erklärte er und bestand darauf, noch einmal mit mir durch die Medina zu gehen.
Viele Läden waren nun schon geschlossen, die Seitengassen lagen im Dunkeln; wer um diese Zeit unterwegs war, lief dicht an den Häusern, zwischen Hunden und Katzen, aber keins dieser huschenden Tiere brachte Julian in Aufruhr, er glaubte jetzt, das Ungeheuer hätte sich in eine Minarettspitze verwandelt, und wir müssten einen Papierflieger falten, der es bis zu dieser Spitze schafft. Ich widersprach dem nicht, um meine Ruhe zu haben. Einer fernen Brandung ähnlich drangen Gebete aus den Moscheen, und wieder einmal bedauerte ich meine völlige Freiheit im Hinblick auf Gott. Da die Medina für mein Gefühl stetig anstieg, glaubte ich, das Hotel mühelos wiederfinden zu können: Man müsste nur dem Gefälle folgen. Ein schwacher Lichtschein ließ mich dann in eine Gasse ohne Pflaster schwenken, und bald kam ich mit Julian an einer Schenke vorbei, in der zahllose Männer durch Gitter vom Gehsteig getrennt wie Eingekerkerte Bier tranken. Ich ging etwas rascher, einer Musik entgegen, wie ich sie liebe, und noch im Schein der Schenke sah ich plötzlich einen Menschen an meiner Seite, zierlich wie eine Turnerin, aber mit dunklem Bartschatten. Er hielt sich ein kleines rotes Transistorradio ans Ohr, eins, das kaum größer war als sein Kopf. Nie zuvor hatte ich eine solche Entstellung gesehen, ich hätte sie nicht einmal für möglich gehalten, nur die Musik machte den Anblick erträglich. Der Kleinköpfige hörte Dvořák, das Konzert für Cello und Orchester in h-Moll. Auch Julian erkannte das Stück, denn es gehörte zu Christines Sonntagmorgenritual. Frühstück, rief er, Frühstück, und ich bedeckte seine Augen. Dann versuchte ich zu entkommen, doch der Kleinköpfige blieb, etwas nach vorn geneigt wie ein Huhn, an meiner Seite; er lenkte mich in einen Nebenweg, wenn es nicht ein Schubsen war, um dann eilig zu verschwinden; nur die Musik klang noch etwas nach.