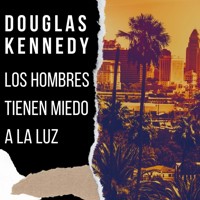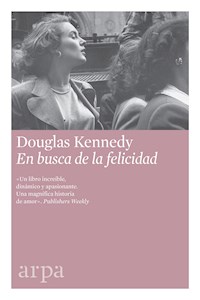5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Erotisch – tödlich – obsessiv
Paris im Winter. Das Leben des amerikanischen Filmdozenten Ricks liegt in Trümmern. Auf einer Party trifft er eine geheimnisvolle Fremde. Niemand kennt sie, niemand sieht sie – außer ihm. Eine abgründige, obsessive Affäre beginnt. Bis Ricks ein schrecklicher Verdacht kommt: Was hat seine Liebhaberin mit der mysteriösen Mordserie zu tun, die Paris erschüttert? Unaufhaltsam gerät er in den Bann einer düsteren, unheimlichen Macht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Zum Buch
Der amerikanische Filmdozent Harry Ricks hat alles verloren: seinen Job, seinen Ruf, seine Familie. In Paris will er ein neues Leben beginnen. Er lernt die geheimnisvolle Margit kennen, die ihn sofort in ihren Bann zieht, und gerät in eine amour fou ohne Tabus. Ricks ahnt, dass Margit ein dunkles Geheimnis umgibt. Stammen die Narben an ihrem Hals und ihren Handgelenken von einem Selbstmordversuch? Und warum darf Ricks sie nur alle drei Tage und nur in ihrem Apartment treffen?
Doch dann wird die leidenschaftliche Affäre zum Alptraum, als im Umkreis von Ricks mehrere äußerst brutale Morde geschehen. Die Opfer sind ausnahmslos Menschen, die er hasste. Hat seine mysteriöse Liebhaberin etwas mit der Mordserie zu tun? Ricks gerät in den Sog einer unerklärlichen Macht. Der Roman wird mit Ethan Hawke und Kristin Scott Thomas verfilmt.
Zum Autor
Douglas Kennedy, 1955 in Manhattan geboren, schrieb zahlreiche Reisebücher, bevor er mit seinen Romanen zum internationalen Bestsellerautor avancierte. Seine Bücher wurden in 16 Sprachen übersetzt; in Frankreich erhielt er 2006 den renommierten Preis Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Douglas Kennedy hat zwei Kinder und lebt zeitweise in London, Paris und Berlin.
Inhaltsverzeichnis
Für Frank Kelcz
Alles, was sie dem Superintendent gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Manchmal jedoch entspricht nichts so wenig der Wahrheit wie die Wahrheit selbst.
Georges Simenon, Die Flucht des Monsieur Monde
Eins
Es passierte in dem Jahr, als mein Leben zerbrach, in dem Jahr, als ich nach Paris zog.
Ich kam ein paar Tage nach Weihnachten dort an. An einem nasskalten, grauen Morgen – der Himmel sah aus wie schmutziger Kalk, und der Regen kam von allen Seiten. Mein Flugzeug war kurz nach Sonnenaufgang gelandet. Ich hatte in den vielen Stunden über dem Atlantik kein Auge zugetan – wieder eine schlaflose Nacht, wie so oft in letzter Zeit. Als ich den Flieger verließ, wurde mir schwindelig – ein Moment panischer Desorientierung –, und als mich der Grenzbeamte fragte, wie lange ich in Frankreich bleiben wolle, wäre ich beinahe gefallen.
»Weiß noch nicht«, sagte ich schneller als ich denken konnte.
Daraufhin musterte er mich eindringlich – da ich noch dazu auf Französisch geantwortet hatte.
»Sie wissen’s nicht?«
»Zwei Wochen«, sagte ich hastig.
»Sie haben also ein Rückflugticket nach Amerika?«
Ich nickte.
»Zeigen Sie es mir bitte.«
Ich gab ihm das Ticket. Er sah es sich an, mein Rückflug war für den zehnten Januar datiert.
»Wieso ›wissen‹ Sie nicht, wann Sie zurückfliegen, wenn es hier doch schwarz auf weiß steht?«
»Ich habe nicht nachgedacht«, sagte ich kleinlaut.
»Évidemment«, entgegnete er. Er stempelte meinen Pass und schob mir wortlos meine Dokumente hin. Dann nickte er und forderte den nächsten Passagier auf, vorzutreten. Er war mit mir fertig.
Ich ging zur Gepäckausgabe und verfluchte mich selbst, weil ich dafür gesorgt hatte, dass ich von offizieller Seite zu meinem Frankreichaufenthalt befragt worden war. Aber ich hatte die Wahrheit gesagt, denn ich hatte wirklich keine Ahnung, wie lange ich bleiben würde. Das Ticket hatte ich Last-Minute im Internet gebucht, es war so günstig gewesen, weil zwischen Hin – und Rückflug zwei Wochen lagen. Sobald der zehnte Januar verstrichen war, würde ich es wegwerfen. Ich hatte nicht vor, so bald wieder in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.
»Wieso ›wissen‹ Sie nicht, wann Sie zurückfliegen, wenn es hier schwarz auf weiß steht?«
Seit wann ist auf einen Beweis hundertprozentig Verlass?
Ich nahm meinen Koffer und widerstand der Versuchung, mich einfach mit dem Taxi in die Innenstadt kutschieren zu lassen. Aber für solche Extravaganzen war mein Budget einfach zu knapp. Stattdessen nahm ich den Zug. Einfache Fahrt sieben Euro. Der Zug war dreckig – der Boden des Waggons war voller Müll, die Sitze klebrig, und es roch nach Bier von gestern Abend. Die Fahrt in die Innenstadt führte durch eine Reihe abstoßender Gewerbegebiete, die von hässlichen Hochhäusern weiter verschandelt wurden. Ich schloss die Augen und döste ein. Als der Zug die Gare du Nord erreichte, schrak ich hoch. Ich folgte der Wegbeschreibung, die ich vom Hotel per Mail bekommen hatte und verließ den Bahnsteig, ging zur Metro und begann eine lange Fahrt bis zu der Haltestelle mit dem duftigen Namen Jasmin.
Dort verließ ich die Metro, trat in den regennassen Morgen hinaus und zog den Koffer durch eine enge Gasse. Der Regen wurde heftiger. Ich senkte den Kopf, bog nach links in die Rue La Fontaine ein und dann nach rechts in die Rue François Millet. Das »Sélect«-Hotel lag auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es war mir von einem Kollegen des kleinen College, an dem ich unterrichtet hatte, empfohlen worden – von dem einzigen Kollegen dort, der noch mit mir redete. Er sagte, das »Sélect« sei sauber, einfach und preiswert – außerdem liege es in einer ruhigen Wohngegend. Er hatte mir allerdings verschwiegen, dass am Morgen meiner Ankunft der diensthabende Portier ein Arschloch sein würde.
»Guten Morgen«, sagte ich. »Ich heiße Harry Ricks. Ich habe eine Zimmerreservierung für ...«
»Sept jours«, erwiderte er und sah kurz von seinem Computerbildschirm auf. »La chambre ne sera pas prête avant quinze heures.«
Er sprach schnell, und ich bekam kaum mit, was er da sagte.
»Desolé, mais ... äh ... je n’ai pas compris ...«
»Sie können erst um drei Uhr nachmittags einchecken«, sagte er, nach wie vor auf Französisch, aber dafür betont laut, so als wäre ich taub.
»Aber bis dahin dauert es ja noch ewig.«
»Um drei Uhr können Sie einchecken«, entgegnete er und zeigte auf ein Schild neben den Postfächern, das an der Wand befestigt war. Mit Ausnahme von zweien hingen in allen achtundzwanzig Fächern Schlüssel.
»Kommen Sie! Sie müssen doch um diese Zeit ein Zimmer fertig haben«, sagte ich.
Er zeigte erneut auf das Schild und schwieg.
»Wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass momentan kein einziges Zimmer fertig ist?«
»Ich sagte Ihnen doch, dass Sie um drei Uhr einchecken können.«
»Und ich sage Ihnen, dass ich erschöpft bin und es wirklich sehr zu schätzen wüsste, wenn ...«
»Ich bin für die Regeln nicht verantwortlich. Lassen Sie Ihren Koffer hier, und kommen Sie um drei zurück.«
»Bitte. Kann ich Sie denn gar nicht überreden?«
Er zuckte nur die Achseln, während ein unmerkliches Lächeln seine Lippen umspielte. Dann klingelte das Telefon. Er ging dran und nutzte die Gelegenheit, mir den Rücken zuzuwenden.
»Ich glaube, ich suche mir ein anderes Hotel«, sagte ich.
Er unterbrach sein Telefonat, schaute über die Schulter und sagte: »Dann müssen Sie allerdings eine Nacht zahlen. Absagen muss man bei uns stets vierundzwanzig Stunden im Voraus.«
Wieder dieses unmerkliche Grinsen, das ich ihm am liebsten aus dem Gesicht geprügelt hätte.
»Wo kann ich meinen Koffer lassen?«, fragte ich.
»Da drüben«, meinte er und zeigte auf eine Tür neben der Rezeption.
Ich zog meinen Koffer dorthin und setzte auch meinen Computerrucksack ab.
»Da ist mein Laptop drin«, sagte ich. »Wenn Sie also bitte ...«
»Der ist in guten Händen«, erwiderte er. »À quinze heures, monsieur.«
»Und wo kann ich jetzt hingehen?«, fragte ich.
»Aucune idée.« Anschließend setzte er sein Telefonat fort.
An einem Sonntagmorgen Ende Dezember gab es um kurz nach acht nichts, wo man hingehen konnte. Ich lief die Rue François Millet auf und ab und suchte nach einem Café, das schon geöffnet hatte. Doch alle waren geschlossen, viele hatten Schilder ins Fenster gehängt, auf denen stand:
Fermeture pour Noël.
Es war eine reine Wohngegend – alte Mietshäuser neben Neubauten, Bausünden der siebziger Jahre. Aber selbst die modernen Gebäude wirkten nicht billig, und die wenigen Autos am Straßenrand ließen vermuten, dass es sich um eine bessere Gegend handelte, die aber um diese Zeit ausgestorben wirkte.
Der Regen war einem ekelhaften Nieseln gewichen. Da ich keinen Schirm dabeihatte, kehrte ich zur Metrostation Jasmin zurück und kaufte mir eine Fahrkarte. Ich nahm den ersten Zug, der kam, und hatte keine Ahnung, wo ich hinfuhr. Es war erst mein zweites Mal in Paris. Zuletzt war ich Mitte der Achtziger hier gewesen, im Sommer vor meinem Hauptstudium. Ich hatte eine Woche in einem billigen Hotel in der Nähe des Boulevard St. Michel verbracht und war dort ständig ins Kino gerannt. Damals hatte es gegenüber von einigen Programmkinos ein kleines Café namens »Le Reflet« gegeben, in der Rue ... – wie hieß sie gleich wieder? Egal. Dort war es billig, und soweit ich mich erinnerte, konnte man dort auch frühstücken.
Ich warf einen kurzen Blick auf den Metroplan in meinem Waggon, stieg an der Haltestelle Michel-Ange Molitor um und war zwanzig Minuten später bei Cluny-Sorbonne. Es war zwar zwanzig Jahre her, dass ich diese Metrostation das letzte Mal verlassen hatte, aber den Weg zu einem Kino vergesse ich niemals. Also bog ich vom Boulevard Saint-Michel instinktiv in die Rue des Écoles ein. Der Anblick des »Le Champo« – das für eine De-Sica – und eine Douglas-Sirk-Retrospektive warb, entlockte mir ein Lächeln. Als ich vor seinen geschlossenen Türen stand und einen Blick in die Rue Champollion warf – jene Straße, deren Namen ich vergessen hatte –, sah ich zwei weitere Kinos, die entlang des schmalen, nassen Bürgersteigs lagen, und dachte: Keine Sorge, die alte Leidenschaft ist noch nicht erloschen.
Aber um neun Uhr morgens war noch kein Kino geöffnet, und auch das Café »Le Reflet« war verriegelt. Fermeture pour Noël.
Ich kehrte zum Boulevard Saint-Michel zurück und machte mich auf den Weg zum Fluss. Kurz nach Weihnachten war Paris wirklich wie ausgestorben. Einzig die Fastfood-Filialen, die hier die Straßen säumten, waren geöffnet. Ihre Neonfassaden verschandelten die Prachtstraßenarchitektur. Obwohl ich liebend gern vor dem Regen geflüchtet wäre, brachte ich es doch nicht über mich, meine ersten Stunden in Paris bei McDonald’s zu verbringen. Also lief ich weiter, bis ich das erste anständige Café entdeckte, das geöffnet war. Es hieß »Le Départ« und lag direkt am Seinekai. Bevor ich es betrat, ging ich an einem Zeitungskiosk vorbei und nahm eine Ausgabe von Pariscope mit – jenes Veranstaltungsblättchens, das 1985 meine Cineastenbibel gewesen war.
Das Café war leer. Ich setzte mich an einen Fenstertisch und bestellte eine Kanne Tee gegen die innere Kälte, die ich plötzlich verspürte. Dann schlug ich den Pariscope auf, sah das Kinoprogramm durch und plante, welche Filme ich mir in der kommenden Woche ansehen würde. Als ich die John-Ford-Retrospektive im »Action Écoles« und die Ealing-Komödien in den »Le Reflet Medicis« sah, spürte ich etwas, das ich schon seit Monaten nicht mehr empfunden hatte: Freude. Als kleine, flüchtige Erinnerung daran, wie es war, nicht ständig daran denken zu müssen, dass ... Eben an alles, was mich so beschäftigte, seit ...
Nein, bloß nicht daran rühren. Zumindest nicht heute. Ich zog ein kleines Notizbuch und meinen Füller aus der Tasche. Es war ein hübscher, alter, roter Parker, ungefähr von 1925: Meine Ex-Frau hatte ihn mir vor zwei Jahren zum Vierzigsten geschenkt – als sie noch meine Frau war. Ich zog die Stiftkappe ab und begann, mir die Termine zu notieren. Das war mein Plan für die nächsten sechs Tage, der mir vormittags genügend Zeit ließ, mein Leben hier zu organisieren und den Rest meiner Zeit in dunklen Sälen zu verbringen, um auf die Leinwand projizierte Schatten zu bestaunen. »Was fasziniert die Menschen so am Kino?«, fragte ich jeden Herbst im Einführungsseminar meine Studenten. »Kann es sein, dass es sich dabei paradoxerweise um einen Ort außerhalb des eigentlichen Lebens handelt, wo das Leben nachgestellt wird? Als solches ist das Kino womöglich ein Versteck, in dem man sich im Grunde aber gar nicht verstecken kann, weil man dort jene Welt ansieht, der man eigentlich entfliehen wollte.«
Selbst wenn man weiß, dass man sich nicht wirklich verstecken kann, versucht man es trotzdem. Und genau deshalb gibt es Menschen, die für den übernächsten Tag einen Flug nach Paris buchen, um den ganzen Mist hinter sich zu lassen.
Ich hielt mich eine Stunde lang an meinem Tee fest und schüttelte den Kopf, als der Kellner kam und fragte, ob ich noch etwas bestellen wolle. Ich goss mir eine letzte Tasse ein. Der Tee war kalt geworden. Ich wusste, dass ich den Rest des Vormittags sitzen bleiben konnte, ohne bedrängt zu werden. Aber wenn ich noch länger hier herumhing, hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, den Tisch so lange mit Beschlag zu belegen – obwohl außer mir nur noch ein anderer Gast da war.
Ich sah aus dem Fenster. Es regnete immer noch. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Noch fünf Stunden, bis ich im Hotel einchecken konnte. Es gab nur eine einzige Lösung. Ich schlug erneut den Pariscope auf und sah, dass es bei Les Halles ein riesiges Multiplex-Kino gab, das täglich ab neun Uhr Filme zeigte. Ich verstaute Notizbuch und Füller, griff nach meinem Mantel, legte vier Euro auf den Tisch und verließ das Café – nicht ohne einen kurzen Sprint zur Metro hinzulegen. Bis zu Les Halles waren es zwei Haltestellen. Ich folgte den Schildern zu »Le Forum«, einem freudlosen Shoppingcenter aus Beton, das tief in den Pariser Boden eingelassen war. Das Kino hatte fünfzehn Säle und sah aus wie ein typisch amerikanisches Multiplex in einem x-beliebigen Einkaufszentrum. Alle großen Weihnachtsblockbuster aus Amerika wurden gezeigt, also entschied ich mich für den Film eines französischen Regisseurs, den ich nicht kannte. In zwanzig Minuten begann die nächste Vorstellung, so dass ich erst noch eine Reihe alberner Werbespots über mich ergehen lassen musste.
Dann begann der Film. Er war lang, und es wurde sehr viel geredet – trotzdem konnte ich der Handlung größtenteils folgen. Die Geschichte spielte überwiegend in einem leicht heruntergekommenen, aber angesagten Viertel von Paris. Es ging um einen Typen um die dreißig namens Mathieu, der an einem Lycée Philosophie unterrichtete, aber (wer hätte das gedacht!) nebenbei versuchte, einen Roman zu schreiben. Dann war da noch seine Ex-Frau Mathilde – eine mäßig erfolgreiche Malerin, die im Schatten ihres Vaters Gérard stand. Dieser war ein berühmter Bildhauer, der mit seiner Assistentin Sandrine zusammenlebte. Mathilde hasste Sandrine, denn diese war zehn Jahre jünger. Und Mathieu konnte Philippe nicht ausstehen, den Geschäftsführer einer Technologiefirma, mit dem Mathilde geschlafen hatte. Sie liebte die Aufmerksamkeiten, mit denen Philippe sie verwöhnte, fand ihn jedoch in intellektueller Hinsicht erbärmlich (»Der Mann hat nicht einmal Montaigne gelesen ...«). Der Film begann damit, dass Mathieu und Mathilde in der Küche sitzen, Kaffee trinken, rauchen und reden. Danach sieht man Sandrine, die nackt in Gérards Atelier auf dem Land Modell steht, während im Hintergrund Bach läuft. Sie machen eine Pause, und sie zieht sich etwas an. Dann gehen sie in seine große Landhausküche, trinken Kaffee, rauchen und reden. Darauf folgt eine Szene in irgendeiner teuren Hotelbar. Mathilde trifft Philippe. Sie sitzen auf einer Polsterbank, trinken Champagner, rauchen und reden ...
Und so weiter und so fort: Reden, reden und nochmals reden. Meine Probleme. Seine Probleme. Deine Probleme. Und ach so, ja: La vie est inutile. Nach einer Stunde gab ich es auf, weiter gegen Jetlag und Schlafmangel anzukämpfen und döste ein. Als ich wieder aufwachte, saßen Mathilde und Philippe in einer Hotelbar, tranken Champagner, rauchten und ... Moment mal, hatte ich diese Szene nicht schon gesehen? Ich versuchte die Augen offen zu halten, schaffte es nicht. Und dann ...
Was ist denn das, verdammt?
Der Vorspann begann erneut – und Mathieu und Mathilde saßen in der Küche, tranken Kaffee, rauchten und redeten. Und ...
Ich rieb mir die Augen. Ich hob meinen Arm. Ich versuchte einen Blick auf meine Armbanduhr zu werfen, aber ich sah nur verschwommen. Schließlich konnte ich die Digitalziffern erkennen: 4... 4... 3.
Vier Uhr dreiundvierzig?
Oh Gott, ich hatte geschlafen, seit ...
Mein Mund war völlig ausgedörrt und faulig. Ich schluckte, alles schmeckte bitter. Mein Hals war steif, kaum zu bewegen. Ich fasste an mein Hemd. Es war schweißnass. Genauso wie mein Gesicht. Ich legte die Finger auf meine Stirn. Sie war unglaublich heiß. Ich setzte die Füße auf den Boden und versuchte aufzustehen, ohne Erfolg. Jede Faser meines Körpers schmerzte. Plötzlich begann ich zu frieren – das Tropenfieber wich einer Art Polarkälte. Die Knie gaben ein wenig nach, als ich erneut versuchte, aufzustehen, doch ich schaffte es, mich irgendwie aus dem Sitz zu stemmen und den Gang zur Tür hinunterzuwanken.
Als ich das Foyer erreicht hatte, verschwamm alles vor meinen Augen. Ich weiß noch, dass ich es irgendwie an der Kasse vorbeischaffte und durch einige Gänge irrte, bis ich den Aufzug fand und auf die Straße gespuckt wurde. Aber ich wollte nicht auf die Straße. Ich wollte in die Metro. Warum war ich hinaufgefahren, wenn ich doch eigentlich nach unten wollte?
Ein Geruch drang mir in die Nase: Fastfood-Fett. Fastfood aus dem Nahen Osten. Ich war neben ein paar billigen Cafés gelandet. Mir gegenüber stand ein dicklicher Typ, der vor dem Laden Falafel frittierte. Neben ihm drehte sich eine schwarz gewordene, bereits zur Hälfte abgeschabte Lammkeule am Spieß. Sie war von Krampfadern übersät (kriegen Lämmer Krampfadern?). Unter dem Lamm lagen Pizzastücke, die aussahen wie Penicillinkulturen. Ein Blick genügte, und mir wurde übel. Zusammen mit dem Falafelduft schlug mir das auf den Magen. Kurz darauf drehte sich mir der Magen um. Ich beugte mich vor und übergab mich, meine Schuhe bekamen einiges ab. Während ich noch würgte, begann der Kellner eines gegenüberliegenden Cafés zu brüllen – irgendwas von wegen, was für ein ekelhaftes Schwein ich sei, das seine Kunden verscheuchte. Ich antwortete nicht, gab keine Erklärung ab, sondern taumelte weiter. Mein Blick war nach wie vor getrübt, ich schaffte es aber, die Plastiklüftungsrohre des nahe gelegenen Centre Pompidou im Auge zu behalten. Kurz bevor ich da war, hielt ein Taxi vor einem kleinen Hotel, auf das ich zuwankte – ein glücklicher Zufall. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen waren, stieg ich ein. Mit Mühe nannte ich dem Fahrer die Adresse des »Sélect«, dann ließ ich mich in den Sitz zurückfallen und spürte, wie sich das Fieber wieder bemerkbar machte.
Die Fahrt bestand aus einer Reihe von Blackouts. Erst fand ich mich in einer dunklen Unterwelt wieder, und als Nächstes beschwerte sich der Fahrer ausgiebig, dass meine vollgekotzten Schuhe sein Taxi vollstanken. Blackout. Noch mehr Verwünschungen vonseiten des Fahrers. Blackout. Ein Stau – grellgelbes Schweinwerferlicht, das durch ein von Regenschlieren überzogenes Wagenfenster fällt. Blackout. Noch mehr gelbes Scheinwerferlicht, und der Fahrer setzt seine Suada fort: Jetzt ging es um irgendwelche Leute, die die Taxispur blockieren, darum, dass er möglichst nie Nordafrikaner mitnehme und dass er einen großen Bogen um mich machen werde, wenn er mich noch einmal auf der Straße sähe. Blackout. Eine Tür ging auf. Eine Hand half mir aus dem Wagen. Eine Stimme flüsterte mir freundlich etwas zu und befahl mir, zwölf Euro auszuhändigen. Ich gehorchte und tastete in meiner Hosentasche nach dem Geldschein-Clip. Im Hintergrund hörte ich Stimmen. Ich stand auf und lehnte mich an das Taxi. Ich sah zum Himmel hinauf und spürte den Regen. Meine Knie gaben nach. Ich fiel.
Blackout.
Und dann lag ich in einem Bett. Meine Augen wurden von einem Lichtstrahl geblendet. Mit einem Klicken ging das Licht aus. Als ich wieder deutlich sehen konnte, erkannte ich, dass auf dem Stuhl neben meinem Bett ein Mann saß, um dessen Hals ein Stethoskop hing. Hinter ihm stand noch jemand, der jedoch von der Dunkelheit verschluckt wurde. Mein Ärmel wurde hochgekrempelt, und mit etwas Feuchtem abgetupft. Dann spürte ich einen schmerzhaften Stich, und eine Nadel drang in meinen Arm.
Blackout.
Zwei
Licht drang mir in die Augen. Aber es blendete nicht so wie beim letzten Mal. Nein, das war Morgenlicht, ein kräftiger Sonnenstrahl, der auf mein Gesicht fiel und mich ...
Wo bin ich?
Es dauerte ein wenig, bis ich das Zimmer erkennen konnte. Vier Wände. Eine Decke. Nun, immerhin etwas. Die Wände waren blau tapeziert. Eine Plastiklampe baumelte von der Decke. Sie war blau. Ich sah nach unten. Die Auslegeware im Zimmer war blau. Ich zwang mich, mich aufzusetzen. Ich lag in einem Doppelbett. Die schweißnassen Laken waren blau. Das Kopfende des Bettes war im passenden Babyblau gepolstert. Ist das etwa einer von diesen LSD-Flashbacks? Ist das die Quittung für mein einziges Experiment mit halluzinogenen Drogen anno 1982 ...
Neben dem Bett stand ein Tisch. Er war nicht blau. (Na gut, ich bin also noch nicht völlig durchgedreht.) Darauf befanden sich eine Flasche Wasser sowie mehrere Schachteln mit Medikamenten. Unweit davon war ein kleiner Schreibtisch, auf dem ein Laptop lag. Mein Laptop. Ein schmaler Metallstuhl stand vor dem Schreibtisch. Er hatte eine blaue Sitzfläche. (Oh nein, es geht schon wieder los!) Meine blaue Jeans und mein blauer Pulli hingen darüber. Es gab einen kleinen Kleiderschrank – mit demselben Holzfurnier wie Nacht – und Schreibtisch. Er stand offen – und auf seinen Bügeln hingen die paar Hosen, Hemden und das eine Jackett, alles, was ich vor zwei Tagen in den Koffer gestopft hatte, als ...
War das wirklich zwei Tage her? Oder besser gefragt, welcher Tag war heute? Und wie war ich in diesem blauen Zimmer gelandet? Denn wenn es eine Farbe gibt, die ich hasse, dann ist es Himmelblau. Und ...
Es klopfte. Ohne meine Antwort abzuwarten, betrat ein Mann mit Tablett das Zimmer. Sein Gesicht kam mir bekannt vor.
»Bonjour«, sagte er knapp. »Voici le petit déjeuner.«
»Danke«, murmelte ich auf Französisch.
»Wie ich hörte, ging es Ihnen schlecht.«
»Ach ja?«
Er stellte das Tablett aufs Bett. Jetzt erkannte ich ihn wieder. Das war der Portier, der mich damals weggeschickt hatte, als ich in dem einen Hotel angekommen war ...
Nein, es war dieses Hotel. Das »Sélect«. Dahin sollte mich der Taxifahrer gestern Abend bringen, nachdem ich ...
So langsam ergab alles einen Sinn.
»Zumindest hat mir Adnan diese Nachricht hinterlassen.«
»Wer ist Adnan?«, fragte ich.
»Der Nachtportier.«
»Ich kann mich nicht erinnern, ihn kennengelernt zu haben.«
»Nun, offensichtlich hat er Sie kennengelernt.«
»Wie krank war ich denn?«
»Krank genug, um sich nicht mehr daran erinnern zu können, wie krank Sie waren. Aber das ist nur eine Vermutung, da ich nicht dabei war. Der Arzt, der Sie behandelt hat, schaut heute Nachmittag nochmal gegen fünf bei Ihnen vorbei. Er wird Ihnen alles erklären. Vorausgesetzt, Sie sind heute Nachmittag noch hier. Ich habe Sie bis morgen eingetragen, monsieur,da Sie das Zimmer in Ihrem Zustand sicherlich noch behalten möchten. Aber Ihre Kreditkarte wurde nicht akzeptiert. Ihr Konto ist nicht gedeckt.«
Das wunderte mich nicht. Der Kreditrahmen meiner Visacard war vollkommen ausgeschöpft, und ich hatte in dem Bewusstsein eingecheckt, hier höchstens zwei Nächte verbringen zu können. Das Geld, um die längst fällige Kreditkartenabrechnung zu bezahlen, hatte ich nicht. Trotzdem erschrak ich über diese Nachricht. Weil sie mich an meine traurige Realität erinnerte: Alles war schiefgegangen, und jetzt war ich weit weg von zu Hause in diesem beschissenen Hotel gelandet ...
Wie kann man von »Zuhause« reden, wenn man gar kein Zuhause mehr hat, weil es einem weggenommen wurde wie alles andere auch?
»Nicht gedeckt?«, sagte ich bemüht amüsiert. »Wie ist das passiert?«
»Wie das passiert ist?«, entgegnete er kühl. »Es ist einfach so.«
»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.«
Er zuckte die Achseln. »Da gibt es nichts zu sagen, es sei denn, Sie haben noch eine andere Kreditkarte.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wie gedenken Sie dann das Zimmer zu bezahlen?«
»Mit Traveler-Schecks.«
»Die akzeptieren wir – vorausgesetzt, sie sind gültig. Sind sie von American Express?«
Ich nickte.
»Gut. Ich werde American Express anrufen. Wenn mir die Gültigkeit der Schecks bestätigt wird, können Sie bleiben. Ansonsten ...«
»Vielleicht sollte ich lieber gleich auschecken«, sagte ich, denn mehr Nächte würde ich mir in diesem Hotel bestimmt nicht leisten können.
»Ganz wie Sie wollen. Bis elf Uhr vormittags kann bei uns ausgecheckt werden. Sie haben etwas mehr als zwei Stunden, um das Zimmer zu räumen.«
Als er sich zum Gehen wandte, beugte ich mich vor und versuchte nach dem Croissant auf dem Frühstückstablett zu greifen. Gleich darauf ließ ich mich wieder erschöpft gegen das Kopfende des Bettes sinken. Ich fasste mir an die Stirn. Ich hatte immer noch Fieber und fühlte mich vollkommen entkräftet. Dieses Bett zu verlassen, kam mir so mühsam vor wie ein größeres Militärmanöver. Mir blieb also nichts anderes übrig, als hierzubleiben und mit dieser Tatsache zu leben.
»Monsieur...«, sagte ich.
Der Portier drehte sich um.
»Ja?«
»Die Traveler-Schecks müssten in meiner Umhängetasche sein.«
Seine Lippen verzogen sich zur Andeutung eines Lächelns. Er holte die Tasche und reichte sie mir, nicht ohne mich daran zu erinnern, dass das Zimmer sechzig Euro pro Nacht koste. Ich öffnete die Tasche und fand mein Bündel mit Traveler-Schecks. Ich zog zwei Schecks heraus – einen über fünfzig und einen über zwanzig Dollar. Ich unterschrieb sie beide.
»Ich brauche nochmal zwanzig«, sagte er. »In Dollar kostet es neunzig.«
»Aber das ist weit mehr als der normale Wechselkurs«, wandte ich ein. Wieder ein herablassendes Achselzucken. »Das ist der Tarif, den wir unten an der Rezeption ausgehängt haben. Wenn Sie herunterkommen und selbst nachsehen möchten ...«
Ich kann mich kaum aufsetzen, geschweige denn nach unten gehen.
Ich zog einen weiteren Traveler-Scheck über zwanzig Dollar hervor, unterschrieb ihn und warf ihn aufs Bett.
»Bitte sehr.«
»Très bien, monsieur«, sagte er und griff danach. »Ich werde alle Angaben, die ich benötige, Ihrem Pass entnehmen. Er liegt unten.«
Ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, ihn dir ausgehändigt zu haben. Ich kann mich an gar nichts erinnern.
»Und ich werde Ihnen Bescheid geben, sobald mir American Express die Gültigkeit der Traveler-Schecks bestätigt hat.«
»Sie sind gültig.«
Wieder so ein schmieriges Lächeln.
»On verra.« Wir werden sehen.
Er ging. Völlig erschöpft ließ ich mich in die Kissen fallen und stierte mit leerem Blick an die Zimmerdecke – wie hypnotisiert von der blauen Leere –, ich versuchte, mich darin zu verlieren. Aber ich musste auf die Toilette. Ich wollte mich aufrichten und die Füße auf den Boden stellen. Keine Kraft, willenlos. Auf dem Nachttisch stand eine Vase. Darin Plastikblumen: blaue Gardenien. Ich griff nach der Vase, nahm die Blumen heraus, warf sie auf den Boden, zog die Boxershorts herunter, steckte meinen Penis in die Vase, und ließ es laufen. Die Erleichterung war ebenso überwältigend wie der Gedanke: Das ist alles so würdelos!
Das Telefon klingelte. Es war der Portier.
»Die Schecks werden akzeptiert. Sie können bleiben.«
Wie nett von Ihnen.
»Adnan hat angerufen. Er wollte wissen, wie es Ihnen geht.«
Was geht ihn das an?
»Er lässt Ihnen auch ausrichten, dass Sie aus den Schachteln auf Ihrem Nachttisch je eine Tablette nehmen sollen. Die hat der Arzt Ihnen verschrieben.«
»Was sind das für Tabletten?«
»Ich bin hier nicht der Arzt, monsieur.«
Ich griff nach den Schachteln und Fläschchen und versuchte die Namen der Medikamente zu entziffern. Keiner davon kam mir bekannt vor. Trotzdem nahm ich wie befohlen eine Tablette aus jeder der sechs Schachteln und schluckte sie mit viel Wasser hinunter.
Innerhalb kürzester Zeit war ich wieder weggedöst – ich verschwand in jene riesige traumlose Leere und verlor jedes Zeitgefühl. Schon der nächste Tag schien in weiter Ferne zu liegen. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Tod, der mich eines Tages holen – und dafür sorgen wird, dass ich nie wieder aufwachen werde.
Drrringgggggggg ...
Telefon. Ich war zurück in dem blauen Zimmer und starrte die Vase mit dem Urin an. Der Reisewecker zeigte zwölf Minuten nach fünf. Das Licht einer Straßenlaterne drang durch die Vorhänge. Der Tag neigte sich seinem Ende zu. Das Telefon läutete weiter. Ich ging dran.
»Der Arzt ist da«, sagte der Portier.
Der Arzt hatte furchtbare Schuppen, abgekaute Nägel, und sein Anzug musste dringend mal wieder gebügelt werden. Er war um die fünfzig, hatte schütteres Haar, einen traurigen Schnurrbart und dermaßen tiefliegende Augen, dass sogar ich als gleichermaßen Schlafloser sah, was ihm fehlte. Er zog einen Stuhl ans Bett und fragte mich, ob ich Französisch spreche. Ich nickte. Mit einer Geste forderte er mich auf, mein T-Shirt auszuziehen. Als ich gehorchte, roch ich, dass ich stank. Ich hatte vierundzwanzig Stunden in meinem eigenen Schweiß gebadet.
Der Arzt schien nicht auf meinen Körpergeruch zu reagieren – vielleicht, weil er seine Aufmerksamkeit der Vase am Bett schenkte.
»Sie hätten keine Urinprobe abgeben müssen«, sagte er und fühlte meinen Puls. Dann kontrollierte er mein Herz, steckte mir ein Thermometer unter die Zunge, legte eine Blutdruckmanschette um meinen linken Bizeps, sah in meinen Hals und leuchtete mir mit einer Taschenlampe ins Weiße meiner Augen. Endlich sprach er wieder mit mir.
»Sie haben ein besonders aggressives Grippevirus erwischt. Es löst eine Form der Grippe aus, die alte Menschen ins Grab bringen kann. Das ist oft ein Hinweis auf andere Probleme.«
»Die da wären?«
»Darf ich fragen, ob Sie gerade eine schwere Zeit haben?«
Ich schwieg.
»Ja«, sagte ich schließlich.
»Sind Sie verheiratet?«
»Das weiß ich nicht.«
»Womit Sie mir sagen wollen, dass ...«
»Rechtlich gesehen bin ich noch verheiratet ...«
»Aber Sie haben Ihre Frau verlassen?«
»Nein – es war genau andersherum.«
»Und sie hat Sie erst vor kurzem verlassen?«
»Ja – sie hat mich vor ein paar Wochen rausgeworfen.«
»Sie wollten also nicht gehen?«
»Nein.«
»Gibt es einen anderen Mann?«
Ich nickte.
»Und beruflich sind Sie ...«
»Ich habe an einem College unterrichtet.«
»Sie haben unterrichtet?«, sagte er und betonte die Vergangenheitsform.
»Ich bin meinen Job los.«
»Auch das erst seit kurzem?«
»Ja.«
»Kinder?«
»Eine fünfzehnjährige Tochter. Sie lebt bei ihrer Mutter.«
»Haben Sie Kontakt zu ihr?«
»Ich wünschte ...«
»Sie will nicht mit Ihnen reden?«
Ich zögerte. Dann sagte ich: »Sie hat mir gesagt, dass sie nie wieder mit mir reden will – aber ich weiß, dass ihre Mutter ihr das eingeredet hat.«
Er legte die Fingerspitzen aneinander und überlegte eine Weile. Dann fragte er:
»Rauchen Sie?«
»Seit fünf Jahren nicht mehr.«
»Trinken Sie viel?«
»In letzter Zeit schon ...«
»Drogen?«
»Ich nehme Schlaftabletten. Keine verschreibungspflichtigen. Aber die haben mir in den letzten Wochen nicht mehr geholfen. Deshalb ...«
»Chronische Schlaflosigkeit?«
»Ja.«
Er schenkte mir ein kurzes Nicken – als Eingeständnis, dass er die Hölle der Schlaflosigkeit ebenfalls kannte. Dann sagte er: »Sie haben eindeutig einen Zusammenbruch erlitten. Der Körper erträgt nur ein gewisses Maß an ... tristesse. Irgendwann schützt er sich vor einem derartigen traumatisme, indem er zusammenbricht oder sich einer Virenattacke ergibt. Die Grippe, an der Sie leiden, ist schlimmer als normal, weil Sie in einer derart schlechten Verfassung sind.«
»Und was tun wir dagegen?«
»Ich kann nur die körperliche Erkrankung behandeln. Und das Grippevirus ist besonders unberechenbar. Ich habe Ihnen verschiedene comprimés verschrieben: gegen die Schmerzen, das Fieber, die Austrocknung, die Übelkeit und gegen den Schlafmangel. Aber das Virus wird Ihren Körper erst verlassen, wenn es sich – na, sagen wir mal, langweilt und weiterziehen will.«
»Wie lange kann das dauern?«
»Vier, fünf Tage, mindestens.«
Ich schloss die Augen. Ich konnte mir keine vier, fünf Tage in diesem Hotel mehr leisten.
»Und auch danach werden Sie sich noch mehrere Tage kraftlos fühlen. Sie sollten noch mindestens eine Woche hierbleiben.«
Er stand auf.
»Ich komme in zweiundsiebzig Stunden wieder, um zu sehen, ob Sie sich dann auf dem Weg der Besserung befinden.«
Kann man sich wirklich jemals von dem erholen, was das Leben als Schlimmstes für uns bereithält?
»Eins noch, eine sehr persönliche Frage an Sie: Was führt Sie kurz nach Weihnachten so ganz allein nach Paris?«
»Ich bin davongelaufen.«
Er ließ die Worte auf sich wirken und sagte dann: »Oft gehört Mut dazu, um davonzulaufen.«
»Nein, da täuschen Sie sich«, erwiderte ich. »Dazu gehört keinerlei Mut.«
Drei
Fünf Minuten, nachdem der Arzt gegangen war, betrat der Portier das Zimmer. Er hielt ein Stück Papier in der Hand. Mit übertriebener Geste reichte er es mir, als wäre es eine offizielle Urkunde.
»La facture du médicin.« Die Arztrechnung.
»Darum kümmere ich mich später.«
»Er möchte jetzt bezahlt werden.«
»Er kommt in drei Tagen wieder. Kann er nicht so lange warten ...?«
»Er hätte schon gestern Abend bezahlt werden müssen. Aber weil es Ihnen so schlechtging, hat er sich entschieden, bis heute zu warten.«
Ich warf einen Blick auf die Rechnung. Sie war auf Hotelbriefpapier gedruckt. Darauf stand eine erstaunliche Summe: 264 Euro.
»Das soll wohl ein Scherz sein!«, sagte ich.
Er verzog keine Miene.
»Das ist sein Honorar zuzüglich der Kosten für die Medikamente.«
»Sein Honorar? Die Rechnung ist auf Ihrem Briefpapier ausgedruckt worden.«
»Alle Arztrechnungen werden über uns abgerechnet.«
»Und der Arzt verlangt hundert Euro für den Hausbesuch?«
»In dieser Summe ist auch eine Verwaltungsgebühr enthalten.«
»Und die beläuft sich auf wie viel?«
Er sah mich direkt an.
»Auf fünfzig Euro pro Besuch.«
»Das ist Halsabschneiderei.«
»Alle Hotels berechnen Verwaltungsgebühren.«
»Aber doch keinen Preisaufschlag von hundert Prozent!«
»Das sind nun mal unsere Konditionen.«
»Und Sie haben auf diese Medikamente auch nochmal hundert Prozent draufgeschlagen?«
»Tout à fait. Ich musste Adnan zur Apotheke schicken, damit er sie besorgt. Das hat eine Stunde gedauert. Da er sich in dieser Zeit nicht ums Hotel kümmern konnte, muss diese Zeit natürlich erstatt...«
»Sich nicht ums Hotel kümmern konnte? Ich bin hier Gast. Und sagen Sie mir jetzt nicht, dass Ihr Nachtportier zweiunddreißig Euro die Stunde bekommt.«
Er versuchte ein amüsiertes Lächeln zu verbergen. Vergebens.
»Die Gehälter unserer Angestellten sind ...«
Ich zerknüllte die Rechnung und warf sie zu Boden.
»Nun. Ich werde das nicht bezahlen.«
»Dann müssen Sie das Hotel sofort verlassen.«
»Sie können mich nicht dazu zwingen.«
»Au contraire, wenn ich will, stehen Sie innerhalb von fünf Minuten auf der Straße. Im Erdgeschoss warten zwei Männer – notre homme à tout faire und der Koch – die Sie gewaltsam aus dem Hotel entfernen werden, wenn ich ihnen eine entsprechende Anweisung gebe.«
»Dann würde ich die Polizei rufen.«
»Und das soll mir Angst machen?«, fragte er. »Die Polizei wird mit Sicherheit Partei für das Hotel ergreifen, nachdem ich sie davon in Kenntnis gesetzt habe, dass wir Sie herauswerfen, weil Sie dem Koch sexuelle Avancen gemacht haben. Und der Koch wird das der Polizei gegenüber bestätigen – ganz einfach, weil er ein ungebildeter, streng gläubiger Moslem ist und ich ihn vor zwei Monaten dans une situation très embarrassante mit notre homme à tout faire erwischt habe. Und jetzt tut er alles, was ich ihm sage, weil er Angst hat, aufzufliegen.«
»Das werden Sie nicht wagen ...«
»Oh, doch. Und die Polizei wird Sie nicht nur wegen Unzucht verhaften, sondern auch Informationen über Sie einholen. Sie wird sich sehr dafür interessieren, warum Sie Ihre Heimat dermaßen überstürzt verlassen haben.«
»Sie wissen doch gar nichts über mich«, sagte ich schon deutlich nervöser.
»Vielleicht – aber zumindest so viel, dass Sie nicht in Paris sind, um hier Urlaub zu machen ... Sie laufen vor irgendwas davon. Das hat mir der Arzt erzählt.«
»Ich habe nichts Verbotenes getan.«
»Das behaupten Sie.«
»Sie sind ein Arschloch«, sagte ich.
»Das ist Ihre persönliche Meinung«, erwiderte er.
Ich schloss die Augen. Er hatte alle Trümpfe in der Hand, und ich war ihm gegenüber machtlos.
»Geben Sie mir meine Tasche.«
Er gehorchte. Ich zog das Bündel mit Traveler-Schecks hervor.
»Das waren 264 Euro, stimmt’?«
»In Dollar macht das dreihundertfünfundvierzig.«
Ich nahm einen Stift, unterschrieb die nötige Anzahl Schecks und warf sie zu Boden.
»Bitte sehr. Bedienen Sie sich.«
»Avec plaisir, monsieur.«
Er hob die Schecks auf und sagte: »Ich werde morgen wiederkommen, und das Geld für das Zimmer abkassieren – vorausgesetzt, Sie möchten noch bleiben.«
»Sobald ich in der Lage bin, diesen Raum zu verlassen, werde ich verschwinden.«
»Trés bien, monsieur. Und übrigens, danke, dass Sie in die Vase gepinkelt haben. Très classe.«
Mit diesen Worten ging er.
Ich ließ mich erschöpft und voller Wut in die Kissen sinken. Vor allem mit letzterem Gefühl hatte ich in den vergangenen Wochen ausgiebig Bekanntschaft gemacht – ich fühlte mich wie eine tickende Zeitbombe. Die Wut richtete sich jedoch nach innen und wurde noch viel zerstörerischer: Sie wandelte sich um in Selbsthass und zwar einen, der zu Depressionen führt. Der Arzt hatte Recht: Ich hatte schlappgemacht.
Und wenn der Grippevirus endlich weiterzog, was dann? Dann wäre ich immer noch völlig erledigt und ruiniert.
Ich griff in meine Umhängetasche und zog die Traveler-Schecks heraus. Viertausendsechshundertfünfzig Dollar. Mein gesamtes Vermögen, mehr besaß ich nicht, denn dank der Schmutzkampagne in der Zeitung würden Susans Anwälte den Scheidungsrichter bestimmt davon überzeugen, alles Susan zuzusprechen: das Haus, die Rentensparpläne, die Lebensversicherungspolicen, auch das kleine Aktiendepot, das wir gemeinsam angelegt hatten. Wir waren nicht reich – das sind Akademiker selten. Und mit einer minderjährigen Tochter, und einem Ex-Mann, dem die Lehrerlaubnis entzogen worden war, würde das Gericht sicherlich zu dem Schluss kommen, dass sie die paar Vermögenswerte verdient hatte, die wir gemeinsam besaßen. Ich würde keinen Widerspruch dagegen einlegen. Ganz einfach, weil ich keinerlei Widerspruchsgeist mehr besaß – außer wenn es darum ging, meine Tochter davon zu überzeugen, wieder mit mir zu reden.
Viertausendsechshundertfünfzig Dollar. Auf dem unbequemen Hinflug hatte ich ein paar Berechnungen auf der Rückseite einer Papierserviette aufgestellt. Damals hatte ich noch knapp über fünftausend Dollar besessen. Beim heutigen, legalen Wechselkurs entsprach das etwas mehr als viertausend Euro. Wenn ich sehr sparsam war, hatte ich geschätzt, damit vielleicht drei bis vier Monate in Paris über die Runden zu kommen – vorausgesetzt, ich fand irgendwo ein billiges Zimmer. Aber bereits achtundvierzig Stunden nach der Landung hatte ich bereits mehr als vierhundert Dollar ausgegeben. Und da es im Moment nicht so aussah, als käme ich in den nächsten Tagen hier weg, musste ich damit rechnen, pro Nacht noch weitere unverschämte hundert Dollar abzudrücken, bis ich mich fit genug fühlte, dieses Drecksloch zu verlassen.
Meine Wut wich der Erschöpfung. Ich wollte ins Bad gehen, mein durchgeschwitztes T-Shirt und meine Unterhose loswerden und duschen. Aber ich schaffte es noch nicht, das Bett zu verlassen. Also blieb ich einfach liegen und starrte geistesabwesend an die Decke, bis mich wieder nichts als Leere umgab.
Es klopfte zweimal leise an der Tür. Ich wurde wach, alles verschwamm vor meinen Augen. Noch ein Klopfen, danach ging die Tür einen Spalt weit auf, und eine Stimme sagte leise: »Monsieur ...?«
»Gehen Sie!«, sagte ich. »Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben.«
Die Tür ging noch weiter auf. Dahinter tauchte ein Mann von Anfang vierzig auf – mit rotbraunem Teint und kurzen schwarzen Haaren. Er trug einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd.
»Monsieur, ich wollte nur wissen, ob Sie irgendetwas brauchen.«
Er sprach zwar fließend Französisch, hatte aber einen starken Akzent.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Ich dachte, Sie wären ...«
»Monsieur Brasseur?«
»Wer ist Monsieur Brasseur?«
»Der Tagportier.«
»So heißt dieser Mistkerl also: Brasseur.«
Ein schwaches Lächeln erreichte mich von dem Mann in dem Türspalt.
»Niemand mag Monsieur Brasseur, außer dem Hotelmanager – denn Brasseur besitzt ein großes Talent zur provocation.«
»Sind Sie der Mann, der mir gestern aus dem Taxi geholfen hat?«
»Ja, ich bin Adnan.«
»Vielen Dank nochmal – auch dafür, dass Sie mich und meine Sachen hier hereingebracht haben.«
»Sie waren sehr krank.«
»Trotzdem hätten Sie mich nicht ausziehen, ins Bett bringen, einen Arzt rufen und alles auspacken müssen. Das war wirklich außergewöhnlich nett von Ihnen.«
Er wandte schüchtern den Blick ab.
»Das ist mein Job«, sagte er. »Wie geht es Ihnen heute Abend?«
»Sehr schlapp und sehr dreckig.«
Er trat ins Zimmer. Als er näher kam, sah ich, dass er tiefe Furchen um die Augen hatte – Falten, die zum Gesicht eines zwanzig Jahre älteren Mannes gepasst hätten. Sein Anzug war eng, ziemlich abgetragen und saß schlecht. Zeige – und Mittelfinger der rechten Hand hatten deutliche Nikotinflecken.
»Glauben Sie, dass Sie aufstehen können?«, fragte er.
»Nicht ohne fremde Hilfe.«
»Dann werde ich Ihnen helfen. Aber erst lasse ich Ihnen Wasser in die Wanne. Ein ausgiebiges Bad wird Ihnen guttun.«
Ich nickte schwach. Er kümmerte sich um alles. Ohne sich über ihren Inhalt zu empören, griff er nach der Vase und verschwand im Bad. Ich hörte, wie er die Toilettenspülung betätigte und den Wasserhahn aufdrehte. Er kam zurück ins Schlafzimmer, zog sein Jackett aus und hängte es in den Schrank. Dann nahm er meine Jeans, das Hemd und die Socken vom Schreibtischstuhl und stopfte sie in einen Kissenbezug.
»Gibt es sonst noch schmutzige Wäsche?«, fragte er.
»Nur das, was ich am Körper trage.«
Er ging zurück ins Bad. Das Wasser wurde abgestellt. Dampf drang durch den Türspalt. Er kehrte zurück, sein Gesicht glänzte feucht, sein rechter Arm war nass.
»Das Wasser ist heiß, aber nicht zu heiß.«
Er trat ans Bett, half mir, mich aufzurichten und meine Füße auf den Boden zu stellen, hob dann meinen linken Arm, legte ihn um seine Schulter und zog mich hoch. Meine Beine fühlten sich an wie Gummi, aber Adnan hielt mich aufrecht und führte mich langsam ins Bad.
»Brauchen Sie Hilfe beim Ausziehen?«, fragte er.
»Nein, das kriege ich schon hin.«
Aber als ich eine Hand vom Waschbecken löste, verlor ich das Gleichgewicht und spürte, wie meine Knie nachgaben. Adnan half mir auf und bat mich leise, mich mit einer Hand am Waschbecken abzustützen und die andere nach oben zu strecken. Ich schaffte es, meinen Arm so lange hoch zu halten, bis er mir das T-Shirt über den Kopf gezogen hatte. Dann bat er mich, mit dem anderen Arm dasselbe zu machen, und nahm es mir ganz ab. Mit einer raschen Bewegung zog er meine Boxershorts herunter, bis sie am Boden lag. Ich stieg heraus und ließ mich von Adnan die zwei Schritte zur Wanne führen. Das Wasser war sehr heiß. So heiß, dass ich zurückzuckte, als mein Fuß die Wasseroberfläche berührte, aber Adnan ignorierte meinen Protest und schob mich sanft in die Wanne. Nach dem ersten Schrecken spürte ich eine merkwürdige Ruhe in mir.
»Brauchen Sie Hilfe beim Waschen?«
»Ich Versuch’s selbst.«
Es gelang mir, meine Genitalien, meine Brust und meine Unterarme einzuseifen, hatte allerdings nicht genug Kraft, um auch meine Füße zu erreichen. Deshalb nahm Adnan das Stück Seife und kümmerte sich darum. Er duschte auch mein Haar ab und wusch es mit Shampoo. Dann nahm er Rasiercreme und einen Rasierer aus meinem Toilettenset, das er vorher geöffnet hatte, kniete sich vor die Wanne und begann mein Gesicht mit Schaum zu bedecken.
»Sie müssen das aber nicht tun«, sagte ich verlegen wegen der vielen Umstände, die er sich meinetwegen machte.
»Sie werden sich danach aber besser fühlen.«
Er ließ die Rasierklinge vorsichtig über mein Gesicht gleiten. Als er fertig war, duschte er den Schaum und das Shampoo ab. Anschließend füllte er das Waschbecken mit heißem Wasser, tauchte ein Handtuch hinein und legte es mir aufs Gesicht, ohne es vorher auszuwringen.
»Jetzt bleiben Sie bitte eine Viertelstunde so liegen«, sagte Adnan.
Er verließ das Bad. Ich öffnete die Augen und sah nur noch das Weiß des Handtuchs. Erneut schloss ich die Augen und versuchte, an nichts zu denken, mich auf nichts zu konzentrieren. Vergeblich. Aber das Badewasser war angenehm, und es tat gut, wieder sauber zu sein. Hin und wieder hörte ich Geräusche aus dem Nebenraum, aber Adnan ließ mich lange in Ruhe. Dann klopfte es leise an die Badezimmertür.
»Fertig?«, fragte er.
Wieder musste er mir helfen. Er wickelte mich in ein dünnes Hotelbadehandtuch und reichte mir dann zwei zusammengefaltete Kleidungsstücke.
»Das hab ich bei Ihren Sachen gefunden: eine Schlafanzughose und ein T-Shirt.«
Er half mir beim Abtrocknen und Anziehen, dann führte er mich zurück zum Bett, das er frisch bezogen hatte. Die Laken fühlten sich herrlich kühl an, als ich mich dazwischenschob. Adnan schob mir die Kissen so in den Rücken, dass ich mich aufsetzen und ans Kopfende lehnen konnte. Er nahm ein Tablett, das auf dem Schreibtisch gestanden hatte. Vorsichtig trug er es zu mir. Darauf waren eine Suppenterrine, eine Schüssel und ein kleines Baguette.
»Das ist eine ganz leichte bouillon«, sagte er und goss etwas davon in die Schüssel. »Sie müssen etwas essen.«
Er reichte mir den Löffel.
»Brauchen Sie Hilfe?«
Ich konnte alleine essen – und die dünne bouillon war sehr kräftigend. Ich schaffte es sogar, fast das ganze Baguette zu essen – mein Hunger war stärker als meine Alles-egal-Stimmung vorher.
»Sie sind viel zu nett zu mir«, sagte ich.
Ein kleines, schüchternes Nicken.
»Das ist mein Job«, wiederholte er und entschuldigte sich. Als er kurz darauf wiederkam, trug er ein weiteres Tablett herein – diesmal standen eine Teekanne und eine Tasse darauf.
»Ich habe Ihnen einen verveine-Aufguss gemacht«, sagte er. »Der hilft beim Einschlafen. Aber erst müssen Sie Ihre Medikamente nehmen.«
Er gab mir die entsprechenden Tabletten und ein Glas Wasser. Ich schluckte sie, eine nach der anderen. Dann trank ich von dem Kräutertee.
»Haben Sie morgen Abend wieder Dienst?«, fragte ich.
»Meine Schicht beginnt um fünf«, sagte er.
»Das ist gut. Niemand hat sich mehr so um mich gekümmert, seit ...«
Ich schlug mir die Hand vor den Mund und verfluchte mich für diese selbstmitleidige Bemerkung. Gleichzeitig versuchte ich ein Aufschluchzen zu unterdrücken. Gerade bevor es mir in die Kehle stieg, konnte ich es stoppen und atmete tief durch. Als ich die Hände von meinen Augen nahm, sah ich, dass Adnan mich beobachtete.
»Entschuldigung ...«, murmelte ich.
»Aber weswegen?«, fragte er.
»Ich weiß nicht ... wegen allem, nehme ich an.«
»Sind Sie allein in Paris?«
Ich nickte.
»Das ist schwer«, sagte er. »Ich kenne das.«
»Wo kommen Sie her?«, fragte ich.
»Aus der Türkei. Aus einem kleinen Dorf, etwa hundert Kilometer von Ankara entfernt.«
»Seit wann sind Sie in Paris?«
»Seit vier Jahren.«
»Gefällt es Ihnen hier?«
»Nein.« Schweigen.
»Sie müssen sich ausruhen«, sagte er.
Er nahm eine Fernbedienung vom Schreibtisch, die er auf den kleinen Fernseher an der Wand richtete.
»Wenn Sie einsam sind oder sich langweilen, gibt es immer noch das hier«, sagte er und drückte mir die Fernbedienung in die Hand.
Ich starrte zum Fernseher hoch. Vier gut aussehende Menschen saßen um einen Tisch, lachten und redeten. Hinter ihnen saß das Publikum auf einer Tribüne und lachte, sobald einer der Gäste einen lustigen Kommentar abgab – oder aber es applaudierte laut, wenn der Schnellsprecher-Moderator es zum Jubel aufrief.
»Ich komme später nochmal wieder und sehe nach Ihnen«, sagte Adnan.
Ich machte den Fernseher aus, denn plötzlich war ich müde. Mein Blick fiel wieder auf die Medikamente. Auf einem stand Zopiclone. Der Name kam mir vage bekannt vor ... vermutlich etwas, das mir mein Arzt zu Hause in den USA gegen die Schlaflosigkeit verschrieben hatte. Egal, was es war, es wirkte schnell, ließ sämtliche Konturen verschwimmen, dämpfte alle Ängste sowie das grelle Licht des blauen Kronleuchters an der Decke und schickte mich ...
Es war Morgen. Oder eher kurz davor. Das graue Licht der Dämmerung drang ins Zimmer. Als ich mich reckte, spürte ich, dass es mir ein bisschen besserging. Ich konnte aufstehen und langsam wie ein alter Mann ins Bad gehen. Ich ging aufs Klo, danach spritzte ich mir ein wenig Wasser ins Gesicht, kehrte in das blaue Zimmer zurück und ließ mich aufs Bett fallen.
Monsieur Brasseur kam gegen neun mit dem Frühstück. Er klopfte zweimal laut an die Tür, kam ohne weitere Vorwarnung herein und stellte das Tablett aufs Bett. Kein Hallo, kein comment allez-vous, monsieur?, nur eine einzige Frage: »Bleiben Sie noch eine weitere Nacht?«
»Ja.«
Er holte meine Tasche. Ich unterschrieb noch einen Traveler-Scheck im Wert von hundert Dollar. Er griff danach und ging. Den Rest des Tages sah ich ihn nicht mehr.
Ich konnte das trockene Croissant und den Milchkaffee zu mir nehmen, machte den Fernseher an und zappte durch die Kanäle. Das Hotel bot nur fünf französische Programme an. Hier war das Frühstücksfernsehen genauso banal wie in den USA. Gameshows, in denen Hausfrauen versuchten, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen und für ein ganzes Jahr eine Putzfrau gewinnen konnten. Reality-Shows, in denen sich längst vergessene Schauspieler auf einem echten Bauernhof bewähren mussten. Talkshows, in denen Promis mit anderen Promis redeten und in denen regelmäßig halbbekleidete Mädchen auftraten und sich auf den Schoß irgendeines alternden Rockstars setzten ...
Ich machte den Fernseher aus, griff nach meinem Pariscope, studierte das Kinoprogramm und dachte an die Filme, die ich jetzt sehen könnte. Ich döste ein. Dann klopfte es an der Tür, gefolgt von einer leisen Stimme, die fragte: »Monsieur?«
Adnan schon wieder? Ich sah auf die Uhr. Viertel nach fünf. War der Tag so schnell vergangen?
Er kam mit einem Tablett ins Zimmer.
»Geht es Ihnen heute besser, monsieur?«
»Ein bisschen, ja.«
»Ich habe Ihre saubere Wäsche unten. Und wenn Sie etwas Gehaltvolleres als Suppe und Baguette möchten ... Ich könnte Ihnen ein Omelett machen.«
»Das wäre sehr nett von Ihnen.«
»Ihr Französisch – es ist sehr gut.«
»Es ist ganz passabel.«
»Sie sind bescheiden«, sagte er.
»Nein, das ist die Wahrheit. Es muss besser werden.«
»Das geht hier ganz schnell. Haben Sie schon mal in Paris gelebt?«
»Ich hab vor Jahren eine Woche hier verbracht.«
Die Originalausgabe THE WOMAN IN THE FIFTH erschien 2007 bei Hutchinson, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 05/2011
Copyright © 2007 by Douglas Kennedy Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture/Christioph von Haussen Satz: Buch Werkstatt GmbH, Bad Aibling
elSBN 978-3-641-10201-2
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe