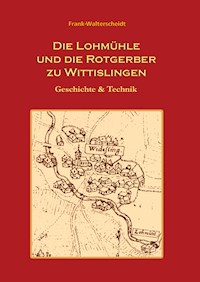
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt nicht nur die Geschichte und Technik einer Mühle sondern versucht darüber hinaus den stetigen Wandel der Technik, die ökonomischen Zwänge im geschichtlichen Rahmen deutlich zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIDMUNG
Allen Menschen dir mir etwas bedeuten.
Ein von dem Wittislinger Steinmetz Felix Liebendorfer um 1650 angefertigter Grenzstein einer Mühle.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Geschichte
Namensgebung
Der Lohschäler
Handwerksregeln für Lohmüller
Das Mühlhaus
Der Mahlgang
Das Wasserrad
Das Vorgelege
Mühlenentwicklung
Getreide
Die Handwerksordnung für Müller
Mühlenformen
Der erste Strom
Der Kammenschreiner
Der Tischlermeister
Mühlsteine
Der Natursteinmühlenbauer
Das Wittislinger Streichwehr
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Erläuterungen
Alte Maße und Werte
Stichwortverzeichnis
Danksagung
Lohmühle mit Gerberwerkstatt im Vordergrund 2004.
VORWORT
Mühlen dienten und dienen dem Menschen, die Arbeit zu erleichtern. Sie sind im eigentlichen Sinne von Wind oder Wasserkraft angetriebene Motoren, die eine Maschine in Bewegung setzen. Die Maschinen in der Lohmühle Wittislingen waren Lohe- und Getreidemahlgänge, Walken, Pumpen, Kühlmaschinen und Schleifsteine.
Aber was ist an Mühlen so faszinierend? Eine Antwort darauf könnte lauten: Mühlen erzählen Geschichten und sind selbst Bestandteil der Geschichte. Einige Mühlenstandorte blicken auf eine mehr als tausendjährige Tradition zurück und gewähren uns einen Einblick in längst vergangene Zeiten.
Sie berichten vom Mittelalter, vom dreißigjährigen Krieg und von den Umbrüchen der Industrialisierung. Bei Letzterem standen die Mühlen im Mittelpunkt – als Vorreiter der modernen Maschinentechnik und als Opfer des rasanten Fortschrittes.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch mal ein kurzes Aufbäumen gegen diese Entwicklung. Durch die Zerstörung der Infrastruktur und durch die enormen Reparationsleistungen waren alte Mühlen für die lokale Versorgung mit Mehl wieder gefragt. Das deutsche Wirtschaftswunder sorgte dann für den endgültigen Niedergang der Mühlen.
Ebenso erging es der Wittislinger Lohmühle. Diese wurde jedoch gerettet und ist bereit Geschichten zu erzählen und Geschichte erfahrbar zu machen.
Skizze, Eichpfahlsetzung 1857.
I. GESCHICHTE
Wittislingen, so beschreibt es Johan Heinrich Zedler im 18 Jhdt.: …ist ein Flecken in dem Bißthum Augsburg, in Schwaben, eine Meile von Dillingen. Es gehörete sonst dem Grafen von Dillingen zu, nachdem aber der leztere davon, Nahmens Hartmann, Bischoff zu Augsburg, 1286 versturbe, und er seine beyden Graffschaften Dillingen und Wittislingen dem Bißthum Augsburg vermachet: so nahm solches Besitz davon1.
Die Gemeinde, an dem Flüsschen Egau gelegen, besaß und besitzt eine ausgeprägte Handwerkertradition. Dazu gehörte auch das Gerberhandwerk. Die erste urkundliche Erwähnung einer Lohmühle datiert aus dem 16. Jahrhundert1. Ein Disput mit dem Bischof in Augsburg um die Mühle ist 1542 urkundlich6 festgehalten und auf einer Ortskarte aus dem Jahre 1610 ist eine Lohmühle am östlichen Ortsrand verzeichnet (Titelbild).
Wittislingen im Jahre 1823. Der rote Pfeil markiert das Ökonomiegebäude (Gerberwerkstatt) des Gerbers Josef Miller an der Egau. Die Gerberwerkstatt wird bereits im 17. Jahrhundert als an der Egau gelegen und zur Mittagssonne hingerichteter Bau beschrieben (Uraufnahmeblatt a.d.J. 1823; © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern, 5216/06).
Die Kenntnis über Baujahr und Baupläne unserer Lohmühle verdanken wir den menschlichen Schwächen Missgunst und Neid. Sie wurde im Jahre 1828 zunächst als Gerberwerkstatt genehmigt und erbaut. Im Folgejahr 1829 sofort zur Loh-Stampf-Mühle ausgebaut. Der Gerber Josef Miller hielt dies nicht für genehmigungspflichtig. Aus seiner Sicht handelte es sich lediglich: „um eine Vervollkommnung seines Gewerbes“. Er berief sich unter anderem auf eine allerhöchste Verordnung vom 20. September 1799 die ausdrücklich Gerber begünstigte. Außerdem sparte die Selbstzubereitung der Lohe erhebliche Kosten: „Die in den Waldungen erkauften Rinden habe er zu den benachbarten Lohstampfmühlen abfahren müssen“.
...Der Ortsvorsteher hat den guten Leumund des Supplikanten und die Nützlichkeit der zu erbauenden Lohstampfmühle bestätigt und dessen Vermögensverhältnisse sind aus den vorliegenden Akten ohnehin schon hinlänglich bekannt...
Der Besitzer der „Unteren Mühle“ klagte gegen den Gemeindebeschluss vor dem königlichen Landgericht in Dillingen. Auch die Gemeinde Wittislingen musste sich mit dem Thema auseinandersetzen. Den Wasserbau betreffend, hatten auch schon damals die direkten Nachbarn ein Recht auf Anhörung. Die neue Rückstauung des Wassers durch die errichtete Wehranlage des Gerbers bedrohte einerseits ein Feuergässchen und eine Furt durch die Egau und andererseits bestand die Gefahr einer Leistungsminderung der Mühlenanlage der „Unteren Mühle“. In der Gemeindeversammlung vom 20. Oktober 1830 unter der Leitung des Ortsvorstehers Alois Wieland, unterstrich die Mehrheit der Anwesenden die mangelnde Notwendigkeit des Feuergässchens. Damals gab es in der Gemeinde 173 Hausnummern und 173 stimmberechtigte Bürger! Der Protokollführer vermerkte nach der Abstimmung: „es hat Parteilichkeit durch Einflüsterung geherrscht“.
Der Rechtsstreit wurde an das königliche Kreis-Bau-Büro verwiesen. Daraufhin erstellte die Bauinspektion ein Gutachten und eine Bauausführungsbestimmung (siehe Erläuterungen) zugunsten des Gerbers.
Am Ort der Gerberwerkstatt erbaute Loh-Stampf-Mühle. Die Wehranlage entstand in einer Holzkonstruktion und ist entlang des nördlichen Ufers zu erkennen2.
Die Anlieger hatten gegen den Bau der Loh-Stampf-Mühle nichts einzuwenden. Auch Josef Keis gab unter der Voraussetzung, dass der Bau unter Beachtung der festgesetzten Normen erstellt, und dass keine andere als die vormals bezeichnete Mühlenart zum Einsatz kam.
Nachdem auch die Bauinspektion einen realisierbaren Vorschlag gemacht hatte, änderten sich die Einwände des Josef Keis dahingehend:
....sondern sie scheinen vielmehr lediglich in den Befürchtungen zu liegen, welche durch die Groß-Sprechung des Gerbers Müller herbeigeführt wurden, in dem Keis nicht die Loh-Stampfe für nachteilig für seine Mühle hält sondern fürchtet, es mochte eine Mahl- oder Ölmühle entstehen....
Doch diese Einwände halfen nicht mehr. Die Wehranlage wurde nach den Vorgaben des königlichen Kreis-Bau-Büros erbaut. Die Streitigkeiten zogen sich aber noch bis in das Jahr 1834 hin2.
Das Anwesen der Mühle wurde steuerrechtlich als Sölde geführt und war ein Lehen des im Jahre 1133 von Graf Heinrich III. von Lechsgemünd gegründeten Zisterzienser Klosters Kaisheim bei Neuburg. Im Zuge der Säkularisation erfolgte 1802 eine militärische Besetzung durch den bayerischen Staat und damit die Aufhebung des Klosters.
Für unseren Gerber und die meisten anderen Menschen änderte sich nichts. Das Obereigentum des Grundes ging vom Besitz der Kirche in den Besitz des Staates über3. Das lässt sich besonders eindrucksvoll an den Steuerbeschreibungen ersehen. Die Staatsbeamten schrieben den zu versteuernden Bestand Wort wörtlich von den Steuerbüchern der Kirche ab. Erhalten blieb bis zur Revolution von 1848 das Obereigentum des Grundes der Ortskirchen und des Adels. Seit 1810 bestand für den Untereigentümer die Möglichkeit den bewirtschafteten Grund zu erwerben. Das Interesse war jedoch kaum vorhanden, da sich die Steuerabgaben nicht änderten. Dann wurde um 1860 das Obereigentum zwangsweise abgelöst. Die Untereigentümer wurden gezwungen ihren Grund zu kaufen. Der Wert des Grundes wurde ihnen als Hypothek eingetragen3. In diese Zeit fällt auch die allgemeine Gewerbefreiheit5.
Im Jahr 1808 gründete König Max I. die königliche Steuervermessungskommission (späteres Landesvermessungsamt) und ordnete erstmals die Vermessung sämtlicher Grundstücke in Bayern an. Ziel war eine gerechte und einheitliche Besteuerung des Grundbesitzes. Bei der Gründung des Königreichs Bayern bestanden über 114 verschiedene Grundsteuersysteme. Die Grundsteuer bildete damals die Haupteinnahmequelle des Staates8.
Sowohl an das Kloster Kaisheim als auch an die Pfarrei in Wittislingen mussten die Gerber als Pächter des Grundes Abgaben in Form des so genannten Zehents entrichten. Ursprünglich war der Zehent eine freiwillige Abgabe an die Kirche. Zurzeit der Frankenherrschaft im 11. und 12. Jahrhundert etablierte sich eine grundsätzliche Abgabenpflicht. Bis 1783 lag die Oberhoheit über Wittislingen bei Pfalz-Neuburg, danach ging es in den Besitz des Hochstiftes Augsburg über5. Die Hälfte bis zwei Drittel der Abgaben ging in die Hände der Ortsgeistlichkeit. Den Rest erhielten die Bischöfe, die wiederum Abgaben an die weltlichen Fürsten für Schutzgewährung zahlen mussten.
…Der Großzehent wurde von Veesen, Roggen, Haber, Gerste und nach seiner Etablierung auch von Weizen entrichtet („was in den Halm schiebt“). Der Großzehent war häufig teilweise oder ganz in fremden Händen. Der Kleinzehent wurde vom Flachs, Hanf, Raps, Erbsen, Linsen, Rüben, Kraut, Kartoffeln, Heu und Ohmad, und seit Ende des 18. Jahrhunderts auch vom Klee gegeben. Im gesamten Bistum Augsburg gehörte der Kleinzehent dem Pfarrer. Daneben bezog die Herrschaft den Blutzehent vom Vieh8…
Maximilian Joseph Graf von Montegelas (1759–1838) führte als Minister unter dem Kurfürsten Maximilian dem IV. die Säkularisation in Bayern durch.
Grenzstein des Hochstiftes Augsburg (Staatsarchiv München).
…Bayern gewährte bereits 1672 für die Kultivierung öder Flächen allgemeine Steuerfreiheit, 1779 Zehentbefreiung auf zehn Jahre und 1801 auf 25 Jahre. In Schwaben bestand hingegen nur eine dreijährige Steuerbefreiung. Die bayerische Inbesitznahme Schwabens brachte auch hier die altbayerische Gesetzgebung9…
Aus der „Steuerbeschreibung der Unterthanen von Witteßlingen“12 geht hervor, dass es 1661 einen Gerber in Wittislingen namens Michel Schieckl(?) gab.
Aus „Eygentliche Beschreibung aller Stände“ von Hans Sachs 156811.
Er war zu dieser Zeit der einzige Gerber im Ort. Im Jahre 1692 ging der Besitz auf Hans Sing über10 von dem nicht überliefert ist, ob es sich bei ihm um einen Gerber handelte.
Der einzige Gerber Wittislingens laut „Steuerbeschreibung der Unterthanen von Witteßlingen“ von 1661/67.





























