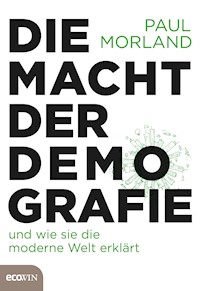
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ecowin
- Sprache: Deutsch
Wie Demografie unsere Welt erklärt Demografische Übergänge, die einst mehrere Generationen Zeit brauchten, vollziehen sich heute in nur wenigen Jahrzehnten – und wir sind mittendrin! Bevölkerungen wachsen oder schrumpfen, werden jünger oder älter, explodieren, emigrieren oder formieren sich neu. Seit der Industrialisierung bewegen sich Bevölkerungstrends nicht mehr im Schneckentempo. Genau das macht die Demografie zu einer spannenden Wissenschaft, die uns ganz neue Erklärungsmodelle für das Zeitgeschehen liefern kann: - Wie gestaltet sich das Wechselspiel zwischen technischem Fortschritt und Bevölkerungswachstum? - Beeinflusst eine höhere Lebenserwartung das globale Machtgefüge? - Welche Auswirkungen haben sinkende Geburtenraten auf die Weltgeschichte? - Wie können wir den demografischen Wandel besser verstehen und angemessen darauf reagieren? Demografische Daten – und was wir daraus lernen können Die Demografie ist tief im Leben verankert. In gewisser Hinsicht ist sie mit ihren Daten zu Geburtenrate, Lebenserwartung und Migration das Leben selbst, denn sie bildet es exakt ab. Doch erst wenn man die Bevölkerungswissenschaft im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie Wirtschaftsentwicklung, technischem Fortschritt und Verbrei-tung von Ideologien betrachtet, liefert sie uns Erklärungen für den Lauf der Weltgeschichte. Paul Morland, Demografieforscher am Birkbeck College der Universität London, rückt mit seinem Buch die Bevölkerungsentwicklung und den globalen demografischen Wandel in den Blick. Er erzählt die Geschichte der modernen Welt neu – erkenntnisreich und faszinierend!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAUL MORLAND
DIE MACHTDER DEMOGRAFIE
UND WIE SIE DIEMODERNE WELT ERKLÄRT
Aus dem Englischen von Hans-Peter Remmler
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.
Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel The Human Tide. How Population Shaped the Modern World bei John Murray (Publishers), London, an Hachette UK Company
1. Auflage 2019
© Paul Morland 2019
Copyright der deutschen Ausgabe © 2019 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Redaktion: Jonas Wegerer
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Gotham
Umschlaggestaltung: © BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Umschlagmotiv: © Evgeniy Yatskov / shutterstock
ISBN: 978-3-7110-0238-9
eISBN: 978-3-7110-526
Für meine Kinder Sonia, Juliet und Adam
Inhalt
TEIL EINSBEVÖLKERUNG UND GESCHICHTE
1. Einleitung
2. Das Gewicht der Zahlen
TEIL ZWEIDER DEMOGRAFISCHE WANDEL NIMMT FAHRT AUF – DIE EUROPÄER UNTER SICH
3. Der Triumph der Angelsachsen
4. Herausforderungen aus Deutschland und Russland
5. Der »Untergang der weißen Rasse«
6. Der Westen seit 1945 – Vom Babyboom bis zur Massenzuwanderung
7. Russland und der Ostblock seit 1945 – Die Demografie des verlorenen Kalten Krieges
TEIL DREIJENSEITS VON EUROPA – DIE GLOBALISIERUNG DES DEMOGRAFISCHEN WANDELS
8. Japan, China und Ostasien – Alternde Riesen
9. Der Nahe Osten und Nordafrika – Die Demografie der Instabilität
10. Nichts Neues unter der Sonne? – Grenzen und Perspektiven
Anhang I: Berechnen der Lebenserwartung
Anhang II: Berechnen der Gesamtfertilitätsrate
Dank
Anmerkungen
Literatur
TEIL EINS
BEVÖLKERUNG UND GESCHICHTE
1. Einleitung
Joan Rumbold war neunzehn Jahre alt, lebte im Londoner Stadtteil Chelsea, und man schrieb das Jahr 1754, als sie John Phillips kennenlernte. Drei Jahre später hatte Phillips sie geschwängert und mit Gonorrhö angesteckt. Dann ließ er sie sitzen, und weil sie nicht wusste, wohin, steckte man sie ins Armenhaus. Um zu arbeiten, wurde sie ins nahe gelegene Brompton geschickt. Ihr Sohn, John Junior, blieb im Armenhaus zurück, wo er zwei Jahre später starb.1 Diese alltägliche Geschichte von Verzweiflung, Einsamkeit und Kindstod würde heutzutage in fast allen entwickelten Gesellschaften einen Skandal auslösen, mit den üblichen Begleiterscheinungen wie Selbsthinterfragung und Schuldzuweisungen. Im England des 18. Jahrhunderts war ein derartiger Vorfall alles andere als ungewöhnlich, und nicht nur dort, sondern fast überall sonst auch, und zwar seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Hunderttausende Mädchen und junge Frauen in ganz Europa und Millionen in aller Welt hätten damals oder in der Zeit zuvor ganz ähnliche Geschichten erzählen können. Das Leben spielte sich vor einem Hintergrund materieller Entbehrung ab, der Kampf gegen Hunger, Krankheit und andere Katastrophen bestimmte den Alltag der meisten Menschen.
In menschheitsgeschichtlichen Dimensionen war das Leben quasi noch gestern derart herzlos, brutal und kurz. Nahezu jeder Bericht über diesen oder jenen Aspekt der Existenz einfacher Leute in der vorindustriellen Gesellschaft oder kurz nach Beginn der industriellen Revolution, sei es Ernährung oder Wohnverhältnisse, Fragen von Geburt und Tod, von Unwissenheit, fehlender Hygiene oder medizinischer Versorgung, lässt dem heutigen Leser die Haare zu Berge stehen. In den Weinanbauregionen Spaniens beispielsweise wurde zur Zeit der Weinlese jede Hand gebraucht, nicht nur die Bauern, auch Mütter von Kleinkindern mussten mit anpacken. Diese ließen dann ihren Nachwuchs alleine, weinend, hungrig und in dreckigen Windeln zurück. Verlassen und hilflos, wie sie waren, konnte den Babys vom heimischen Federvieh, das in der Hütte ein und aus ging, die Augen ausgehackt, von den Schweinen die Hände abgekaut werden, auch bestand die Gefahr, dass die Kleinen »ins Feuer fielen, oder in Kübeln oder Waschzubern, die man achtlos an der Türschwelle hatte stehen lassen, jämmerlich ertranken«.2 Da verwundert es nicht, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel der im Spanien des 18. Jahrhunderts geborenen Babys ihren ersten Geburtstag nicht erlebten.
Jenseits der Pyrenäen, in Frankreich, sah das Leben der einfachen Bauern – und das war der allergrößte Teil der Bevölkerung – nicht viel besser aus. Heute ist das Departement Lozère eine reizende Gegend, beliebt vor allem bei Kajaksportlern und Anglern. Im 18. Jahrhundert jedoch kleideten sich die meisten Bewohner in ärmliche Lumpen und lebten in elenden Hütten, »inmitten von Unrat«, der fürchterlich stank. Die Behausungen hatten nur selten Fenster, auf dem Boden lagen Leinen- und Wollfetzen, die als Betten dienten, »in denen der altersschwache Greis und das Neugeborene, die Gesunden, die Kranken, die Sterbenden und nicht selten die gerade Gestorbenen Seite an Seite lagen«.3 Derartige Beschreibungen grauenvollen Elends hätten auf fast jeden Ort auf dem Globus zu fast jeder Zeit zutreffen können, zumindest seit die Menschen rund zehntausend Jahre zuvor sesshaft geworden waren und begonnen hatten, Landwirtschaft zu betreiben.
So viel zum idyllischen Landleben früherer Zeiten. Dieser Mythos kann sich wohl nur in einer Gesellschaft halten, die schon so lange urbanisiert ist, dass keine Erinnerung mehr an das reale Landleben in vorindustrieller Zeit existiert. Das war das Leben, dem die bettelarmen Heldinnen in Jane-Austen-Romanen auf der Suche nach einem reichen Erben zu entrinnen suchten, wenn nicht für sich selbst, dann wenigstens für ihre Kinder und Enkelkinder in einer gnadenlosen Welt ohne Wohlfahrtsstaat, in der es für die einfachen Leute wirtschaftlich und gesellschaftlich stetig bergab ging.
Das Landleben heute sieht fast überall auf der Welt ganz anders aus als im Spanien oder Frankreich des 18. Jahrhunderts. Auch das Leben in der Stadt hat sich, verglichen mit den erbärmlichen Zuständen, die bis ins 19. Jahrhundert selbst in den damals am höchsten entwickelten Teilen der Welt herrschten, geradezu unermesslich verbessert. Bestens beschrieben ist dies in den Memoiren des Ehemanns der berühmten Schriftstellerin Virginia Woolf. Leonard Woolf, 1880 geboren und 1969 gestorben, wurde Zeuge des Wandels in Südostengland, wo er abgesehen von einem Jahrzehnt als Kolonialverwalter in Ceylon (dem heutigen Sri Lanka) sein ganzes Leben verbrachte. Woolf schrieb gegen Ende seines Lebens, der »immense gesellschaftliche Wandel von der Barbarei zur Zivilisation«, der sich in London und fast ganz Großbritannien in seiner Lebensspanne vollzogen hat, mache ihn geradezu sprachlos. Er sah darin »eines der Wunder, die Ökonomie und Bildung zu vollbringen vermochten«. Die Slums mit ihren »schockierenden Hervorbringungen« existierten nicht mehr, und Mitte des 20. Jahrhunderts, so dachte Woolf, könnte sich jemand, der das London der 1880er-Jahre nicht selbst erlebt hat, die Lebensbedingungen der Armen in dieser Zeit nur schwer ausmalen, »in ihren kläglichen Behausungen, voller Armut, Unrat, Trunksucht und Gewalt«.4
Dieser Wandel beschränkte sich nicht allein auf Großbritannien. Stefan Zweig, Memoirenautor wie Leonard Woolf und nur ein Jahr nach diesem in Wien geboren, bemerkte eine deutliche Verbesserung in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg dank der Verbreitung elektrischen Lichts. Dieses leuchtete die einst düsteren Straßen hell aus, hellere und besser bestückte Geschäfte zeigten einen »verführerischen neuen Glanz«, die Annehmlichkeiten des Telefons, all der Komfort und Luxus, der bis dahin der vornehmen Gesellschaft Vorbehalten blieb, waren nun auch der Mittelschicht zugänglich. Das Wasser musste nicht mehr vom Brunnen geholt, nicht mehr »mühsam am Herd das Feuer entzündet« werden. Fortschritte bei Hygiene und Sauberkeit stellten sich ein, die grundlegende Lebensqualität stieg Jahr um Jahr, und »selbst das Problem der Probleme, die Armut der großen Massen, schien nicht mehr unüberwindlich«.5
Gewiss sehen wir noch Elend und Mangel in den übelsten Slums der Entwicklungs- und Schwellenländer oder in den letzten Winkeln ländlicher Armut. Für den Großteil der Menschheit jedoch sind dies, wenn überhaupt, Erinnerungen an eine mehr oder weniger ferne Vergangenheit.
Die enormen Verbesserungen der materiellen Lebensbedingungen, der Ernährung, der Wohnverhältnisse, der Gesundheit und der Bildung, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts den größten Teil des Globus erfasst haben, waren eindeutig ökonomischer, aber ebenso gewiss demografischer Natur. Sie spiegeln sich nicht nur in Produktion und Konsum wider, sondern auch in den Zahlen der Neugeborenen, im Rückgang der Kindersterblichkeit, in der Anzahl der Kinder in der jeweiligen Folgegeneration, in der jeweiligen Lebenserwartung und der Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen ihrer Heimatregion, ihrem Land oder ihrem Kontinent den Rücken kehren. All diese Fortschritte lassen sich an Daten über die Bevölkerung ablesen, vor allem an Geburten- und Sterberaten.
Kurz gesagt zeichnen sich die Gesellschaften, in denen die meisten Menschen heute leben, im Gegensatz zu derjenigen, in der Joan Rumbold lebte und in die ihr vom Schicksal geschlagener Sohn im Jahr 1757 hineingeboren wurde, durch eine dramatisch gesunkene Kindersterblichkeit aus: Viel weniger Babys und Kleinkinder sterben, und fast jeder Mensch, der geboren wird, schafft es zumindest bis ins Erwachsenenalter. Ein weiteres Merkmal ist die generell höhere Lebenserwartung, zum Teil als Folge der geringeren Kindersterblichkeit, teils aber auch der Tatsache geschuldet, dass weit weniger Menschen in mittleren Jahren sterben und entsprechend mehr ein reifes Alter erreichen, bisweilen gar so alt werden, wie es noch einige Hundert Jahre zuvor kaum vorstellbar war. Frauen bekommen dank besserer Bildung und entsprechender Wahlmöglichkeiten heutzutage deutlich weniger Kinder. Viele haben gar keine Kinder, und nur die allerwenigsten haben sechs oder mehr, wie es in Großbritannien noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus üblich war. Im Zuge des Wandels der Demografie von Joan Rumbolds Zeiten bis heute ist die Gesamtbevölkerung enorm gewachsen. Noch im 18. Jahrhundert lebten weniger als eine Milliarde Menschen auf unserem Planeten. Heute sind es über sieben Milliarden. Nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft und das Zusammenleben heutiger Gesellschaften unterscheiden sich radikal von den Zuständen der Vergangenheit, und dasselbe gilt für die Demografie.
Dieser Prozess, der auf den Britischen Inseln und in den Bruderstaaten der USA und des Britischen Empires etwa um das Jahr 1800 seinen Anfang nahm, erfasste zunächst Europa und später die ganze Welt. Afrika hat diese Umstellung größtenteils noch nicht bewerkstelligt, aber viele Länder sind auch dort zumindest auf dem Weg. Abgesehen vom Afrika südlich der Sahara gibt es heute kaum noch ein halbes Dutzend Länder, in denen Frauen im Durchschnitt mehr als vier Kinder bekommen – noch in den 1970ern war dies weltweit die Norm. Heute gibt es außerhalb Afrikas kein Territorium mehr, das eine Lebenserwartung von unter sechzig Jahren aufweist, wie es in den 1970ern noch die Norm war, vielmehr kommt die weltweite Lebenserwartung heute dem europäischen Durchschnitt der 1950er ziemlich nahe. Was in der Mitte des 20. Jahrhunderts nur die Besten schafften, war ein paar Jahrzehnte später zum weltweiten Durchschnitt geworden. Und umgekehrt gilt der weltweite Durchschnitt von vor wenigen Jahrzehnten heute im größten Teil der Welt als absolutes Minimum. Erreicht wurde dies durch eine Kombination einfacher und sehr komplexer Mittel; Händewaschen, bessere Wasserversorgung, oft ganz rudimentäre, aber entscheidende Maßnahmen während der Schwangerschaft und bei der Geburt, bessere allgemeine Gesundheitsversorgung und Ernährung. Nichts davon wäre in weltweitem Maßstab möglich gewesen ohne Bildung, auch diese oft rudimentär, aber unendlich viel besser als nichts, vor allem für Frauen, da Bildung unmittelbar mit der Verbreitung und der praktischen Umsetzung lebenswichtiger Maßnahmen in Verbindung steht. Natürlich bedurfte es auch diverser wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften, vom Ackerbau bis zum Transportwesen.
Geschichtsphilosophen debattieren seit Langem über die grundlegenden Faktoren, die historische Vorgänge in diese oder jene Form gießen. Manche sagen, die enormen materiellen Kräfte seien am wichtigsten, wenn es um die groben Umrisse, wenn auch nicht die subtileren Details der Menschheitsgeschichte geht. Andere sehen die Geschichte im Wesentlichen als Ablauf des Spiels von Ideen. Wieder andere behaupten, Zufall und Glück seien die hauptsächlichen Triebkräfte, und dass es mithin vergeblich sei, nach tiefer liegenden Ursachen hinter dem Lauf der Dinge zu forschen. Einst sprachen Historiker über die Geschichte, als sei diese das Werk »großer Männer«. Keine dieser Sichtweisen kann voll überzeugen, und keine vermag die Geschichte wirklich umfassend zu erklären. Die Interaktion zwischen Menschen über Zeit und Raum ist einfach zu umfangreich und komplex, als dass eine einzige Theorie sie schlüssig erfassen könnte. Materielle Kräfte, Ideen und der Zufall sowie große Persönlichkeiten und ihr Zusammenspiel mit allen diesen Faktoren müssen allesamt einbezogen werden, will man die Vergangenheit wirklich verstehen.
In diesem Buch geht es um die Revolution der Bevölkerung – der Bevölkerungen – über die letzten etwa zweihundert Jahre und darum, wie diese Revolution die Welt verändert hat. Es ist eine Geschichte über Aufstieg und Fall von Staaten, über große Veränderungen von Macht und Wirtschaft, aber auch eine Geschichte des Wandels im Leben des Einzelnen. Es ist die Geschichte von britischen Frauen, die innerhalb einer einzigen Generation die Furcht ablegten, dass die meisten ihrer Kinder das Erwachsenenalter gar nicht erst erleben würden. Es ist die Geschichte von kinderlosen Japanern, die alt, einsam und verlassen in ihren Appartements dahinscheiden, von Kindern aus Afrika, die sich auf der Suche nach dem Glück auf den Weg übers Mittelmeer machen.
Einige dieser Phänomene, etwa die Abnahme der Kindersterblichkeit vom einst hohen Niveau im Vereinigten Königreich, sind historisch. Andere, wie die einsam und kinderlos sterbenden Japaner und die afrikanischen Kinder auf dem Weg nach Europa, sind nach wie vor sehr präsent und werden sich vermutlich noch verstärken. In diesem Buch geht es darum, wie der Sturmwind der Demografie – der immer schneller verlaufende Wandel in der Bevölkerungsentwicklung – eine Weltregion nach der anderen durchwirbelte, alte Gewohnheiten und Lebensweisen einfach wegwischte und durch völlig neue ersetzte. Es geht um demografische Bewegungen, den großen Strom der Menschheit, mal hier anschwellend, mal dort verebbend, und wie daraus ein enormer und nur allzu oft übersehener oder unterschätzter Beitrag zum Lauf der Geschichte werden konnte.
Die Tatsache, dass sich das Leben für Milliarden Menschen in unermesslicher Weise verbessert hat – und dass die Welt durchaus in der Lage sein sollte, sieben Milliarden Menschen und mehr zu ernähren –, sollte uns nicht den Blick für die Schattenseiten der Geschichte verstellen. Der Westen, der die Bedingungen, welche so vielen Menschen ihre Existenz und ihren Wohlstand ermöglichen, überhaupt erst erfunden hat, hat allen Grund, stolz zu sein. Viele seiner Kritiker wären heute gar nicht am Leben oder würden zumindest kein Leben in Wohlstand und Bildung genießen können, gäbe es nicht die Fortschritte in Wissenschaft und Technik, von Pharmazeutika und Düngemitteln bis hin zu Seife und Kanalisation. Doch bei allen atemberaubenden Fortschritten dürfen wir auch nicht übersehen, dass viele Völker außerhalb Europas Opfer von Vertreibung und Genozid wurden, dass die Dezimierung indigener Völker von Amerika bis Tasmanien vorangetrieben wurde und dass ein transatlantischer Sklavenhandel industriellen Ausmaßes entstand, der Menschen schwarzer Hautfarbe als Waren behandelte.
Der Anstieg der Lebenserwartung der Briten im 19. Jahrhundert war eine enorme Leistung, aber wir dürfen darüber die Hungersnot und die massenhafte Auswanderung der Iren nicht vergessen. Der Rückgang der Kindersterblichkeit im Europa des frühen 20. Jahrhunderts ist wahrlich zu feiern, aber wir dürfen darüber die zwei Weltkriege und den Holocaust nicht vergessen. Auch im Nahen Osten hat die Kindersterblichkeit abgenommen, aber die Gesellschaften dort sind jung und instabil, und viele dieser jungen Menschen haben kaum Chancen auf Integration in die Arbeitswelt und gleiten in Fundamentalismus und Gewalt ab. Bei aller Freude über die in den letzten Jahren gestiegene Lebenserwartung in großen Teilen Afrikas dürfen wir den Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 nicht vergessen und auch nicht die furchtbaren Verluste von Menschenleben in den Kriegen in Zaire/Kongo in den Jahren kurz danach. Und wir dürfen auch nicht die vielen tatsächlichen oder potenziellen Umweltschäden übersehen, die mit dem Bevölkerungswachstum einhergehen. Die Geschichte der ersten Phasen dieses tief greifenden demografischen Wandels ist alles andere als makellos, wir dürfen kein verklärtes Bild des endlosen und unaufhaltsamen Fortschritts zeichnen, hin zu immer besseren, glänzenderen Zukunftsaussichten. Es überrascht nicht, dass eine solche Weltsicht in der britischen Elite des 19. Jahrhunderts weitverbreitet war – immerhin waren diese Leute damals die reichsten und mächtigsten der Welt; doch heutzutage lässt sich eine solche Sicht der Dinge nicht mehr halten.
Wir sollten aber bei allen Vorbehalten auch nicht die außergewöhnliche Leistung verkennen, die es für die Menschheit darstellt, ihre Zahl so enorm gesteigert zu haben und dabei den allergrößten Teil mit einem Maß an Lebensstandard, Gesundheitsversorgung und Bildung zu versorgen, um das uns die Reichsten früherer Zeiten beneidet hätten. Die Geschichte der Macht der Demografie muss mit all ihren Fehlern und Schwächen erzählt werden, aber eben auch als das, was sie tatsächlich ist: nichts weniger als ein Triumph der Menschheit. Weder die Sklavenschiffe noch die Gaskammern sollten wir jemals vergessen. Aber diese Schrecken dürfen uns nicht den Blick dafür verstellen, dass heute zahllose Eltern nicht mehr wie Joan Rumbold um Gesundheit und Leben ihrer Kinder fürchten müssen und dass Milliarden Menschen von Patagonien bis zur Mongolei mit einem Leben rechnen können, das unendlich viel reichhaltiger und länger ist, als man es sich vor gar nicht langer Zeit hätte ausmalen können. Diese Fülle von Leben hat das Reservoir an menschlicher Kreativität und Erfindungsgabe erweitert und damit wiederum zu entscheidenden Erfolgen beigetragen, von Impfstoffen bis zur Mondlandung und auch zur – wenn auch unvollständigen – Verbreitung von Demokratie und Menschenrechten.
Worum es in diesem Buch geht – und warum es wichtig ist
Dieses Buch behandelt die Rolle der Bevölkerung in der Geschichte. Es behauptet nicht, die großen Trends in der Bevölkerungsentwicklung – das Auf und Ab der Geburten- und Sterberaten, das Anschwellen und Schrumpfen der Bevölkerungszahl, die Wellen der Migration – würden den Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte bestimmen. Demografie ist ein Teil unseres Schicksals, aber sie ist nicht alles. Es geht nicht um eine vereinfachende, monokausale oder deterministische Sicht auf die Geschichte. Es wird auch nicht behauptet, die Demografie sei in gewissem Sinne primäre Ursache, ein Anstoß, ein unabhängiges oder externes Phänomen, das zwar geschichtliche Tragweite und Auswirkungen hat, aber keine ihr vorangehenden Ursachen. Die Demografie ist vielmehr ein Faktor, der selbst von anderen zahlreichen und komplexen Faktoren angetrieben wird, manche davon sind materieller, andere ideologischer und wieder andere rein zufälliger Natur. Ihre Auswirkungen sind vielfältig, langfristig und tief greifend, ihre Ursachen sind es nicht minder.
Die Demografie ist tief im Leben verankert – in gewisser Hinsicht ist sie das Leben, dessen Anfang und Ende. Bevölkerung muss im Verbund mit anderen kausalen Faktoren verstanden werden, als da sind technologische Innovation, wirtschaftlicher Fortschritt und sich wandelnde Überzeugungen und Ideologien, dann liefert uns die Bevölkerungswissenschaft eine Menge Erklärungen. Nehmen wir als Beispiel den Feminismus. Es ist unmöglich zu sagen, ob diese Bewegung den demografischen Wandel vorgezeichnet und vorangetrieben hat oder ein Produkt dieses Wandels ist. Wir können jedoch abbilden, wie beide Phänomene zusammengewirkt haben. Heute durchdringen feministische Ideen nahezu jeden gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekt, von der Akzeptanz vorehelichen Sex bis zur Gleichberechtigung in der Arbeitswelt. Andererseits wäre die Revolution der gesellschaftlichen Haltung zu Sex und Geschlechterfragen vielleicht gar nicht entlang dieser Argumentationslinien verlaufen, hätte es nicht die Erfindung der Pille und die damit verbundenen Entscheidungsfreiheiten gegeben. Die Pille wiederum war aber nicht allein das Produkt des Einfallsreichtums und der Hartnäckigkeit von ein paar Frauen und Männern, sie war auch Folge eines Wandels in der Haltung zu Sex, Sexualität und den Geschlechtern. Erst dadurch wurde die Forschung in diese Richtung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde akzeptabel und konnte zum attraktiven Gegenstand der Finanzierung durch wirtschaftliche und philanthropische Interessen werden. Der Feminismus, die Technologie der Pille und die Veränderung der gesellschaftlichen Haltung zu Sex und Fortpflanzung haben alle ihren Anteil an der Reduzierung der Fertilitätsraten (also der Anzahl Kinder, die eine Frau im Leben zu bekommen erwarten kann). All dies wiederum hatte tief greifende Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und den Lauf der Geschichte. Die Frage, was zuerst da war – der gesellschaftliche Wille oder die Pille –, hat etwas von der Frage nach dem Huhn und dem Ei. Wir können die Geschichte des Wechselspiels dieser Kräfte erzählen, es führt aber zu nichts, wenn wir versuchen wollten, einen der Faktoren als »primäre« oder »ultimative« Ursache herauszustellen und die anderen als bloße Nebenfolgen abzutun.
Ebenso falsch wäre es, die Demografie in eine pseudo-marxistische Sicht der Menschheitsgeschichte zu überführen, also »Klasse« durch »Bevölkerung« als denjenigen verborgenen Faktor zu ersetzen, der die gesamte Weltgeschichte zu erklären vermag. Die Demografie außen vor zu lassen jedoch würde bedeuten, den vielleicht wichtigsten erläuternden Faktor der Weltgeschichte in den letzten zweihundert Jahren zu vernachlässigen. Über Jahrtausende spielte sich die immer gleiche triste Geschichte ab, in der es ein konstantes Bevölkerungswachstum gab, bevor die Bevölkerung dann durch Seuchen, Hungersnot und Krieg immer wieder dezimiert wurde. Seit 1800 jedoch schafft es die Menschheit zunehmend, über ihre eigene Anzahl zu bestimmen und dies mit erstaunlichen Folgen. Die Demografie wurde von der langsamsten zur am schnellsten wachsenden Disziplin. Die Bevölkerungstrends bewegen sich nicht mehr im Schneckentempo, mit gelegentlichen dramatischen Einbrüchen wie der Pest im Mittelalter. Fertilitäts- und Sterblichkeitsraten nehmen immer schneller ab, und demografische Übergänge, die einst mehrere Generationen Zeit brauchten, vollziehen sich nun in wenigen Jahrzehnten.
2. Das Gewicht der Zahlen
Stellen Sie sich ein Auto vor, das langsam und gemächlich Kilometer für Kilometer vor sich hin rollt, immer in der gleichen Geschwindigkeit. Stellen Sie sich nun vor, dass das Auto beschleunigt, zunächst eher sanft, dann immer stärker, bis es schließlich mit enormer, geradezu beängstigender Geschwindigkeit unterwegs ist. Dann tritt, nach einer relativ kurzen Strecke in rasender Fahrt, der Fahrer unvermittelt auf die Bremse und verlangsamt das Gefährt abrupt. Genau so stellt sich die Entwicklung der Weltbevölkerung seit 1800 dar.
Es stellt sich die Frage: Warum ausgerechnet die letzten zweihundert Jahre? Warum setzt unsere Betrachtung etwa im Jahr 1800 ein? Die Antwort ist einfach: Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts tritt eine Diskontinuität in der demografischen Geschichte ein, ein entscheidender Wandel. Auch davor ereigneten sich zweifellos dramatische Dinge von demografischer Relevanz, zumeist was Todesfälle betraf, wie etwa Seuchen und Massaker, aber das waren sporadische Ereignisse, keine Elemente langfristiger Trends. Was es damals an langfristigen Trends gegeben hatte, etwa das Bevölkerungswachstum in Europa und der Welt insgesamt, verlief sehr maßvoll, durchzogen durch tragische Einbrüche.
Etwa um 1800 durchbrachen die »Angelsachsen« (im Wesentlichen also Briten und Amerikaner) die bis dahin geltenden Grenzen des Bevölkerungswachstums, wie sie Thomas Malthus beschrieben hatte, ein englischer Geistlicher, Schriftsteller und Denker, der in der Zeit des ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts lebte und von dem später noch ausführlich die Rede sein wird. Die Angelsachsen streiften – Ironie der Geschichte – die demografischen Fesseln just zu der Zeit ab, als diese erkannt wurden. Dies markiert einen bedeutenden Bruch in der demografischen Historie, die demografische Parallele zur industriellen Revolution, einen Meilenstein, der geografisch wie historisch weit über seinen Ausgangspunkt hinaus wirkte und in einen globalen und permanenten Wandel mündete. Parallel zu dieser auf industriellen Gegebenheiten gründenden Bevölkerungsexplosion verliefen das Anwachsen militärischer und wirtschaftlicher Macht sowie eines riesigen Stroms von Siedlern. Diese demografisch getriebenen Ereignisse bildeten schließlich ein Muster, das die etablierte Ordnung infrage stellte, durchbrach und bisweilen vollständig kippte.
Der große Wandel
Um ein Gespür dafür zu bekommen, wie absolut revolutionär diese Veränderungen der letzten rund zweihundert Jahre tatsächlich waren, ist eine langfristige Betrachtung der Demografie hilfreich. Im Jahr 47 vor unserer Zeitrechnung wurde Julius Caesar zum Herrscher der Römischen Republik auf Lebenszeit ernannt. Sein Reich erstreckte sich vom heutigen Spanien bis zum modernen Griechenland, im Norden bis zur französischen Normandie, es umfasste den größten Teil des übrigen Mittelmeerraums, den sich heute mehr als dreißig Länder teilen. In diesem riesigen Gebiet lebten etwa fünfzig Millionen Menschen, damals etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung von etwa 250 Millionen.1 Über 18 Jahrhunderte später, als anno 1837 Königin Victoria den Thron des Vereinigten Königreiches bestieg, war die Zahl der Weltbevölkerung auf rund eine Milliarde gewachsen, hatte sich also in etwa vervierfacht. Doch schon weniger als zweihundert Jahre nach der Krönung Victorias hatte sich die Weltbevölkerung noch einmal versiebenfacht – fast der doppelte Anstieg also, in einem Zehntel der Zeit. Dieses erstaunlich rasante Wachstum hatte weltweit durchgreifende Folgen.
Zwischen 1840 und 1857 brachte Queen Victoria neun Kinder zur Welt, und alle erreichten das Erwachsenenalter. Die frühere Monarchin, Queen Anne, war 1714 im Alter von 49 Jahren gestorben. Sie hatte achtzehn Schwangerschaften, doch kein einziges ihrer Kinder überlebte sie. Im Jahr 1930, nur 29 Jahre nach dem Tod von Königin Victoria, hatte eine weitere Matriarchin Großbritanniens, Queen Elizabeth, gerade einmal zwei Kindern das Leben geschenkt, Elizabeth (die heutige Königin Elizabeth II.) und Margaret. Die Daten dreier Königinnen – Anne, Victoria und Elizabeth, die »Queen Mum« – bilden auf plastische Weise die zwei Trends ab, die in Großbritannien zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert einsetzten und sich seitdem auf die ganze Welt ausdehnten.
Der erste Trend war der massive Rückgang der Kindersterblichkeit: Der Tod eines Kindes wurde vom schrecklichen Normalfall zur Ausnahme. Der zweite, sich anschließende Trend war die dramatische Verringerung der durchschnittlichen Kinderzahl, die eine gewöhnliche Frau zur Welt brachte. In den Zeiten von Queen Anne geschah es ständig, dass eine Mutter ein Kind nach dem anderen verlor. In der Blütezeit des viktorianischen Zeitalters war es immer noch die Norm, sehr viele Kinder zu haben. Dass alle ihr Erwachsenenalter erlebten, war ungewöhnlich (hier war Victoria nicht nur durch Glück, sondern auch durch ihren Reichtum begünstigt), aber auch das sollte schon bald ganz normal sein. In den Zwischenkriegsjahren des 20. Jahrhunderts konnte die »Queen Mum« sehr zuversichtlich sein, dass aus ihren beiden Töchtern, wie aus den meisten anderen Kindern, jedenfalls in Großbritannien, normale und gesunde Erwachsene werden würden.
Als Queen Victoria 1819 geboren wurde, lebten nur wenige Europäer – etwa 30 000 – in Australien. Die Zahl der Aborigines zu jener Zeit ist ungewiss, Schätzungen reichen von 300 000 bis zu einer Million. Als Victoria Anfang des 20. Jahrhunderts starb, gab es weniger als 100 000 Aborigines, Australier europäischer Abstammung hingegen schon fast vier Millionen, mehr als hundert Mal so viele wie noch achtzig Jahre zuvor. Dieser Wandel in der Größe und Zusammensetzung der Bevölkerung eines Kontinents vollzog sich innerhalb eines Menschenlebens. Er veränderte Australien vollständig und für alle Zeiten, und er sollte auch über Australien hinaus bedeutende Auswirkungen haben, da dem Land später eine wichtige Rolle in der Versorgung und der personellen Ausstattung Großbritanniens in beiden Weltkriegen zukommen würde. Ähnliches gilt für Kanada und Neuseeland.
Diese verblüffenden Fakten – die rasche, wenn auch sehr selektive Beschleunigung des Bevölkerungswachstums; der dramatische Rückgang der Kindersterblichkeit; die abnehmende Fertilitätsrate; und im 19. Jahrhundert der Strom europäischer Auswanderer in Länder außerhalb Europas – hängen alle miteinander zusammen. Sie sind Folgen des gleichen tief greifenden gesellschaftlichen Wandels, der die industrielle Revolution begleitete, und ihren gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Geschichte haben sie bereits bewiesen: Manchen Ländern haben sie auf Kosten anderer zu Macht verholfen und damit das Schicksal von Volkswirtschaften und ganzen Imperien geprägt. Und sie haben die Grundlagen für vieles gelegt, das wir in unserer heutigen Welt für selbstverständlich halten. Als nach 1945 diese Trends aber wahrhaft globale Bedeutung erlangten, stellten sich die damit einhergehenden Veränderungen noch viel schneller und heftiger ein.
Die großen Bevölkerungstrends – gestern und heute
In der großen Beschleunigung, die im viktorianischen Großbritannien begann, steckt eine komplexe Geschichte. Es dauerte viele Hunderttausend Jahre, vom Aufbruch der Menschheit bis ins 19. Jahrhundert, bis die Weltbevölkerung die Zahl von einer Milliarde erreicht hatte, aber kaum zweihundert weitere Jahre bis zu den heutigen sieben Milliarden. Nun jedoch stellt sich eine Verlangsamung ein. In den späten 1960ern verdoppelte sich die Anzahl der Bewohner unseres Planeten in etwa alle dreißig Jahre. Heute liegt dieser Wert bei sechzig Jahren. Es ist gut möglich, dass das Wachstum der Weltbevölkerung bis zum Ende unseres Jahrhunderts ganz zum Stillstand gekommen sein wird. Manche Länder erleben schon jetzt einen Bevölkerungsrückgang.
Rasche Ausschläge in der Entwicklung der Bevölkerungszahl nach oben oder unten senden Schockwellen um den ganzen Globus, und sie formen den Lauf der Geschichte in einer Weise, die kaum jemals angemessen gewürdigt wurde. Viele Menschen im Westen wären wohl überrascht zu erfahren, dass Frauen in Thailand heute vier Kinder weniger bekommen als Ende der 1960er, dass die Lebenserwartung von Männern in Glasgow geringer ist als die der männlichen Einwohner in Gaza oder dass die Weltbevölkerung heute kaum noch halb so schnell wächst wie zu Beginn der 1970er. Sobald wir uns diese immense Beschleunigung und die anschließende, recht abrupte Verlangsamung bewusst machen, bekommen wir einen Sinn für die große Achterbahnfahrt, die der Wandel in der Weltbevölkerung darstellt, und auch für unsere eigene Position in diesem Gesamtbild: Wir befinden uns heute an einem Wendepunkt.
Innerhalb dieses globalen Gesamtbilds zeigen sich verblüffende Kontraste zwischen einzelnen Ländern und Kontinenten. 1950 standen statistisch jedem Bewohner Afrikas südlich der Sahara zwischen zwei und drei Europäer gegenüber. Im Jahr 2100 wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit sechs oder sieben Mal mehr Afrikaner als Europäer geben. Im gleichen Zeitraum von 150 Jahren wird sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Japanern und Nigerianern von 2:1 für Japan zu 9:1 für Nigeria gewandelt haben. Verschiebungen der Bevölkerungszahl in diesem Ausmaß verändern alles, von Geostrategie bis Makroökonomie, von der Nachfrage nach Wiegen bis zum Bedarf an Friedhöfen. Ohne das Verständnis dieser Fakten lassen sich weder die Vergangenheit noch die Zukunft wirklich verstehen.
Der große demografische Wandel der Menschheit nahm auf den Britischen Inseln seinen Anfang und unter jenen, die sich von dort stammend nach Nordamerika und Australien und Ozeanien ausbreiteten. Bald erfasste dieser Wandel auch andere europäische Nationen, später Asien und Lateinamerika. Heute erleben wir seine gewaltigen Wirkungen in unterschiedlichen Phasen auf aller Welt, gerade vor allem in Afrika, wo der Wandel den Kontinent durchwirbelt und neu gestaltet. Der Mensch breitete sich vor über 100 000 Jahren ausgehend von Afrika auf der ganzen Erde aus. Der große demografische Wandel kehrt in unseren Tagen dorthin zurück. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieses Wandels mit seinen Ursprüngen in Nordwesteuropa und verfolgt seine immer rascheren und dramatischeren Auswirkungen über die ganze Erdkugel. Dabei wollen wir zunächst die Regionen betrachten, in denen sich die demografische Veränderung zuerst einstellte. Dem Verlauf dieses Wandels folgend blicken wir über Europa hinaus, nach China und Japan, in den Nahen Osten, nach Lateinamerika und Südasien und schließlich nach Afrika. So sehen wir, wie die demografische Entwicklung ihre anfänglich engen geografischen Grenzen sprengte und zu einem globalen Phänomen wurde. Zu jeder Region werden Hintergrundinformationen geliefert, aber die Geschichte beginnt jeweils im Wesentlichen an dem Punkt, an dem sich die alte demografische Ordnung verabschiedete und durch eine neue ersetzt wurde, hier früher, dort später.
So funktioniert die demografische Gleichung
Der größte Motor des Bevölkerungswachstums ist der Rückgang der Kindersterblichkeit. Königin Victoria hatte gewiss die beste ärztliche Versorgung, die ihre Epoche zu bieten hatte, dazu eine robuste Gesundheit und ein günstiges Schicksal, aber noch als ihre Herrschaft sich dem Ende zuneigte, erlebte eines von sechs britischen Babys seinen ersten Geburtstag nicht. Heute, gerade einmal ein Jahrhundert danach, stirbt nur eines von dreihundert in England geborenen Kindern im Säuglingsalter. In manchen Teilen der Welt, in Ländern wie Afghanistan und Angola, steht es um die Kindersterblichkeit kaum besser als im England der Zeit vor hundert Jahren, aber auch in diesen Ländern verbessern sich die Verhältnisse. In anderen Teilen der Welt verlief der Fortschritt gar noch schneller als bei den Briten. Noch in den 1920ern starben fast drei von zehn Babys in Südkorea im ersten Lebensjahr, heute kaum noch drei von tausend – eine Verbesserung um den Faktor hundert in weniger als hundert Jahren. Bei einem solch rasanten Fortschritt ist für die meisten Leute das Ausmaß der damit verbundenen Veränderung gar nicht erfassbar. Dennoch kann eine derart schwindelerregende Abnahme der Kindersterblichkeit eine Vervierfachung der Bevölkerungszahl innerhalb weniger Jahrzehnte bewirken, was tief greifende ökonomische und ökologische Folgen für das betreffende Land mit sich bringt und auch für seine Fähigkeit, Streitkräfte aufzustellen oder Migranten in andere Länder zu senden.
Von Kriegen, Seuchen oder Naturkatastrophen abgesehen, ist der zweitgrößte Faktor, der auf die Bevölkerungszahl einwirkt, nach der Kindersterblichkeit, die Anzahl der Geburten. Auch hier haben sich in den letzten zweihundert Jahren atemberaubende Veränderungen zugetragen. In der Mitte der viktorianischen Epoche hatten Frauen in England im Durchschnitt etwa fünf Kinder (eine beachtliche Zahl, wenngleich weniger als die Monarchin); in den 1930ern waren es kaum noch zwei (was der Kinderzahl der Queen Mum entspricht). Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl zur allgemeinen Überraschung zwanzig Jahre lang wieder an, wie in der gesamten westlichen Welt. In der Spitze kamen die USA in den späten 1950ern auf einen Wert von 3,7, in Großbritannien waren es Anfang der 1960er immerhin knapp über drei. Danach nahm der Wert wieder deutlich ab. Im 21. Jahrhundert ist die Fertilitätsrate überall auf der Welt zurückgegangen. Heute bekommen Frauen im Iran weniger Kinder als Frauen in Frankreich, die Frauen in Bangladesch liegen mit den Französinnen in etwa gleichauf.
Die gesellschaftlichen Auswirkungen sind oft enorm. Die rasche Zunahme des Durchschnittsalters einer Gesellschaft bedeutet leere Schulen und volle Altersheime. Auch besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der allgemeinen Friedfertigkeit der Schweiz und der Tatsache, dass der durchschnittliche Bewohner der Schweiz deutlich älter ist als vierzig Jahre. Mit entsprechend großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass die Gewalt im Jemen mit der Tatsache in Verbindung steht, dass das Durchschnittsalter der Menschen dort unter zwanzig Jahren liegt. Natürlich spielen noch andere Faktoren mit hinein: Die Schweiz ist sehr reich, der Jemen extrem arm, aber es ist eben auch so, dass Länder mit einer älteren Bevölkerung tendenziell deutlich reicher sind als Länder mit besonders junger Bevölkerung. In den armen Ländern sind es nicht selten gerade die Jüngsten, von denen die meiste Gewalt ausgeht. Den Südafrikanern geht es wirtschaftlich nicht viel schlechter als, sagen wir, den Mazedoniern, aber Südafrika hat ein Durchschnittsalter von ungefähr 26 Jahren, in Mazedonien liegt dies dagegen um etwa 38. Es überrascht daher nicht, dass die Mordrate in Südafrika zwanzig Mal höher ist als diejenige in Mazedonien. Andererseits weisen El Salvador und Bangladesch ein ähnliches Durchschnittsalter auf wie Südafrika – circa 27 Jahre –, die Mordrate des mittelamerikanischen Landes ist jedoch doppelt so hoch wie in Südafrika, in Bangladesch beträgt sie dagegen weniger als ein Zehntel im Vergleich zu Südafrika. Sozioökonomische und kulturelle Faktoren sind überaus wichtig, und hier wie anderswo vermag die Demografie längst nicht alles zu erklären. Dennoch existiert zweifelsfrei eine starke Korrelation zwischen Alter und Gewalt; von ein paar Ausnahmen abgesehen, haben fast alle Länder mit auffällig hohen Mordraten eine besonders junge Bevölkerung.
Der dritte große Faktor bei der Umgestaltung der Welt ist die Migration. Großbritannien veranschaulicht dies sehr gut. Einst das Ziel großer Wellen von Einwanderern – Angelsachsen, Wikinger und Normannen –, haben die Britischen Inseln nach 1066 ihre Tore für massenhafte Zuwanderung verschlossen. Vor 1945 wanderten Millionen Briten nach Übersee aus und bevölkerten dabei neue Gebiete in wahrlich kontinentalem Maßstab. Aber diese Wanderungsbewegung war quasi eine Einbahnstraße: weg von den Britischen Inseln. Die Zuwanderung der Hugenotten gegen Ende des 17. Jahrhunderts – höchstens 200 000 Menschen, vermutlich deutlich weniger – war die einzige nennenswerte Zuwanderung von außerhalb der Britischen Inseln über mehrere Jahrhunderte.2 Die Einwanderung osteuropäischer Juden in Großbritannien zum Ende des 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts ging auch zu Spitzenzeiten wohl nicht über 12 000 Menschen pro Jahr hinaus.
Das hat sich vollkommen umgekehrt. Noch immer zieht es manche Briten ins Ausland, allerdings wartet dort dann eher eine Villa an der Costa del Sol als Altersruhesitz und kein entbehrungsreicher Existenzkampf in der kanadischen Prärie. Unterdessen kommen jedes Jahr Hunderttausende Migranten aus aller Welt nach Großbritannien. Ganz unabhängig davon, ob das wünschenswert ist oder nicht: Wer nicht erkennt, dass dies ein in der Geschichte nie da gewesener Umstand ist, wird das Ausmaß des damit verbundenen gesellschaftlichen Wandels kaum erfassen können. Diejenigen, die sich bei der Volkszählung des Jahres 2011 als »weiße Briten« charakterisierten oder deren Vorfahren mindestens seit 1066 auf den Britischen Inseln ansässig waren, dürften mit einiger Wahrscheinlichkeit in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zu einer Minderheit innerhalb des Vereinigten Königreichs werden.
Die Demografie macht den Unterschied
Viele historische Ereignisse wären ohne den demografischen Wandel nicht möglich gewesen. Ohne die Bevölkerungsexplosion im 19. Jahrhundert wären die Briten niemals in der Lage gewesen, riesige Territorien überall auf der Welt zu besiedeln, darunter auch Australien. Damit schufen sie viel von dem, was wir heute »global« nennen, von der Allgegenwart der englischen Sprache bis zu den Normen des freien Handels. Ohne den Rückgang der Kindersterblichkeit in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts wären Hitlers Armeen 1941 vielleicht tatsächlich bis nach Moskau vorgedrungen und nicht an den unerschöpflichen Wellen russischer Soldaten abgeprallt. Ein Amerika, das nicht in der Lage gewesen wäre, Jahr für Jahr Millionen von Migranten anzuziehen und das seine Bevölkerungszahl seit den 1950ern nicht verdoppelt hätte, würde vielleicht schon heute ökonomisch von China in den Schatten gestellt. Einem Japan, das nicht über ein halbes Jahrhundert mit sinkenden Geburtenraten durchlebt hätte, wäre vermutlich auch ein Vierteljahrhundert wirtschaftlicher Stagnation erspart geblieben. Läge das Durchschnittsalter in Syrien etwas näher an dem der Schweiz und nicht an dem des Jemen, wäre das Land vielleicht niemals im Bürgerkrieg versunken. Während ein Libanon, der in den vergangenen vierzig Jahren keine deutliche Alterung seiner Bevölkerung erlebt hätte, vielleicht in einen Bürgerkrieg zurückgeworfen worden wäre.
Es gibt keinerlei Garantie, dass die Menschheit die großen natürlichen Kräfte, die die Bevölkerung dezimieren – allen voran Kriege, Seuchen und Hunger –, für immer überwunden hat. Nie war die Gefahr eines Krieges, der die gesamte Weltbevölkerung auslöscht, größer als seit Beginn des Atomzeitalters. Nie konnten sich Krankheiten so leicht und rasch verbreiten wie seit der Erfindung des Düsenantriebs und dem Beginn des interkontinentalen Massentourismus. Und noch immer können Umweltkatastrophen unser aller Ende bedeuten. Die Tatsache anzuführen, dass sich die Menschheit in den letzten ungefähr zweihundert Jahren immer mehr von den Kräften der Natur befreit hat, die zuvor die demografische Expansion gehemmt hatten, ist etwas anderes, als zu sagen, diese Befreiung habe nun für immer Bestand.
Demografie und militärische Macht
Die erste und offenkundigste Art und Weise, in der Bevölkerungszahlen die Menschheitsgeschichte beeinflusst und geprägt haben, liegt im Aspekt der militärischen Macht. Dass wir uns an die Triumphe kleiner Länder oder Armeen über große Gegner besonders gut erinnern, liegt gerade daran, dass sie die Ausnahme von der Regel sind. Der größere und gewichtigere Kombattant ist immer im Vorteil, ganz gleich ob im Kollektiv oder Mann gegen Mann. Daher sind die vielen Schlachten, die die Regel und nicht die Ausnahme bestätigen, ungefähr so spannend wie die Schlagzeile »Hund beißt Mann«. Die vielen Fälle, in denen große Nationen oder Armeen ihre kleineren Widersacher vernichteten, sind längst vergessen oder doch kaum mehr als historische Fußnoten.
Im Altertum zählte die Befehlsgewalt über möglichst viele Soldaten mehr als alles andere, wenn es zum militärischen Konflikt kam. Die Annalen früherer Zeiten sind notorisch unzuverlässig, wenn es um Zahlen geht, und es ist gut möglich, dass es keineswegs 600 000 Perser waren, auf welche die 17 000 mazedonischen Soldaten bei der Schlacht am Granikos trafen. Unzweifelhaft jedoch erreichte Alexander der Große seinen ersten Sieg in Asien in dramatischer militärischer Unterzahl.3 Auch wenn zeitgenössische Berichte aus dem Mittelalter, ebenso wie die aus dem Altertum, häufig übertreiben und daher mit einer gesunden Portion Skepsis zu lesen sind, gilt es dennoch als glaubhaft, dass die englischen Eroberer bei Azincourt gegen die Franzosen im Verhältnis 1:6 in der Unterzahl waren.4
Aber diese Schlachten sind deshalb so denkwürdig, weil ihr Ausgang der Regel der zahlenmäßigen Übermacht widerspricht. Die Geschichte des Krieges kennt nun einmal viel mehr Fälle, in denen die Zahl das Entscheidende war, und in fast allen Fällen hatten die Zahlen doch zumindest irgendeine Bedeutung. Auch geringfügigen Unterschieden kam oft entscheidende Bedeutung zu, vor allem dann, wenn die Truppen qualitativ mehr oder weniger gleichwertig waren und es keinen großen strategischen Vorteil gab, auf den sich eine Seite stützen konnte. Vor Waterloo hatte Wellington keinen Moment daran gedacht, die Initiative gegen Napoleon zu übernehmen, schließlich hatte er nur 67 000 Männer gegenüber 74 000 auf der Gegenseite.5 In den vorhersehbaren Abnutzungs- und Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs kämpften etwa gleichwertig ausgebildete und motivierte Truppen mit wenig Aussicht auf strategische Vorteile, da kam es entscheidend auf die Zahlen an. Den Kriegseintritt einer ersten Welle von 2,8 Millionen amerikanischen Rekruten vor Augen, der in den Jahren 1917/1918 drohte, das Gleichgewicht zwischen den erschöpften Armeen an der Westfront entscheidend zu kippen, veranlasste die Deutschen zu letztendlich sinnlosen Verzweiflungsmaßnahmen.6
Hinter den Zahlen an der Front stehen die Zahlen der jeweiligen Gesellschaften. Im Jahr 1800 machte die Bevölkerung Frankreichs knapp ein Fünftel der Europäer aus – und Frankreich konnte versuchen, den gesamten Kontinent zu beherrschen; 1900, mit einer Bevölkerung, die weniger als zehn Prozent der Bewohner Europas umfasste, war Frankreich auf dem Weg zur Macht der zweiten Reihe. Seit die konkurrierenden Banden und Stämme in der Frühgeschichte ihre Kräfte maßen, haben in aller Regel Geburtenraten und Bevölkerungszahl entschieden, wer Kriege gewinnt oder verliert. Die Anzahl der Männer auf dem Schlachtfeld hängt letztlich ja davon ab, wie viele Kinder zwei oder drei Jahrzehnte zuvor geboren wurden, vor allem in Zeiten der Massenmobilisierung, der Levée en masse oder des »totalen Kriegs«.
Manche Gesellschaften waren und sind hinsichtlich dieser Mobilisierung erfolgreicher als andere, aber auch eine höhere Mobilisierungsrate kann zahlenmäßige Unterlegenheit nicht vollständig kompensieren. Oft werden Reservisten für Aufgaben benötigt, die zur Unterstützung der eigentlichen Kriegshandlungen erforderlich sind, und eine große Anzahl Frauen war, jedenfalls in modernen Zeiten, gleichbedeutend mit einem größeren Rekrutierungsreservoir für die Produktion von Munition und Ausrüstung für die Front. Ein Staat oder eine Allianz von Staaten mit einem demografischen Vorteil – sprich: mit mehr Menschen und vor allem mehr Männern im wehrfähigen Alter – war normalerweise in einem Konflikt klar im Vorteil. Durch die Umsetzung demografischer Übermacht in militärischen Vorteil ist die Demografie zu einem bedeutenden Faktor der Weltgeschichte geworden.
Auch wenn der Hinweis in vielen Berichten über historische Vorgänge fehlt, wurde der Stellenwert der Demografie für weltgeschichtlich bedeutende Angelegenheiten durchaus oft erwähnt, und entsprechend lang ist die Tradition des auf hohe Fertilität ausgerichteten Denkens und Schreibens gerade bei besonders patriotisch gesinnten Köpfen. Der römische Geschichtsschreiber und Staatsmann Tacitus sah in den kleinen Familien der Römer ein Defizit gegenüber den fruchtbareren Germanen, und Ibn Chaldūn, ein arabischer Historiker des Mittelalters, assoziierte den Bevölkerungsrückgang mit der Verödung und Rückentwicklung von Zivilisation.7 Der Marquis de Vauban, der große Festungsbaumeister von Ludwig XIV., gab sich keiner Illusion hin, was letztendlich militärische Macht begründete: Festungen könnten noch so innovativ und massiv sein, erklärte er, »die Größe von Königen bemisst sich an der Anzahl ihrer Untertanen«. Clausewitz, der preußische Militärwissenschaftler in der Zeit Napoleons, sah in der zahlenmäßigen Überlegenheit das strategische Grundprinzip des militärischen Sieges, und Voltaire sah Gott immer auf der Seite der zahlreicheren Bataillone. Adam Smith erklärte: »Am ehesten drückt sich die Prosperität eines Landes in der Zunahme der Bevölkerung aus.« Auf die Frage, wen er für die bedeutendste Frau der Geschichte halte, soll Napoleon einmal geantwortet haben: »die mit den meisten Kindern«.8
Ein großer technologischer Vorsprung der einen Seite kann zweifellos entscheidend sein. Aber solche technologischen Vorteile, seien es Maschinengewehre oder Atombomben, haben nicht auf immer und ewig Bestand, auch der Feind wird sich seiner bemächtigen, und dann kommt es doch wieder auf die Bevölkerungszahl an. Die Versuche der Russen in den 1980ern, Afghanistan zu beherrschen, und Amerikas Versuche im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, Irak und Afghanistan unter Kontrolle zu bringen, wurden weitestgehend durch eine simple demografische Tatsache vereitelt: Afghanistan und Irak hatten Bevölkerungen mit einem Durchschnittsalter unter zwanzig Jahren, die UdSSR und die USA zur entsprechenden Zeit deutlich über dreißig Jahren. Man könnte vorbringen, was den Russen wie den Amerikanern am Ende fehlte, war nicht die schiere Truppenzahl, sondern der Wille und die Entschlossenheit, doch auch hier spielt die Demografie eine Rolle. In einem Land mit einer Fertilitätsrate von zwei oder weniger werden schon wegen des kulturellen Hintergrunds zivile oder militärische Verluste viel weniger akzeptiert als in Ländern mit einer Fertilitätsrate von über sieben oder fast fünf – dies waren die Zahlen für Afghanistan bzw. den Irak zum Zeitpunkt der US-Invasionen in den Jahren 2002 und 2003. In Industrieländern hat jede Mutter schlicht und einfach weniger Söhne zu verlieren. Die Vorstellung, Mütter großer Familien seien eher bereit, ihre Kinder in Konflikten zu opfern, wirkt ganz und gar herzlos, es gibt aber überzeugende Belege dafür, dass Gesellschaften mit kleineren Familien generell weniger kriegerisch gesinnt sind.9
Demografie und ökonomische Schlagkraft
Neben der militärischen Macht ist der bedeutendste Faktor für die Beurteilung der Macht eines Landes die Größe seiner Wirtschaft. Eine große Volkswirtschaft stützt schon für sich genommen eine Militärmacht, weil sie in der Lage ist, große Truppenzahlen zu versorgen und, in modernen Zeiten, auch im industriellen Maßstab mit Waffen auszurüsten. Neben dem indirekten Beitrag zur staatlichen Macht durch die Fähigkeit zur Unterstützung militärischer Aktivität ist eine große Volkswirtschaft auch in sich selbst ein Aktivposten im Sinne staatlicher Macht: Der betreffende Staat hat dadurch Einfluss auf die Weltmärkte, sowohl als Käufer von Waren und Dienstleistungen als auch als Markt für die Waren anderer. Auch dies ist schon lange bekannt; Friedrich der Große postulierte einst, die Zahl der Menschen mache den Reichtum des Staates aus.10
In einer Welt, in der der Großteil der Bevölkerung mehr oder weniger am Existenzminimum lebt, steht die Größe der Volkswirtschaft in sehr engem Zusammenhang mit der Bevölkerungszahl. Wenn fast alle ungefähr das gleiche Einkommen haben und die Volkswirtschaft nicht mehr und nicht weniger abbildet als die Summe der einzelnen Einkommen, dann wird die Größe der Wirtschaft im Ländervergleich ausschließlich auf der Basis der jeweiligen Bevölkerungszahl variieren. Das ändert sich, sobald die Durchschnittseinkommen der zwei Vergleichsländer voneinander abweichen. Wenn die Pro-Kopf-Einkommen variieren, können Länder mit relativ kleiner Bevölkerung außergewöhnlich große Volkswirtschaften unterhalten, während jene mit großer Bevölkerung so arm sein können, dass auch ihre Volkswirtschaft entsprechend klein bleibt.
Dies war besonders augenfällig in der Zeit der industriellen Revolution, als zuerst Großbritannien und danach andere Teile Westeuropas und Nordamerikas begannen, ihre Volkswirtschaften umzustellen und eine Zeit konstanten Wachstums der Pro-Kopf-Einkommen erlebten. Um 1800 entsprachen die Durchschnittseinkommen in Westeuropa und an der Ostküste der USA in etwa denjenigen an der Küste Chinas. Hundert Jahre danach lagen sie ungefähr zehn Mal höher.11 Nur so war es für die britische Wirtschaft möglich, trotz der weitaus geringeren Bevölkerungszahl um ein Vielfaches größer zu werden als die chinesische. Die Korrelation zwischen Bevölkerungszahl und Größe der Volkswirtschaft geriet aus dem Gleichgewicht, sobald bestimmte Wirtschaften raschen Fortschritt erlebten und andere in Rückstand gerieten.
Allerdings tendiert die Industrialisierung zur Ausbreitung, und genau dies ist in den letzten Jahrzehnten in dramatischem Ausmaß geschehen und nirgendwo stärker als in China. Die Technologien, die das Wirtschaftswachstum vorantreiben, verbreiten sich dabei am schnellsten. Es überrascht daher nicht, dass die Volkswirtschaften von Entwicklungs- und Schwellenländern zuletzt stärker gewachsen sind als diejenigen der entwickelten Länder. Das heißt nicht, dass dies überall oder gleichmäßig geschieht. Es bedeutet aber sehr wohl, dass global betrachtet ein großer Aufholprozess im Gange ist, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, wobei viele in den ärmeren Ländern rasch reicher werden, während die meisten in den reicheren Ländern stagnierende Einkommen registrieren. Wenn also die ganze Welt überwiegend auf moderne Wirtschaftssysteme umgestellt ist, wird die Bevölkerungszahl, wie schon in der vorindustriellen Zeit, wieder an Aussagekraft über die Größe einer Volkswirtschaft gewinnen.
Die Beziehung zwischen Modernisierung und Demografie ist durchaus komplex.12 Gewiss liegt die Fertilitätsrate in fast allen Ländern, in denen die meisten Frauen Zugang zu Bildung haben, die meisten Menschen in Städten leben und ein relativ hoher Lebensstandard herrscht – Ländern also, die unserer Definition von »modern« genügen –, nicht höher als drei, bei einer Lebenserwartung von deutlich über siebzig Jahren. Die Modernisierung ist eine hinreichende Bedingung, um den demografischen Wandel zu niedriger Fertilitätsrate und hoher Lebenserwartung zu durchlaufen bzw. durchlaufen zu haben. Sie sorgt dafür, dass der demografische Wandel stattfindet – Frauen mit Hochschulabschluss bekommen tendenziell nun einmal keine sieben Kinder. Büroangestellte, die sich Wohnungen und Häuser mit Anschluss an die Kanalisation und auch ein Auto leisten können, leben länger als ihre bäuerlichen Vorfahren, die auf den Feldern schuften und, wenn sie von A nach B wollten, zu Fuß gehen mussten – und nur im günstigsten Fall Schuhe für diesen Zweck besaßen.
Die Modernisierung ist jedoch keine notwendige Bedingung für diesen demografischen Wandel. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts war es auch für immer noch vergleichsweise landwirtschaftlich geprägte Länder mit geringem Einkommens- und Bildungsniveau möglich, niedrige Fertilitätsraten und eine längere Lebensdauer zu erreichen. Staatlich finanzierte Familienplanung, häufig in Verbindung mit Hilfen durch die internationale Gemeinschaft, sowie eine grundlegende Gesundheitsversorgung und Verfügbarkeit medizinischer Einrichtungen, auch dies meist mit internationaler Unterstützung, können die demografische Entwicklung auf modernen Kurs bringen, auch wenn die generelle Modernisierung noch nicht so weit ist. So konnte etwa ein Land wie Marokko – dort konnten noch 2009 über die Hälfte aller Frauen weder lesen noch schreiben – eine Fertilitätsrate von nur 2,5 Kindern pro Frau erreichen. So kann ein Land wie Vietnam – mit einem Pro-Kopf-Einkommen von einem Fünftel oder Sechstel dessen in den USA – eine Lebenserwartung bei der Geburt erreichen, die nur wenige Jahre unter der der USA liegt.13 Preiswerte Technologie und praktische Nächstenliebe im privaten und öffentlichen Sektor verschaffen hier der Demografie einen Vorsprung vor der Ökonomie.
Dennoch, sobald der Großteil der Menschheit in der Moderne angekommen oder auf bestem Weg dazu ist, einschließlich eines entsprechend höheren Pro-Kopf-Einkommens, ist es für besonders bevölkerungsreiche Länder wie China, Indien und Indonesien gar nicht mehr möglich, eine relativ kleine Volkswirtschaft zu führen. Entsprechend werden Länder mit relativ kleiner Bevölkerung (etwa das Vereinigte Königreich oder Deutschland) ihre Position an der Tabellenspitze der absoluten wirtschaftlichen Größe nicht mehr halten können. Unter der Voraussetzung einer drei Mal größeren Bevölkerung Indonesiens im Vergleich zu Deutschland wird die deutsche Wirtschaft so lange größer bleiben als die indonesische, so lange der Durchschnittsdeutsche drei Mal so reich ist wie der durchschnittliche Indonesier. Sobald der durchschnittliche Deutsche aber nicht mehr drei Mal so reich ist wie der durchschnittliche Indonesier – bis dahin ist es noch ein relativ weiter Weg, aber längst nicht mehr so weit, wie man bis vor Kurzem dachte –, wird die Volkswirtschaft Indonesiens größer sein als die deutsche, auch wenn der Durchschnittsdeutsche dann immer noch deutlich wohlhabender ist als der Durchschnittsindonesier. Da sich industrielle und kommerzielle Technologie weltweit verbreiten und große nationale Vorteile immer schwerer zu etablieren und zu halten sind, wird die Bevölkerungszahl wieder an Einfluss gewinnen, was die relative Größe der Volkswirtschaften angeht.
Man mag diese Sichtweise kritisieren, immerhin bedient sie sich eines recht groben Blicks auf die Gesamtgröße einer Volkswirtschaft und vernachlässigt die Bedeutung des Pro-Kopf-Einkommens. Zwei mögliche Antworten gibt es auf diese Kritik. Zunächst kann demografisches Wachstum an sich schon zu einem Wirtschaftswachstum pro Kopf beitragen. Junge und wachsende Bevölkerungen stellen eine Erwerbsbevölkerung und einen Binnenmarkt. Eine große Bevölkerung schafft das Potenzial für einen großen Binnenmarkt, was besonders wichtig ist, wenn die nationalen Märkte geschlossen sind, und das war im Verlauf der Geschichte nicht selten der Fall. Zweitens ist es, wenn es um Macht geht und darum, was den Lauf der Geschichte antreibt und nicht etwa um Maßnahmen für den persönlichen Wohlstand, die Gesamtgröße einer Volkswirtschaft, auf die es ankommt. Die Niederländer blieben auch im 18. und 19. Jahrhundert ein wohlhabendes Volk, aber in Ermangelung einer großen Bevölkerung haben sie im globalen Maßstab dennoch seit dem 17. Jahrhundert an Bedeutung verloren. Die Briten begannen, ihre Vormachtstellung vor den USA einzubüßen, als die Bevölkerungszahl der USA gegen Ende des 19. Jahrhunderts die britische überholte. Eines der reichsten Länder im modernen Europa, nämlich Luxemburg, ist auch eines der unbedeutendsten: So reich seine Einwohner auch sein mögen – es gibt einfach so wenige von ihnen, dass die Wirtschaft des Landes im Weltmaßstab ein Zwerg ist und bleibt.
Im Kontrast dazu könnte China schon bald zur weltgrößten Volkswirtschaft aufsteigen (auf der Basis bestimmter Kennzahlen ist dies schon heute der Fall) – obgleich die Chinesen nach wie vor relativ arm sind – und zwar einfach dank ihrer riesigen Zahl. Diese verschafft China eine bedeutende Machtposition in der Weltwirtschaft, als Käufer wie als Verkäufer, und sie ermöglicht China auch Zugriff auf die Ressourcen, die es zu einer gewichtigen Militärmacht werden lassen.
Komplexer wird es, wenn es um die »weichen« Machtfaktoren geht, die einem rein zahlenbasierten Ansatz weniger zugänglich sind. Dennoch erhöht die schiere Macht der Bevölkerungszahl auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land in der Lage sein wird, auf der kulturellen Bühne der Welt eine Rolle zu spielen. Die Größe der Bevölkerung Indiens macht Bollywood zu einem globalen Phänomen, was man beispielsweise vom Kino Albaniens gewiss nicht behaupten kann. Der Unterschied mag zum Teil auch an der Qualität der Produktionen oder an deren Wirkung auf das allgemeine Publikum liegen, aber er liegt mit Sicherheit auch an der jeweiligen Bevölkerungszahl. Japanisches Design hätte mit geringerer Wahrscheinlichkeit sein weltweites Ansehen erlangt, wenn es nicht über hundert Millionen Japaner gäbe, sondern bloß zehn Millionen oder weniger. Das Ausmaß der »weichen« Machtfülle eines Landes ist zwar gewiss nicht stärker demografisch determiniert als die militärische oder wirtschaftliche Macht, aber in allen beschriebenen Fällen schlägt das Gewicht der Zahlen zu Buche, immer zu mindestens einem gewissen Grad und nicht selten sogar sehr stark.
Demografie innerhalb von Landesgrenzen
Die Bevölkerungszahl ist nicht nur für das Geschehen zwischen verschiedenen Staaten wichtig, sondern auch für die Vorgänge in den Staaten selbst. Wären die USA im Jahr 2008 noch so »weiß« gewesen wie fünfzig Jahre zuvor, wäre Barack Obama nicht Präsident geworden. Obama gewann nur 43 Prozent der Stimmen weißer Wähler, sein Gegenkandidat John McCain 55 Prozent. Die überwältigende Mehrheit, die er bei nichtweißen Wählern erzielte, zeigte jedoch, dass die USA einfach nicht mehr »europäisch« genug waren, um mit dem geschrumpften weißen Stimmenanteil seine Wahl zu verhindern. Umgekehrt würde bei der voraussichtlichen Zusammensetzung der Gesellschaft der USA im Jahr 2040 für einen Kandidaten wie Donald Trump, der die Interessen der weißen Arbeiterschaft Amerikas zu vertreten behauptet, ein Wahlsieg nahezu unmöglich werden, trotz der im Wahlsystem begründeten, überproportionalen Gewichtung kleiner und ländlicher Bundesstaaten wie Wyoming und North Dakota, die beide zu etwa neunzig Prozent weiß sind.
2016 machten diejenigen, die sich als »nicht hispanische Weiße« definieren, über drei Fünftel der US-Bevölkerung und 71 Prozent der Wähler aus. Donald Trump hatte bei den Wahlen von 2016 bei diesen einen großen Stimmenvorsprung: 58 Prozent der sich als »weiß« definierenden Wähler stimmten für ihn, nur 37 Prozent für Hillary Clinton. Angesichts der nach wie vor signifikanten weißen Mehrheit ebnete diese Tatsache Trump den Weg ins Weiße Haus. Wenn aber ungefähr um die Mitte des 21. Jahrhunderts die weiße Bevölkerung Amerikas weniger als fünfzig Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, wird ihre Unterstützung schwerlich ausreichen, um das sehr schwache Abschneiden eines Kandidaten wie Trump bei den nichtweißen Amerikanern auszugleichen. Amerikaner, deren wichtigstes Anliegen die Ungleichheit war, stimmten mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit für Trump als diejenigen, denen es vor allem um Themen wie Einwanderung und den raschen demografischen Wandel ging, die im Zentrum der US-Wahlen von 2016 standen.
In England und Wales ist der Anteil der Bevölkerung, die sich nicht als »weiße Briten« sehen, von ungefähr zwei Prozent in den 1960ern auf rund sieben Prozent in den frühen 1990ern und fast zwanzig Prozent im Jahr 2011 gestiegen. Für eine Prognose zum Abstimmungsverhalten beim Brexit-Referendum bestand die stärkste Korrelation zur Entscheidung für den Ausstieg aus der EU – nach den Bedenken wegen der europäischen Integration und dem Verlust britischer Souveränitätsrechte – in der Haltung des jeweiligen Wählers zum Thema Einwanderung. Analysen der Daten des Referendums zeigen, dass Regionen wie Boston in Lincolnshire und Stoke-on-Trent in Staffordshire, die den größten Zuwachs an Menschen mit Migrationshintergrund in den Jahren 2005–2015 erlebten (interessanterweise bleibt London davon ausgenommen, wo die meisten im Ausland geborenen Menschen leben), am stärksten zu einem Votum für den Brexit neigten. Das spricht dafür, dass Fragen der Identität angesichts der im Wandel begriffenen örtlichen ethnischen Zusammensetzung entscheidenden Einfluss auf das Abstimmungsverhalten hatten.14
In Frankreich hätte die Regierung wohl kaum Gesetze gegen den Burkini auf den Weg gebracht, wenn es nur ein paar Hundert oder einige Tausend Muslime im Land gäbe und eben nicht die rund fünf Millionen, die es in Wirklichkeit sind. Quebec hätte wahrscheinlich für die Loslösung von Kanada votiert, wenn die vorwiegend katholische, französischsprachige Bevölkerung ihre außergewöhnlich hohe Fertilitätsrate über die 1960er hinaus gehalten hätte. Diese zählte über eine gewisse Zeit zu den höchsten in den Industriestaaten. Ein paar frankophone Stimmen mehr hätten das Unabhängigkeitsreferendum, das Quebec im Jahr 1995 abhielt, in die andere Richtung kippen können: Das »Nein«-Lager gewann mit ganzen 54 000 Stimmen Vorsprung – weniger als ein Prozent aller Teilnehmer.
Veränderungen in der ethnischen Zusammensetzung von Staaten wirken sich nicht nur auf die entwickelte Welt aus und auch nicht nur auf Wahlstrategien.15 Die Demografie hat in jüngerer Zeit vor allem als Faktor bei innerstaatlichen Konflikten noch an Bedeutung gewonnen.16 Das schiere Ausmaß des demografischen Wandels mit seiner allmählichen Beschleunigung, dem demografischen Wirbelsturm, ist einer der Gründe dafür. Wenn Geburtenraten über längere Phasen unerwartet hohe Werte erreichen, bei gleichzeitiger starker Abnahme der Sterberaten, kann die Bevölkerung sehr rasch wachsen. Oft betreffen diese Wachstumseffekte aber nur eine bestimmte ethnische Gruppe. Dies liegt an unterschiedlichen gesellschaftlichen oder religiösen Gepflogenheiten oder Unterschieden im Niveau der sozioökonomischen Entwicklung. Es wurde schon häufiger auf extreme Weise deutlich, dass sich die demografische Stärke zwischen verschiedenen ethnischen und sozialen Gruppen in bisher nie da gewesener Geschwindigkeit verändern kann, was wiederum oft zu Spannungen und Orientierungslosigkeit bei den Betroffenen führte.
Dies mag sich mitunter zu einem zwischenstaatlichen Phänomen auswachsen, oft jedoch spielt es sich innerstaatlich ab in einer Welt, in der es in den meisten Ländern ethnische Minderheiten gibt und in der viele dieser Minderheiten ein deutlich anderes demografisches Verhalten an den Tag legen als die Bevölkerungsmehrheit. Die Tschetschenen in Russland, die Albaner in Serbien und die Katholiken in Nordirland kommen einem da in den Sinn. All dies sind Fälle, in denen Minderheiten eine höhere Geburtenrate aufweisen als die jeweilige Bevölkerungsmehrheit, was zu einer Verschiebung oder Infragestellung der bestehenden Machtstrukturen führt. Mitunter haben aber auch die Minderheiten eine geringere Geburtenrate, so etwa die Weißen in Südafrika oder die Chinesen in Malaysia, und auch hier bleiben politische Folgen im jeweiligen Land nicht aus.
Die Demografie ist heute auch deshalb wichtiger als früher, weil die Politik in der Moderne, vor allem seit der Französischen Revolution, immer stärker ethnisch geprägt ist. Die Ära, in der eine ethnisch klar definierte Elite über die Mehrheit herrscht, seien es die Normannen in England, die Weißen in Südafrika oder die Alawiten in Syrien, scheint dem Ende zuzugehen. In einer immer demokratischer werdenden Umgebung kommt es auf die Zahlen an, und dort, wo Politik eine ethnische Ausprägung besitzt, wird das Zahlenverhältnis der diversen ethnischen Gruppen zueinander ganz besonders wichtig.
Im Verlauf dieser modernen Periode, in der zwischenstaatliche Konflikte weniger werden, aber innerstaatliche zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen immer mehr zunehmen, gewinnt die Demografie an Bedeutung, eben weil sich konkurrierende ethnische Gruppen sehr oft im demografischen Profil deutlich unterscheiden.17 Angesichts der Bedeutung der Zahlen für diese konkurrierenden ethnischen und nationalen Gruppen ist zu erwarten, dass solche Gruppen strategisch darauf abzielen, ihre eigene demografische Präsenz zu stärken – durch Zunahme im eigenen Lager, Abnahme bei den Rivalen oder beides. Diese Strategien, üblicherweise zusammengefasst unter dem Terminus demographic engineering, gibt es in der harten und der weichen Version. »Hart« bedeutet das Erzeugen, Vernichten und Verpflanzen von Menschen, mit Maßnahmen wie selektiven Anreizen zur Fruchtbarkeitssteigerung, Genozid und dem Zwang oder Anreiz zum Ein- oder Abwandern von Menschen in ein oder aus einem bestimmten Territorium.
Beispiele für dieses »harte« demographic engineering gibt es leider mehr als genug. In den 1920ern schnitten die USA ihre Einwanderungspolitik gezielt auf die Wahrung ihres »angelsächsischen« Charakters zu und agierten damit gegen den weiteren Zustrom aus Süd- und Osteuropa. Mitte des 20. Jahrhunderts förderten protestantische Führer in Nordirland heimlich, still und leise die Auswanderung von Katholiken, während es die Katholiken selbst auf höhere Geburtenraten anlegten, teilweise tatsächlich mit dem Ziel, ihren Anteil an der Bevölkerung zu vergrößern. Sri Lankas singhalesisch dominierte Regierung bürgerte Tamilen relativ kurz zurückreichender südindischer Abstammung kurzerhand aus, um den singhalesischen Charakter des Landes zu betonen. Im kommunistischen Rumänien erhielten ethnische Ungarn schneller und einfacher Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibung als ethnische Rumänen, während ethnische Deutsche und Juden direkt zum Verlassen des Landes angehalten wurden. All dies geschah im Namen der Stärkung des ethnisch-rumänischen Landescharakters.18
Das »weiche« demographic engineering umfasst Maßnahmen, die ebenfalls auf die zahlenmäßige Überlegenheit einer Gruppe gegenüber einer anderen abzielen. Nur die Mittel sind hier andere, etwa das Verändern von Grenzverläufen, die Manipulation von Identitäten oder von Volkszählungen oder Volkszählungskategorien, etwa die Konsolidierung der singhalesischen Identität in Sri Lanka durch Zusammenfassen der Menschen aus der Region Kandy und der Bewohner des Low Country, oder die Idee des türkischen Regimes, die Kurden als »Bergtürken« umzudefinieren.19 Auch so kann Demografie Schicksale formen.
Man schätzt, dass gegenüber den 1950ern, in denen etwa die Hälfte der Konflikte zwischen Staaten und die Hälfte innerhalb





























