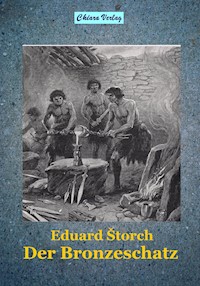3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Gebiet des heutigen Tschechien vor 12.000 Jahren. Das Gebiet der Flüsse Thaya, Elbe und Moldau durchzieht eine Sippe von Steinzeitmenschen in ständigem harten Kampf ums Überleben. Harte Winter, ausbleibendes Jagdwild und Hungersnot, mächtige Raubtiere und nicht zuletzt feindliche andere Sippen zum einen, großer Jagderfolg mit anschließender Völlerei zum anderen bestimmen den Jahreslauf. Überall droht Tod und Verderben, sowie das größte Übel: der Verlust des kostbaren Feuers In spannender Romanform erzählt Eduard Štorch in wissenschaftlich korrekter Weise vom Leben im Wechsel von der Altsteinzeit zur Junsteinzeit in der Mitte Europas. Ein Paläofiction-Roman der junge wie erwachsene Leser gleichermaßen begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Mammutjäger
Roman aus der Urzeit des Menschen
Cover
Eduard Štorch
Die Mammutjäger
Roman aus der Urzeit des Menschen
Impressum
Die Mammutjäger
Eduard Štorch
© 2020 Chiara-Verlag im vss-verlag, 60389 Frankfurt
Übersetzung: Franz Groß
Covergestaltung: Oliver Sauer unter Verwendung eines Fotos von Pixabay
Lektorat: Hermann Schladt
Vorwort: Vor 12 000 Jahren ...
— oder waren es gar 25000? — zogen Sippen urzeitlicher Jäger durch Mähren und Südböhmen, von der Thaya über die Gegend des heutigen Brünn an die Betschwa, von der oberen Elbe zur Moldau. Überall hinterließen sie Spuren ihrer Anwesenheit: Siedlungen in Berghöhlen, Grabstätten mit zahlreichen aus Stein verfertigten Waffen und Geräten, steinernen und knöchernen Schmuck und vor allem die Knochen der von ihnen erlegten Wildtiere.
Die zahlreichen Funde aus jener fernen Zeit beweisen, dass der Mensch viel, viel älter ist als seine uns bekannte und bereits geläufige „Geschichte“, und gewähren uns einigermaßen Einblick in die Lebensweise unserer frühen Vorfahren. Wir wissen, dass sie der unerbittlichen Natur die Nahrung abjagen mussten, dass sie gezwungen waren, für ihren harten Daseinskampf Hilfsmittel zu ersinnen und anzufertigen — Waffen, Werkzeuge, Geräte —, und dass es gerade diese Tätigkeit, also die Arbeit war, die den Menschen immer mehr über das Tierreich hinaushob und ihn in der Folgezeit im Verlaufe vieler Jahrtausende zu dem machte, was wir heute sind. Damals, in jener Zeit, in die uns dieses Buch führt, waren die Menschen noch ganz anders als die Menschen von heute. Sie befanden sich auf der „Mittelstufe der Wildheit“, wie die Wissenschaft jene Periode nennt.
Die Menschen lebten in Gemeinschaften, in Sippen, denn als Einzelgänger wären sie nie imstande gewesen, im Daseinskampf zu bestehen. Sie lebten vornehmlich von Jagd, und da die Beutetiere häufig ihren Standort wechselten, mussten die Menschen, die von ihnen lebten, das gleiche tun. Das Leben der urzeitlichen Jäger war ein Leben ständiger Wanderschaft innerhalb eines größeren Jagdgebiets.
Der Wildreichtum war groß: Rentiere und Wildpferde, Moschustiere und Wisente, das gefährliche Nashorn und das riesenhafte Mammut lieferten den Menschen die heiß erkämpfte Nahrung. Und auch den gefürchtetsten Raubtieren, dem Höhlenlöwen und dem Höhlenbären, gingen sie kühn zu Leibe; in gemeinsamem Angriff der ganzen Jägersippe wurden die wilden Bestien mit Keulen und Speeren erlegt.
Die Flüsse und die Seen wimmelten von Fischen, die Wälder boten eine Fülle von Früchten, essbaren Wurzeln und Kräutern, deren Sammeln Aufgabe der Frauen und der Kinder war. Kraft und Rückgrat der Sippe bildeten aber die Jäger: von ihrem Erfolg hingen Leben und Wachstum aller ab.
Das Leben der Mammutzäger war reich an Mühen und Gefahren. Der Kampf gegen die wilden Tiere forderte immer neue Opfer, und so mancher tapfere Jäger kehrte von den Beutezügen nicht mehr heim ins Lager. Das Feuer, der größte Schatz des urzeitlichen Menschen, musste auf beschwerlicher Wanderung mitgetragen und sorgsam vor Regen und Wind und feindlichen Sippen behütet werden — denn wenn es erlosch oder etwa geraubt wurde, konnte es nur schwer und unter großen Mühen wiedererlangt werden: entweder durch den Fund feuerspendenden Materials oder durch Diebstahl von einer benachbarten Menschengruppe. Der Winter war stets eine Zeit größter Not: Hunger, Kälte und Krankheit gefährdeten die Sippe, Wölfe bedrohten Kinder und Vorräte. Aber auch in der schönen Jahreszeit gab es viele Gefahren; Feinde drangen in das Jagdgebiet ein und vertrieben, wenn sie in Überzahl erschienen, seine bisherigen Besitzer, die dann weiterwandern mussten, neuen Jagdgefilden, neuen Kämpfen entgegen.
Aber die Begegnungen mit fremden Sippen waren durchaus nicht immer feindseliger Art. Es wurden auch friedliche Beziehungen angeknüpft, die Anfänge eines Tauschhandels bildeten sich heraus, besonders zur Erlangung des oft von weither kommenden Feuersteins für Waffen und Geräte. Die Menschen lernten das wechselvolle Jagdglück durch beständigere Formen der Versorgung ergänzen.
Wie sah es nun innerhalb einer urzeitlichen Jägersippe aus?
Hierüber können die Funde wenig Auskunft geben, und auch Vergleiche mit heute lebenden primitiven Jägerstämmen — etwa Australiens oder Amerikas — bieten keine Gewähr für völlige Übereinstimmung. Immerhin können einige Grundzüge der gesellschaftlichen Gliederung der Jägersippe aus den Lebensbedingungen unserer frühen Vorfahren abgeleitet werden. In der urzeitlichen Sippe, die vornehmlich von der Jagd lebte, waren die Jäger, die auf dem Höhepunkt ihrer Körperkraft stehenden Männer, die bestimmende Kraft; der Tüchtigste und Tapferste aus ihrer Schar wurde zum Häuptling oder Anführer der Sippe gewählt. Die Alten, die Träger der Erfahrung und der Weisheit, genossen hohe Achtung und spielten eine bedeutsame Rolle im Leben ihrer Gemeinschaft. Die Scheu vor dem Alter und dessen höherem Wissen gab Anlass zur Entstehung vieler Mythen und religiöser Vorstellungen.
Die Stellung der Frau scheint auf den ersten Blick sehr gedrückt gewesen zu sein. Die Frau, vielfach durch Raub erworben, wurde mit Arbeit überlastet; aber ihre harte Lage war im wesentlichen durch die Schwierigkeiten des Lebenskampfes und nicht durch eine Versklavung von Seiten des Mannes bedingt. Ihre nützliche, nimmermüde Tätigkeit in der Gemeinschaft, ihre tatkräftige Mithilfe im Kampf um den Lebensunterhalt, all das musste der Frau einen Platz in der Sippe einräumen, der sich wesentlich von dem untergeordneten Dasein des weiblichen Geschlechts in der späteren sogenannten vaterrechtlichen Großfamilie unterschied. In der Sippe der Mammutzäger gehörten die Kinder, wie Vergleiche mit heute lebenden Primitiven nahelegen, der Mutter, und dies war der Ausgangspunkt für eine spätere Periode, in der mit der Entwicklung des Ackerbaus und der Sesshaftwerdung der Menschen die Frau die Vormachtstellung innerhalb der Sippe erwarb, die dann auf mutterrechtlicher Grundlage auf gebaut war.
Die Sprachen der Mammutzäger waren schon hoch entwickelt — und dies war ja erforderlich, da man sich im gemeinschaftlichen Zusammenwirken bei der Jagd und im Lebenskampf untereinander wirksam verständigen musste. Nach den Verhältnissen zu urteilen, die wir bei primitiven Völkerschaften von heute vorfinden, war die Zahl der Sprachen sehr groß — vielleicht sprach jede Sippe ihre eigene. Im Vergleich zu den unsrigen waren diese Sprachen sehr kompliziert; Abstraktionen und Verallgemeinerungen fehlten gänzlich, dafür waren sie außerordentlich reich an Schattierungen und Einzelprägungen, ein Abmalen und Abtasten der Umwelt bis in ihre kleinsten Einzelheiten. Es gab kein Tier, keine Pflanze als Gattung, sondern nur ein bestimmtes Tier, eine bestimmte Pflanze; nicht „Vater“ oder „Speer“ an und für sich, sondern „mein Vater“, „dein Vater“, „dieser Speer hier“, „jener Speer dort“; nicht „gehen“ im allgemeinen, sondern „hinaufgehen“, „hinuntergehen“, „schnell gehen“, „langsam gehen“ usw. Der Wortschatz war also ungemein reich, ebenso die Möglichkeit des Ausdrucks und der Neuschöpfung. Natürlich war der Gesichtskreis des primitiven Jägers beschränkt, aber innerhalb seiner Welt kannte er sich gut aus und beobachtete alle ihre Einzelheiten — nur dass sein Bewusstsein sie anders ordnete und verband, als der zivilisierte Mensch von heute dies tut.
Durch das Leben und Wirken in der Gemeinschaft entwickelten sich Sprache und Denken in dauernder Wechselwirkung immer höher. Schon regte sich die ständig wachsende Bewusstheit und mit ihr höhere geistige Fähigkeiten, die den Aufschwung des Menschengeschlechts und seine Beherrschung der Natur vorausahnen lassen: Erfinderkraft, Entdeckergeist, erste Anfänge künstlerischer Betätigung.
Mit einer der wichtigsten Geistestaten des urzeitlichen Menschen, mit der Erfindung des Feuerbohrens, das die Jägersippe fortan von der ständigen Sorge um das zum Leben unentbehrliche Element befreit, schließt dieses Buch über die Mammutzäger. Es gibt, so weit die Funde und unsere Schlussfolgerungen dies gestatten, ein getreues Bild vom Leben des Menschen der jüngeren Altsteinzeit im Herzen Europas und bringt uns jene fremde, so weit entfernte Zeit lebendig nahe.
PROF. R. BLEICHSTEINER
Die jungen Jäger
Die Sonne steht über dem höchsten Gipfel des Pollauer Bergkammes und badet ihre warmen Strahlen in den Wassern des großen Tieflandes. Dreimal mächtiger als in der heutigen Zeit windet sich die Thaya durch die Gegend, teilt sich in Arme, vereinigt diese dann wieder zu Seen und bildet verwachsene Sümpfe, so dass im üppigen Grün oftmals nicht zu erkennen ist, wo Wasser ist und wo festes Land.
Die Flüsse Iglawa und Schwarzawa breiten in der unabsehbaren Ebene unzählige Arme aus, und wir wissen gar nicht, wo sie sich in die Thaya ergießen. Wolken von Mücken und Fliegen schwirren über der sumpfigen Niederung und stechen unbarmherzig Tiere und Menschen, die sich in diesem weiten Land bewegen. Wer kann, flieht vor ihnen in die Wälder und auf die Berge, wo sie doch nicht in solchen Massen vorhanden sind, weil ein frischer Wind die Insektenschwärme auseinandertreibt.
Auf einer Anhöhe zwischen Thaya und Bergkamm spielt ein Haufen nackter Kinder. Vor einer Weile haben die Buben die kleinen Mädchen fortgejagt und ihnen mit Steinen gedroht; sie wollen nicht mit ihnen spielen! Aus den Buben werden doch einmal Jäger, die mit Bären, mit Mammuten und Nashörnern kämpfen — wie sollen sie sich da erniedrigen, indem sie mit Mädchen spielen, die nur Häute kauen! Die Männer sind die Herren — auch wenn sie noch so klein sind, dass sie vorläufig nicht einmal den Bogen spannen können.
In der Hitze des Spiels mischen sich nun aber alle Kinder doch wieder durcheinander. Und schon spielen sie lustig Verstecken — Buben und Mädchen gemeinsam. Im Spiel vergessen sie den ursprünglichsten Unterschied in der menschlichen Gesellschaft: jenen zwischen Bub und Mädel. Sie sind alle gleich geschickt, sie können gleich gut laufen, springen und auf Bäume klettern; selbst der kleinste unter ihnen hält sich tapfer und will in nichts zurückstehen.
Da ist ein Knirps zwischen den Steinen gestürzt, und nun rinnt ihm das Blut von Schulter und Stirn; auch das Knie hat er sich angeschlagen, es läuft alsbald blau an. Jetzt steht er da, die Augen voll Tränen, und krümmt sich vor Schmerz. Die anderen Buben sind schon herbeigelaufen und stehen um ihn herum. Wenn er zu weinen beginnt, werden sie ihn schonungslos auslachen! Aber der verletzte Knirps wischt sich mit der schmutzigen Hand die Augen ab, schnupft kräftig auf — und es gelingt ihm sogar, zu lächeln.
Das Gelächter der Gefährten wäre schmerzhafter als Hunger, beißender als Frost, wäre unerträglich wie das Feuer! Deshalb unterdrückt der Knirps den Schmerz und grinst recht kläglich. In seinen Kindersinn hat sich schon tief das in der Sippe von Geschlecht zu Geschlecht vererbte Jägergesetz gegraben, das besagt, dass für die Gemeinschaft wertlos ist, wer sich von körperlichen Schmerzen übermannen lässt. Zu Recht wird der Schwächling mit Gelächter bestraft, denn er ist für die übrige Sippe nichts als Ballast in ihrem schweren Kampf ums Dasein. —
Die Buben geben cs auf — aus dem Auslachen ist diesmal nichts geworden. Käfer! ist ein tapferer Bub, auch wenn er noch nicht auf Bäume klettern und weit werfen kann. Er verdient Anerkennung, und alle Buben brüllen im Chor auf Bärenart:
„Huaa! Huaa! Huaa!“
Der Kleine nimmt mit Befriedigung das derart ausgedrückte Lob entgegen und — vergisst seinen Schmerz! Er mengt sich wieder ins Spiel und hinkt nur ein bisschen.
Die Mädchen haben indessen eine Schar Rebhühner aufgescheucht, und jetzt halten alle Kinder Ausschau, wo sie niedergehen würde. Aber ein flinker Bub, etwa zwölf Jahre alt, mit einem Halsband aus einigen Knöchelchen geschmückt, zeigt plötzlich mit der Hand in die Höhe: Im hellen Blau kreist über der Niederung, dort, wo sich heute der Ort Wisternitz befindet, ein Raubvogel. Er kommt näher, fast ohne die Flügel zu bewegen; kaum sind jedoch die Rebhühner niedergegangen, stößt der große Vogel wie ein Stein zur Erde und verschwindet hinter einem Dickicht. Es dauert nicht länger, als ein Kuckuck dreimal ruft, und der Raubvogel erhebt sich wieder; in den Fängen hält er ein Rebhuhn. Er fliegt damit über den Bergkamm und verschwindet langsam in der Ferne.
„Habicht jung!“ sagt der Bub mit dem Halsband und zeigt mit der Hand in die Richtung der Pollauer Berge. Seine Stimme ist rau. Man merkt, er kann sich nur schwer ausdrücken. Seine Rede ergänzt er ausgiebig mit Gebärden, wie überhaupt alle mehr mit Händen und Mienen sprechen als mit dem Mund.
„Stoß — Rebhühner fangen!“ fordert ein Gefährte den Buben auf und nimmt gleich Richtung dorthin, wo die Rebhühner niedergegangen sind.
Stoß quiekt zustimmend und folgt seinem besten Kameraden, dem immer lustigen Eichhorn. Noch zwei Buben gehen mit, während die übrigen Kinder wieder im jungen Gebüsch herum jagen.
Die vier Buben — sie mögen alle zwischen acht und zwölf Jahre alt sein — schleichen zwischen Büschen und Felsblöcken vorwärts. Unterwegs klaubt jeder einige schöne Steine auf, um sich mit Wurfgeschossen auszustatten. Der lebhafte Stoß ist offenbar der Führer des kleinen Trupps; die anderen Buben folgen in allem seinem Beispiel.
An der Hangbiegung bleibt Stoß stehen und blickt sich um
Die unendliche Ebene dehnt sich ins Weite, den Gesichtskreis entlang von blauen Hügeln umrahmt. Gegen Nordwesten hebt sich Welle um Welle, und in weiter Ferne ruht der Himmel auf dem böhmisch-mährischen Höhenzug. Auf den Hügeln jenseits der Thaya wechseln grüne Wäldchen mit buschbewachsenen Lichtungen. Die Thaya entlang glänzen kleine Seen und winden sich stille Wasserarme. Und da, unter dem Hügel, bezeichnet eine Gruppe von Lederzelten nahe am Fluss den Lagerplatz der Sippe. Von der Feuerstelle steigt der Rauch gerade zum Himmel; keine Stimme dringt vom Lager bis zu den Buben herauf, ja man kann von hier kaum die unten sich bewegenden Jäger erkennen.
Stoß ist nun wieder vorwärts gekrochen und hat die stachligen Brombeersträucher umgangen. Er schleicht weiter, dorthin, wo er die Rebhühnerschar zu finden hofft. Seine Kameraden sind zurückgeblieben und kümmern sich augenblicklich nicht um ihn; ihre Aufmerksamkeit ist ganz von den gerade reifenden Erdbeeren in Anspruch genommen. Der Erdbeerwuchs zieht sich den ganzen Hang entlang weiter, und die Buben sind nicht imstande, der Verlockung zu widerstehen, und verzehren eifrig die roten Früchte. Sie haben es damit so eilig, dass sie sich die Erdbeeren geradezu um die Wette in den Mund schütten. Sie schmatzen und spucken die Blätter aus, die ihnen mit den Beeren in den Mund geraten sind.
Stoß schaut verächtlich auf die Erdbeernascher zurück und schreitet vorsichtig vorwärts. Geschickt nützt er jede Deckung von Bodenvertiefungen und Gesträuch aus und kriecht wie eine Eidechse auf dem Bauch über die Felsen. Er brennt vor JagdIcidcnschaft, denn er zählt sich nicht mehr zu dem Kinderkleinzeug ohne eigene Kraft, das sich nur auf das verlässt, was cs von der Mutter kriegt oder was von den erwachsenen Jägern beim Lagerfeuer weggeworfen wird. Nein, Stoß ist kein unbeholfenes Kind mehr — die Fuchszähne an seinem Halsband zeigen, dass er sogar schon mehrere ausgewachsene Füchse im Kampf überwältigt hat! Und was er bereits an weißen Hasen, an scheuen Murmeltieren und schmackhaften Lemmingen erbeutet hat, damit prahlt ein so starker und flinker Bub gar nicht mehr, das bringt ja manchmal auch ein Mädel zustande! (Gestern hat sogar der kleine Zappel, der noch nicht einmal schwimmen und auf Bäume klettern kann, einen Ziesel gefangen!) Stoß fürchtet wcdcr den listigen Wolf noch den wütenden Luchs, ja nicht einmal mit dem gefährlichen Vielfraß scheut er den Kampf!
Es wird gar nicht mehr lange dauern, dann wird er mit den großen Buben gehen wie Schwärzei und Spürnas, die kaum um einen halben Kopf größer sind als er. Bis jetzt haben ihm die erwachsenen Jäger leider noch nie erlaubt, mit ihnen zu jagen; erst neulich haben sie ihn wie einen kleinen Buben mit Steinen zurück gejagt, als er sich einem Rentierfang hatte anschließen wollen. Und dabei kann Stoß schon pirschen, kann Wildfährten verfolgen, hält das Laufen durch dichtes Gras durch und hätte bestimmt nichts verdorben! — Nun, heute wird er zufrieden sein, wenn er wenigstens ein Rebhuhn mit einem Stein treffen kann.
Holla, dort gibt Eichhorn ihm Zeichen! Da hat er sicher etwas gesichtet!
Stoß umgeht vorsichtig die Sträucher und die mit kleinen Steinchen bedeckte Stelle unter dem Felsen und hockt sich zu Eichhorn. Dieser, ein Bub gleichen Alters wie Stoß und dessen treuer Kamerad bei jeder Unternehmung, deutet mit der ausgestreckten Hand zwischen die Brombeerstauden. Dort, auf einer kleinen Lichtung im Strauchwerk, bescheint die Sonne einen Stein, und auf dem Stein liegt, lang ausgestreckt und bewegungslos, ein Fuchs.
„Fuchs schläft“, flüstert Eichhorn Stoß zu.
Die beiden Buben schleichen ein paar Schritte näher an den Stein heran. Sie drücken sich eng an die Erde und heben nur ein wenig die Köpfe über Heidekraut und Preiselbeerstauden, um besser zu sehen. Der Fuchs hat ein dichtes, glänzendes Fell; ganz gelbbraun, nur um die Schnauze und am Ende des buschigen Schweifes sind helle weiße Flecke. Ein schönes Stück...
Über dem Stein fliegen einige Krähen hin und her und krächzen aufgeregt.
„Fuchs schläft nicht — tot!“ sagt Stoß leise zu seinem Kameraden und deutet mit dem Kopf, Eichhorn möge die schreienden Krähen beachten.
Schon wollen die Buben aufstehen, um die leichte Beute aufzuheben, da springt der bis dahin bewegungslose Fuchs blitzschnell in die Höhe und schnappt eine Krähe am Flügel. Die übrigen Vögel stürzen sich mit furchtbarem Gezeter auf den listigen Fuchs, der aber ergreift mit der Krähe im Maul die Flucht.
Noch bevor er den Wechsel im nahen Gebüsch erreicht, trifft ihn der geistesgegenwärtige Stoß mit einem Stein am vorderen Lauf und erschwert ihm dadurch das Entkommen. Dennoch springt er hinter das Gebüsch und jagt dann in gestrecktem Lauf bergab. Sein kerzengerade hochgestellter Schweif fliegt nur so durch die Lücken im dichten Graswuchs und lässt die Richtung seiner Flucht erkennen. Und schon rennen die beiden Buben hinter dem verletzten Fuchs her. Die unverhoffte Jagd erregt sie, so dass sie alles andere alsbald vergessen haben.
Auf einem kleinen Hügel bei einem Hartriegelstrauch bleibt der Fuchs stehen. Er hat schon bemerkt, dass er jetzt von einem gefährlicheren Feind verfolgt wird, als es die lärmenden Krähen sind, und bekundet jetzt durch Heulen seine Wut darüber. Aber er erlaubt den Buben nicht, sich ihm zu nähern, und läuft weiter den sanften Hang hinab.
Stoß und Eichhorn sind gute und ausdauernde Läufer. Ihre hat hartgetretenen Sohlen fühlen die spitzen Steinchen, die stachligen Gräser und die dornigen Zweige nicht. Sogar durch das Brombeergestrüpp können sie laufen, das tückisch nach ihren Beinen greift, und durch gürtelhohe Brennesseln jagen. jetzt laufen sie in einer gewissen Entfernung voneinander, um den Fuchs zwischen sich zu bekommen und ihn nicht seitwärts entwischen zu lassen. Kein Wort, keine Verabredung war nötig — sic haben beide den gleichen Gedanken. Sie geben dem Fuchs keine Möglichkeit, seitwärts zu entkommen, und vereiteln jeden diesbezüglichen Versuch mit Steinwürfen. Der Fuchs ist also gezwungen, geradeaus zum Fluss zu laufen; und dort — so hoffen die Buben — werden sie ihn erwischen und erschlagen.
Stoß keucht heftig, sein Gesicht ist ganz dunkelrot. Er ist ein wenig zurückgeblieben, denn ein Dorn ist ihm in den Fuß geraten. Aber schon hat er den schmerzenden Dorn wieder herausgezogen und läuft nun weiter. Auch Eichhorn hat einen Augenblick haltgemacht und sich mit der Hand das Blut vom linken Fuß gewischt. Es schien ihm einen Augenblick, als fehlte ihm eine Zehe; aber nun atmet er erleichtert auf — es sind noch alle da! Zwar kann er sie nicht zählen, aber er kennt sie ja alle. Und die Jagd geht nun wieder weiter!
Unter dem Hang bis ganz zum Fluss heran steht das Gras sehr hoch; die Buben müssen gut schauen, wo der Fuchs läuft, wollen sie ihn hier nicht aus den Augen verlieren. Nur an der Bewegung der hohen Halme erkennen sie, wohin der Fuchs ihnen vorausgelaufen ist. Sie nehmen alle Kraft zusammen, um das Tier nicht ins Schilf entwischen zu lassen, aber vergeblich: Sie sehen noch, wie es um einen Strauch huscht, die Krähe im Maul herumwirft und von neuem schnappt; dann schwankt das Schilf — und der Fuchs ist weg!
Verlegen schauen die Buben einander an, kratzen sich die Waden und schlagen nach den frechen Stechmücken und Fliegen.
Die Jagd ist misslungen.
Der Angriff der Bisons
Eichhorn schnappt mit der Hand und fängt eine große Wiesenheuschrekke. Gcsdiickt reißt er ihr Beine und Flügeldeckel aus und isst sie dann. Stoß wischt sich den Schweiß vom Gesicht, weil der ihn in den Augen beißt, und schaut zurück auf den Hügel, wo die spielenden Kinder geblieben sind.
Dort ist doch etwas los!
Die beiden Buben stehen regungslos mit offenem Mund da. Denn dort aus dem Wäldchen unter dem Berggürtel kommen soeben einige große Tiere. An dem hohen und mächtigen Vorderkörper ist schon von weitem leicht zu erkennen, dass es Auerochsen sind! Bisons!
Voran ein starker Stier, hinterdrein drei Kühe und ein Kalb. Der Stier hält an einer freistehenden Kiefer an und reibt sich an ihr, dann setzt er im Überschwang seiner Kraft die Hörner unten au der Erde an und schlitzt mit einer mächtigen Kopfbewegung die Rinde des Baumes auf — von der Wurzel bis weit hinauf, sodass nun lange Fetzen niederbaumeln. Und noch einmal senkt der Stier den Kopf, um seine Leistung zu wiederholen, aber da hält er mit angezogenem Schwanz plötzlich inne; seine dunklen Augen blinzeln aufmerksam.
Der Wind hat ihm die Rufe der Kinder zugetragen.
Der Bison hebt langsam den Kopf und streckt sich in seiner ganzen furchtbaren Größe und Stärke. Er stampft auf, um seine Herde aufmerksam zu machen. Auf dieses Zeichen ihres Führers lassen die Kühe das Grasen sein, mit dem sie eben begonnen haben, und blicken ihn erwartungsvoll an . . .
Im Wäldchen laufen die spielenden Kinder umher. Ganz in der Nähe der Tiere schreit ein Bub auf, der auf einen Dorn getreten ist, und einige Kinder bahnen sich durch das dichte Jungholz einen Weg zu ihm.
Das Rascheln des Reisigs und das Knacken der abgebrochenen Zweige scheucht die Bisons auf. Der Stier schlägt mit dem Schwanz, macht mit einem Sprung kehrt und setzt sich gegen die grasige Niederung zu in Trab. Mit kleinen Schritten läuft er den Hang hinunter, ohne sich um die Herde zu kümmern, denn er weiß ja ganz genau, dass alle hinter ihm herlaufen; das Gestampfe ist deutlich zu hören.
Das Kalb ist etwas zurückgeblieben, aber die Mutterkuh lässt es nicht im Stich: sie bleibt bei ihm, um es zu schützen.
Nun haben die Kinder die fliehenden Bisons bemerkt und laufen aus dem Wald auf den freien Hang hinaus; das Fangspiel ist vergessen, alle schauen ganz überrascht der aufgescheuchten Herde nach. Dann, nach einer Weile stummen Staunens, beginnen die Kinder aufs neue zu schreien; sie jubeln über das unerwartete Abenteuer, und schon laufen sie alle den davoneilenden Tieren nach, hinunter zur Thaya, als ob sie sie fangen wollten.
Stoß und Eichhorn sehen vom Fluss her diese Jagd. Zuerst sind auch sie freudig überrascht, aber alsbald beginnen sie zu knurren, unzufrieden darüber, dass die Kinder die Bisons gerade zum Fluss treiben.
Eine Bisonherde — welch willkommene Beute für die Sippe wäre das! Aber diese Dummköpfe verderben ja alles — rennen hinter der Herde her und lassen sie nirgends zur Ruhe kommen, wo die Jäger aus dem Lager sie umzingeln könnten! Auf diese Weise werden die Bisons schließlich an den Fluss gelangen, hinüberschwimmen und sich am jenseitigen Ufer verlieren — und die Sippe kommt um eine Beute, wie sie sie schon lange nicht gehabt hat!
Wenn Stoß und Eichhorn die Kinder jetzt in der Nähe hätten, erginge es ihnen schlecht! Die Haare würden sie ihnen ausreißen und den Buckel vollhauen für ihr unvernünftiges Tun! Wenn die Knirpse zumindest die Jäger im Lager aufmerksam machen wollten — aber das fällt diesen Dummköpfen gar nicht ein! Und das sollen einmal junge Jäger werden! Blinde Maulwürfe sind sie! Eine Bisonherde läuft am Lager vorbei — und die Jäger sitzen dort bei der Feuerstelle, kratzen trockene Knochen ab und wissen von nichts ...
Stoß durchwatet eine kleine Pfütze; auf einer mit niedrigen Weiden und Birken bewachsenen Anhöhe beschattet er seine Augen mit den Händen, und schon nicht er erfreut seinem Gefährten zu: Die Kinder haben es nicht ausgehalten, der Herde lange nachzulaufen, und sind weit zurückgeblieben. Die Bisons sind den beiden Buben schon ziemlich nahe gekommen und gehen nur mehr in langsamem Schritt.
Stoß flicht aus Gräsern einen Kranz und bindet sich ihn um den Kopf; in den Kranz steckt er langes Schilf, so dass er nun eine große Krone auf dem Kopf hat. Eichhorn macht sofort dasselbe. Und schon gehen beide Buben den Bisons entgegen.
Gebückt huschen sie durch das dichte Wiesengras, aber von Zeit zu Zeit tauchen sic hervor und schütteln die Köpfe.
Der Bisonstier ist schon aufmerksam geworden. Die Herde bleibt stehen und schaut neugierig auf die sonderbar hergerichteten Buben.
Die Buben bewegen sich langsam, sie senken die Köpfe ins Gras und heben sie wieder langsam hervor. Dann bleiben sie ruhig stehen.
Die Bisons beobachten sie nun lange Zeit, ohne sich zu bewegen. Der Wind weht seitlich, so dass die Tiere keinen Menschengeruch wittern und sich beruhigen. Die Kühe rücken zusammen und reiben sich aneinander; so zerdrücken sie die lästigen Stechmücken, die sich zu beiden Seiten der Bäuche in dichten Scharen niedergelassen haben. Das Kalb lässt sich sorglos den Klee, den Sauerampfer und den Löwenzahn schmecken. Der Führer der Herde senkt den Kopf, rupft ein ganzes Büschel Farnkräuter aus, aber zerkaut es nicht; mit den hängenden Farnkräutern im Maul hebt er den Kopf. Er hat nun doch etwas gewittert.
Stoß und Eichhorn wimmern leise vor Aufregung. Sie sehen, wie aus dem Lager die Jäger mit Speeren und Beilen herbeieilen. Also hat man im Lager doch von der Bisonherde erfahren! dass aber jetzt die Bisons nur nicht übers Wasser flüchten!
Der Leitstier wird unruhig. Bestimmt wird er im nächsten Augenblick weiter flüchten ...
Achtung! Die Bisons dürfen nicht zum Fluss! Aber die Jäger sind noch ziemlich weit — wer wird der Herde den Weg verstellen?
Der Leitstier hat Gefahr gewittert; er beginnt zu laufen, die übrigen Tiere hinterher. Und geradewegs zur Thaya!
Stoß und Eichhorn springen auf und stellen sich herzhaft der Herde in den Weg. Sie springen im Gras hoch, schwenken Zweige und schreien aus vollem Hals.
Aber der Leitstier beachtet es nicht. Er stürzt vorwärts — so plötzlich, dass die Buben, von Angst überwältigt, nur mit knapper Not ins Weidengestrüpp springen können.
Der Wind weht dem Bison nun entgegen. Nur noch wenige Schritte ist der Stier von den Buben entfernt, da spürt er den unangenehmen Menschengeruch, spuckt schnaufend das Farnbüschel aus und ändert die Richtung. Er biegt vom Fluss ab und wendet sich seitwärts; Kühe und Kalb laufen blindlings hinterdrein.
Die Buben springen wieder aus ihrem Versteck und grinsen voll Freude: die Bisons bleiben also am diesseitigen Ufer der Thaya! Übermütig laufen die beiden jungen Jäger neben der Herde her und wagen es sogar, das Kalb von der Kuh abzudrängen. Dabei kommt jedoch Stoß der Kuh unvorsichtig nahe, und diese geht sofort mit gesenktem Kopf auf ihn los, um ihn auf die Hörner zu spießen. Der Bub wirft sich aber auf die Erde und drückt sich so schnell in den weichen Boden, dass er augenblicklich dem wütenden Blick des mächtigen Tieres entschwindet; die Kuh fährt mit dem Maul über den Rücken ihres Kalbes und läuft mit ihm dem Stier nach.
Die Pollauer Berge sind steil und ragen über dem Lager der Sippe schroff auf, hier an der Thaya aber verlaufen sie nur mehr in sanften, gezogenen Wellen ins weite Tiefland. Aus einer seichten Bodenfurche dieses Hügelgeländes kommen jetzt mehrere Jäger den Bisons entgegen. Der Leitstier bleibt einen Augenblick stehen, aber er hat keine Lust zum Kampf, der sicherlich für beide Teile furchtbar wäre. Ohne zu zögern, springt er ins Wasser — nicht in die Strömung der Thaya, sondern in einen ihrer vielen blinden Arme, die das Land durchziehen. Die Kühe durchbrechen das Erlengebüsch und werfen sich ihm nach. Die Bisonmutter stößt das ermüdete Kalb mit dem Kopf ins seichte Wasser.
Die Bisons können hier jedoch nicht schwimmen — es ist zu wenig Wasser da! Mühselig ziehen sie die Beine aus dem bodenlosen Schlamm und kommen kaum vorwärts.
Stoß ist so in Hitze, dass er gar nicht an die Gefahren des trügerischen Sumpfes denkt. Er stürzt ins Wasser, der Herde nach. Vergeblich schreit Eichhorn, er möge doch zurückkommen — Stoß hört ihn nicht. Und würde er auch hören, in diesem Augenblick ist er für Ratschläge und Warnungen unzugänglich!
Das Wasser des blinden Flussarms geht Stoß am Rand kaum über die Knie, aber der Schlammboden weicht unter seinen Füßen und zieht ihn hinunter, so dass er gleich bis über die Hüften im Wasser steht. Nur mit großer Mühe zieht er die Füße aus dem klebrigen Schlamm und erreicht an einer etwas gangbareren Stelle den Leitstier. Er packt den hin und her schwankenden Riesen am Schwanz und versucht mit aller Kraft, den Bison am Weiterstapfen zu hindern. Die heraneilenden Jäger lachen über das verrückte Beginnen des waghalsigen Buben so sehr, dass sie sich die Bäuche halten.
Die schweren Bisons kommen nicht vorwärts. Sie stechen in dem sumpfigen Flussarm fest, und je mehr sie sich herausarbeiten wollen, um so mehr sinken sie ein. Manchmal kann eines der Tiere zwei, drei Schritte vorwärts machen, aber tückisch gibt alsbald der Schlamm unter der schweren Last abermals nach, und der Bison steckt wieder bis über den Bauch darin.
Die Jäger brechen unter großem Geschrei Äste von Bäumen und Sträuchern und werfen das Holzwerk auf den Sumpfboden, damit der sie besser trage. Sie freuen sich schon auf die reiche Beute. Eine der Kühe haben sie bereits erreicht und bearbeiten sie mit ihren Speeren; die zweite Kuh ist indessen ganz im Sumpf verschwunden, die dritte hat tieferes Wasser erreicht und schwimmt schnaufend ans andere Ufer.
Stoß hält noch immer den Stier hartnäckig am Schwanz und schlägt wie verrückt mit einem Knüppel auf den Rücken des riesigen Tieres ein. Der Bison wirft sich wütend herum — wehe dem Buben, wenn der Riese ihn mit dem Huf trifft! Am Ufer feuert Eichhorn ganz aufgeregt mit Rufen und Gebärden verspätet herankommende Jäger und einige Frauen zur Eile an. Alle Hände werden gebraucht! Einer abgehetzten Frau zeigt er den kämpfenden Stoß — ihren Sohn.
Die Frau schreit erschrocken auf und ruft sofort mit durchdringender Stimme den Buben zu sich ans Ufer. Aber Stoß schaut sich nur flüchtig um und antwortet nicht. Wie kann jetzt jemand — und sei es auch die eigene Mutter — von ihm verlangen, dass er seinen waghalsigen Kampf vor den Augen der ganzen Sippe aufgebe? Nun ja, Frauen können eben die Jagdleidenschaft nicht verstehen! Stoß überhört absichtlich das Rufen der Mutter; er wird sich doch nicht die Schmach antun, einen Kampf aufzugeben, in dem er vor allen glänzen kann!
Der Bison ist schon mehr als zur Hälfte im Schlamm versunken. Er atmet schwer; mit jedem Atemzug saugt er eine Menge Stechmücken in sich hinein, so dass in der Insektenwolke, die ihn umgibt, ein leerer Fleck entsteht. Zwar hustet er den eingesogenen Schwarm sofort wieder aus, aber seine Wut wird immer mehr angestachelt. Wild rollt er die Augen, aber er kann die Stechmücken nicht verjagen, die sich klumpenweise auf ihm festsetzen — denn sein Schwanz kann nicht zuschlagen; Stoß hält ihn unverdrossen umklammert.
Die aufgeregte Mutter sieht nun, dass ihr Sohn alle Warnungen unbeachtet lässt. Da springt die Besorgte kurz entschlossen in den Sumpf und arbeitet sich an Stoß heran. Eben als der keuchende Bison sich hochreckt und den zottigen Kopf dem Buben zudreht, um ihn mit den Hörnern fortzuschleudern, packt sie Stoß an der Hand und reißt ihn weg. Sie selber aber sinkt dabei tief in den tückischen Schlamm. Schon treffen die Speere der Jäger den Bison, und der sich aufbäumende Stier wälzt sich auf die unglückliche Mutter und drückt sie unter sich in den Sumpf.
Niana hat ihr Leben für den Sohn geopfert.
Die Jäger dreschen mit ihren Steinbeilen wild auf das große Tier los. Sie wollen die arme Frau hervorziehen, aber sie sind nicht imstande, den schweren Bison wegzuwälzen, der noch immer heftig herumschlägt und sie gefährlich bedroht. Mit Kot vermischtes Blut deutet auf zahlreiche Wunden am Körper des immer schwächer werdenden Riesen; es geht zu Ende mit ihm.
Am Ufer haben Frauen und Kinder das gefangene Bisonkalb umzingelt und necken und plagen es mit Geschrei. Sie haben gar nicht beachtet, dass die arme Niana unter dem Bison im Sumpf verschwunden ist. Nur zwei ältere Frauen, die neue Speere für die Jäger bereit halten, stehen unweit der Unglücksstelle und schauen still und mit traurigem Gesichtsausdruck dem Kampf gegen den riesigen Bison zu; sie denken an die arme Niana, die so plötzlich ihr Leben geendet hat. Aber sie klagen nicht — im Kampf weint man nicht um Gefallene.
Nianas Tod wirkt nicht allzu sehr auf die Sippe. Es ist nun einmal nicht anders im Jägerleben. Niemand weiß am Morgen, ob er abends noch leben wird. Im ständigen Kampf um die Nahrung siegt einmal der Mensch, ein andermal wieder das Tier — so war es, so ist es, und so wird es sein.
Aber Nian, Nianas Mann und Herr, ist doch bestürzt, und sein Schnauben und das auffällige Blinzeln seiner Augen zeigen, dass er bewegt und aufgewühlt ist. Er hat die Frau verloren — eine tüchtige und verlässliche Dienerin, die er einst gegen ein herrliches Bärenfell eingetauscht hat. Schwer wird er sich jetzt eine neue verschaffen können, böse Sorgen erwarten ihn. Wer wird ihm auf Jagdfahrten das Zelt tragen? Wer wird seine Felle kauen, um sie weich zu machen? Nian ist sehr traurig ...
Stoß hat die Jagdleidenschaft verlassen. Reglos schaut er auf ein mit Blut bespritztes Wasserrosenblatt. Er wartet darauf, dass die Jäger den Bison fortwälzen und dass seine Mutter wieder aufsteht. Aber ein Jäger schiebt den Buben beiseite, dass er nicht im Wege stehe.
Stoß bleibt noch eine Weile im Wasser, den Daumen der linken Hand zwischen die Zähne geklemmt. Dann kriecht er gesenkten Blickes an den Rand des Sumpfes und setzt sich an einen Erlenbusch.
Laute Siegesschreie verkünden das Ende des Kampfes mit dem Bisonstier. Die müden Jäger kriechen aus dem Sumpf und befehlen den Frauen, beide Bisons herauszuziehen; sie selber legen sich ins Gras. Jetzt erst sprechen sie ein paar Worte über den unvermuteten Tod Nianas, der treuen Gefährtin des tapferen Jägers Nian.
Die Frauen, gewohnt, den Männern zu gehorchen, sind sofort in den Morast gestiegen. Fast alle sind sichtlich krummbeinig vom ständigen Sitzen mit gekreuzten Beinen. Sie haben den ersten Bison bei Beinen, Hörnern, Mähne und Schwanz gepackt und schleppen ihn unter Anspannung aller Kräfte durch das Wasser ans Ufer.
Weithin schallen Geschrei und Lärm, Weisungen und Warnungen. Das Wasser spritzt hoch auf, wenn die Arbeitenden im Schlamm straucheln, und das Kreischen der Frauen, die ihre Füße nicht aus dem Sumpf herausziehen können, vermischt sich mit dem lauten Lachen der Männer, die angesichts der reichen Beute in gehobener Stimmung sind. Nach den Mühen des Kampfes ruhen die Jäger aus. Sie haben eine große Leistung hinter sich.
Man würde gar nicht glauben, dass die mageren Männer über so viel Kraft und Ausdauer verfügen. Sie haben kein Fett am Körper, aber ihre Muskeln sind elastisch und zäh und ziehen sich über die Arme wie dicke Seile. In ihrer Mehrzahl sind die Jäger nackt, nur manche haben ein Fell um die Hüften gebunden — mehr zur Zierde, als weil sie es brauchen. Ihre sonngebräunten, Wind- und Regen gewohnten Körper sind sehr abgehärtet. Die erwachsenen Männer sind am ganzen Körper behaart, nur die Narben der furchtbaren Wunden aus den verschiedenen Kämpfen bilden unbewachsene Flecke. Ohne Narben gibt es keinen in der Sippe — es wäre doch eine Schande, wenn ein erwachsener Jäger kein Zeichen von den heldenhaften Kämpfen mit wilden Tieren an seinem Körper hätte! Sogar manche Frauen prahlen mit Narben — mit selbst zugefügten, allerdings. Sie haben sich nämlich im Gesicht und auf der Brust Hautstückchen herausgeschnitten, und diese Wunden, die mit Holzasche bestreut wurden, sind dann erhaben hervorgequollen und bilden jetzt eine dauernde Verzierung der mannbaren Mädchen und Frauen.
Die Jäger, die den im Schlamm wütenden Frauen zuschauen, lachen behaglich in der Vorfreude auf das bevorstehende reiche Mahl. Ihre geöffneten Lippen enthüllen das starke Gebiss; besonders die Eckzähne ragen wuchtig hervor, und das gibt den Gesichtern ein wildes Aussehen. Der Mund ist besonders üppig, Kinn und Stirn hingegen treten merklich zurück; besonders die Stirn verliert sich hinter den mächtigen Augenbrauenwülsten. Die Beine sind auffallend dünn, denn diese Jäger haben noch nicht so volle Waden wie die späteren, ansässigen Menschen. Und wenn die Zehen über den Lehmboden gleiten, so zeigt die Fußspur sehr deutlich, wie sehr — zum Unterschied von den späteren Menschen — die große Zehe von den übrigen Zehen absteht. Ohne Zweifel würde heute jeder, der im Wald einen urzeitlichen Menschen sähe, auf den ersten Blick glauben, einen großen Affen vor sich zu haben. Aber das wäre ein großer Irrtum: denn die Mammutzäger sind schon wirkliche Menschen und sind durch den aufrechten Gang, durch die Sprache und durch den Gebrauch von Werkzeugen sogar den höchstentwickelten ihrer tierischen Vorfahren weit voraus. Sie ragen auch über die ursprüngliche Menschengattung, über den wilden Neandertaler, der in jener Zeit längst ausgestorben ist, weit hinaus. —
Die kotbeschmierten Frauen haben den toten Bison nun ans Ufer gebracht, aber auf der Böschung können sie ihn nicht halten. Der schwere Körper rutscht wieder zurück ins Wasser, und die unten schiebenden Frauen können kaum ausweichen; das Wasser spritzt hoch auf. Laut lachen die Männer; sie sehen schon, dass es ohne sie nicht geht, und da fühlen sie sich eben geschmeichelt und stehen nun langsam auf. Mit verächtlichem Lachen schauen sie auf die abgerackerten Frauen und packen jetzt selber den Bison.
Aber es fällt auch ihnen gar nicht so leicht, das schwere Tier an Land zu bringen. Die gespannten Muskeln, die hervorquellenden Augen und die zusammengebissenen Zähne der Männer verraten, wie sehr sie sich anstrengen. Sie brummen und schimpfen, aber endlich ist der Bison doch oben. Befriedigt tasten die Männer den großen Stier ab, aber lange halten sie sich nicht damit auf, sondern steigen wieder ins Wasser, um die im Schlamm halb versunkene Bisonkuh zu holen. Schließlich wird auch sie an Land gebracht.
Erst dann durchsuchen die Männer den Schlamm an der Stelle, wo Niana versunken ist — freilich nur oberflächlich, denn es wäre vergebliche Mühe, den Körper der Verunglückten lange zu suchen; man könnte ihr ja doch nicht mehr helfen. Die Sippe hat etliche Bisons erjagt und diese Jagdbeute eben mit Nianas Leben bezahlt; damit ist die Sache beglichen — und das Ergebnis ist für die Sippe befriedigend.
Am Ufer hat indessen bereits der Schmaus begonnen. Die Bisons sind schon aufgeschnitten und liefern nun eine große Menge noch warmer Innereien. Die Buben sind daran, aus dem Lager Feuer zu holen, um es hier anzufachen, aber die ungeduldigen Jäger reißen Leber, Magen und andere Eingeweide aus den Tierkörpern und essen sie roh. Kinder und Frauen warten, bis die Männer satt sind. Heute ist ja genug für alle da! Man isst sich an, bis die Bäuche zum Bersten voll sind!
Die Männer haben den Frauen die abgezogene Bisonhaut gegeben, und die haben sie sofort im Gras ausgebreitet und mit scharfen Steinen abzukratzen begonnen, wobei sie das Abgekratzte eifrig naschen. Die zweite Haut haben die größeren Kinder übernommen.
Hinter den Sträuchern heulen die Füchse, die durch den starken Geruch von Blut, Fleisch und Eingeweiden angelockt wurden. Eichhorn wirft mit Steinen nach ihnen, und da sie noch immer nicht davonlaufen wollen, packt er wütend einen Prügel und beginnt sie zu jagen. Aber die Jäger lachen ihn aus, denn die eben davon gejagten Füchse schleichen nun prompt von der anderen Seite heran! Immer näher kommen sie und lauern, ob von dem fetten Mahl auch für sie etwas abfällt. Eichhorn gibt seine vergeblichen Bemühungen bald auf und tritt nur noch nach einem besonders frechen Fuchs, der ihm bis unter die Füße huscht.
Die Jäger sitzen im Kreis um die Feuerstelle, jeder ein Stück Fleisch in der einen Hand und einen Prügel in der anderen, um die zudringlichen Füchse zu verscheuchen, die aus allen Löchern der Pollauer Berge hier zusammenzuströmen scheinen. In der glimmenden Asche an der Feuerstelle braten die Jäger die auf Stäbe gespießten Fleischstücke. Die Männer sind alle schrecklich mit Blut beschmiert, sie haben sich nach dem Kampf nicht gewaschen — das tun sie überhaupt nie; im Gegenteil, sie sind richtig stolz auf die kämpferische Bemalung und prahlen damit, und gar mancher verschmiert das Blut eifrig nach allen Richtungen und freut sich, wenn er damit sein Gesicht zur Gänze rot färben kann. Sie grinsen einander an und fletschen die Zähne, dass es ganz furchtbar aussieht; aber ihnen gefällt es sehr. Ihrer Meinung nach ist man ein um so größerer und tüchtigerer Jäger, je mehr Blutspuren man aufweist.