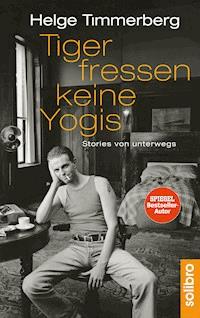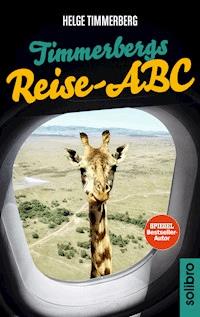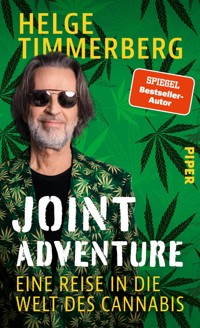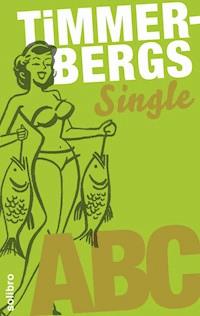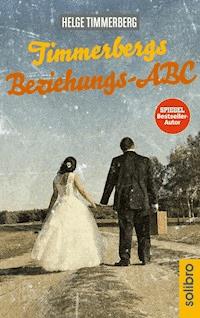12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Lose Seiten eines Märchens, genannt »Die Perlenkarawane«: Seit einer Berliner Winternacht vor über dreißig Jahren ist Helge Timmerberg davon fasziniert - und von seiner Erfinderin, Elsa Sophia von Kamphoevener. Als Mann verkleidet hatte sie an türkischen Lagerfeuern die besten Erzählungen gesammelt. Mit großer Wucht und Sinn für Komik schildert Timmerberg, wie die Geschichte der Märchenbaronin ihm immer wieder Türen, Herzen und Geldbörsen öffnete. Er erzählt von seinen Anläufen, mit ihrer Story Hollywood zu erobern, und von seiner eigenen Suche über Jahrzehnte, die ihn nach Kairo und an den Bosporus führte. Und von Marokko, dem Land, das ihn vom hartnäckigsten Liebeskummer befreite, ihm einen guten Freund schenkte und schließlich sogar den Vater zurückgab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Holly
ISBN 978-3-492-96609-2 Oktober 2015
© 2014 Piper Verlag GmbH, München Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de Covermotiv: Frank Zauritz (fotografiert im KOKON Lifestyle Haus, Lenbach Palais, München) Jugendfoto: Mirta Navas Strichzeichnung: Andreas Wald Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht.
»Wussten Sie, wie der letzte Sultan des Osmanischen Weltreiches seine Palastgärten zu beleuchten pflegte, wenn er ein Fest gab? Er ließ auf den Panzern von 2000 Schildkröten Kerzenlämpchen anbringen. Langsamer hat sich Licht nie bewegt.«
Höre, o Freund und Bruder
Es war einmal ein Märchen …
Es lauerte einmal ein Märchen in einem losen Stapel DIN-A4-Blätter neben dem Gästebett von Endi Effendi. Draußen fielen Schneeflocken, drinnen Schleier. Können Sätze wie Schleier fallen? Warum nicht. Sätze sind Alleskönner. Sie können ver- und entschleiern, sie können auch leiern, eiern, abschweifen und verloren gehen.Verloren im Orient, in diesem Fall, denn es war ein türkisches Märchen. Es führte mich in einen Basar, in ein Kaffeehaus und in den Harem des Sultans. Und dann brachte es mich in die Wüste hinaus. Das Märchen hieß »Die Perlenkarawane« und handelte von einem Mann, der vor seiner streitsüchtigen Frau erst in die Schwerhörigkeit und dann in die Welt der Träume flüchtete.
Ich sollte spätestens an dieser Stelle meine Beziehung zu Volksmärchen thematisieren. Sie war denkbar schlecht. Ich war dreißig, ich war Profi, ich war zum Mann gereift, und wann immer mir ein beseeltes Hippiekind indianische, vietnamesische, chinesische, bolivianische, afrikanische und indische Märchen schenkte, landeten sie in der Tonne. Man muss Völkerkundler sein, um sie spannend zu finden, oder man nimmt vor der Lektüre psychedelische Pilze ein. Aber wer macht das, wer will das, wer braucht Geschichten, die erst durch Drogengenuss unterhaltend werden? Es sollte sich umgekehrt verhalten: Ein Satz, der nicht wie eine Pille wirkt, ist kein guter Satz, und ein Märchen, das dich nicht wie eine Droge an sich reißt, ist keine gute Geschichte.
Es gibt sanfte und harte Drogen. Eine Geschichte, die das Gemüt eines Abends umdreht, gehört zu den sanften, eine Geschichte, die dein Leben verändert, zu den harten, und ein Märchen, das zu meinem Leben wird, zu den superharten. Dreißig Jahre später öffnet das natürlich alle Türen, Tore, Balkon- und Fensterläden zu den wildesten Spekulationen. War die »Perlenkarawane« eines dieser Vampirmärchen, die sich den Leser wie frisches Blut reinziehen? Gehörte sie zu den Zaubergeschichten, die dich mitnehmen und nie wieder zurückbringen, weil du eine Rolle, vielleicht sogar der Held in ihnen geworden bist? Wurde mein Leben von einem Märchen verschluckt? Das wäre dann Voodoo. Oder war es vielleicht gar kein Märchen, das in dem Stapel loser DIN-A4-Blätter neben Endi Effendis Gästebett lauerte, sondern einer jener uralten türkischen Geister, die die Form eines Märchens angenommen haben? Soll alles vorkommen. Und zuzutrauen wäre es ihnen. Die bösen heißen Dschinn und sind männlich, die guten heißen Peri und sind weiblich, und tatsächlich glaubte ich einer Frau zuzuhören, als ich das Märchen las.
Endi Effendi bestätigte beim Frühstück meine Vermutung. Er sagte, eine alte Schachtel habe »Die Perlenkarawane« aufgeschrieben, wobei er das »auf-« betonte, denn wenn es mir um die wahre Autorenschaft ginge, müssten wir bei den zentralasiatischen Schamanen suchen, und das vor etwa 1300Jahren. Weil ich das ablehnte, blieben wir bei der alten Schachtel. Sie kam in Hameln zur Welt, sie wuchs in Istanbul auf, sie ritt als Mann verkleidet jahrelang durch das Weltreich der Sultane, um an den Feuern der Karawansereien so lange den Märchenerzählern zu lauschen, bis sie selbst einer geworden war, und später, viel später, hatte sie an den Fronten des Zweiten Weltkrieges deutschen Landsern türkische Märchen erzählt, damit ihnen das Sterben leichter fiel. Ihr Name: Baronin Elsa Sophia von Kamphoevener. Die Landser nannten sie »Kamerad Märchen«.
Wer Endi Effendi kannte, weiß, dass seine Frühstücke lang waren und ich hier nur die absolute Kurzfassung seines Vortrages wiedergebe. Wer Endi Effendi kannte, weiß, dass er bei etwa tausend Bechern Tee und etwa tausend Pall Mall in etwa tausend Unter-, Neben- und Parallelgeschichten schwelgte, und wer das für arg übertrieben hält, kannte Endi Effendi eben nicht. Er war ein fleischgewordenes Lexikon, durch das hin und wieder der Kosmos gepfiffen ist. Er wusste nicht nur alles, er wusste mehr. Allgemeinwissen, Geheimwissen, mein Wissen, dein Wissen, sein Gehirn saugte es wie ein Schwamm auf. Wäre sein barocker Bauch nicht gewesen, würde ich sagen, sein Gehirn war der größte Körperteil an ihm. Ich nutzte es gern, egal, zu welcher Geschichte. Endi Effendis goldene Worte ließen jeden Text glänzen. Dass es sich dabei immer auch um Blattgold oder um ein Goldimitat handeln konnte, erwies sich nie als Problem. Die Redaktionen schluckten alles; selbst den Schlussredakteuren, intern auch »Korinthenkacker« genannt, fiel nicht ein einziges Mal auf, wenn sich Wissen mit Wahnsinn verband oder Journalismus mit Science-Fiction. Der nahtlose Übergang war seine Königsdisziplin. Es brauchte Vorstopper-Qualitäten, um nicht immer wieder bei den zentralasiatischen Schamanen zu landen oder bei den Architekten von Samarkand. Ich hatte sie. Ich konnte ihn stoppen. Ich arbeitete daran, seitdem wir Freunde waren, und wir waren das nun schon zehn Jahre lang. Das ideale Team. Dick und Doof. So sah er es, wenn er ehrlich war, aber das erfuhr ich erst nach seinem Tod. Es wird Zeit, ihm zu vergeben, darum schreibe ich über ihn, aber auch, weil ich ohne Endi Effendi nicht beschreiben kann, wie alles begann. Und auch nicht, wie es weiterging.
Drei Brüder
Es ist schön, durch den Schnee zu fahren, wenn man gerade eine Idee hat, die fürs Leben reicht. Obwohl der ich weiß nicht wie viele Jahre alte Peugeot 204 aus der ich weiß nicht wie vielten Hand brav mit mir nach Hause eilte, schien alles stillzustehen. Fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn, vor allem nachts, wenn sich meine Gedanken synchron mit den Scheinwerferkegeln in die Dunkelheit fraßen, der Motor sein Mantra brummte und eine Bluesgitarre aus dem Radio perlte, war immer große Meditation für mich, auch ohne eine große Idee. Aber jetzt standen die Uhr, der Planet und das Weltall still, nur der Peugeot und die Schneeflocken nicht. Für eine Idee ist dieses allgemeine Innehalten wie ein Nest, in dem sie brüten, ausschlüpfen und erste Flugversuche proben kann, um dann den Flattermann durch Zeit und Raum zu machen. Zum Beispiel nach L.A.
Diesem Stoff kann sich Hollywood nicht entziehen. Vor der Märchenerzählerin müssen sie sich verbeugen, anders geht es nicht. Sie ist die Mutter aller Filme, und der Orient ist der Vater aller Träume, und wir erwischen ihn mit ihr gerade noch zwanzig Jahre vor dem Untergang des Osmanischen Reichs. Noch hatte der Sultan das Sagen, und es gab Eunuchen und Haremsdamen, noch zogen die Karawanen von Persien bis Marokko, von Bagdad bis Belgrad, von Turkmenistan bis Jerusalem ungehindert durch den 37-Völker-Staat, noch war die Türkei, wie die Baronin im Alter traurig sagte, »ein Märchenland«. In diesem Märchen wuchs sie auf, durch dieses Märchen ist sie geritten, als Mann verkleidet und scharf auf Geschichten. Und als die vereinigten Staaten des märchenhaften Orients an der Übermacht des Okzidents zugrunde gingen, kehrte sie nach Deutschland zurück und erzählte keine Märchen mehr, denn sie versuchte zu vergessen. Und wovon lebte sie? Sie heiratete einen Arzt. Aber der wurde irgendwann schwer krank, und als er wieder einmal in der Nacht vor Schmerzen nicht schlafen konnte, bat er, ohne von ihrer Vergangenheit zu wissen, sie darum, ihm eine Geschichte zu erzählen, irgendeine – was sie tat. Das Ergebnis war die klassische Win-win-Situation. Er vergaß seine Schmerzen, und sie verstand, dass sie den Untergang des alten Orients mit dessen Märchen jederzeit wieder rückgängig machen konnte, und verbrachte von nun an ihr Leben damit, überall, wo man es wünschte, den Himmel über der Wüste aufzuspannen, damit ihre Märchenkarawanen ein artgerechtes Umfeld bekamen.
Auch ich konnte sie mittlerweile sehen. Zwischen den Schneeflocken, die der Himmel über Norddeutschland entlud, wogte die prächtigste Karawane, die jemals durch den Orient zog, und jeder, der sich ihr anschloss, wurde zum reichsten Mann der Welt. Dabei ging es mir nicht um Geld, oder besser, nicht nur um Geld, oder noch besser, es ging mir um mehr als Geld, denn Geld beweist nur die Kommunizierbarkeit einer Idee.
Natürlich war das ein Irrtum. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, müsste ich sagen, es war keine Idee, weder eine große noch eine kleine, die auf der Heimfahrt durch den Schnee in mir wallte, sondern etwas ungleich Wertvolleres, aber auch ungleich Fragileres. Ein Traum ward geboren in dieser Nacht. Ein Traum, der sich wie eine Idee verkleidete und bereits zu einem Plan zu transformieren schien, und sobald mich der Schrott-Peugeot nach Haus geklappert hatte, rief ich Endi Effendi an und sagte ihm, dass ich aus dem Leben der Märchenerzählerin ein Drehbuch machen und ihre Märchen als zweite Ebene mit in den Film einfließen lassen wolle, und schlug ihm vor, mit ins Boot zu kommen. Er lachte und sagte, er sei schon drin, aber er nehme mich gern mit, außerdem sollten wir noch Chris mit ins Boot holen, aber es ihm gegenüber anders formulieren, sonst würde auch er sagen, es sei seins und er hole uns mit hinein. Und Chris habe in jedem Fall die besseren Argumente, denn er sei kürzlich in ein Dorf am Chiemsee gezogen, und in dem Haus, das er dort gemietet habe, habe er in einem alten Schreibtisch verblichene Schwarz-Weiß-Fotografien eines kleinen Mädchens vor dem Hintergrund von Istanbul gefunden sowie verblichene Schwarz-Weiß-Fotografien derselben Person als alte Dame mit Stock am Chiemsee, auch Fotos von ihrem Vater und dem Sultan und ein paar handgeschriebene Briefe und Aufzeichnungen. Die »Perlenkarawane« allerdings sei mit der Maschine geschrieben worden. Nee, ohne Chris gehe es nicht, und ich sah das ein.
Am Abend rief Endi Effendi zurück.
»Ich habe mit Chris gesprochen. Er schlägt vor, dass wir uns Silvester an ihrem Grab treffen.«
Der Ort, in dem die Märchenerzählerin für immer ruht und Chris seit Kurzem wohnte, heißt Marquartstein und liegt im Chiemgau, zehn Kilometer entfernt vom See. Man kommt auf der Autobahn A8München – Salzburg hin, dann Abfahrt Bernau und weiter auf der B 305Richtung Reit im Winkl, und schon ist man im Friedhof der Pfarrkirche Zum kostbaren Blut. Ihr Grab ist unscheinbar, aber gut gepflegt, ein gusseisernes Kreuz mit orientalischen Ausschmückungen bewacht es. »Selig sind, die in dem Herrn sterben«, steht dran, ansonsten scheint das Grab ein namenloses zu sein, erst wenn man eine kleine Klappe an dem Kreuz öffnet, weiß man, wen man unter sich hat.
Hier ruht die Märchenerzählerin
Elsa Sophia von Kamphoevener.
1878–1963
Mehr nicht.
Kein Mausoleum, kein Denkmal, keine Tafel mit den Eckdaten ihrer Abenteuer. Am Grab von Lawrence von Arabien ist mit Sicherheit mehr los. Aber Lawrence machte Geschichte, und Elsa erzählte nur welche. Ihr Ruhm überdauerte ihr Leben nicht. Das ist ungerecht, und wir beschlossen, das zu ändern. Drei Brüder, ein dicker, ein dünner und ein noch dünnerer, ließen deshalb in der letzten Nacht des Jahres 1981 drei Raketen über das Grab der Baronin in den Winterhimmel zischen und verabredeten bei schneegekühltem Champagner, das Drehbuch in den nächsten zwei Wochen gemeinsam zu schreiben. Der Zeitrahmen kam vom dünnsten, denn Chris war unter uns der einzige aus der Branche. Er drehte Dokumentarfilme, solche Leute schreiben Drehbücher auch in einer Woche, außerdem arbeiteten wir bei ihm, also in dem Haus, in dem unsere Heldin die letzten zwanzig Jahre ihres Lebens verbracht hatte, was sollte da schiefgehen? Wir konnten es sogar in drei Tagen schaffen, oder noch schneller. Die Kamphoevener hätte für die Geschichte ihres Lebens auch nur eine Nacht gebraucht. Das war kein Größenwahn, das war der Zeitgeist. Wir standen am Rande eines legendären Jahrzehnts, und die Achtzigerjahre lagen wie eine Goldgrube vor uns.
Zurück in Chris’ Küche, legte er die Schwarz-Weiß-Fotos aus den Schubladen der Märchenerzählerin auf den Tisch, und wir begannen mit der Arbeit. Wer spielte wen? Bei ihrem Vater war es einfach. Er wurde von Kaiser Wilhelm II. nach Istanbul geschickt, um dem Sultan bei dessen Kampf gegen den Rest der Welt als Militärberater beizustehen. Der deutsche Kaiser war der einzige Freund, den der Sultan noch hatte, und der Vater der Märchenerzählerin war ein Teil des Freundschaftsvertrags.
Sein Foto zeigte einen orientalisierten preußischen Offizier in der Paradeuniform eines Marschalls der osmanischen Armee. Den Bart gezwirbelt nach wilhelminischer Art, auf dem Kopf den Türkenhut, einen Teppich voller Orden an der Brust und zwei Seelen innen drin, die okzidentale und die orientalische, die sich aber prächtig miteinander verstanden, weil der Marschall Louis von Kamphoevener Pascha sich von jeder Welt das Beste nahm, und dafür kam natürlich nur Sean Connery infrage.
Für Sultan Abdülhamid II. aber brauchten wir mehr als einen charismatischen Weltstar im richtigen Alter, für den musste ein schauspielerisches Kaliber aus der Shakespeare-Liga her, denn wir sahen auf seiner Fotografie das verblichene Antlitz eines Mannes, von dem man nicht auf Anhieb weiß, wie er drauf ist. Seine Gesichtszüge wirken grausam, aber in seinen Augen liegt eine Schwermut, die man mögen kann. Elsa Sophia sprach zwar immer gut von ihm, aber das würden die 300000 während seiner Regentschaft massakrierten Armenier so nicht unterschreiben. Die englische Regierung auch nicht. Sie hatte ihn »den fürchterlichen Türken« genannt, doch das konnte auch britische Propaganda gewesen sein. Vielleicht hatte der Sultan, wie er selbst verlauten ließ, mit den Pogromen wirklich nichts zu tun, aber er hätte sie verhindern können. Oder nicht? Wenn seine Wesire und Generäle ohne sein Wissen, aber in seinem Namen ein Volk abgeschlachtet hätten, dann würde man seinen schwermütigen Blick verstehen.
Außerdem war er der Letzte seiner Art, und er wusste es. Das letzte Glied einer Herrscherkette, die 600Jahre lang nicht gerissen war, sah das größte Weltreich des Orients untergehen. Der Krieg mit dem Zaren hatte das Schwarze Meer und die östlichen Provinzen gekostet, die Engländer nahmen Ägypten, die Franzosen Marokko und den Libanon, und dass die Europäer und Russen nicht gleich das ganze Reich unter sich aufteilten, hatte Abdülhamid ausschließlich seinem diplomatischen Talent zu verdanken, mit dem er seine Feinde gegeneinander ausspielte, um Zeit zu gewinnen. Aber auch die Balkanvölker standen auf und wollten Freiheit, die Griechen sowieso, das Imperium der Sultane brannte an allen Ecken und Enden, und Abdülhamid II. wusste, dass er es sein würde, der das Licht ausmacht, und als ob das alles noch nicht reichen würde, um seinen Gesichtsausdruck zu verstehen, war der Sultan privat und persönlich auch noch ein bisschen paranoid. Er traute keiner Frau und keinem Diener. Er fürchtete, alle wollten ihn vergiften. Wer konnte so einen Typen spielen? Und wer hatte eine so große Hakennase? Und wer war als Grieche wie auch als Türke vorstellbar? Natürlich nur Anthony Quinn.
Nun zu den Problemfällen. Wer spielte Fehim Bey? Wer war Fehim Bey? Und wie sah Fehim Bey aus? Es gab keine Fotos von ihm. Auch keine Zeichnung. Der Mann, von dem unsere Heldin an den Feuern der Karawansereien das Erzählen lernte und der ihr all seine Märchen schenkte, als er in Rente ging, blieb im Großen und Ganzen unserer Phantasie überlassen.
Endi Effendi nutzte die Chance, um endlich sein Wissen über die zentralasiatischen Schamanen auszupacken, denn ohne die Wurzeln von Fehim Beys Erzählkunst zu kennen, könnten wir uns unmöglich ein vollständiges Bild von ihm machen. Folgendes kam bei Endi Effendis Vortrag heraus:
Die frühen Turkstämme lebten im heutigen Staatsgebiet der Mongolei. Ihre Religion war der Schamanismus, ihre Priester waren die Schamanen. Im Gegensatz zu den Gottesmännern anderer Religionen ging es ihnen nicht so sehr darum, die Gläubigen auf das Jenseits vorzubereiten, sondern sie im Diesseits gesund und munter zu halten. Ihre spirituelle Mission war das Heilen, ihre Methode die Zauberei. Sie rieten, zum Beispiel, einem chronisch Kranken dazu, andere Kleidung zu tragen. Andere Farben, andere Muster. Grün statt Blau und Karos statt Streifen, und ein paar Wochen später war er gesund. Oder sie schnappten sich sein Herz mit Trommeln. Schlugen sie zunächst, wie sein Herz schlug, und wenn Herz und Trommeln eins geworden waren, veränderten sie langsam, ganz langsam den Rhythmus. Damit brachten sie die hyperaktiven Zentralorgane runter, die phlegmatischen hoch und die stockenden in Fluss. Und eine dritte Lieblingsmedizin der zentralasiatischen Schamanen waren Geschichten, deren Zauberei darin bestand, den Kranken auf andere Gedanken zu bringen oder gewohnte Gedanken auf andere Bahnen. Ganze Gedankenkarawanen wurden umgeleitet und zu neuen Ufern gebracht.
Erkenntnis befreit, und Befreiung heilt. Und wer Endi Effendi kannte, weiß, dass er jetzt nicht mehr so einfach zu stoppen war, denn mit der Völkerwanderung der Turkstämme wanderten auch die schamanischen Geschichten von Zentral- nach Vorderasien, wo sich die Mystiker des Islam ihrer annahmen. Sie nannten sich Sufis, und die Schamanen hießen jetzt Derwische, und weil viele von ihnen hauptberuflich auch Märchenerzähler waren, schien Endi Effendi der Gedanke nicht abwegig, dass es sich auch bei Fehim Bey nicht um einen verlausten Märchenonkel handelte, sondern um einen Heiler, der seine Geschichten wie Gedankenschrittmacher in die Gehirnwindungen seiner Zuhörer einpflanzte, oder sollte man sagen, wie Traumschrittmacher? Darüber hinaus erfüllte er natürlich auch alle anderen Aufgaben, die der Beruf eines türkischen Geschichtenerzählers verlangte:
1. wachhalten
2. unterhalten
3. unterrichten
4. berichten
Zu 1.: Die Wächter der Karawanen durften nicht einschlafen. Für diese Klientel gab es extralange Geschichten, zum Beispiel die »Perlenkarawane«.
Zu 2.: Erklärt sich eigentlich aus 1.
Zu 3.: Kinder wie Erwachsene bedurften hin und wieder des Unterrichts in der Schule des Lebens. Religionsunterricht, Sozialkunde, Eheberatung, Orientknigge – die Märchen deckten alles ab.
Zu 4.: Die Märchen der Osmanen stammten aus allen Teilen ihres Reichs, und das war zwar nicht ganz so groß wie die Welt, aber seine Grenzen verliefen immerhin durch drei Kontinente. So erfuhr das Publikum im Kaukasus und in Kleinasien, wie es in Nordafrika aussah, und an den milden Gestaden der Levante hörte man Geschichten aus Südosteuropa.
Man könne all das auch kürzer sagen, meinte ausgerechnet Endi Effendi: Die alten türkischen Märchen waren das Kino der Nomaden, und aufgeführt wurde es jeden Abend in den Karawansereien. Die Herbergen des osmanischen Fernverkehrs hatten Mauern wie Burgen und hohe Tore für die Kamele, und drinnen fand der müde Nomade alles, was er begehrte: Ställe für die Tiere, Schlafräume, Gastronomie. Es gab Schuster, Ärzte und Barbiere, und es gab keinen Streit. Das war Punkt 1 der Hausordnung: Feinde müssen nicht Freunde werden, aber sie dürfen nicht aufeinander losgehen, solange sie den Schutz der Karawanserei genießen, und tun sie es doch, fliegen beide raus.
Die Märchenerzähler hatten in den Karawansereien ihre eigenen Feuer und eigenen Gesetze, aber ihre Strafen fielen ähnlich aus. Wer die Geschichten eines anderen erzählte, machte sich des Märchendiebstahls schuldig. Das führte zum Ausschluss aus der Gilde und beinhaltete das Erzählverbot in der Karawanserei. De facto kam das einem Berufsverbot gleich, denn die Karawansereien waren nun mal ihr traditioneller Arbeitsplatz. Außerdem war es verboten, die Geschichten aufzuschreiben, und ein drittes Gesetz der alttürkischen Märchenerzählergilde lautete, dass Anfang, Mitte und Ende der Geschichten niemals verändert werden durften, aber dazwischen konnte jeder so viel spinnen, wie er wollte.
Die ersten beiden Gesetze schützten die Rechte und das Überleben der Erzähler, das dritte schützte die Märchen, und nun müsse man, frohlockte Endi Effendi, doch noch mal auf das erste Gebot zurückkommen. Jeder erzählte nur seine Geschichten, und dass es seine waren, bewies ein Ring, der den Träger für sein Repertoire autorisierte. In der Regel wurde er von Vater zu Sohn weitergegeben. Aber Fehim Bey hatte keine Söhne, darum gab er den Ring an seinen besten Schüler weiter, der eine als Mann verkleidete deutsche Baronin war, aber wenn ihr mich fragt, so Endi Effendi, hat er ihre Verkleidung durchschaut. Sie begleitete Fehim Bey jahrelang, und große Erzähler sind große Menschenkenner.
Wollte Endi Effendi damit andeuten, dass die beiden gepoppt haben? Natürlich nicht. Wir saßen in Chris’ Küche, und das war die Küche, in der auch unsere Märchenerzählerin lange Jahre gesessen hatte, deshalb behandelte der Vortragende das Thema weiter mit Respekt. Endi Effendi vermutete eher eine versteckte platonische Liebesgeschichte, denn Fehim Bey war zwar in dem richtigen Alter für junge Mädchen, aber nicht in der richtigen gesellschaftlichen Position. Ihm wurde die Verkleidete als Spross einer mächtigen Familie aus Istanbul vorgestellt, und davon lässt man die Finger, im Märchen wie in der Realität, und was Elsas Potenzial für romantische Gefühle zu älteren Herren anging, wies Endi Effendi darauf hin, dass ein Altersunterschied von schätzungsweise dreißig Jahren keine Rolle für eine unter Zwanzigjährige spielt, wenn der Mann gut erzählen kann.
Endi Effendi schlug deshalb vor, dass Omar Sharif die Rolle von Fehim Bey kriegte, und wir nickten das ab, denn Omar Sharif machte an allen Feuern eine gute Figur, und Omar Sharif würde auch wissen, wie man mit einem Blick und einem Lächeln von der unerfüllten Liebe zu einer verkleideten Frau erzählen konnte.
Die Nebenrollen waren also flugs besetzt, die Arbeit ging voran, nur für die Hauptrolle fiel uns nicht sofort jemand ein, denn sie führte durch sämtliche Jahreszeiten eines Lebens und musste vierfach besetzt sein, als Kind, Mädchen, Frau und alte Schachtel, und weil das jetzt einfach zu viel verlangt war, verschoben wir die Besetzung der Hauptrolle auf den nächsten Tag, und am nächsten Tag vergaßen wir sie oder stuften ihre Priorität anders ein, denn Endi Effendi wollte nun über orientalische Ornamentik referieren, weil die Türken bekanntlich ihre Märchen wie ihre Teppiche weben, und Chris wollte bis zum Mittagessen die erste Szene geschrieben haben, und weil ich seinen Vorschlag entspannender fand, als Professor Endi Effendi Paschas Strickanleitung für fliegende Teppiche zu lauschen, stimmte ich Chris zu, und der Ärger begann. Jeder der drei Brüder sah einen anderen Anfang. Auf den auch leider jeder der drei Brüder bestand.
Die drei Anfänge
Mein Anfang:
»Europa, 1942«.
Kriegspanorama im Novemberwetter. Es regnet, es dunkelt, der Horizont glüht, dumpfe Detonationen einschlagender Granaten ersetzen die Musik. Ein Kübelwagen quält sich über einen Feldweg zur Etappe. Ein sympathischer Offizier (Armin Mueller-Stahl) lenkt ihn. Er raucht, er flucht, der Weg ist schwer. Scheinwerferkegel hüpfen über Querrillen, Schlaglöcher, Schlamm und Pfützen. Ein Dorf taucht auf. Zerschossene Häuser, rauchende Ruinen, dazwischen dampfende Gulaschkanonen. Landser laufen herum oder sitzen auf Holzblöcken und tun, was Landser tun, wenn sie sich ausruhen. Essen, Karten spielen, Waffen reinigen. Militärlastwagen stehen zwischen den Häusern, zwei, drei Schützenpanzer, ein Motorrad, ein paar Munitionstransporter.
Armin Mueller-Stahl stellt den Wagen ab und geht über den Dorfplatz auf ein Haus zu, dessen Frontseite zum größten Teil weggeschossen ist. Hier arbeitet der Bataillonsstab. Posten stehen davor und salutieren. Im Haus sind ein Funker, ein Melder, und hinter einer Kiste, die ihm als Schreibtisch dient, sitzt der Adjutant des Kommandeurs. Petroleumlampen beleuchten die Szene. Im Zimmer nebenan wird laut telefoniert.
Armin Mueller-Stahl salutiert vor dem Adjutanten, der, über seine Kiste gebeugt, Zahlenkolonnen studiert. Er sieht kurz auf.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
»Hauptmann Stahl, von der Truppenbetreuung der 1. Grenadierdivision. Ich habe den Auftrag, Frau von Kamphoevener abzuholen. Wo finde ich sie?«
Der Adjutant lässt seine Zahlenkolonnen liegen, er schaut jetzt interessiert.
»Die Märchentante? Sie wird im Lazarett sein. Eine Schande, dass sie weitermuss. Die Frau ist fast so gut wie Morphium.«
Das Feldlazarett ist in der Schule untergebracht. Die ist auch ganz schön zerschossen. Armin Mueller-Stahl grüßt im Gang eine Krankenschwester, öffnet eine Tür und betritt ein großes ehemaliges Klassenzimmer. Die Fenster haben keine Scheiben, Segelplanen verdecken sie, auch die Löcher in den Wänden und das große Loch im Dach sind mit Planen so gut wie möglich dicht gemacht. Die Planen schlagen im Wind. Licht flackert aus Petroleumlampen, ein paar Kerzen brennen. Die Verwundeten liegen auf Feldbetten oder haben sich auf die Seite gedreht, einige hocken auf den Liegen und rauchen. Alle sind still und hören der Frau zu, die in der Mitte des Raums auf einer leeren Munitionskiste sitzt. Sie ist Anfang sechzig und trägt einen schweren, langen Mantel der Wehrmacht. Ihre Stimme ist warm und tief. Armin Mueller-Stahl lehnt sich neben der Tür an die Wand und hört wie die anderen im Raum der Märchenstimme zu, die das entfernte Stakkato der Maschinengewehre und die ewigen Detonationen mühelos verdrängt. Aber es ist nicht nur ihre Stimme, diese Frau kann mit den Augen Frage- und Ausrufezeichen setzen, mit ihren Händen Sandstürme bewegen und jedes Gesicht der Geschichte auf ihr eigenes legen, sogar die Gesichter der Kamele.
Sie erzählt von einer Karawane mit grünen, blauen, roten und gelben Satteltaschen. Die Farben repräsentieren die Edelsteine, die in den Taschen sind. Aber die Karawane transportiert auch Unmengen von Perlen. Sie wurden an Seidenschnüren aufgezogen, und wenn sich eine der Satteltaschen durch das ewige Gewoge öffnet, geben sie die Perlenschnüre frei, die dann langsam herabgleiten und sich um die Beine der Kamele wickeln.
Im Publikum ist, wie gesagt, niemand ohne frische Schusswunden. Jede Art von Verwundungen. Kopfverbände, verstümmelte Arme, Beinamputierte, und wir trumpfen mit Nahaufnahmen von den Bedauernswerten, die alle trotz ihrer Leiden schöne Augen haben. Ein Glanz liegt auf ihnen, wie ein Vorhang zwischen den Welten. Öllampen flackern, das Flackern wird diffuser, bis es nur noch jenes Flimmern ist, das die Hitze der Wüste in der Luft kreiert, und durch das Flimmern leicht transzendiert, kommt uns die Perlenkarawane entgegen.
MUSIK:
Flöten, Trommeln, türkische Laute.
TITEL:
»Kamerad Märchen«.
Die Credits fließen ein, Sean Connery, Omar Sharif, Anthony Quinn, Armin Mueller-Stahl, und wenn der Name der Schauspielerin an der Reihe ist, die unsere Märchenerzählerin mit sechzig spielt, kommen wir zurück in den Krieg und zurück zu ihrem Gesicht, jetzt aber nicht im Lazarett, sondern im Kübelwagen. Armin Mueller-Stahl bringt sie zu ihrem nächsten Job. Wieder Regen, Geschützfeuer und stürmende Wolken, wieder Schlamm, Querrillen und entgegenkommende Militärfahrzeuge, wieder Flüche und Zigaretten. Die Märchenerzählerin raucht mit, und natürlich will Armin Mueller-Stahl von ihr wissen, warum sie deutschen Landsern türkische Märchen erzählt und warum sie das so gut kann und wo sie es gelernt hat und von wem, und die Märchenerzählerin sagt: »Das ist aber eine lange Geschichte, Herr Hauptmann.«
Und Armin Mueller-Stahl antwortet: »Keine Sorge, Frau Baronin. Wir haben die ganze Nacht.«
Endi Effendis Anfang:
»Istanbul, 1888«.
»Wisst ihr, wie der Sultan des Osmanischen Reiches seine Palastgärten zu beleuchten pflegte, wenn er ein Fest gab?«
Die Märchenerzählerin spricht. Man sieht sie nicht. Man hört nur ihre warme, tiefe Stimme.
»Er ließ auf den Panzern von 2000 Schildkröten Kerzenlämpchen anbringen. Langsamer hat sich Licht nie bewegt.«
Vorhang auf. Eine leuchtende Schildkröte schleicht an diamantenbesetzten Türkenpuschen und golddurchwirkten Beinkleidern vorbei. Und schon ist da noch eine schleichende Lichtkröte zu sehen, auch mal zwei, drei und vier oder unterwegs als Fünfergruppe, und bei denen ist es heller. Die Schildkröten sind die Bodenbeleuchtung, den Luftraum ab 1,70Meter beherrschen wie Stehlampen positionierte Feuerspucker und eine Sonderzüchtung Glühwürmchen.
Die Schildkröten und die Feuerspucker sind historisch belegt, die dressierten Glühwürmchen filmische Freiheit, und die Tiger, Affen, Elefanten, Riesenschlangen und Giraffen, die hinter ihren Gittern zum Teil brüllend mitfeiern, zeigen schon wieder die Realität von Tausendundeiner Nacht Ende des 19.Jahrhunderts in Istanbul. Wie jeder Mensch, der Menschen misstraut, liebte Sultan Abdülhamid II. die Unschuld und Wahrhaftigkeit der Tiere, deshalb schenkten ihm die Abgesandten der Maharadschas und Mogule gern das Wildeste ihrer Welten für den Privatzoo in seinen Palastgärten, und was das Gästeprofil seiner Feste betrifft: Hier tut man einfach so, als wäre seit dem 16.Jahrhundert nichts geschehen und das Osmanische Reich noch immer ein prachtvoller Vielvölkerstaat mit aller Art Nasen, Hautfarben und Hutmoden. Albanische Herzöge, bulgarische Khans, russische Fürsten, arabische Scheichs, ägyptische Prinzen, die Bosse der Berber, der Adel der Levante, die Könige aus dem Jemen und dem Sudan und natürlich die Wesire und Großwesire, die Marschälle und Janitscharengeneräle, die Paschas und Beys unserer türkischen Gastgeber mischen sich zu einer großosmanischen Turban-Party, in der sich die Botschafter Frankreichs und Englands wie grinsende Krokodile bewegen.
»Wer die größten Turbane trägt, hatte mal die größte Macht«, sagt der grinsende britische Diplomat und verzichtet darauf, das »mal« zu betonen, denn er weiß um die intellektuellen Fähigkeiten seines Kollegen. »Da haben Sie recht, Mylord«, antwortet der Franzose, »und was halten Sie davon, den Bau der Bagdadbahn ein bisschen zu sabotieren? Außerdem würde ich gern ihr Beleuchtungssystem exportieren. Das müsste doch auch mit kleinen Schildkröten und kleinen Kerzen gehen. Mein Frau wäre hingerissen von der Idee.«
Schnitt. Wir sehen das Pariser Schlafzimmer des französischen Gesandten, durch das 24 kleine Schildkröten mit kleinen Kerzen schleichen, während seine Frau mit dem Gärtner fickt. Dass es seine Frau ist, machen wir durch Untertitel klar, und sie schreit wirklich hingerissen: »Jaaaaaaaaaaaaaaa …«
Schnitt zurück. Wir sind wieder auf der Party am Bosporus, aber der Schrei der Französin im fernen Paris hallt noch immer zu uns herüber, und das passt auch ganz gut zu den türkischen Trommeln, die nun immer lauter werden, und den Derwischen, die sich immer schneller um ihre eigene Achse drehen, und den Bauchtänzerinnen, Schwertschluckern und Salto mortale schlagenden Pluderhosenartisten, und just, als zwei Fußsohlen nach einem Dreifachsalto wieder auf den Boden treffen, finden wir auch die Riesenschildkröte vom Anfang wieder. Nun könnte man einwenden, dass zwar in den Augen einer Riesenschildkröte keine Riesenschildkröte wie die andere aussieht, aber für menschliche Augen besteht da kaum ein Unterschied, und weil das stimmt, trägt unsere Riesenschildkröte kein blaues Öllämpchen wie die anderen, sondern ein rotes auf ihrem Panzer, und wir folgen der schleichenden Bodenlampe, weil sie uns nunmehr direkt zu Sean Connery und seinem reizenden Töchterchen führt, damit die Geschichte beginnen und endlich der Titel eingeblendet werden kann:
»Die Märchenerzählerin«.
Chris’ Anfang:
»Bayern, 1945«.
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Monaten zu Ende. Die Österreicher deportieren Deutsche aus ihrem Land. Sie bringen sie zur Grenze und lassen sie laufen, egal wohin.
Ende der Leseprobe