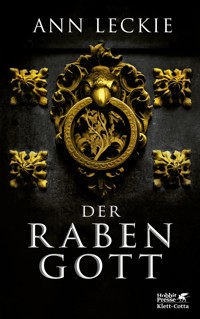11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Maschinen - Universum
- Sprache: Deutsch
Was wird aus den Menschen, wenn die Maschinen frei sein wollen?
Breq ist eine Kämpferin, die auf einem einsamen Planeten auf Rache sinnt. Hinter ihrer verletzlichen, menschlichen Fassade verbirgt sich mehr, als es zunächst den Anschein hat: Sie wurde von den Radch geschaffen, die nach und nach das gesamte Universum unterworfen haben. Breq ist nur dem Äußeren nach eine Frau, vor allem aber ist sie ist eine perfekt konstruierte Maschine, abgerichtet zum Erobern und Töten. Nun aber beschließt sie das Unmögliche: Ganz allein will sie es mit Anaander Mianaai aufnehmen, dem unbesiegbaren Herrscher der Radch. Denn Breq will endlich frei sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Breq ist eine Kämpferin, die auf einem einsamen Planeten auf Rache sinnt. Hinter ihrer verletzlichen, menschlichen Fassade verbirgt sich allerdings mehr, als es zunächst den Anschein hat: Breq ist gar keine menschliche Frau, sondern die letzte lebende Verkörperung der Künstlichen Intelligenz eines Militärraumschiffs. Normalerweise hat jede KI viele Hundert Körper als Hilfseinheiten zur Verfügung, mit denen das Raumschiff die Eroberungsfeldzüge der Radchaai, einer sich aggressiv in der Galaxis ausbreitenden Zivilisation, durchgeführt hat. Aber Breqs Schiff wurde zerstört, und ihr Körper ist das letzte Überbleibsel einer perfekt konstruierten Maschine, abgerichtet zum Erobern und Töten. Doch damit will sich Breq nicht abfinden, und so beschließt sie das Unmögliche: Ganz allein will sie es mit Anaander Mianaai aufnehmen, dem unbesiegbaren Herrscher der Radch – Anaander Mianaai, der seit Tausenden von Jahren unerbittlich die Herrschaft in der Hand hält und seine Befehle in Gestalt von vielen Tausend Körpern durchsetzt. Aber Breq gibt nicht auf, denn Breq will endlich frei sein …
»Ann Leckie hat eine Welt erschaffen, die die Leser so schnell nicht vergessen werden!« Publishers Weekly
Die Autorin
Ann Leckie, 1966 in Ohio geboren, hat bereits mehrere Kurzgeschichten in amerikanischen Fantasy- und Science-Fiction-Magazinen veröffentlicht, bevor sie sich mit Die Maschinen an ihren ersten Roman wagte und damit einen großen internationalen Erfolg landete. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in St. Louis, Missouri.
ANN LECKIE
DIEMASCHINEN
EIN ROMAN AUS DER FERNEN ZUKUNFT
Aus dem Amerikanischenvon Bernhard Kempen
Mit einer Vorbemerkung des Übersetzersund einem Interview mit der Autorin
Deutsche Erstausgabe
Titel der amerikanischen Originalausgabe
ANCILLARY JUSTICE
Deutsche Erstausgabe 03/2015
Redaktion: Birgit Herden
Copyright © 2013 by Ann Leckie
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Billy Nunez
Umschlaggestaltung: Stardust, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-14564-4
www.diezukunft.de
Für meine Eltern,
Mary P. und David N. Dietzler,
die dieses Buch nicht mehr erlebt,
aber immer daran geglaubt haben
Vorbemerkung des Übersetzers
Sehr geehrte Leser dieses Buches!
Sind Sie der Ansicht, dass ich Sie mit dieser Anrede korrekt angesprochen habe? Oder fühlen Sie sich ausgeschlossen, weil Sie weiblichen Geschlechts sind und finden, dass ich mich nicht nur an die Leser, sondern auch an die Leserinnen dieses Buches hätte wenden sollen? Diese Frage wird im Zuge des Gender-Mainstreaming und der Bemühungen zur Gleichstellung seit Jahren zum Teil leidenschaftlich debattiert.
Sprachwissenschaftler argumentieren, die Form »Leser« sei ein generisches Maskulinum. Das heißt, die Endung »-er« bezeichnet lediglich den Genus, also das grammatikalische Geschlecht, das nicht zwangsläufig mit dem Sexus, dem biologischen Geschlecht, identisch sein muss. Wenn die »Leser« angesprochen werden, ist das lediglich die sprachliche Grundform dieses Wortes, die selbstverständlich beide biologische Geschlechter einschließt.
Von feministischer Seite wird dagegen der Einwand vorgebracht, dass wir mit dem grammatikalischen Geschlecht natürlich auch das biologische assoziieren. Wenn von einem Arzt die Rede ist, denken wir automatisch an einen männlichen Mediziner und vergessen dabei, dass es ja auch Ärztinnen gibt. Das Problem mit dem generischen Maskulinum ist also, dass das Männliche als Norm und das Weibliche sozusagen nur als Ausnahme gekennzeichnet wird.
Politisch korrekt wäre es insofern, von »Lesern und Leserinnen« oder, um dem bislang benachteiligten Geschlecht entgegenzukommen, von »Leserinnen und Lesern« zu sprechen. Ein anderer Ansatz bemüht sich, nach Möglichkeit ganz auf geschlechtlich markierte Formen zu verzichten und sich stattdessen an die »Lesenden« zu wenden. Was jedoch bedeuten würde, dass man beispielsweise für den »Arzt« eine ganz neue Bezeichnung finden müsste.
Im Frühjahr 2013 wurde an der Universität Leipzig beschlossen, in allen offiziellen Texten das generische Femininum zu benutzen. Das heißt, dass von nun an nur noch von »Studentinnen« und »Professorinnen« die Rede ist, wobei selbstverständlich auch alle Personen männlichen Geschlechts mitgemeint sind. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich diese Regelung allgemein durchsetzen wird, aber es handelt sich zweifellos um einen zum Nachdenken anregenden Beitrag zur Debatte. Wie fühlt es sich für die Männer an, wenn sie aufgrund ihres Geschlechts erst an nachfolgender Stelle oder gar als »Sonderfall« genannt werden?
Genau dieses Szenario spielt Ann Leckies mehrfach preisgekrönter Roman Die Maschinen durch, das Buch, das Sie, sehr geehrte Leserinnen (und Leser), in den Händen halten. Das Besondere daran ist, dass dieser Umstand in weit größerem Ausmaß auf die deutsche Übersetzung zutrifft, als es beim englischen Original der Fall ist.
Die Ich-Erzählerin entstammt einer Kultur, in der geschlechtliche Unterschiede so gut wie keine Rolle spielen. Ihre Muttersprache, das Radchaai, kennt überhaupt keine Genus-Markierungen, was die Autorin zum Anlass genommen hat, im englischen Original als generische Form ausschließlich weibliche Pronomen zu verwenden. Doch gelegentlich kommuniziert Breq mit Vertretern anderer Kulturen, die sprachlich zwischen weiblichen und männlichen Personen unterscheiden. Und dann steht sie vor der schwierigen Frage, welche Genusformen sie benutzen soll. Denn in ihrem Fall kommt erschwerend hinzu, dass sie das Geschlecht fremder Personen oft nicht auf den ersten Blick eindeutig zuordnen kann. Und wenn sie eine fremde Sprache benutzt, fällt es ihr sichtlich schwer, für einen Mann das Pronomen »he« zu verwenden.
Nachdem ich die ersten paar Seiten dieses Buches übersetzt hatte, wurde mir schnell klar, dass ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe. Im Original wird zum Beispiel für Lieutenant Awn durchgängig das Pronomen »she« verwendet, was sich natürlich problemlos mit »sie« übersetzen lässt. Aber was ist, wenn von »the lieutenant« die Rede ist? Im Englischen sind Formen wie »the lieutenant« oder »the doctor« (ähnlich wie im Radchaai) geschlechtlich unmarkiert. Doch im Deutschen muss ich mich zwischen einem männlichen oder weiblichen Artikel und einem »Arzt« oder einer »Ärztin« entscheiden. Wenn ich »der Leutnant« schreiben würde, wäre die Sache eindeutig männlich markiert. Damit es zum »sie« passt, muss ich konsequenterweise von »der Leutnantin« sprechen. Und logischerweise auch von »Ärztinnen«. Selbst aus einem »visitor« oder »friend« muss ich im Deutschen konsequent eine »Besucherin« und eine »Freundin« machen.
Damit ist die deutsche Übersetzung des Romans Ancillary Justice der amerikanischen Autorin Ann Leckie offenbar der erste literarische Text in Romanlänge, der konsequent im generischen Femininum geschrieben ist. Zumindest konnte ich bei einer schnellen Recherche keine Hinweise finden, dass so etwas schon einmal gemacht wurde.
Konsequent, aber nicht durchgängig, möchte ich hinzufügen. Falls Sie beim Lesen über die Gespräche mit Denz Ay und Arilesperas Strigan stolpern, denken Sie bitte daran, dass diese Dialoge eben nicht auf Radchaai geführt werden.
Und die Verwendung des generischen Femininums wirkt sich auf viele andere Kleinigkeiten aus, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Wundern Sie sich, wenn von »den Presger« die Rede ist? Fehlt da am Ende nicht ein »n«? So könnte man argumentieren, aber dann müsste man noch einen Schritt weitergehen und von »Presgerinnen« sprechen. Nein, in diesem Fall ist das »-er« keineswegs eine deutsche männliche Endung, sondern etwas ganz anderes.
Eine wichtige Figur des Romans ist »the Lord of the Radch«, im Englischen mit dem Pronomen »she« beschrieben. Ein Widerspruch? Welches Geschlecht hat »sie« denn nun wirklich? Keine Sorge, ich verrate es hier nicht. In der Übersetzung habe ich »die Herrin der Radch« daraus gemacht, weil ich finde, dass »die Herrin« – ein männliches Grundwort mit weiblicher Endung – das uneindeutige englische Begriffspaar »Lord«/»she« ziemlich gut wiedergibt.
Meine schwierige Entscheidung hatte zur Folge, dass die deutsche Ausgabe dieses Romans ein bis zwei Schritte weiter als die englische Originalausgabe geht. Denn im Deutschen lässt sich die Grundidee wirklich nicht anders umsetzen, es sei denn, ich hätte Formen wie »die Besuchenden« oder gar »die Leutnant« verwendet, die die Lesbarkeit des Textes nicht unbedingt verbessern würden. Es war keine leichte Aufgabe, das generische Femininum so konsequent wie möglich durchzuhalten, aber nach einer Weile war ich selbst erstaunt, wie schnell man sich daran gewöhnt. Für mich war es unter anderem auch ein hochinteressantes literarisches Experiment. Und genau das ist es ja, was richtig gute Science-Fiction ausmacht. Aber urteilen Sie selbst …
Bernhard Kempen
DIE MASCHINEN
1
Der Körper lag nackt mit dem Gesicht nach unten im Schnee, leichengrau, umgeben von Blutspritzern. Es war minus fünfzehn Grad Celsius, und nur wenige Stunden zuvor war ein Sturm vorbeigezogen. Der Schnee breitete sich glatt im fahlen Licht der aufgehenden Sonne aus, nur vereinzelte Spuren führten zu einem nahegelegenen Gebäude aus Eisblöcken. Ein Gasthaus. Oder was in dieser Stadt als Gasthaus galt.
Der ausgestreckte Arm und die Linie von der Schulter bis zur Hüfte kamen mir irritierend vertraut vor. Aber es war kaum möglich, dass ich diese Person kannte. Ich kannte hier niemanden. Das vereiste hintere Ende auf einem kalten und abgelegenen Planeten war so weit von radchaaianischen Vorstellungen von Zivilisation entfernt, wie es nur sein konnte. Ich befand mich lediglich wegen einer dringenden persönlichen Angelegenheit in dieser Stadt auf diesem Planeten. Für auf der Straße liegende Körper war ich nicht zuständig.
Manchmal weiß ich nicht, warum ich etwas tue. Selbst nach so langer Zeit ist es immer noch neu für mich, das nicht zu wissen, nicht mehr von einem Moment auf den anderen den nächsten Befehl befolgen zu müssen. Deshalb kann ich nicht erklären, warum ich stehen blieb und mit dem Fuß die nackte Schulter anhob, um das Gesicht dieser Person zu betrachten.
Obwohl sie halb erfroren, verletzt und blutig war, erkannte ich sie. Ihr Name war Seivarden Vendaai, und sie war vor langer Zeit als junge Leutnantin eine meiner Offizierinnen gewesen, bis sie später befördert wurde, das Kommando über ein eigenes Schiff erhielt. Ich hatte gedacht, sie wäre schon vor tausend Jahren gestorben, aber nun lag sie unbestreitbar hier. Ich ging in die Hocke, tastete nach ihrem Puls, suchte nach Anzeichen, ob sie atmete.
Sie lebte noch.
Mit Seivarden Vendaai hatte ich nichts mehr zu tun, ich war nicht für sie verantwortlich. Und sie war auch nie eine meiner bevorzugten Offizierinnen gewesen. Natürlich hatte ich ihre Befehle befolgt, und sie hatte ihre Hilfseinheiten niemals schlecht behandelt, meinen Segmenten niemals Schaden zugefügt (wie es Offizierinnen gelegentlich taten). Ich hatte keinen Grund, schlecht über sie zu denken. Im Gegenteil, sie hatte die Manieren einer gut erzogenen, gebildeten Person aus guter Familie. Mir gegenüber natürlich nicht – denn ich war ja keine Person, ich war ein Teil der Ausrüstung, ein Bestandteil des Raumschiffs. Aber sie war mir nie besonders sympathisch gewesen.
Ich stand auf und ging in das Gasthaus. Drinnen war es dunkel, das Weiß der Wände aus Eis war schon seit Langem mit Ruß und Schlimmerem bedeckt. Die Luft roch nach Alkohol und Erbrochenem. Die Wirtin stand hinter einer hohen Theke. Sie war eine Eingeborene – klein und feist, blass und mit großen Augen. Drei Stammgäste flegelten sich auf den Stühlen um einen dreckigen Tisch. Trotz der Kälte trugen sie nur Hosen und wattierte Hemden – auf dieser Hemisphäre von Nilt war es Frühling, und sie genossen die kurze warme Phase. Sie taten so, als würden sie mich nicht sehen, obwohl sie mich sicher auf der Straße bemerkt hatten und wussten, warum ich hereingekommen war. Wahrscheinlich war die eine oder andere sogar involviert, denn Seivarden hatte noch nicht lange da draußen gelegen, weil sie sonst längst tot gewesen wäre.
»Ich möchte einen Schlitten mieten«, sagte ich, »und ein Hypothermie-Kit kaufen.«
Hinter mir schmunzelte eine der Stammkundinnen und sagte spöttisch: »Was bist du doch für ein tapferes kleines Mädchen!«
Ich wandte mich ihr zu, um ihr Gesicht zu mustern. Sie war größer als die meisten Nilter, aber genauso dick und blass wie alle. Sie hatte mehr Muskelmasse als ich, obwohl ich größer und erheblich stärker war, als ich wirkte. Ihr war nicht bewusst, mit wem sie sich anlegte. Nach dem eckigen Labyrinth-Muster zu urteilen, in dem ihr Hemd abgesteppt war, war sie vermutlich männlich. Ganz sicher war ich mir nicht. Innerhalb des Radch-Territoriums wäre es egal gewesen. Die Radchaai scherten sich wenig um das Geschlecht, und in ihrer Sprache – meiner Muttersprache – wird das Geschlecht in keiner Weise markiert. In der Sprache, in der wir jetzt redeten, hingegen schon, und ich konnte mich in Schwierigkeiten bringen, wenn ich die falschen Formen benutzte. Es war auch nicht gerade hilfreich, dass die Hinweise zur Unterscheidung der Geschlechter von Ort zu Ort manchmal radikal verschieden und mir meistens unverständlich waren.
Ich beschloss, nichts zu sagen. Ein paar Sekunden später interessierte sie sich plötzlich mehr für etwas in der Tischplatte. Ich hätte sie ohne allzu viel Mühe umbringen können. Ich fand den Gedanken verlockend. Aber im Moment war Seivarden meine höchste Priorität. Ich wandte mich wieder der Wirtin zu.
Sie stand lässig da und sagte, als hätte es keine Unterbrechung gegeben: »Was glauben Sie, wo wir hier sind?«
»An einem Ort«, sagte ich, immer noch auf linguistisch ungefährlichem Terrain, wo keine Geschlechtsformen notwendig waren, »wo man mir einen Schlitten vermieten und ein Hypothermie-Kit verkaufen wird. Wie viel kostet das?«
»Zweihundert Shen.« Das war bestimmt doppelt so viel wie der übliche Preis. »Für den Schlitten. Hinter dem Haus. Den müssen Sie sich selber holen. Noch ein Hunderter für das Kit.«
»Vollständig«, sagte ich. »Unbenutzt.«
Sie zog eins unter der Theke hervor, und das Siegel sah unbeschädigt aus. »Ihr Kumpel hat seine Rechnung noch nicht bezahlt.«
Vielleicht war das gelogen. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer, der Preis konnte nur frei erfunden sein. »Wie viel?«
»Dreihundertfünfzig.«
Ich konnte versuchen, mich weiterhin nicht auf das Geschlecht der Wirtin zu beziehen. Oder ich könnte es erraten. Die Chancen standen schlimmstenfalls fünfzig zu fünfzig. »Sie sind sehr gutgläubig«, sagte ich und entschied mich für die männliche Form, »wenn Sie einen Mittellosen« – ich wusste, dass Seivarden männlich war, also war das einfach – »so hohe Schulden machen lassen.« Die Wirtin sagte nichts. »Sechshundertfünfzig für alles zusammen?«
»Ja«, sagte die Wirtin. »So ziemlich.«
»Nein, alles. Wir einigen uns jetzt. Und wer danach noch mehr von mir verlangt oder versuchen sollte, mich auszurauben, wird sterben.«
Stille. Dann hinter mir das Geräusch von einer Person, die ausspuckte. »Radchaai-Abschaum.«
»Ich bin keine Radchaai.« Was stimmte. Nur Menschen konnten Radchaai sein.
»Der schon«, sagte die Wirtin mit einem leichten Schulterzucken zur Tür. »Sie haben zwar nicht den Akzent, aber Sie stinken wie ein Radchaai.«
»Das ist der Fusel, den Sie Ihren Gästen servieren.« Gejohle von den Stammgästen hinter mir. Ich griff in eine Tasche, zog eine Handvoll Scheine heraus und warf sie auf die Theke. »Behalten Sie den Rest.« Ich wandte mich zum Gehen.
»Ihr Geld ist hoffentlich echt.«
»Ihr Schlitten ist hoffentlich dort, wo Sie gesagt haben.« Dann ging ich.
Zuerst das Hypothermie-Kit. Ich drehte Seivarden um. Dann riss ich die Versiegelung des Kits auf, brach eine Tablette von der Karte ab und schob sie ihr in den blutigen, halb erfrorenen Mund. Sobald die Anzeige auf der Karte grün wurde, wickelte ich die dünne Folie auseinander, prüfte die Ladung, legte sie um sie und schaltete sie ein. Danach ging ich hinter das Gasthaus, um den Schlitten zu holen.
Zum Glück wartete niemand auf mich. Ich wollte jetzt noch keine Leichen hinterlassen, denn ich war nicht hierhergekommen, um Ärger zu machen. Ich zog den Schlitten nach vorn, lud Seivarden auf und überlegte, ob ich meinen Außenmantel ausziehen und sie damit zudecken sollte, aber am Ende entschied ich mich dagegen, da die Hypothermie-Folie eigentlich reichen sollte. Ich startete den Schlitten und fuhr los.
Am Stadtrand mietete ich ein Zimmer, einen von mehreren Zwei-Meter-Würfeln aus schmutzigen graugrünen Plastikfertigteilen. Ohne Bettwäsche, denn Decken kosteten ebenso wie die Heizung extra. Ich bezahlte – ich hatte ohnehin schon eine idiotische Summe darauf verschwendet, Seivarden aus dem Schnee zu holen.
Ich säuberte sie, so gut es ging, vom Blut, überprüfte ihren Puls (immer noch vorhanden) und ihre Temperatur (steigend). Früher hätte ich ihre Kerntemperatur, Herzfrequenz, den Blutsauerstoff und die Hormonwerte gewusst. Allein durch die Kraft meines Willens hätte ich mir jede einzelne Verletzung ansehen können. Jetzt war ich blind. Offensichtlich war sie geschlagen worden – das Gesicht war geschwollen, der Oberkörper voller Prellungen.
Das Hypothermie-Kit war mit einem sehr simplen Korrektiv ausgestattet, aber nur mit einem einzigen, das lediglich zur Ersten Hilfe zu gebrauchen war. Seivarden mochte innere Verletzungen oder ein schweres Schädeltrauma haben, aber ich konnte nur Schnittwunden und Verstauchungen versorgen. Wenn ich Glück hatte, waren die Unterkühlung und die Prellungen das Einzige, worum ich mich kümmern musste. Aber ich kannte mich in der Medizin nicht mehr so aus wie früher. Zu mehr als einer sehr rudimentären Diagnose war ich nicht in der Lage.
Ich schob ihr eine weitere Kapsel in den Rachen. Noch einmal überprüfte ich die Werte – ihre Haut war angesichts der Umstände nicht kälter als erwartet, und sie schien nicht feucht zu sein. Abgesehen von den Prellungen nahm ihre Farbe wieder ein etwas normaleres Braun an. Ich brachte einen Behälter mit Schnee herein, um ihn schmelzen zu lassen, und stellte ihn in eine Ecke, wo sie ihn hoffentlich nicht umwarf, wenn sie aufwachte. Danach ging ich hinaus und schloss die Tür hinter mir ab.
Die Sonne stand nun höher am Himmel, aber das Licht war kaum stärker geworden. Inzwischen waren mehr Fußspuren auf dem gleichmäßigen Schnee zu sehen, den der Sturm der gestrigen Nacht gebracht hatte, und einige Nilter waren unterwegs. Ich zog den Schlitten wieder zum Gasthaus zurück, stellte ihn dahinter ab. Niemand sprach mich an, kein Laut drang aus dem dunklen Türeingang. Ich ging in Richtung Stadtzentrum.
Hier waren Leute unterwegs, gingen ihren Geschäften nach. Dicke blasse Kinder in Hosen und wattierten Hemden bewarfen sich mit Schnee, hielten inne und starrten mich mit großen staunenden Augen an, wenn sie mich bemerkten. Die Erwachsenen taten so, als würde ich nicht existieren, doch im Vorbeigehen verfolgten mich ihre Blicke. Ich ging in einen Laden, trat aus dem, was man hier Tageslicht nannte, in Düsternis und Kälte, die nur fünf Grad wärmer als draußen war.
Mehrere Leute standen herum und redeten, verstummten aber sofort, als ich hereinkam. Mir wurde klar, dass mein Gesicht ausdruckslos war, also richtete ich meine Gesichtsmuskeln so aus, dass ich freundlich und unverbindlich wirkte.
»Was wollen Sie?«, brummte die Ladenbesitzerin.
»Die Leute hier sind doch bestimmt vor mir dran.« Ich hoffte, dass es tatsächlich eine gemischtgeschlechtliche Gruppe war, wie ich in meinen Satz angedeutet hatte. Als Antwort kam nur Schweigen. »Ich hätte gern vier Scheiben Brot und ein dickes Stück Fett. Dazu zwei Hypothermie-Kits und zwei Universalkorrektiva, falls Sie so etwas haben.«
»Ich habe Zehner, Zwanziger und Dreißiger.«
»Dreißiger, bitte.«
Sie stapelte meinen Einkauf auf dem Ladentisch. »Dreihundertfünfundsiebzig.« Hinter mir hustete jemand – man berechnete mir schon wieder zu viel.
Ich bezahlte und ging. Die Kinder lachten immer noch zusammengedrängt auf der Straße. Die Erwachsenen gingen immer noch an mir vorbei, als wäre ich Luft. Ich machte noch einen weiteren Einkauf – Seivarden würde etwas zum Anziehen brauchen. Danach ging ich zum Zimmer zurück.
Seivarden war immer noch bewusstlos, und es gab immer noch keine Hinweise auf einen Schock, soweit ich sehen konnte. Der Schnee im Behälter war fast geschmolzen, und ich legte eine halbe Scheibe vom steinharten Brot hinein, um es aufzuweichen.
Eine Kopfverletzung oder eine Schädigung der inneren Organe waren die größtmöglichen Gefahren. Ich brach die soeben gekauften zwei Korrektiva auf, hob die Decke an, um Seivarden eins auf den Bauch zu legen, schaute zu, wie es zerfloss, sich ausbreitete und dann zu einer durchsichtigen Schale verhärtete. Das andere legte ich ihr seitlich am Gesicht an, wo die Verletzung am schlimmsten zu sein schien. Als es sich verhärtet hatte, zog ich meinen Außenmantel aus, legte mich hin und schlief ein.
Etwas mehr als siebeneinhalb Stunden später regte sich Seivarden, und ich wachte auf. »Sind Sie wach?«, fragte ich. Das von mir angebrachte Korrektiv hielt ein Auge und eine Hälfte des Mundes geschlossen, aber die Prellungen und Schwellungen an ihrem Gesicht waren sichtlich zurückgegangen. Ich überlegte kurz, was der beste Gesichtsausdruck wäre, und nahm ihn an. »Ich habe Sie vor einem Gasthaus im Schnee gefunden. Sie sahen aus, als hätten Sie Hilfe nötig.« Sie atmete leicht krächzend, ohne mir den Kopf zuzuwenden. »Haben Sie Hunger?« Keine Antwort, sie starrte nur ins Leere. »Haben Sie sich am Kopf gestoßen?«
»Nein«, sagte sie leise, das Gesicht entspannt und schlaff.
»Haben Sie Hunger?«
»Nein.«
»Wann haben Sie zuletzt gegessen?«
»Ich weiß nicht.« Ihre Stimme war ruhig und gleichmäßig.
Ich richtete sie auf und lehnte sie behutsam gegen die graugrüne Wand, damit ich nicht noch mehr Verletzungen verursachte, und passte auf, dass sie nicht umkippte. Sie blieb sitzen, also löffelte ich ihr vorsichtig am Korrektiv vorbei langsam etwas Brot-und-Wasser-Brei in den Mund. »Schlucken Sie«, sagte ich, was sie auch tat. Auf diese Weise gab ich ihr die Hälfte von dem, was in der Schüssel war, dann aß ich den Rest und holte noch einen Topf voll Schnee herein.
Sie beobachtete, wie ich wieder eine halbe Scheibe vom harten Brot in den Topf legte, sagte aber nichts, ihr Gesicht immer noch friedlich. »Wie heißen Sie?«, fragte ich. Keine Antwort.
Sie hatte vermutlich Kef genommen. Es hieß immer wieder, Kef würde Gefühle unterdrücken, was zwar stimmte, aber das war noch nicht alles. Früher einmal hätte ich die Wirkung von Kef genau beschreiben können, aber ich bin nicht mehr so, wie ich einmal war.
Soweit ich wusste, nahmen die Leute Kef, um nichts mehr zu fühlen. Oder weil sie glaubten, dass sie ohne Gefühle höchste Vernunft, äußerste Stringenz, wahre Erleuchtung erlangen würden. Aber so funktioniert es nicht.
Seivarden aus dem Schnee zu ziehen hatte mich viel Zeit und Geld gekostet, was ich mir kaum leisten konnte. Und wozu überhaupt? Sich selbst überlassen würde sie sich bald den nächsten Schuss Kef besorgen und den Weg in eine andere schmierige Kneipe finden, um dann wirklich zu Tode zu kommen. Wenn sie es so wollte, hatte ich kein Recht, sie davon abzuhalten. Aber wenn sie tatsächlich sterben wollte, warum hatte sie es dann nicht sauber erledigt, ihre Absicht kundgetan und einen Arzt aufgesucht, so wie es alle taten? Ich verstand es nicht.
Es gab sehr vieles, das ich nicht verstand, und in den neunzehn Jahren, seit ich vorgab, ein Mensch zu sein, hatte ich längst nicht so viel gelernt, wie ich erwartet hatte.
2
Neunzehn Jahre, drei Monate und eine Woche bevor ich Seivarden im Schnee fand, war ich ein Truppentransporter im Orbit um den Planeten Shis’urna. Truppentransporter gehörten mit sechzehn Decks übereinander zu den mächtigsten Schiffen der Radchaai. Kommandobrücke, Verwaltung, Medizinische Abteilung, Hydrokultur, Technik, Zentraler Zugang und ein Deck für jede Dekade, Wohn- und Arbeitsraum für meine Offizierinnen, von denen mir jeder Atemzug und jede Muskelzuckung bekannt waren.
Truppentransporter bewegen sich nur selten. Ich saß fest, wie ich die längste Zeit meiner zweitausendjährigen Existenz im jeweiligen System festgesessen hatte, und spürte die bittere Kälte des Vakuums außerhalb meines Schiffskörpers. Der Planet Shis’urna ähnelte einer blau-weißen gläsernen Empfangshalle, umkreist von einer Raumstation mit einem steten Strom ankommender, an- und abdockender Raumschiffe, die wieder zu einem der mit Leuchtbojen markierten Tore abflogen. Aus meiner Perspektive im Orbit waren die Grenzen der verschiedenen Nationen und Hoheitsgebiete auf Shis’urna nicht zu erkennen, nur auf der Nachtseite des Planeten waren die Städte und Straßennetze dazwischen stellenweise hell erleuchtet, zumindest da, wo sie seit der Annexion wiederhergestellt worden waren.
Ich spürte und hörte – ohne sie immer sehen zu können – die Anwesenheit der anderen Schiffe, der kleineren und schnelleren Schwerter und Gnaden sowie der Gerechtigkeiten, die zu jener Zeit am zahlreichsten waren, allesamt Truppentransporter wie ich. Die ältesten von uns waren fast dreitausend Jahre alt. Wir kannten uns schon sehr lange, und inzwischen gab es unter uns nicht mehr viel zu sagen, was nicht schon oft gesagt worden wäre. Von Routine-Mitteilungen abgesehen herrschte zwischen uns im Großen und Ganzen eher ein kameradschaftliches Schweigen.
Da ich noch über Hilfseinheiten verfügte, konnte ich an mehr als einem Ort gleichzeitig sein. Ich war auch in der Stadt Ors auf dem Planeten Shis’urna unter dem Kommando von Esk-Dekaden-Leutnantin Awn im Einsatz.
Ors lag zur einen Hälfte auf wasserdurchzogenem Gelände, zur anderen in einem sumpfigen See, wobei die Seeseite auf Steinplatten über Fundamenten errichtet worden war, die man tief in den Sumpf getrieben hatte. Grüner Schleim bildete sich in den Kanälen und an den Stellen zwischen den Platten, am unteren Teil von Säulen und an allen festen Objekten, die je nach Jahreszeit höher oder tiefer im Wasser standen. Nur selten verzog sich der allgegenwärtige Gestank nach Schwefelwasserstoff, wenn Sommerstürme die seewärts gelegene Stadthälfte erzittern ließen und die Gehwege knietief unter Wasser setzten, das von jenseits der Barriereinseln hereingeflutet kam. Selten. Gewöhnlich verstärkten die Stürme den Gestank noch. Sie kühlten die Luft vorübergehend ab, aber die Linderung hielt jeweils nur ein paar Tage an. Sonst war es ständig feucht und heiß.
Ich konnte Ors aus dem Orbit nicht sehen. Es war eher ein Dorf als eine Stadt, obwohl es früher an einer Flussmündung gelegen hatte und die Hauptstadt eines Landes gewesen war, das sich die Küste entlangzog. Der Handel blühte dank der Flusswege und der Flachboote, die das an der Küste gelegene Sumpfland ansteuerten und die Leute von einem Ort zum nächsten beförderten. Der Fluss hatte sich über die Jahrhunderte verlagert, und nun bestand Ors zur Hälfte aus Ruinen. Wo sich früher kilometerweit rechteckige Inseln in einem Netz aus Kanälen ausgebreitet hatten, lag jetzt ein viel kleinerer Ort, der von zerbrochenen, halb versunkenen Platten umgeben und durchsetzt war, worauf manchmal Pfeiler und Dächer standen, die in der trockenen Jahreszeit aus dem grünen Schlammwasser ragten. Hier waren früher Millionen zu Hause gewesen. Als Radchaai-Truppen vor fünf Jahren Shis’urna annektierten, lebten hier nur noch 6.318 Personen, und natürlich hatte sich die Zahl durch die Annexion weiter verringert. In Ors weniger als in einigen anderen Orten: Sobald wir eingetroffen waren – ich in Gestalt meiner Esk-Kohorten mit ihren Dekaden-Leutnantinnen, die bewaffnet und gerüstet in den Straßen der Stadt aufmarschiert waren –, hatte sich die Oberpriesterin der Ikkt an die ranghöchste anwesende Offizierin gewandt – Leutnantin Awn, wie schon erwähnt – und die sofortige Kapitulation angeboten. Die Oberpriesterin hatte ihren Anhängerinnen gesagt, wie sie sich zu verhalten hätten, um die Annexion zu überleben, und die meisten Anhängerinnen überlebten tatsächlich. Das war nicht so selbstverständlich, wie man glauben möchte. Wir hatten von Anfang an klargemacht, dass schon die kleinste Störung während der Annexion den Tod bedeuten könnte, und als die Annexion dann begonnen hatte, wurden überall Exempel statuiert, die deutlich machten, was wir damit meinten, denn es gab immer irgendwelche Leute, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, uns auf die Probe zu stellen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!