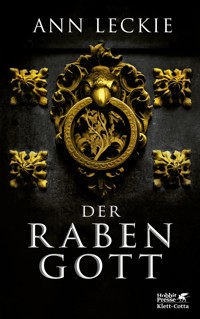11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Maschinen - Universum
- Sprache: Deutsch
Das erfolgreichste Science-Fiction-Epos der Gegenwart
Über Tausende von Sternsystemen erstreckt sich das mächtige Imperium der Radchaai – doch es ist in sich gespalten und steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Breq, die Maschinenintelligenz des interstellaren Kriegsschiffs Gerechtigkeit der Torren, ist die Einzige, die den Zerfall noch aufhalten kann. Das Schiff wurde vor Jahrhunderten vollständig zerstört, und nur Breq, die Maschinenintelligenz im Körper einer Frau, hat überlebt. Nun wird sie von Anaander Mianaai, der totalitären Herrscherin der Radch, formell adoptiert, zur Flottenkapitänin ernannt und ins Athoek-System beordert. Dort haben die Gegner der Herrscherin zwei Tore für den interstellaren Schiffsverkehr zerstört und das System von seiner Versorgung abgeschnitten. Über Jahrtausende hinweg haben die Radch riesige Bereiche der Galaxis annektiert und sich viele Feinde gemacht. Vor allem aber wird das Reich der Radch aus seinem Inneren bedroht, denn seine Herrscherin Anaander Mianaai ist in Tausende von geklonten Körpern gespalten. Jetzt ist ein heimtückischer Kampf zwischen zwei Fraktionen ihrer multiplen Existenz ausgebrochen, der das ganze Imperium bedroht – und es gibt nur eine Person, die Anaander Mianaai mehr fürchtet als sich selbst: Breq …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Über Tausende von Sternsystemen erstreckt sich das mächtige Imperium der Radchaai – aufgebaut auf einer gewaltigen Militäradministration und einer Kultur, in der Geschlechtsunterschiede bedeutungslos sind und man sich nur mit dem Femininum anspricht. Doch es ist in sich gespalten und steht kurz vor einem Bürgerkrieg, denn seine Herrscherin Anaander Mianaai ist in Tausende von geklonten Körpern gespalten. Breq, die Maschinenintelligenz des interstellaren Kriegsschiffs Gerechtigkeit der Torren, ist die Einzige, die den Zerfall noch aufhalten kann. Das Schiff wurde vor Jahrhunderten vollständig zerstört, und nur Breq hat überlebt. Nun wird sie ins Athoek-System beordert. Dort haben die Gegner der Herrscherin zwei Tore für den interstellaren Schiffsverkehr zerstört und das System von seiner Versorgung abgeschnitten. Währenddessen wird das Reich der Radch aus seinem Inneren bedroht. Ein heimtückischer Kampf zwischen zwei Fraktionen von Anaander Mianaais multipler Existenz ist ausgebrochen, der das ganze Imperium bedroht – und es gibt nur eine Person, die Anaander Mianaai mehr fürchtet als sich selbst: Breq …
Ein ausführliches Vorwort des Übersetzers sowie ein Interview mit Ann Leckie finden Sie auf www.diezukunft.de.
Erster Roman: Die Maschinen
Zweiter Roman: Die Mission
Der Autor
Ann Leckie hat bereits mehrere Kurzgeschichten in amerikanischen Fantasy- und Science-Fiction-Magazinen veröffentlicht, bevor sie sich mit Die Maschinen an ihren ersten Roman wagte. Sie wurde für Die Maschinen mit dem Hugo Award und vielen weiteren Preisen ausgezeichnet und von Kritikern und Lesern weltweit gefeiert. Ann Leckie lebt mit ihrer Familie in St. Louis, Missouri.
ANN LECKIE
DIEMISSION
EIN ROMAN AUS DER FERNEN ZUKUNFT
Aus dem Amerikanischenvon Bernhard Kempen
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
ANCILLARY SWORD
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Deutsche Erstausgabe 03/2016
Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2014 by Ann Leckie
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Billy Nunez
Umschlaggestaltung: Stardust, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17114-8V001
www.diezukunft.de
1
»IN ANBETRACHT DER UMSTÄNDE KÖNNTEN Sie eine neue Leutnantin gebrauchen.« Anaander Mianaai, die (derzeitige) Herrscherin der unermesslichen Weiten des Territoriums der Radch, saß in einem breiten, mit bestickter Seide gepolsterten Sessel. Dieser Körper, der zu mir sprach – einer von Tausenden – schien ungefähr dreizehn Jahre alt zu sein. Schwarze Kleidung, schwarze Haut. Das Gesicht war bereits von den aristokratischen Zügen geprägt, die im Radchaai-Hoheitsgebiet als Zeichen des höchsten gesellschaftlichen Rangs galten. Unter normalen Umständen bekam niemand so junge Versionen der Herrin der Radch zu Gesicht, aber diese Umstände waren alles andere als normal.
Das Zimmer war klein, dreieinhalb Meter im Quadrat, mit einem Gitterwerk aus dunklem Holz getäfelt. In einer Ecke fehlte das Holz, nachdem es vermutlich bei der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Teilen von Anaander Mianaai beschädigt worden war. Wo das Holz noch vorhanden war, schlängelten sich Ranken einer zarten Pflanze mit dünnen silbrig-grünen Blättern und hier und dort winzigen weißen Blüten. Das Zimmer gehörte nicht zum öffentlichen Bereich des Palastes, es war kein Audienzraum. Ein leerer Sessel stand neben dem der Herrin der Radch, ein Tisch zwischen diesen Sesseln war mit einem Teeservice, einer Kanne und Tassen aus unverziertem weißem Porzellan gedeckt, anmutig liniert, von der Art, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht weiter beachtet und erst auf den zweiten als Kunstwerk erkennt, das mehr wert ist als manche Planeten.
Mir war Tee und ein Sitzplatz angeboten worden, doch ich hatte entschieden, stehen zu bleiben. »Sie sagten, ich könne mir meine Offizierinnen selbst aussuchen.« Ich hätte ein respektvolles Herrin hinzufügen sollen, tat es aber nicht. Außerdem hätte ich mich niederknien und die Stirn auf den Boden legen sollen, als ich eingetreten und der Herrin der Radch begegnet war. Auch das hatte ich nicht getan.
»Sie haben sich zwei ausgesucht. Natürlich Seivarden, und Leutnantin Ekalu war eine offensichtliche Wahl.« Die Namen riefen mir reflexartig beide Personen in den Sinn. In ungefähr einer Zehntelsekunde würde die Gnade der Kalr, die in etwa fünfunddreißigtausend Kilometern Entfernung von dieser Station parkte, die beinahe instinktive Datenabfrage empfangen, und eine Zehntelsekunde später würde mich ihre Antwort erreichen. Ich hatte die letzten Tage damit verbracht, diese sehr alte Gewohnheit unter Kontrolle zu bekommen. Es war mir nicht vollständig gelungen. »Eine Flottenkapitänin hat Anspruch auf eine dritte Leutnantin«, fuhr Anaander Mianaai fort. Mit einer wunderschönen Porzellantasse zwischen den Fingern des schwarzen Handschuhs deutete sie auf mich, auf meine Uniform, wie ich vermutete. Das Militär der Radch trug dunkelbraune Jacken und Hosen, Stiefel und Handschuhe. Meine Uniform war anders. Die linke Seite war braun, die rechte schwarz, und meine Insignien einer Kapitänin enthielten die Zeichen, dass ich nicht nur mein eigenes Schiff kommandierte, sondern auch die Kapitäninnen anderer Schiffe. Natürlich hatte ich in meiner Flotte keine Schiffe außer meinem eigenen, der Gnade der Kalr, und es gab keine anderen Flottenkapitäninnen in der Nähe von Athoek, wohin ich abkommandiert wurde; doch mein Rang würde mir einen Vorteil gegenüber anderen Kapitäninnen verschaffen, denen ich möglicherweise begegnete. Natürlich vorausgesetzt, dass diese anderen Kapitäninnen geneigt waren, meine Autorität anzuerkennen.
Erst vor wenigen Tagen war ein lange schwelender Konflikt ausgebrochen, und eine Partei hatte zwei der Tore innerhalb des Systems zerstört. Jetzt bestand die höchste Priorität darin, unbedingt zu vermeiden, dass weitere Tore ausgeschaltet wurden – und diese Partei daran zu hindern, weitere Tore und Stationen in anderen Systemen unter ihre Gewalt zu bringen. Ich verstand Anaanders Gründe, warum sie mir diesen Rang verliehen hatte, aber es gefiel mir trotzdem nicht. »Begehen Sie nicht den Fehler«, sagte ich, »zu denken, dass ich für Sie arbeite.«
Sie lächelte. »Oh, das tue ich keineswegs. Sie hätten lediglich die Wahl zwischen anderen Offizierinnen, die sich derzeit im System und in der Nähe dieser Station aufhalten. Leutnantin Tisarwat hat gerade erst ihr Training abgeschlossen. Sie stand kurz davor, ihre erste Anstellung zu übernehmen, was nun natürlich außer Frage steht. Und ich dachte, Sie hätten gern eine Offizierin, die Sie von Anfang an nach Ihren Vorstellungen ausbilden können.« Sie schien sich über diesen letzten Punkt zu amüsieren.
Während sie sprach, war mir bewusst, dass Seivarden sich in der Phase zwei des NREM-Schlafs befand. Ich sah Puls, Temperatur, Atmung, Blutsauerstoff, Hormonwerte. Dann verschwanden diese Daten und wurden durch Leutnantin Ekalu ersetzt, die Wachdienst hatte. Angespannt – die Kiefer leicht verkrampft, erhöhte Cortisolwerte. Bis vor einer Woche war sie eine gewöhnliche Soldatin gewesen, als die Kapitänin der Gnade der Kalr wegen Verrats verhaftet worden war. Sie hatte nie erwartet, zur Offizierin befördert zu werden. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie dazu fähig war, dachte ich.
»Sie können unmöglich davon überzeugt sein«, sagte ich zur Herrin der Radch und blinzelte diese Vision weg, »dass es eine gute Idee ist, mich mit nur einer einzigen erfahrenen Offizierin in einen jüngst ausgebrochenen Bürgerkrieg zu schicken.«
»Es wäre nicht schlimmer, als mit zu wenig Personal in den Einsatz zu gehen«, sagte Anaander Mianaai, die sich vielleicht meiner vorübergehenden Ablenkungen bewusst war, vielleicht aber auch nicht. »Und das Kind ist völlig außer sich von der Vorstellung, unter einer Flottenkapitänin zu dienen. Sie wartet am Dock auf Sie.« Sie stellte die Teetasse auf den Tisch, richtete sich im Sessel auf. »Nachdem das nach Athoek führende Tor geschlossen ist und ich keine Ahnung habe, wie die Situation dort aussehen könnte, kann ich Ihnen keine konkreten Befehle erteilen. Außerdem« – sie hob ihre jetzt leere Hand, als wollte sie einen möglichen Einwand von mir unterbinden – »würde ich nur meine Zeit verschwenden, wenn ich Sie allzu genau zu dirigieren versuchte. Sie würden ohnehin tun, was Ihnen beliebt, ganz gleich, was ich sage. Haben Sie sämtliche Ausrüstung an Bord, die Sie benötigen?«
Die Frage war rhetorisch, denn sie kannte den Status der Lagerräume meines Schiffs zweifellos genauso gut wie ich. Meine Antwort bestand in einer unbestimmten, bewusst geringschätzigen Geste.
»Sie könnten genauso gut die Sachen von Kapitänin Vel übernehmen«, sagte sie, als hätte ich eine klare Antwort gegeben. »Sie wird sie nicht mehr brauchen.«
Vel Osck war bis vor einer Woche die Kapitänin der Gnade der Kalr gewesen. Es gab mehrere Gründe, warum sie ihren Besitz nicht mehr benötigte, wobei der wahrscheinlichste natürlich der war, dass sie nicht mehr lebte. Anaander Mianaai machte keine halben Sachen, und erst recht nicht, wenn es darum ging, sich mit ihren Feindinnen auseinanderzusetzen. Allerdings war in diesem Fall die Feindin, die Vel Osck unterstützt hatte, Anaander Mianaai selbst gewesen. »Ich will sie nicht«, sagte ich. »Schicken Sie die Sachen zu ihrer Familie.«
»Wenn ich es kann.« Es war durchaus möglich, dass sie nicht dazu in der Lage war. »Gibt es noch irgendetwas, das Sie brauchen, bevor Sie aufbrechen? Was auch immer?«
Verschiedene Antworten kamen mir in den Sinn. Doch keine erschien mir sinnvoll. »Nein.«
»Ich werde Sie vermissen, wissen Sie«, sagte sie. »Niemand sonst wird so zu mir sprechen, wie Sie es tun. Sie sind eine der sehr wenigen Personen, denen ich begegnet bin, die sich wirklich nicht vor den Konsequenzen fürchten, mich zu verärgern. Und bei niemandem dieser sehr wenigen ist die … Ähnlichkeit des Hintergrunds gegeben, den Sie und ich haben.«
Weil ich früher ein Schiff gewesen war. Eine KI, die einen riesigen Truppentransporter und Tausende von Hilfseinheiten befehligte, menschliche Körper, die Teile von mir waren. Zu jener Zeit hatte ich mich selbst nicht als Sklavin gesehen, aber ich war eine Eroberungswaffe gewesen, der Besitz von Anaander Mianaai, die selbst Tausende von Körpern bewohnte, die über die gesamte Radch verstreut waren.
Jetzt war ich nur noch dieser einzelne menschliche Körper. »Sie können mir nichts Schlimmeres antun als das, was Sie mir bereits angetan haben.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, sagte sie, »und der Tatsache, wie gefährlich Sie das macht. Es könnte durchaus sehr dumm von mir sein, Sie am Leben zu lassen, geschweige denn, Ihnen offizielle Autorität und ein Schiff zu geben. Doch meine Spiele zeichnen sich nicht durch Zaghaftigkeit aus.«
»Für die meisten von uns«, sagte ich jetzt mit offener Wut, im Bewusstsein, dass sie die entsprechenden körperlichen Anzeichen erkennen konnte, mochte ich äußerlich noch so leidenschaftslos erscheinen, »sind es keine Spiele.«
»Auch dessen bin ich mir bewusst«, sagte die Herrin der Radch. »Wirklich. Es ist nur so, dass manche Verluste unvermeidlich sind.«
An diesem Punkt hätte ich zwischen einem halben Dutzend möglicher Erwiderungen auswählen können. Stattdessen drehte ich mich um und verließ den Raum, ohne zu antworten. Als ich durch die Tür trat, kam ich an der Soldatin Eins Kalr Fünf der Gnade der Kalr vorbei, die draußen strammgestanden hatte und mir nun lautlos und effizient folgte. Kalr Fünf war ein Mensch wie alle Soldatinnen der Gnade der Kalr und keine Hilfseinheit. Sie hatte einen Namen, neben dem ihrer Dekade, ihrer Nummer und ihres Schiffs. Ich hatte sie einmal mit diesem Namen angesprochen. Sie hatte darauf äußerlich unbeeindruckt, aber mit plötzlicher innerer Erschrockenheit und Unbehagen reagiert. Danach hatte ich es nicht mehr getan.
Als ich ein Schiff gewesen war – nur eine Komponente des Truppentransporters Gerechtigkeit der Torren –, war ich mir jederzeit des Zustandes meiner Offizierinnen bewusst gewesen. Was sie gehört und gesehen hatten. Jeder Atemzug, jedes Zucken eines Muskels. Hormonwerte, Sauerstoffwerte. Nahezu alles, außer dem konkreten Inhalt ihrer Gedanken, obwohl ich selbst den häufig erraten konnte, aus Erfahrung, aus intimer Vertrautheit mit ihnen. Nicht dass ich es jemals einer meiner Kapitäninnen gezeigt hätte, zumal sie nur wenig damit hätten anfangen können, nicht mehr als ein Strom bedeutungsloser Daten. Aber für mich war es zu jener Zeit einfach ein Teil meines Bewusstseins gewesen.
Ich war nicht mehr mein Schiff. Aber ich war immer noch eine Hilfseinheit, hätte immer noch die Daten lesen können, die keine menschliche Kapitänin entziffern konnte. Doch ich hatte jetzt nur noch ein einziges menschliches Gehirn, konnte nur noch einen winzigen Bruchteil der Informationen verarbeiten, die mir einst jederzeit im Hintergrund bewusst gewesen waren. Und selbst diese geringe Menge erforderte eine gewisse Sorgfalt – ich war gegen eine Wand gelaufen, als ich zum ersten Mal versucht hatte, gleichzeitig zu gehen und Daten zu empfangen. Diesmal fragte ich die Gnade der Kalr gezielt ab. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich durch diesen Korridor gehen und gleichzeitig Fünf überprüfen konnte, ohne zu stocken oder zu stolpern.
Ich schaffte es ohne Zwischenfall bis zum Empfangsbereich des Palastes. Fünf war müde und hatte einen leichten Kater. Sicherlich gelangweilt, als sie während meiner Besprechung mit der Herrin der Radch herumgestanden und auf die Wand gestarrt hatte. Ich erkannte eine seltsame Mischung aus Vorfreude und Scheu, was mich ein wenig besorgte, weil ich nicht erraten konnte, was für diesen Konflikt verantwortlich war.
Draußen auf der Hauptpromenade – hoch, weit, hallend, mit Stein gepflastert – wandte ich mich den Aufzügen zu, die mich zu den Docks bringen würden, zum Shuttle, der darauf wartete, mit mir zur Gnade der Kalr zurückzufliegen. Die meisten Geschäfte und Büros an den Seiten der Promenade, einschließlich der großen, bunt bemalten Götter, die sich an der Tempelfassade drängten, in Orange und Blau und Rot und Grün, wirkten erstaunlich unbeschädigt nach den Kämpfen der vergangenen Wochen, als der Konflikt der Herrin der Radch mit sich selbst offen ausgebrochen war. Nun liefen Bürgerinnen in farbenfrohen Mänteln, Hosen und Handschuhen, an denen Edelsteine glitzerten, scheinbar unbekümmert vorbei. Als wäre letzte Woche nichts geschehen. Als wäre Anaander Mianaai, die Herrin der Radch, immer noch sie selbst, mit vielen Körpern, aber eine einzige, ungeteilte Person. Doch die vergangene Woche hatte sich ereignet, und Anaander Mianaai war tatsächlich keine einzelne Person. Sie war es schon seit einiger Zeit nicht mehr gewesen.
Als ich mich den Aufzügen näherte, überkam mich ein plötzlicher Schwall der Verärgerung und Bestürzung. Ich hielt an, drehte mich um. Kalr Fünf war stehen geblieben, als ich stehen geblieben war, und starrte nun leidenschaftslos geradeaus. Als wäre der Schwall der Verärgerung, den das Schiff mir gezeigt hatte, gar nicht von ihr gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass die meisten Menschen so starke Emotionen so effektiv verbergen konnten – ihr Gesicht war absolut ausdruckslos. Aber wie sich herausgestellt hatte, waren alle Soldatinnen der Gnade der Kalr dazu imstande. Kapitänin Vel war recht altmodisch eingestellt gewesen – oder zumindest hatte sie idealisierte Vorstellungen davon gehabt, was »altmodisch« bedeutete – und hatte verlangt, dass sich ihre menschlichen Soldatinnen in ihrem Verhalten so weit wie möglich dem von Hilfseinheiten anpassten.
Fünf wusste nicht, dass ich eine Hilfseinheit gewesen war. Ihres Wissens war ich Flottenkapitänin Breq Mianaai, befördert wegen Kapitänin Vels Verhaftung und meiner, von vielen vermuteten einflussreichen familiären Verbindungen. Sie konnte nicht wissen, wie viel von ihr ich sah. »Was gibt es?«, fragte ich schroff, verblüfft.
»Herrin?« Tonlos, ausdruckslos. Sie wollte, wie ich nach der winzigen Signalverzögerung sah, dass ich meine Aufmerksamkeit von ihr abwandte, dass ich sie wieder ignorierte. Und sie wollte auch reden.
Ich hatte recht, für diese Verärgerung, diese Bestürzung war ich verantwortlich. »Sie haben etwas zu sagen. Sprechen Sie es aus.«
Überraschung. Erschrecken. Und nicht das winzigste Muskelzucken. »Herrin«, sagte sie erneut, und endlich zeigte sie einen schwachen, flüchtigen, unbestimmten Ausdruck, der schnell wieder verschwunden war. Sie schluckte. »Es ist wegen des Geschirrs.«
Nun war ich es, die Überraschung zeigte. »Wegen des Geschirrs?«
»Herrin, Sie ließen Kapitänin Vels Sachen hier in der Station einlagern.«
Und es waren hübsche Sachen gewesen. Das Geschirr (und das Besteck und das Teeservice), das Kalr Fünf offenbar so sehr beschäftigte, hatte aus Porzellan, Glas sowie mit Edelsteinen und Emaille verziertem Metall bestanden. Doch es war nicht meins gewesen. Und ich wollte nichts von Kapitänin Vels Sachen haben. Fünf erwartete, dass ich sie verstand. Wollte so sehr, dass ich sie verstand. Aber ich verstand sie nicht. »Ja?«
Frust. Sogar Wut. Anscheinend war es aus Fünfs Perspektive offensichtlich, was sie wollte. Doch der einzige für mich offensichtliche Teil war die Tatsache, dass sie es nicht offen sagen konnte, obwohl ich sie dazu aufgefordert hatte. »Herrin«, sagte sie schließlich, während Bürgerinnen an uns vorbeiliefen, von denen manche uns neugierige Blicke zuwarfen und andere vorgaben, uns nicht zu bemerken. »Wie ich gehört habe, werden wir bald das System verlassen.«
»Soldatin«, sagte ich und empfand nun selbst Frust und Verärgerung, zumal meine Stimmung nach dem Gespräch mit der Herrin der Radch ohnehin nicht die beste war. »Sind Sie imstande, die Angelegenheit direkt anzusprechen?«
»Wir können das System nicht ohne gutes Geschirr verlassen!«, platzte es schließlich aus ihr heraus, während ihr Gesicht weiterhin erstaunlich ausdruckslos blieb. »Herrin.« Als ich nicht antwortete, fuhr sie fort, empfand wieder Furcht, weil sie so offen sprach. »Natürlich spielt es für Sie keine Rolle. Sie sind eine Flottenkapitänin, also genügt allein Ihr Rang, jede zu beeindrucken.« Und der Name meines Hauses – schließlich war ich jetzt Breq Mianaai. Es gefiel mir nicht allzu sehr, dass mir dieser spezielle Name verliehen worden war, der mich als Cousine der Herrin der Radch höchstpersönlich auszeichnete. Niemand aus meiner Besatzung außer Seivarden und der Bordärztin wusste, dass ich nicht als solche geboren war. »Sie könnten eine Kapitänin zum Mittagessen einladen und mit ihr in der Soldatinnenmesse speisen, und sie würde kein Wort sagen, Herrin.« Nur falls sie im Rang höher stand als ich.
»Wir unternehmen diese Reise nicht, um Dinnerpartys zu veranstalten«, sagte ich. Das schien sie zu verblüffen, da sich für einen Moment Verwirrung auf ihrem Gesicht zeigte.
»Herrin!«, sagte sie in flehendem Tonfall und mit einiger Verzweiflung. »Sie müssen sich keine Sorgen machen, was andere Leute über Sie denken könnten. Ich habe es nur angesprochen, weil Sie es mir befohlen haben.«
Natürlich. Ich hätte es gleich erkennen sollen. Schon vor Tagen. Sie machte sich Sorgen, dass sie einen schlechten Eindruck machte, wenn ich kein Geschirr besaß, das meinem Rang entsprach. Dass es kein gutes Licht auf das Schiff warf. »Sie sorgen sich um den Ruf des Schiffs.«
Verdruss, aber auch Erleichterung. »Ja, Herrin.«
»Ich bin nicht Kapitänin Vel.« Kapitänin Vel hatte großen Wert auf solche Dinge gelegt.
»Nein, Herrin.« Ich war mir nicht sicher, ob die Betonung – und die Erleichterung, die ich in Fünf las – darauf zurückzuführen war, dass es gut war, dass ich nicht Kapitänin Vel war, oder darauf, dass ich endlich verstanden hatte, was sie mir zu sagen versucht hatte. Oder beides.
Ich hatte hier bereits mein Konto aufgelöst und all mein Geld in meinem Quartier an Bord der Gnade der Kalr eingeschlossen. Die wenigen Scheine, die ich bei mir trug, würden nicht genügen, um Kalr Fünfs Bedenken zu zerstreuen. Die Station – die KI, die die Station in Betrieb hielt, die die Station war – könnte wahrscheinlich die finanziellen Details für mich klären. Aber die Station war nicht gut auf mich zu sprechen, da ich der Grund für die Gewalttätigkeiten der vergangenen Woche war, und wäre eher nicht geneigt, mich zu unterstützen.
»Gehen Sie zurück zum Palast«, sagte ich. »Erklären Sie der Herrin der Radch, was Sie benötigen.« Ihre Augen weiteten sich nur ein klein wenig, und zwei Zehntelsekunden später las ich in Kalr Fünf Fassungslosigkeit und dann offenes Entsetzen. »Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit arrangiert wurde, kommen Sie zum Shuttle.«
Drei Bürgerinnen gingen vorbei, Taschen in den behandschuhten Händen, und das Fragment ihrer Unterhaltung, das ich mithörte, verriet mir, dass sie auf dem Weg zum Dock waren, um ein Schiff zu einer äußeren Station zu erreichen. Eine Lifttür glitt gehorsam auf. Natürlich. Die Station wusste, wohin sie gingen, musste sie nicht danach fragen.
Die Station wusste auch, wohin ich unterwegs war, aber sie war nicht bereit, irgendeine Tür für mich zu öffnen, ohne dass ich sie ausdrücklich dazu aufforderte. Ich drehte mich um, trat schnell zu den dreien in den Lift zum Dock, sah, wie sich die Tür vor Fünf schloss, die erschrocken auf dem schwarzen Steinpflaster der Hauptpromenade stand. Der Lift setzte sich in Bewegung, die drei Bürgerinnen plapperten. Ich schloss die Augen und sah, wie Kalr Fünf auf den Lift starrte und leicht hyperventilierte. Sie runzelte ganz leicht die Stirn – was vermutlich keine Passantin bemerkt hätte. Ihre Finger zuckten, riefen die Gnade der Kalr, jedoch mit einer gewissen Nervosität, als würde sie befürchten, dass sie vielleicht nicht antwortete.
Aber natürlich hatte sie längst die Aufmerksamkeit des Schiffs. »Keine Sorge«, sprach die Gnade der Kalr mit abgeklärter und neutraler Stimme in Fünfs und mein Ohr. »Die Flottenkapitänin ist nicht wütend auf Sie. Machen Sie nur. Kein Problem.«
Wohl wahr. Es war nicht Kalr Fünf, auf die ich wütend war. Ich verdrängte die Daten, die von ihr kamen, empfing ein verwirrendes Gedankenbild von Seivarden, die schlief und träumte, und von Leutnantin Ekalu, die immer noch angespannt war und gerade eine ihrer Etrepas um Tee bat. Ich öffnete die Augen. Die Bürgerinnen im Lift lachten über irgendetwas, ich wusste nicht, worüber, und es interessierte mich auch nicht, und als die Lifttür aufglitt, traten wir hinaus in die weite Vorhalle der Docks, die auf allen Seiten von Ikonen der Göttinnen gesäumt wurde, die Reisende als nützlich oder tröstlich empfinden mochten. Für diese Tageszeit war es hier ungewöhnlich leer, außer am Eingang zum Büro der Dockverwaltung, wo eine Schlange aus schlecht gelaunten Schiffskapitäninnen und Pilotinnen darauf warteten, dass sie an die Reihe kamen, sich bei den überlasteten Inspektionsgehilfinnen zu beschweren. Zwei Tore innerhalb des Systems waren seit den Unruhen der vergangenen Woche nicht mehr benutzbar, und in naher Zukunft würden es wahrscheinlich noch mehr werden, und die Herrin der Radch hatte sämtliche Reisen durch die noch übrigen verboten, womit Dutzende von Schiffen im System festsaßen, mitsamt ihrer gesamten Fracht und allen Passagierinnen.
Sie traten für mich zur Seite, verbeugten sich leicht, als würde eine Windböe durch die Reihe fahren. Es war die Uniform, der ich dies zu verdanken hatte – ich hörte, wie eine Kapitänin einer anderen zuflüsterte: »Wer ist das?« Es folgte Gemurmel, als ihre Kollegin antwortete und andere Bemerkungen über ihre Unwissenheit fallen ließen oder hinzufügten, was sie wussten. Ich hörte »Mianaai« und »Sondermission«. Was sie aus den Ereignissen der letzten Woche schlussfolgern konnten. Die offizielle Version lautete, dass ich undercover zum Omaugh-Palast gekommen war, um eine aufwieglerische Verschwörung aufzudecken. Dass ich die ganze Zeit für Anaander Mianaai gearbeitet hatte. Jeder, der in irgendeiner Form an den Ereignissen beteiligt gewesen war, von denen später eine offizielle Version herausgegeben wurde, musste wissen oder vermuten, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Aber die meisten Radchaai führten ein unscheinbares Leben und hätten keinen Grund, daran zu zweifeln.
Niemand stellte infrage, dass ich an den Gehilfinnen vorbeiging und das Bürovorzimmer der Inspektionsleiterin betrat. Daos Ceit, ihre eigentliche Assistentin, erholte sich immer noch von ihren Verletzungen. An ihrer Stelle saß eine Assistentin, die ich nicht kannte, die sich aber eilig erhob und vor mir verbeugte. Das Gleiche tat eine sehr, sehr junge Leutnantin, deutlich anmutiger und beherrschter, als ich es von einer Siebzehnjährigen erwartet hätte. Sie war der Typ mit schlaksigen Armen und Beinen, frivol genug, um ihr erstes Gehalt für fliederfarbene Augen auszugeben – zweifellos war sie nicht mit Augen in dieser Farbe geboren. Ihre Jacke, Hose, Handschuhe und Stiefel in Dunkelbraun waren ordentlich und tadellos, ihr glattes dunkles Haar kurz geschnitten. »Flottenkapitänin. Herrin«, sagte sie. »Leutnantin Tisarwat, Herrin.« Sie verbeugte sich erneut.
Ich antwortete nicht, sah sie nur an. Falls meine Prüfung sie irritierte, merkte ich es ihr nicht an. Sie sendete noch keine Daten an die Gnade der Kalr, und ihre braune Haut hatte sich nicht errötend verdunkelt. Die kleine, diskrete Anordnung von Nadeln an einer Schulter wies auf eine Familie von gewissem Vermögen hin, die jedoch nicht zu den höchsten in der Radch zählte. Sie war, dachte ich, entweder außergewöhnlich selbstbeherrscht oder eine Närrin. Keine der beiden Optionen gefiel mir.
»Gehen Sie hinein, Herrin«, sagte die mir unbekannte Assistentin und deutete auf die Tür zum Büro. Ich tat es, ohne ein Wort zu Leutnantin Tisarwat zu sagen.
Inspektionsleiterin Skaaiat Awer – dunkelhäutig, bernsteinfarbene Augen, elegant und aristokratisch selbst in der dunkelblauen Uniform der Dockverwaltung – erhob und verbeugte sich, während sich die Tür hinter mir schloss. »Breq. Sie gehen also?«
Ich öffnete den Mund, um Sobald Sie unseren Abflug autorisieren zu sagen, doch dann erinnerte ich mich an Fünf und den Auftrag, den ich ihr erteilt hatte. »Ich warte nur noch auf Kalr Fünf. Anscheinend kann ich nicht ohne angemessenes Geschirr aufbrechen.«
Überraschung zeigte sich auf ihrem Gesicht, war im nächsten Moment aber wieder verschwunden. Sie hatte natürlich gewusst, dass ich die Sachen von Kapitänin Vel hierher geschickt hatte und nichts besaß, um sie zu ersetzen. Nachdem ihre Überraschung sich gelegt hatte, sah ich Belustigung. »Nun«, sagte sie. »Hätten Sie nicht genauso empfunden?« Wäre ich an Fünfs Stelle gewesen, meinte sie. Als ich noch ein Schiff gewesen war.
»Nein, das hätte ich nicht. Manch andere Schiffe schon.« Hauptsächlich die Schwerter, die überwiegend bereits dachten, sie stünden über den kleineren, weniger prestigeträchtigen Gnaden oder den Truppentransportern, den Gerechtigkeiten.
»Meinen Sieben Issas lag viel an solchen Dingen.« Skaaiat hatte als Leutnantin an Bord eines Schiffs mit menschlichen Soldatinnen gedient, bevor sie hier am Omaugh-Palast zur Inspektionsleiterin befördert worden war. Ihr Blick ging zu meinem einzigen Schmuckstück, einem kleinen goldenen Abzeichen, das nahe meiner linken Schulter angebracht war. Sie zeigte darauf, ein Themenwechsel, der eigentlich gar kein Themenwechsel war. »Athoek, nicht wahr?« Mein Flugziel war nicht öffentlich bekanntgegeben worden, wurde vielleicht sogar als vertrauliche Information eingestuft. Awer war jedoch eins der ältesten und vermögendsten Häuser. Skaaiat hatte Cousinen, die Leute kannten, die Dinge wussten. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie dorthin geschickt hätte.«
»Es ist mein Ziel.«
Sie akzeptierte diese Antwort, ohne mit Überraschung oder Verärgerung zu reagieren. »Setzen Sie sich. Tee?«
»Danke, nein.« In Wirklichkeit hätte ein Tee mir gutgetan, unter anderen Umständen wäre ich über ein entspanntes Geplauder mit Skaaiat Awer vielleicht sogar froh gewesen, aber ich wollte möglichst schnell wieder gehen.
Auch das nahm Inspektionsleiterin Skaaiat mit Gleichmut auf. Sie selbst setzte sich nicht. »Sie werden sich mit Basnaaid Elming in Verbindung setzen, wenn Sie die Athoek-Station erreicht haben.« Es war keine Frage. Sie wusste, dass ich es tun würde. Basnaaid war die jüngere Schwester einer Person, die sowohl Skaaiat als auch ich einst geliebt hatten. Eine Person, die ich auf Anweisung von Anaander Mianaai getötet hatte. »In mancher Hinsicht ist sie wie Awn, in anderer nicht.«
»Eigensinnig, sagten Sie.«
»Sehr stolz. Und genauso eigensinnig wie ihre Schwester. Möglicherweise noch mehr. Sie war empört, als ich ihr um ihrer Schwester willen die Klientinnenschaft angeboten habe. Ich erwähne es, weil ich vermute, dass Sie etwas Ähnliches beabsichtigen könnten. Und Sie könnten durchaus die einzige lebende Person sein, die sogar noch eigensinniger ist als sie.«
Ich hob eine Augenbraue. »Nicht einmal die Tyrannin?« Es war kein Radchaai-Wort, sondern es stammte von einer der Welten, die von der Radch annektiert und absorbiert worden waren. Anaander Mianaai. Die Tyrannin selbst, vielleicht die einzige Person im Omaugh-Palast, die das Wort erkannt oder verstanden hätte, abgesehen von Skaaiat und mir.
Skaaiat Awers Mund verzog sich zu einem sarkastischen Ausdruck. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer, seien Sie vorsichtig damit, Basnaaid Geld oder sonstige Hilfe anzubieten. Sie würde es nicht goutieren.« Sie gestikulierte freundlich, aber schicksalsergeben, als wollte sie sagen: Aber natürlich werden Sie tun, was Ihnen beliebt. »Sie dürften Ihrer blutjungen neuen Leutnantin begegnet sein.«
Sie meinte Leutnantin Tisarwat. »Warum ist sie hierher und nicht direkt zum Shuttle gekommen?«
»Um sich bei meiner Gehilfin zu entschuldigen.« Daos Ceits Vertretung im Vorzimmer. »Ihre Mütter sind Cousinen.« Eigentlich bezog sich das Wort, das Skaaiat benutzte, auf eine Beziehung zwischen zwei Personen aus verschiedenen Häusern, die einen gemeinsamen Eltern- oder Großelternteil hatten, aber umgangssprachlich bedeutete es eine entferntere Verwandte, mit der man zusammen aufgewachsen war, oder eine Freundin. »Sie sollten sich gestern zum Tee treffen, doch Tisarwat kam nicht und beantwortete auch keine Nachrichten. Und Sie kennen das Verhältnis zwischen Militär und Dockverwaltung.« Das äußerlich von Höflichkeit und insgeheim von Verachtung geprägt war. »Meine Gehilfin fühlte sich beleidigt.«
»Warum sollte Leutnantin Tisarwat das interessieren?«
»Sie hatten nie eine Mutter, die wütend wird, weil Sie ihre Cousine beleidigt haben«, sagte Skaaiat mit dem Ansatz eines Lachens. »Sonst würden Sie nicht fragen.«
Wohl wahr. »Wie schätzen Sie sie ein?«
»Flatterhaft, hätte ich noch vor ein oder zwei Tagen gesagt. Aber heute ist sie sehr kleinlaut.« Flatterhaft passte gar nicht zu der sehr beherrschten jungen Person, die ich im Vorzimmer gesehen hatte. Ausgenommen vielleicht diese unmöglichen Augen. »Bis heute war sie auf dem besten Weg zu einem Schreibtischjob in einem Randsystem.«
»Die Tyrannin hat mir ein Baby als Verwalterin geschickt?«
»Ich hätte niemals gedacht, dass sie Ihnen ein Baby in welcher Funktion auch immer schicken würde«, sagte Skaaiat. »Ich hätte gedacht, dass sie selbst Sie begleiten würde. Aber vielleicht sind hier nicht mehr genug von ihr übrig.« Sie holte Luft, als wollte sie noch mehr sagen, doch dann runzelte sie die Stirn, legte den Kopf schief. »Es tut mir leid, aber es gibt da etwas, um das ich mich kümmern muss.«
An den Docks drängten sich Schiffe, die Vorräte, Reparaturen oder medizinische Notfallversorgung benötigten, Schiffe, die in diesem System feststeckten, mit Besatzungen und Passagierinnen, die äußerst unglücklich über die Situation waren. Skaaiats Personal hatte seit Tagen hart gearbeitet und sich nur wenige Pausen gegönnt. »Selbstverständlich«, sagte ich und verbeugte mich. »Ich werde Ihnen aus dem Weg gehen.« Sie horchte immer noch auf die Nachricht, die sie empfangen hatte. Ich wandte mich zum Gehen.
»Breq.« Ich blickte mich um. Skaaiat hielt den Kopf immer noch ein wenig geneigt, um zu horchen. »Passen Sie auf sich auf.«
»Sie auch.« Ich trat durch die Tür ins Vorzimmer. Leutnantin Tisarwat stand still und schweigend da. Die Gehilfin starrte geradeaus, ihre Finger bewegten sich, sie kümmerte sich zweifellos um wichtige Angelegenheiten im Dock. »Leutnantin«, sagte ich in scharfem Tonfall und wartete nicht auf eine Antwort, sondern verließ das Büro, durchquerte die Menge der missmutigen Schiffskapitäninnen, ging hinüber zum Dock, wo ich den Shuttle finden würde, der mich zur Gnade der Kalr bringen sollte.
Der Shuttle war zu klein, um eigene Schwerkraft erzeugen zu können. Ich hatte keinerlei Schwierigkeiten mit einer solchen Situation, aber bei sehr jungen Offizierinnen war das oft anders. Ich stationierte Leutnantin Tisarwat am Dock, damit sie auf Kalr Fünf wartete, dann schob ich mich über die heikle und riskante Grenze zwischen der Gravitation des Palasts und der Schwerelosigkeit des Shuttles, hangelte mich zu einem Sitz hinüber und schnallte mich dort an. Die Pilotin begrüßte mich mit einem respektvollen Nicken, da eine Verbeugung unter diesen Umständen schwierig war. Ich schloss die Augen, sah, dass Fünf in einem großen Lagerraum innerhalb des eigentlichen Palasts stand, schlicht, zweckmäßig, graue Wände. Der Raum war voller Kisten und Truhen. In ihrem braunen Handschuh hielt sie eine Teetasse aus feinem Glas in Tiefrosa. In einer offenen Kiste vor ihr war mehr Geschirr dieser Art zu sehen – eine Kanne, sieben weitere Tassen, andere Stücke. Ihre Freude an diesen schönen Dingen, ihr Begehren, wurde von Zweifeln untergraben. Ich konnte ihre Gedanken nicht lesen, aber ich vermutete, dass man ihr gesagt hatte, sich in diesem Lagerraum etwas auszusuchen, worauf sie dieses Geschirr gefunden hatte und es sich innigst wünschte, aber nicht recht glauben konnte, dass man ihr erlauben würde, es mitzunehmen. Ich war mir ziemlich sicher, dass dieses Service mundgeblasen und gut siebenhundert Jahre alt war. Mir war nicht bewusst gewesen, dass sie in solchen Dingen das Auge einer Kennerin hatte.
Ich verdrängte diese Bilder. Sie würde noch eine Weile brauchen, dachte ich, und in der Zeit konnte ich genauso gut ein wenig schlafen.
Ich wachte drei Stunden später auf, während sich die fliederäugige Leutnantin Tisarwat geschickt auf einem Sitz mir gegenüber anschnallte. Kalr Fünf – die nun Zufriedenheit ausstrahlte, die vermutlich mit ihrem Aufenthalt im Lagerraum des Palastes zusammenhing – schob sich zu Leutnantin Tisarwat hinüber und bot ihr mit einem Nicken und einem stummen Nur für alle Fälle, Herrin einen Beutel für den nahezu unvermeidlichen Moment an, wenn der Magen der neuen Offizierin auf die Mikrogravitation reagierte.
Ich hatte junge Leutnantinnen kennengelernt, die ein solches Angebot als Beleidigung auffassten. Leutnantin Tisarwat akzeptierte es mit einem leichten, vagen Lächeln, das nicht ganz den Rest ihres Gesichts erreichte. Sie wirkte immer noch völlig ruhig und beherrscht.
»Leutnantin«, sagte ich, während sich Kalr Fünf nach vorn abstieß, um sich neben der Pilotin anzuschnallen, ebenfalls eine Kalr. »Haben Sie irgendwelche Medikamente genommen?« Eine weitere potenzielle Beleidigung. Mittel gegen Übelkeit waren verfügbar, und ich hatte ausgezeichnete, langgediente Offizierinnen gekannt, die sie während ihrer gesamten Karriere jedes Mal genommen hatten, sobald sie einen Shuttle bestiegen. Doch keine von ihnen hätte es jemals zugegeben.
Die letzten Spuren von Leutnantin Tisarwats Lächeln verflüchtigten sich. »Nein, Herrin«. Völlig ruhig.
»Die Pilotin hat welche, falls Sie etwas brauchen.« Das hätte irgendeine Reaktion hervorrufen sollen.
Und so war es auch, nur einen winzigen Sekundenbruchteil später, als ich erwartet hatte. Die Andeutung eines Stirnrunzelns, empört gereckte Schultern, behindert durch die Sitzgurte. »Nein, danke, Herrin.«
Flatterhaft, hatte Skaaiat Awer gesagt. Normalerweise schätzte sie Leute nicht so falsch ein. »Ich habe nicht um Ihre Anwesenheit gebeten, Leutnantin.« Ich sprach mit ruhiger Stimme, jedoch mit einem Hauch von Verärgerung. Was mir unter den Umständen leicht genug fiel. »Sie sind nur hier, weil Anaander Mianaai es angeordnet hat. Ich habe weder die Zeit noch die Mittel, um mit eigener Hand ein blutjunges Baby großzuziehen. Sie sollten sich lieber ganz schnell auf Trab bringen. Ich brauche Offizierinnen, die wissen, was sie tun. Ich brauche eine Besatzung, auf die ich mich ausnahmslos verlassen kann.«
»Herrin«, erwiderte Leutnantin Tisarwat. Immer noch ruhig, aber nun mit einer gewissen Ernsthaftigkeit im Tonfall, und ihr Stirnrunzeln wurde ein klein wenig tiefer. »Ja, Herrin.«
Irgendetwas hatte sie sich verabreicht. Vermutlich ein Mittel gegen Übelkeit, und wenn ich zu Wettspielen neigen würde, hätte ich mein beträchtliches Vermögen darauf gesetzt, dass sie zumindest mit einem Sedativ bis zu den Ohren voll war. Ich wollte ihre Personalakte aufrufen – die Gnade der Kalr müsste sie inzwischen haben. Aber die Tyrannin würde sehen, dass ich das Dokument angefordert hatte. Die Gnade der Kalr gehörte letztlich Anaander Mianaai, und mit ihrem Zugang konnte sie das Schiff völlig unter ihre Kontrolle bringen. Die Gnade der Kalr sah und hörte alles, was ich sah und hörte, und wenn die Tyrannin an diesen Informationen interessiert war, musste sie sie nur abrufen. Und ich wollte nicht, dass sie wusste, welchen Verdacht ich hegte. Um ehrlich zu sein, wollte ich, dass sich mein Verdacht als falsch erwies. Als unsinnig.
Vorläufig, sofern die Tyrannin zuschaute – was sie zweifellos tat, durch die Gnade der Kalr, was sie so lange tun würde, wie wir uns im System aufhielten –, sollte sie denken, dass ich mich darüber ärgerte, dass mir ein Baby untergeschoben worden war, während mir Leute lieber waren, die wussten, was sie taten.
Ich wandte meine Aufmerksamkeit von Leutnantin Tisarwat ab. Vorn beugte sich die Pilotin zu Fünf hinüber und fragte leise und indirekt: »Alles in Ordnung?« Und auf Fünfs Reaktion, die in einem verdutzten Stirnrunzeln bestand, antwortete sie: »Zu still.«
»Die ganze Zeit?«, fragte Fünf. Immer noch indirekt. Weil sie über mich sprachen und keine Anfragen ans Schiff provozieren wollten, mit denen ich es möglicherweise aufforderte, mir zu sagen, wenn die Besatzung über mich sprach. Ich hatte die alte Angewohnheit – seit nahezu zweitausend Jahren –, irgendein Lied zu singen, das mir gerade durch den Kopf ging. Oder zu summen. Das hatte bei der Besatzung anfangs einige Verwirrung und Bestürzung ausgelöst. Dieser Körper, der einzige, der mir verblieben war, hatte keine besonders gute Stimme. Doch sie gewöhnten sich daran, und nun amüsierte es mich insgeheim, dass meine Besatzungsmitglieder durch mein Schweigen irritiert wurden.
»Keinen Piep«, sagte die Pilotin zu Kalr Fünf. Mit einem kurzen Seitenblick und einem winzigen Zucken der Hals- und Schultermuskeln, das mir verriet, dass sie überlegt hatte, sich zu Leutnantin Tisarwat umzublicken.
»Ja«, sagte Fünf und stimmte damit, wie ich vermutete, der unausgesprochenen Einschätzung der Pilotin zu, was mir möglicherweise Sorgen machen könnte.
Gut. Sollte Anaander Mianaai auch das beobachten.
Es war ein langer Flug zurück zur Gnade der Kalr, doch Leutnantin Tisarwat ließ sich die ganze Zeit kein Unbehagen anmerken, geschweige denn, dass sie den Beutel benutzt hätte. Ich verbrachte die Zeit damit, zu schlafen und nachzudenken.
Schiffe, Sendungen und Daten gelangten von Stern zu Stern, indem sie die Tore benutzten, die durch Leuchtfeuer markiert und ständig offen gehalten wurden. Die Berechnungen waren bereits erledigt, die Routen durch die Fremdartigkeit des Tor-Raums abgesteckt, wo Entfernung und Nähe nicht den Verhältnissen im Normalraum entsprachen. Aber militärische Schiffe – wie die Gnade der Kalr – konnten ihre eigenen Tore erzeugen. Das war erheblich riskanter; wählte man die falsche Route, den falschen Aus- oder Eingang, konnte ein Schiff schließlich sonstwo oder nirgendwo landen. Das machte mir keine Sorgen. Die Gnade der Kalr wusste, was sie tat, und wir würden wohlbehalten an der Athoek-Station eintreffen.
Und während wir uns durch den Tor-Raum bewegten, innerhalb unserer eigenen Normalraumblase, wären wir komplett isoliert. Das wollte ich. Fort vom Omaugh-Palast, fort von Anaander Mianaais Anblick und fort von allen Befehlen oder Einmischungen, die sie schicken könnte.
Als wir fast da waren, nur noch wenige Minuten bis zum Andocken, sprach das Schiff direkt in mein Ohr. »Flottenkapitänin.« Es musste mich nicht auf diese Weise anreden, es konnte mir einfach seinen Wunsch nach meiner Aufmerksamkeit vermitteln. Und es wusste fast immer, was ich wollte, ohne dass ich es sagen musste. Ich konnte mich auf eine Weise mit der Gnade der Kalr verbinden, wie es sonst niemand an Bord konnte. Allerdings konnte ich nicht die Gnade der Kalr sein, wie ich die Gerechtigkeit der Torren gewesen war. Nicht ohne mich selbst völlig zu verlieren. Dauerhaft.
»Schiff«, antwortete ich leise. Und ohne dass ich ein weiteres Wort sagte, übermittelte die Gnade der Kalr mir die Ergebnisse ihrer Berechnungen, die sie unaufgefordert angestellt hatte, eine Auswahl möglicher Routen und Abflugzeiten, die in meinem Sichtfeld aufblitzten. Ich wählte die früheste, gab Befehle, und nach etwas mehr als sechs Stunden waren wir fort.
2
DIE TYRANNIN HATTE GESAGT, WIR HÄTTEN EINEN ähnlichen Hintergrund, und in gewisser Hinsicht stimmte das auch. Sie hatte – genauso wie ich seinerzeit – aus Hunderten von Körpern mit einer gemeinsamen Identität bestanden. In diesem Punkt waren wir uns ungefähr gleich. Was einige Bürgerinnen bemerkt hatten (wenn auch erst vor relativ kurzer Zeit, in den letzten hundert Jahren oder so), als über die militärische Verwendung von Hilfseinheiten diskutiert worden war.
Die Vorstellung erschien schrecklich, wenn man daran dachte, dass man selbst, eine Freundin oder eine Verwandte davon betroffen sein könnte. Doch die Herrin der Radch hatte das Gleiche durchgemacht, war in gewisser Hinsicht die gleiche Art von Entität wie die Schiffe, die ihr dienten. Konnte es also so schlimm sein, wie die Kritiker behaupteten? Eine lächerliche Idee, dass es die ganze Zeit in der Radch nicht absolut gerecht zugegangen sein könnte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!