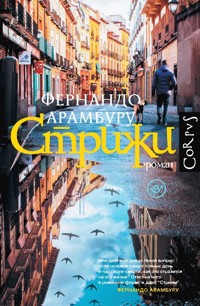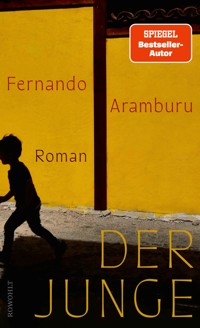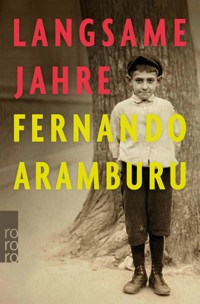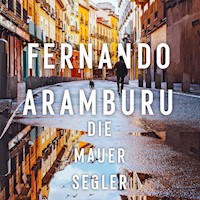
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Toni ist Philosophielehrer an einem Gymnasium in Madrid, lebt alleine, mit Hund, und fasst einen Entschluss: Er will seinem Leben ein Ende setzen. In genau 365 Tagen. Am 31. Juli beginnt das letzte Jahr, und dieser Roman hat 365 Kapitel, eins für jeden Tag. Die ersten Monate sind für Toni geprägt von Erinnerungen an seine Familie in der wechselhaften spanischen Geschichte, Beobachtungen seiner Landsleute und Erlebnissen, die ihn in seiner Weltsicht bestärken. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit einer Frau, deren Hund auch Toni heißt. Ein Zeichen! Und mit einem Mal gerät Tonis Plan ins Wanken. Nach dem internationalen Bestseller «Patria» legt Aramburu einen großen humanistischen Roman vor. Voller Herzenswärme, traurig, lustig, zutiefst berührend: ein meisterhaftes Werk. Die Chronik eines Countdowns, die auf fantastische Weise von der Hoffnung auf ein glückliches Leben erzählt. Für die spanische Kritik ist es schon jetzt ein Klassiker des 21. Jahrhunderts.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Aramburu
Die Mauersegler
Roman
Über dieses Buch
Toni ist Philosophielehrer an einem Gymnasium in Madrid, lebt nach einer Trennung alleine, mit Hund. Er liebt das Leben nicht und fasst einen Entschluss: Er will seinem Leben ein Ende setzen. In genau 365 Tagen. Am 31. Juli beginnt das letzte Jahr, und dieser Roman hat 365 Kapitel, eins für jeden Tag. Die ersten Monate sind für Toni geprägt von Erinnerungen an seine Familie in der wechselhaften spanischen Geschichte, Beobachtungen seiner Landsleute und Erlebnissen, die ihn in seiner Weltsicht bestärken. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit einer Frau, deren Hund auch Toni heißt. Ein Zeichen! Und mit einem Mal gerät Tonis Plan ins Wanken.
Nach dem internationalen Bestseller Patria legt Aramburu einen großen humanistischen Roman vor. Voller Herzenswärme, traurig, lustig, zutiefst berührend: ein meisterhaftes Werk. Die Chronik eines Countdowns, die auf fantastische Weise von der Hoffnung auf ein glückliches Leben erzählt. Für die spanische Kritik ist es schon jetzt ein Klassiker des 21. Jahrhunderts.
Vita
Fernando Aramburu wurde 1959 in San Sebastián im Baskenland geboren. Seit Mitte der Achtzigerjahre lebt er in Hannover. Für seine Romane wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Vargas Llosa, dem Premio Biblioteca Breve, dem Premio Euskadi, dem Premio Nacional de la Crítica, dem Premio Nacional de Narrativa und dem Premio Strega Europeo. Patria wurde als Serie für HBO verfilmt.
Willi Zurbrüggen, geboren 1949 in Borghorst, Westfalen. Er übersetzte u.a. Antonio Muñoz Molina, Luis Sepúlveda und Rolando Villazón aus dem Spanischen. Ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis des spanischen Kulturministeriums und dem Jane Scatcherd-Preis.
Impressum
Die spanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Los vencejos» bei Tusquets Editores, S.A. Barcelona.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Los vencejos» Copyright © 2021 by Fernando Aramburu
Published by agreement with Tusquets Editores, Barcelona, Spain
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Julia Davila-Lampe, John Russell/Getty Images; iStock
ISBN 978-3-644-01370-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für die Hübsche
August
1
Es kommt der Tag, an dem man, auch wenn man noch so begriffsstutzig ist, bestimmte Dinge zu begreifen lernt. Bei mir geschah das in der Mitte meiner Jugend, kurz danach vielleicht, denn ich war ein Spätentwickler, ein unfertiger Junge, wie Amalia sagte.
Dem anfänglichen Befremden folgte die Enttäuschung, und danach ist alles nur noch ein Dahinschleppen durch die Niederungen des Lebens gewesen. Es gab Zeiten, in denen ich mich mit einer Schnecke verglich. Ich sage das nicht, weil ich heute einen schlechten Tag habe, und auch nicht wegen ihrer schleimigen Hässlichkeit, sondern ausschließlich wegen der Art, wie diese Viecher in ihrem trägen, eintönigen Leben dahinkriechen.
Ich mache es nicht mehr lange. Ein Jahr noch. Warum ein Jahr? Keine Ahnung. Aber das ist mein absolutes Limit. Auf dem Höhepunkt ihres Hasses warf Amalia mir immer vor, dass ich nie reif geworden bin. Von Verbitterung zerfressene Frauen werfen einem solche Kränkungen an den Kopf. Meine Mutter hasste meinen Vater, und das kann ich verstehen. Er hasste sich auch selbst, daher seine Neigung zu Gewalttätigkeit. Ein schönes Vorbild sind sie für meinen Bruder und mich gewesen! Sie züchtigen und bestrafen uns, zerbrechen uns innerlich, und dann erwarten sie, dass wir unseren Verstand zu gebrauchen wissen, dankbar und liebevoll sind und das Leben meistern.
Ich mag das Leben nicht. Selbst wenn es so schön ist, wie Sänger und Dichter immer behaupten, ich mag es nicht. Und komme mir keiner mit seiner Begeisterung für Sonnenuntergänge, für Musik oder für die Streifen von Tigern. Scheiß auf diese ganze Dekoration. Für mich ist das Leben eine abnorme Erfindung, schlecht ausgedacht und noch schlechter umgesetzt. Ich wünschte mir, dass Gott existiert, damit ich ihn zur Rechenschaft ziehen könnte. Damit ich ihm ins Gesicht sagen könnte, was er ist: ein Stümper nämlich. Wahrscheinlich ist Gott ein perverser alter Mann, der aus himmlischen Höhen zuschaut, wie seine Geschöpfe sich paaren, sich bekriegen und gegenseitig auffressen. Die einzige Entschuldigung für Gott ist, dass es ihn nicht gibt. Und selbst so weigere ich mich, ihm Absolution zu erteilen.
Als Kind habe ich gerne gelebt. Sehr gerne sogar, obwohl es mir nicht bewusst war. Kaum lag ich abends im Bett, kam Mama und gab mir einen Kuss auf die Wimpern, bevor sie das Licht ausmachte. Am meisten mochte ich an meiner Mutter ihren Geruch. Mein Vater roch schlecht. Nicht schlecht im Sinne von Gestank; vielmehr hatte er, selbst wenn er einen Duft benutzte, einen Geruch an sich, der mich unwillkürlich abstieß. Eines Tages (ich muss sieben oder acht gewesen sein), Mutter lag mit einer ihrer Migränen im Bett, saßen wir in der Küche, und ich weigerte mich, eine gebratene Leber zu essen, bei deren Anblick allein ich schon Brechreiz bekam; da holte er wutentbrannt seinen riesigen Schwengel heraus und sagte mir: «Wenn du eines Tages auch so einen haben willst, musst du diese Leber essen und noch viele, viele mehr.» Ich weiß nicht, ob er das bei meinem Bruder auch einmal gemacht hat. Mein Bruder wurde zu Hause mehr verwöhnt als ich. Vermutlich weil meine Eltern ihn für kränklich hielten. Er ist gegenteiliger Meinung und glaubt, dass ich ihr Lieblingssohn war.
In der Jugend gefiel mir das Leben nicht mehr so gut, aber es gefiel mir noch. Heute tut es das nicht mehr, und ich gedenke nicht, der Natur die Entscheidung zu überlassen, wann ich ihr die mir von ihr geliehenen Atome zurückzugeben habe. Mein Plan ist, mir innerhalb eines Jahres das Leben zu nehmen. Ich habe sogar schon die genaue Zeit festgelegt: 31. Juli, Mittwoch, nachts. Das ist die Frist, die ich mir gesetzt habe, um meine Angelegenheiten zu regeln und herauszufinden, warum ich nicht mehr weiterleben will. Ich hoffe, dass mein Entschluss unwiderruflich ist. Im Moment ist er das.
Es gab Zeiten, da wollte ich ein Mann sein, der einem Ideal nacheifert, was mir aber nicht gelungen ist. Ebenso wenig ist es mir vergönnt gewesen, wahre Liebe zu erleben. Ich habe sie mit Geschick geheuchelt, manchmal aus Mitleid, manchmal für ein paar freundliche Worte, ein bisschen Gesellschaft oder einen Orgasmus, so wie es, will mir scheinen, alle anderen auch tun und immer schon getan haben. Möglicherweise hat mein Vater mir bei der Szene mit der gebratenen Leber seine Liebe zeigen wollen. Das Problem ist, dass man Dinge nicht begreift, weil man sie einfach nicht wahrnimmt, obwohl sie einem direkt vor der Nase stehen; außerdem, Liebe unter Zwang funktioniert bei mir nicht. Bin ich ein armer Mensch, wie Amalia immer sagte? Wer ist das nicht? Tatsache ist einfach, dass ich mich nicht so akzeptiere, wie ich bin. Es macht mir nichts aus, diese Welt zu verlassen. Ich habe immer noch ein gefälliges Gesicht, trotz meiner vierundfünfzig Jahre, und ein paar Tugenden, die ich nicht zu nutzen gewusst habe. Ich bin gesund, verdiene genug, und zu Heiterkeit finde ich leicht. Vielleicht hat mir ein Krieg gefehlt, genau wie Papa. Papa hat seinen unerfüllten Wunsch, sich im Kampf zu beweisen, in Gewalt gegen die Seinen umgemünzt, mit allem, was dazugehörte, und auch gegen sich selbst. Noch so ein armer Mensch.
2
Wir verbrachten unsere Sommerferien alle vier in einem Küstenort in der Nähe von Alicante. Papa – gescheiterter Schriftsteller, gescheiterter Sportler, gescheiterter Gelehrter – verdiente sein Geld mit Kursen an der Universität; Mama – klugerweise entschlossen, sich aus der ökonomischen Abhängigkeit ihres Mannes zu befreien – arbeitete als Angestellte auf einem Postamt. Bezüglich der Finanzen ging es uns so gut, wie es einer mittelständischen Familie in Spanien nur gehen kann. Wir hatten einen blauen Seat 124 aus erster Hand; Raulito und ich besuchten eine Privatschule; im August konnte sich unsere Familie eine Ferienwohnung mit Terrasse und gemeinsamem Swimmingpool in Strandnähe leisten. Ich will damit sagen, dass wir alles besaßen, um vernünftigerweise glücklich zu sein. In dem Alter, vierzehn Jahre, dachte ich, dass wir das wären.
Im September musste ich eine Klassenarbeit wiederholen. Mit meinem Zeugnis in der Hand gab Mama ein paar vorwurfsvolle Seufzer von sich und bekam gleich darauf Migräne, und Papa, dessen Reaktionen primitiver waren, verpasste mir eine Ohrfeige, nannte mich einen Dummkopf und vertiefte sich wieder in seine Zeitung. Nichts davon beeinträchtigte meine Freude am Leben. Tatsächlich wünschte ich mir schon als Kind, später einmal Vater zu sein, um meine Kinder schlagen zu können. Das hatte ich bereits früh als bevorzugte Erziehungsmethode verinnerlicht. Später war ich nicht einmal imstande, mit Nikita zu schimpfen, und so ist uns der Junge auch geraten.
In den Ferien, an die ich mich heute Abend erinnere, die des Sommers mit der verpatzten Klassenarbeit, wurde ich Zeuge einer Szene, die in meinem Kopf ein rotes Alarmlämpchen aufleuchten ließ. Als wir eines Nachmittags vom Minigolfspielen heimkamen, zog ich Raulito im Nacken das Unterhemd zurück und ließ eine Eidechse hineingleiten. Was Kinder so machen. Er schrak zusammen. Es war für ihn nicht leicht, mich als Bruder zu haben. Einmal, da waren wir schon erwachsen, warf er mir am Ende einer Familienfeier vor, ich hätte ihm die ganze Kindheit versaut. Ich starrte ihn an. Was tun? Ich wählte den bequemsten Weg und bat ihn um Verzeihung. «Das kommt aber früh», knurrte er, von lang brütendem Hass zerfressen.
Als er die Eidechse in seinem Rücken spürte, begann Raulito vor Schreck so komisch herumzuhüpfen, wie ich es erhofft hatte. Dabei muss er wohl das Gleichgewicht verloren haben und stürzte auf dem steinigen Weg, der neben einer Zitronenplantage verlief, zu Boden. Er stand gleich wieder auf; aber als er seine blutenden Knie sah, fing er laut an zu heulen. Ich befahl ihm, still zu sein. War ihm nicht klar, dass er mich in Schwierigkeiten brachte? Mama hörte sein Geschrei in der Ferienwohnung und kam besorgt angelaufen, Papa trottete hinterdrein, verärgert, nehme ich an, weil er durch einen blöden familiären Zwischenfall in seiner Zeitungslektüre, seiner Siesta oder was immer gestört worden war. Mama sah das Blut, und ohne zu fragen, was passiert war, klatschte sie mir eine. Irgendwie lustlos ohrfeigte mich Papa auch gleich. In der Regel schlug Mama zorniger zu, richtete aber weniger Schaden an. Sie brachten Raulito zur Rote-Kreuz-Station an der Strandpromenade. Eine Stunde später kam er mit einem Pflaster auf jedem Knie und eisverschmiertem Mund in die Wohnung zurück. Um später zu behaupten, er sei nicht der Eltern Lieblingskind gewesen.
Ich wurde ohne Abendessen ins Bett geschickt. Die drei saßen schweigend am Tisch, spießten große Scheiben Tomaten mit Olivenöl und Salz auf ihre Gabeln, und ich beobachtete sie, schon im Schlafanzug, heimlich oben von der Spindeltreppe. Ich wollte meinem Bruder ein Zeichen geben, dass er mir später etwas zu essen hochbrächte, doch der Blödmann schaute kein einziges Mal zu mir hin. Auf dem Küchenherd dampfte ein Topf mit Suppe. Mama schenkte Raulito einen Teller voll ein. Mein Bruder beugte sich darüber, als wollte er den Dampf einatmen, der ihm ins Gesicht schlug. Und ich in meinem Versteck brach vor Neid und Hunger beinahe zusammen. Mama ging wieder zum Suppentopf, diesmal mit Papas Teller, und als sie ihn gefüllt hatte, spuckte sie unauffällig hinein. Hineinspucken ist nicht das richtige Wort. Vielmehr ließ sie ihre Spucke langsam hineinfallen. Sie hing ihr einen Moment an den Lippen, bevor sie sich löste. Dann rührte sie die Suppe mit dem Löffel um und stellte den Teller vor Papa auf den Tisch. Am liebsten hätte ich ihn oben von der Schneckenstiege aus gewarnt; aber mir war klar, dass ich erst einmal verstehen musste, was da vor sich ging. Meine Eltern stritten oft. Hatten sie sich wieder gestritten und aßen deswegen wortlos, ohne einander anzusehen? Ich fragte mich, ob meine Mutter mir auch schon mal ins Essen gespuckt hatte. Vielleicht war Mamas Speichel ja nahrhaft; doch wenn dem so war, warum hatte sie dann Raulitos Teller übergangen? Warum den armen Engel benachteiligen? Möglicherweise war dem Ehemann in die Suppe spucken ein alter Brauch, den sie aus ihrer Kindheit kannte, den sie bei ihrer Mutter oder einer ihrer Tanten beobachtet hatte.
3
Und falls mich im entscheidenden Moment nicht der Mut verlässt, was wird dann aus Pepa? Ich kann sie nicht Humpel aufhalsen, der schon genug für mich tut und sie manchmal über Nacht zu sich nimmt. Gut, dass ich mir ein Jahr Zeit zugestanden habe, um diese und andere wichtige Fragen zu klären. Pepa ist vor Kurzem dreizehn Jahre alt geworden. Es heißt, man muss das mit sieben multiplizieren, um auf das entsprechende Menschenalter zu kommen; wobei sicher nicht alle Hunderassen die gleiche Lebenserwartung haben. Als alte Dame wäre Pepa jetzt in den Neunzigern. Wenn Menschen in dem Alter noch so herumspringen könnten wie sie! Eigentlich gehört sie Nikita. Deswegen könnte ich sie, kurz bevor ich meinem Leben ein Ende setze, an seine Wohnungstür im besetzten Haus anbinden. Eine andere Lösung fällt mir im Moment nicht ein.
Amalia weigerte sich hartnäckig, ein Haustier in der Wohnung zu halten. Wir hatten nie eines gehabt. Als die Idee mit dem Hund aufkam, zählte sie alle möglichen Nachteile auf. Hunde machen Dreck, brauchen permanente Aufmerksamkeit, kriegen Flöhe, kosten Geld, werden krank, geraten mit anderen Hunden aneinander, bellen, beißen, pinkeln, kacken, stinken. Du gewinnst sie lieb, und ihr Tod stürzt dich in tiefe Trauer. Ich glaube, Amalia hätte nicht einmal davor zurückgeschreckt, mit den Kosten für eine tödliche Spritze zu argumentieren.
Anfangs hielt ich es auch für keine gute Idee, einen Hund ins Haus zu holen. Der Junge kam immer mit dem Argument, sein bester Schulfreund habe von seinen Eltern einen geschenkt bekommen, und er wolle nicht zurückstehen. Irgendwann merkte ich, dass Nikita den Druck erhöhte, wenn er mit mir allein war. Da wurde mir klar, dass er mich hinter dem Rücken der unnachgiebigen Mutter für seine Sache zu gewinnen suchte. Ich war für ihn also das schwächste oder am leichtesten zu knackende Glied des Familienvorstands. Er hat das nie so gesagt; aber seine Gedanken waren leicht zu erraten. Weit davon entfernt, mich darüber zu ärgern, fand ich es anrührend. Im Grunde war da keine Verachtung für den Vater, sondern eine Art Identifizierung mit ihm. Gefährten in der Schwäche, würden wir seine und meine Ziele nur erreichen, wenn wir unsere Kräfte gebündelt gegen das dominante Weib einsetzten. Also bündelten wir sie. Von nun an war ich es, der am liebsten einen Hund haben wollte. Um das durchzusetzen, gab ich mich analytisch, didaktisch, oberlehrerhaft. Und scheiterte. Ich bat Marta Gutiérrez um Rat, die einzige Person im Lehrerzimmer, zu der ich so viel Vertrauen hatte, dass ich sie in einer privaten Angelegenheit befragen konnte. Ob sie eine Idee habe, fragte ich sie, wie man eine eigensinnige Frau bei einem Familienstreit zum Einlenken bewegen könne. Sie wollte wissen, ob meine Frau gemeint sei. «Nein, ganz allgemein.» «Es gibt keine ganz allgemeinen Frauen.» «Also gut, ja, meine.» Ich erzählte ihr das mit dem Hund und beschrieb ihr in groben Zügen Amalias Temperament. Sie empfahl mir, es mit moralischer Intelligenz zu versuchen, worauf ich ihr antwortete, ich hätte nur Chinesisch verstanden. Ich bräuchte nicht mehr zu tun, sagte sie, als Amalia ein schlechtes Gewissen zu machen. Wie? Sowohl mein Sohn als auch ich selbst sollten uns melancholisch und unglücklich geben und sie glauben lassen, dass sie daran schuld sei. Dann würde sie sich möglicherweise im Unrecht fühlen, oder zumindest ärgerlich auf sich sein, würde Zweifel bekommen und am Ende nachgeben, allein schon um des lieben Friedens willen. Laut Marta Gutiérrez funktioniert diese Strategie nicht immer; aber es versuchen schadete ja nichts.
Sie funktionierte; allerdings um den Preis, dass es eine Reihe von Bedingungen und Regeln zu akzeptieren galt, die in Amalias kategorischer Ansage gipfelten, sie werde sich nicht eine Sekunde um das Tier kümmern. Es nicht ausführen, ihm nicht zu fressen geben, nichts. Zum Beweis, dass sie es ernst meinte, weigerte sie sich am ersten Tag, die Hündin überhaupt an sich heranzulassen. Der kleine Vierbeiner verstand die abwehrenden Gesten natürlich nicht und wollte Amalia unbedingt auf den Schoß springen, wedelte als Freundschaftsangebot mit dem Schwanz. «Willst du sie nicht streicheln?», fragte ich Amalia. Als Antwort zeigte sie mit dem Finger: «Willst du das nicht wegmachen?» Die Hündin hatte auf den Teppich gepinkelt. Zuerst mit einem nassen Lappen und danach mit dem Haartrockner schaffte ich es, dass nichts zurückblieb. Nicht einmal ein Geruch. Der Urin von Hundewelpen ist so gut wie geruchlos. Amalia, misstrauisch, ließ sich auf alle viere nieder, um sich zu vergewissern. Für die Namen, die Nikita und mir einfielen, hatte sie nur Spott übrig. «Dann gib du ihr einen», forderten wir sie auf. «Pepa», sagte sie knapp. «Wieso Pepa?» «Wieso nicht?» Und das war dann der Name, den sie bekam.
4
Die erste anonyme Mitteilung, die ich im Briefkasten fand, war mit Hand geschrieben, der gesamte Text in Großbuchstaben. Irgendein kleinlicher Nachbar, dachte ich. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass diese Notiz der Anfang einer Serie war, die sich über annähernd zwölf Jahre hinziehen sollte. Ich knüllte das Papier zu einer Kugel zusammen und warf sie auf der Straße in eine Pfütze. Ich erinnere mich nur noch, dass es eine Mahnung von knapp zwei Zeilen war, weil ich den Hundekot nicht beseitigt hatte. In einem der Sätze war das Wort Schweinzu lesen. Dabei habe ich immer mindestens zwei Plastiktüten in der Tasche, muss allerdings gestehen, dass es anfangs (später nicht mehr) vorkommen konnte, dass ich in Gedanken versunken oder mit ihnen beim Unterricht des nächsten Tages war, oder schlicht zu faul, mich zu bücken, und in der Überzeugung, von niemandem gesehen zu werden, Pepas Exkremente liegen ließ, wo sie gerade lagen. Möglicherweise war der Zettel ohne Namen und Datum für Nikita bestimmt, der den Hund auch manchmal ausführte. Amalia habe ich kein Wort von der Sache gesagt.
5
Ich weiß nicht mehr, warum wir Anfang der Siebzigerjahre alle vier nach Paris gefahren sind und nicht, beispielsweise, nach Segovia, Toledo oder sonst eine Stadt, die näher lag und wo die Leute unsere Sprache sprechen. Papa radebrechte etwas Französisch, Mama verstand kein Wort. Ein möglicher Grund für die Reise war vielleicht, dass wir die Nachbarn beeindrucken oder den Verwandten zeigen wollten, was für eine harmonische Familie wir waren und dass wir uns eine solche Fahrt leisten konnten.
Es gab einen Fluss. Ich weiß nicht, ob ich damals seinen Namen kannte oder nicht, ist ja auch egal. Ich weiß nicht mehr, über welche Brücke wir gingen und wohin wir wollten. Nicht vergessen habe ich, dass ich sechs oder sieben Schritte zurückgeblieben war. Vor mir gingen Mama und Papa mit Raulito in der Mitte. Sie hielten ihn an den Händen und schienen durch ihn miteinander verbunden zu sein. Ich hatte da das Gefühl, dass sie ihn lieber mochten als mich. Schlimmer noch; dass sie ihn mochten und mich nicht, oder dass sie sich um ihn kümmerten und ich ihnen egal war. Ich konnte von einem Auto oder Motorrad angefahren werden, und sie würden, ohne von dem Unfall etwas zu merken, einfach weitergehen. Ich litt unter der Vorstellung, dass ich ihnen völlig gleichgültig war. Und dann war da das leicht zu erklimmende Brückengeländer und unten der Fluss mit seinem trüben, ruhig dahinfließenden Wasser, in dem sich die Nachmittagssonne spiegelte. Ich erinnere mich noch genau an das Geräusch des Aufpralls und wie sehr ich von dem Gefühl jäher Kälte überrascht war. Im Fallen hörte ich die Schreie einer Frau.
Noch bevor ich Wasser in den Mund bekam, zogen mich kräftige Hände an die Oberfläche. Papa verlor seine Schuhe im Fluss. In den folgenden Jahren erzählte er immer voller Stolz von dem, was er für die größte Heldentat seines Lebens hielt. Im Grunde fand er es auch wunderbar, dass seine Uhr dabei kaputtgegangen war; eine offenbar wertvolle Armbanduhr, die einmal seinem Vater gehört hatte. Bei dieser Geschichte brach immer die heroische Ader in ihm durch. Als er zwischen Uhr und Sohn wählen musste, hatte er nicht eine Sekunde gezögert.
Weder Mama noch er schimpften mit mir. Und Mama war so außer sich und so dankbar, dass sie inmitten all der Leute, die uns auf dem Uferweg umringten, den tropfnassen Papa umarmte und sein Gesicht mit spitzlippigen Küsschen bedeckte. Papa machte gern den Scherz, dass ich zwei Mal geboren worden sei. Das erste Mal hatte Mama mir das Leben geschenkt, das zweite Mal er.
Ich erinnere mich, dass im Hotelzimmer Papas schwarze Brieftasche, sein Reisepass, französische Geldscheine und andere Papiere, die ihm gehörten, auf den Möbeln zum Trocknen ausgelegt waren. Abends feierten wir in einem Restaurant, dass ich nicht ertrunken war, und Papa trank allein eine ganze Flasche Wein. Auf seiner Hemdbrust zeigte sich ein roter Fleck; doch diesmal hielt Mama es wohl nicht für angebracht, ihn deswegen zu tadeln.
6
Gestern habe ich Mama besucht. Wie üblich sah ich vorher nach, ob Raúls Auto auf dem Parkplatz stand. Wenn es da steht, gehe ich nicht hinauf. Bei anderen Gelegenheiten macht es mir nichts aus, mich mit ihm zu unterhalten; aber wenn ich Mama besuche, will ich sie ganz für mich. Wenn dem nichts entgegensteht, gehe ich einmal die Woche ins Altenheim, doch in letzter Zeit, muss ich gestehen, bin ich etwas nachlässig geworden. Es ist mir wichtig, dass Mama jederzeit anständig behandelt wird. Momentan können wir uns nicht beschweren. Ich verlange oft Auskunft über ihren Gesundheitszustand und sorge dafür, dass das Personal mitbekommt, wie ich das Zimmer inspiziere und im Kleiderschrank und in Mutters Sachen herumschnüffle. Raúl macht es genauso. Es war seine Idee, uns wie Aufpasser aufzuführen, selbst um den Preis, für Nervensägen gehalten zu werden, und ich habe zugestimmt. Es gibt Alte im Heim, die niemals Besuch bekommen. Man hat sie dahin gebracht, wie man alten Plunder entsorgt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pfleger sich mit ihnen weniger Mühe geben als mit anderen, deren Angehörige jederzeit auftauchen, sich bei der Heimleitung beschweren oder in der Zeitung oder den sozialen Netzwerken Kritik anbringen können, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
Schon seit einer ganzen Weile erkennt Mama uns nicht mehr. Für Raúl war das anfangs ein harter Schlag; er wollte sich sogar wegen Depressionen krankschreiben lassen. Kann sein, dass es andere Gründe für seinen Gemütszustand gibt, die durch das Erlöschen von Mamas Verstand verschlimmert worden sind. Ich bin aber nicht sicher und habe auch keine Lust, ihn danach zu fragen. Ich kann auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass mein Bruder sich das mit dem Krankschreiben nur ausgedacht hat, um mir irgendetwas zu beweisen, das ich übersehen oder nicht bemerkt habe, womit am Ende jedenfalls klargestellt würde, dass er bei einem Problem, in einer bestimmten Angelegenheit oder Situation richtig gehandelt hatte und ich falsch.
Mamas geistiger Verfall kam allmählich. So wie ich das verstehe, enthebt sie die Alzheimerkrankheit der sogenannten Tragik des Lebens. Man muss nur sehen, wie sie sich der Apathie ergibt und langsam erlischt. Raúl hat ihr bei Gelegenheit ein Foto von ihr mitgebracht für den Fall, dass sie einmal einen lichten Moment hat. Da steht das gerahmte Ding jetzt, beansprucht Platz auf dem Tisch und ist so nutzlos wie ein ausgestopftes Tier.
Den Umständen entsprechend geht es ihr gut. Ihr Rücken ist ein bisschen krumm, und sie ist sehr schmal geworden. Gestern, ich war auf dem Weg zum Fahrstuhl, rief mir eine Pflegerin zu, meine Frau Mutter sei gerade eingeschlafen. Daraufhin bin ich umgekehrt, habe mich an ihr Bett gesetzt und sie eine Weile betrachtet. Ihre Gesichtszüge sind ganz entspannt. Darüber bin ich sehr zufrieden. Wenn ich sie leiden sähe, würde ich verrückt werden. Sie atmete ruhig, und auf ihren Lippen glaubte ich den Anflug eines Lächelns zu erkennen. Vielleicht sieht sie im Traum Bilder aus der Vergangenheit; allerdings bezweifle ich, dass sie ihnen einen Sinn zuzuschreiben vermag.
Ich habe das Gefühl, dass Mama nächstes Jahr um diese Zeit noch am Leben sein wird. Wenn ihr dann jemand von meinem Hinscheiden berichtet, wird sie es nicht verstehen. Sie wird nicht einmal bemerken, dass ich sie nicht mehr besuche. Einer der Vorteile von Alzheimer.
Irgendwann beugte ich mich zu ihr und flüsterte ihr ins Ohr: «Am letzten Tag im Juli nächsten Jahres werde ich mir das Leben nehmen.»
Mutter schlief in aller Ruhe weiter.
Ich fügte hinzu: «Einmal habe ich gesehen, wie du Papa in die Suppe gespuckt hast.»
7
Ein Interview mit einem U-Bahn-Zugführer fand ich sehr interessant. Es nimmt eine ganze Zeitungsseite ein. Es geht dabei um die Menschen, die sich vor den Zug werfen, und um die psychischen Folgen, die diese anscheinend gar nicht so selten vorkommende Tat bei dem Menschen hinterlässt, der den Selbstmord aus kürzester Entfernung miterlebt und ihn nicht verhindern kann, selbst wenn er sofort die Bremsen betätigt. Und nicht alle Selbstmörder erreichen ihr Ziel. Die Statistiken besagen, dass mehr als die Hälfte von ihnen, oft mit grauenhaften Verstümmelungen, überlebt. Als ich das gelesen habe, lief es mir kalt den Rücken hinunter. Die Vorstellung, gelähmt oder ohne Beine im Rollstuhl zu sitzen, ist nichts, was mich besonders euphorisch stimmt. Wer sollte sich dann um mich kümmern?
Nachmittags, in Alfonsos Bar, habe ich Humpel von meinem Plan erzählt. Ich wollte unbedingt eine Meinung hören, die nicht meine eigene war, und er ist nun mal mein einziger Freund. Humpels Reaktion kann man nicht anders als euphorisch bezeichnen. Dabei hatte ich damit gerechnet, dass er sich entsetzt zeigen und mich mit allen Mitteln von meinem Plan abzubringen versuchen würde.
Einen Moment lang habe ich gedacht, dass er mich auf den Arm nimmt. Ich habe ihn geradeheraus gefragt. Da hat er mir gestanden, dass auch er seit ein paar Jahren mit dem Gedanken liebäugelt, sich das Leben zu nehmen. Gründe hat er natürlich genug; angefangen mit seinem körperlichen Problem, obwohl die unter dem Hosenbein und im Schuh verborgene Prothese das ganz gut kaschiert.
Humpel kannte das Interview nicht. Da die Zeitung in der Bar nicht auslag, obwohl sie sie eigentlich haben, jedenfalls so lange, bis der Flegel vom Dienst sie mitnimmt, ist er schnell nach draußen und hat sich am Kiosk eine gekauft. Ich kenne die Vorliebe meines Freundes für morbide Themen, einschließlich natürlich der für Selbstmorde oder Freitode, die von ihm bevorzugte Bezeichnung dafür. Er behauptet, alles, was damit in Zusammenhang steht, gründlich studiert und eine Menge Bücher zu dem Thema gelesen zu haben.
Wir sind das Interview gemeinsam durchgegangen. Der Interviewte, ein fünfundvierzigjähriger Mann mit vierundzwanzig Jahren Berufserfahrung, beklagt sich, dass in den Medien immer von denen die Rede ist, die sich vor den Zug geworfen haben, aber nie von dem Zugführer. Sein erster Selbstmordfall war der eines siebzehnjährigen Mädchens. Danach war er neun Monate lang krankgeschrieben. Er berichtet in aller Ausführlichkeit von ähnlichen Fällen. Humpel neben mir las und kommentierte lustvoll die Antworten des Interviewten. Er hat angeboten, mir bei meinem Selbstmord zu assistieren. Er will sogar darüber nachdenken, ob er mich bei dem Unterfangen begleitet. Seine Begründung: «Ich will nicht allein bleiben.» Sein Gesicht strahlt dabei vor Begeisterung. Dann wird er plötzlich ernst. Er beschwört mich, mich nicht vor die U-Bahn zu werfen. «So eine Sauerei kann man den Zugführern nicht antun!» Mit dem Zeigefinger deutet er auf eine Passage des Interviews, in der der Befragte erzählt, dass er in seinen Träumen immer noch den Blick eines alten Mannes im Moment des Aufpralls vor Augen hat.
Humpel weiß nicht, dass ich ihn in meinen privaten Aufzeichnungen Humpel nenne.
8
Jemand hat gegen Mitternacht Mama angerufen. Irgendein Bekannter oder Verwandter, vielleicht jemand aus der Nachbarschaft hat sie, aus meiner heutigen Perspektive als Erwachsener gesehen, mit nicht ganz lauteren Absichten aus dem Bett geholt.
Fange ich jetzt schon wieder mit Kindheitserinnerungen an? Am Ende stimmt es ja vielleicht doch, dass, wenn man sein Ende kommen sieht, unwillkürlich das ganze Leben vor einem abläuft. Das habe ich mehr als einmal gelesen und gehört. Ich dachte immer, das sei Unfug; allmählich glaube ich das nicht mehr. Aber weiter.
Raulito und ich schliefen in unserem gemeinsamen Zimmer, jeder in seinem Bett, und der nächste Tag war für uns ein normaler Schultag. Ich dürfte damals neun gewesen sein. Jedenfalls war es nach unserer Parisreise. Plötzlich ging das Licht an. Mama, barfuß und im Nachthemd, rüttelte uns wach und trieb uns an, uns anzuziehen. Todmüde fragte ich sie, was passiert sei. Ich bekam keine Antwort.
Minuten später hasteten wir drei durchs Treppenhaus nach unten, Mama mit Raulito an der Hand, ich hinterdrein. Ich vermute, dass Mama nicht wollte, dass die in den Nachbarwohnungen den ratternden Fahrstuhl hörten, oder sie hatte einfach keine Geduld, darauf zu warten. Auf jedem Treppenabsatz drehte sie sich um und mahnte mich mit dem Finger auf den Lippen, still zu sein, dabei war ich still wie eine Maus.
Auf der Straße schlug uns winterliche Kälte ins Gesicht. Der Himmel war tiefschwarz. Im Licht der Laternen sah man kaum Menschen. Aus unseren Mündern kam dampfender Atem. Nach einer Weile gelang es Mama, vom Straßenrand aus ein Taxi anzuhalten. Wir setzten uns alle drei auf die Rückbank, Mama in der Mitte. Ich wusste nicht, wohin wir fuhren und wozu überhaupt, und Mama gab mir einen Klaps, damit ich aufhörte, Fragen zu stellen. Sie stieß das Kinn in Richtung Hinterkopf des Taxifahrers, und da begriff ich, dass der Mann nicht hören sollte, was wir sprachen. Mich überkam das beunruhigende Gefühl, dass wir aus unserer Wohnung geflohen waren, und mich quälte der Gedanke, dass ich für immer mein Spielzeug verloren haben sollte. Ärgerlich. Wenigstens eines hätte ich mitnehmen können! Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Raulito war wieder eingeschlafen. Mama hob ihn auf den Schoß und legte die Arme um ihn.
Wir hielten vor einer Bar, in welcher Straße, könnte ich nicht sagen. Mama sagte, wir sollten still vorm Eingang stehen bleiben und uns nicht von der Stelle rühren, gleich käme jemand und würde uns wieder nach Hause bringen. Dann zog sie die Tür des Taxis zu und fuhr davon, ließ meinen Bruder und mich allein und frierend mitten in der Nacht auf dem schmalen Gehweg stehen. Raulito fragte mich, ob ich ihm für ein Weilchen meine Handschuhe geben könnte. Ich sagte ihm, mir wäre auch kalt und warum er seine nicht mitgenommen hätte. Ich fragte ihn, ob er sich fürchte. Er sagte Ja. Ich nannte ihn Feigling, Memme, Angsthase, Pfeffernase.
Ich weiß nicht mehr, wie lange mein Bruder und ich vor dieser Bar standen; mindestens zwanzig Minuten, in denen wir keinen Menschen herauskommen oder hineingehen sahen. Hinter den Fensterscheiben blinkten rote Glühbirnen, das ist alles, woran ich mich erinnere. Schließlich ging die Tür auf. Ein Schwall von Musik, Stimmen und Gelächter drang an unsere Ohren. Ein hochgewachsener Mann kam herausgestolpert und hielt eine Frau im Arm, deren Brust er zu küssen versuchte, was ihm aber nicht gelang, weil sie sich seinen Übergriffen lachend entzog. Raulito erkannte den Mann sofort. «Papa!», rief er und rannte auf ihn zu.
9
Vergangene Nacht hat Humpel mich angerufen, als ich schon schlief. Ich erschrak, weil ich dachte, Nikita hätte einen Unfall gehabt oder säße, mit dem Blut eines anderen befleckt, auf dem Polizeirevier in einer Gefängniszelle. Ich frage Humpel, ob er weiß, wie spät es ist. Ich war so wütend, als ich seine Stimme hörte, dass mir beinahe sein Spitzname herausgerutscht wäre. Ja, ich möge entschuldigen; aber da er morgen in Urlaub fährt, ruft er mich lieber jetzt noch an, weil er glaubt, dass mich interessiert, was er mir zu erzählen hat.
Seit ich ihm (zur falschen Zeit!) meinen Vorsatz für das kommende Jahr verraten habe, tut er nichts anderes mehr, als Informationen über den Freitod zusammenzutragen. Freitod, das ist jetzt sein Steckenpferd. Man merkt, dass ihn das Thema begeistert, dass er sich jede Information, jeden Begriff, jedes Zitat auf der Zunge zergehen lässt. Ich glaube allmählich, dass er mich nicht ernst nimmt. Und wenn ich ihm sagte, ich hätte den Plan verworfen, in dem ich nur noch den Ausfluss einer vorübergegangenen Gefühlsduselei sähe? Auf diese Weise könnte ich seine lästige, gnadenlose und natürlich völlig kindische Begeisterung vielleicht von mir fernhalten.
Er erzählte mir, in einigen mittelalterlichen Reichen seien die Leichen von Selbstmördern verstümmelt worden, als Bestrafung. Die Köpfe traf es dabei am schlimmsten. Während er spricht, schaue ich auf den Wecker. Viertel nach zwölf. Am liebsten würde ich auflegen; tue es aber nicht. Humpel ist mein einziger Freund. Ich hörte ihm weiter zu. Sie banden den Kopf an ein Reittier und schleiften ihn durch die Straßen, als Warnung für die Lebenden. Danach wurde er auf dem Marktplatz zur Schau gestellt oder an einen Baum gehängt. Was ich davon halte.
Wieder im Bett, konnte ich keinen Schlaf mehr finden; nicht wegen des Vortrags, den Humpel mir gehalten hatte, und der mir mit seinen Schauerlichkeiten und überhaupt schlicht gestohlen bleiben konnte, sondern wegen einer Sache, die mich in letzter Zeit zunehmend beschäftigt. Ich bin mir nämlich unsicher, ob ich nach den Schulferien weiter unterrichten soll oder nicht. Was für einen Sinn hat es, weiter zu arbeiten und die verhassten Kollegen zu ertragen, bis auf zwei oder drei, besonders die Direktorin, die mir verhassteste von allen, sowie diese Ungeheuer, die man Schüler nennt? Ich könnte meine Ersparnisse dafür verwenden, es mir ein Jahr lang richtig gut gehen zu lassen. Ich könnte in Länder reisen, die ich immer schon mal besuchen wollte. Das Problem ist, dass ich wegen Pepa zu Hause bleiben muss. Für längere Zeit kann ich sie Humpel nicht zumuten. Ich will auch Nikita nicht allein lassen. Und Mama nicht.
10
Immer wenn ich auf der Straße, in der U-Bahn oder sonst wo einen tätowierten Menschen sehe, muss ich an Nikita denken. Als das anfing, schien es mir weder gut noch schlecht, dass mein Sohn bei der Mode mitmachte, sich Zeichnungen in die Haut zu ritzen; davon abgesehen bemühte ich mich in der wenigen Zeit, die wir zusammen verbrachten, um eine konfliktfreie Beziehung zu ihm.
Vorschriften soll seine Mutter ihm machen, zu dem Zweck hat sie ja – mit anwaltlicher Hilfe – das Sorgerecht für sich beantragt, das ich ihr gar nicht streitig machte. Der Sohn für sie, der Hund für mich. Für mich stellt sich nicht eine Sekunde die Frage, wer bei dieser Aufteilung den Kürzeren gezogen hat. Nikitas Naivität hat ihn zu offenen Worten verleitet, und er hat mir einige von Amalias Geheimnissen verraten: «Mama spricht schlecht über dich», sagte er. Und ein anderes Mal: «Mama bringt Frauen mit nach Hause und geht mit ihnen ins Bett.»
Der Junge war sechzehn, als er sich zum ersten Mal tätowieren ließ, ohne mütterliche Genehmigung. Ich habe das unvorteilhafte Ergebnis von Anfang an gelobt. Mir ist lieber, dass er mich als Kumpel sieht, denn als repressiven Vater. Schlechten Geschmack kann man ihm nicht nachsagen. Ich bin sogar versucht, ihm eine poetische Absicht zuzugestehen, da er als Motiv ein Eichenlaubblatt gewählt hat; wenngleich die Zeichnung so klein ist, dass man sie nur auf kurze Entfernung erkennen kann. Nach drei Metern wird sie zu einem undefinierbaren Fleck. Das Problem ist die Stelle, die er sich für die Tätowierung ausgesucht hat, mitten auf der Stirn. Als ich sie zum ersten Mal sah, musste ich mir auf die Zunge beißen, um nicht loszulachen. Voller Stolz erklärte er mir, seine ganze Clique hätte sich tätowieren lassen. «Auf der Stirn?», fragte ich. Nein, auf der Stirn nur er.
Eine Weile später ließ er sich noch eine Tätowierung machen, diesmal auf dem Rücken. Horror: ein Hakenkreuz. Ich stellte mich dumm und fragte ihn, ob er die Bedeutung des Zeichens kenne. Der arme Kerl hatte nicht die geringste Ahnung. Für ihn zählte nur, dass er und seine Freunde jetzt das gleiche Tattoo trugen, als Erkennungszeichen der Clique.
Ich merke, dass ich unfähig bin, an meinen Sohn zu denken, ohne dass er mir peinlich ist. Es passiert mir immer wieder – obwohl in letzter Zeit seltener –, dass ich einen Turm von Missbilligungen gegen ihn errichte und diesen am Ende aus Mitleid selbst wieder umpuste. Ich weiß nicht, wie weit man Nikita etwas vorwerfen kann, wenn man bedenkt, was für einen Vater und eine Mutter er gehabt hat.
Amalia bestellte mich in die Cafeteria del Círculo de Bellas Artes, um über das neue Tattoo unseres Sohnes zu sprechen und zu einer Lösung zu finden. Das sei ja fürs ganze Leben, was für eine Schande, vielleicht könne man das Nazisymbol mit Laserstrahlen entfernen. Ich bewahrte eine distanzierte Ruhe, bis sie sich immer mehr aufregte und mich schließlich fragte, ob es mich denn gar nicht kümmere, was unser Sohn getan habe. Ich antwortete ihr, dass ich mehr als bekümmert sei; dass mir aber, da ich den Jungen nur zu den von der Richterin festgelegten Zeiten sehen dürfe, zu sehr die Hände gebunden seien, um mich in seine Angelegenheiten einzumischen. Amalia sah mich an, als wollte sie sagen: «Sag doch, dass ich unfähig bin, ihn zu erziehen, sag’s mir bitte, beleidige mich, damit ich mir Luft machen und dir deinen Anteil an Schuld ins Gesicht schleudern kann.» Aber ich sagte es nicht, und sie – enttäuscht, könnte ich schwören – verabschiedete sich mit gewohnter Bitterkeit. «Du hasst mich, nicht wahr?»
11
Ich war nicht mehr auf dem Friedhof, seit wir Papa beerdigt haben. Das ist lange her. Diese mutmaßlichen Oasen des Friedens ziehen mich nicht an. Sie langweilen mich. Ganz im Gegensatz zu Humpel, der ab und zu gerne einen Spaziergang über die Friedhöfe der Stadt unternimmt, besonders über den Friedhof La Almudena, weil der groß ist, weil viele Berühmtheiten dort begraben sind und weil er ganz in der Nähe liegt. Vor allem besucht er die Gräber von Prominenten, und wenn er auf Reisen ist, sorgt er dafür, dass er das unterwegs ebenfalls tun kann, im Ausland selbstverständlich auch. Er macht dann Fotos. Die stellt er ins Internet und zeigt sie mir. Sieh mal, das Grab von Oscar Wilde. Schau da, das Grab von Beethoven. So, auf diese Art. Ich bin heute Morgen nur deshalb auf den Almudena-Friedhof gegangen, weil mein Freund im Urlaub ist und ich daher nicht seiner Begleitung und makabren Gelehrtheit ausgesetzt bin. Ich wusste nicht, ob Hunde zugelassen sind. Zur Vorsicht habe ich Pepa zu Hause gelassen. Später habe ich auf dem Friedhof eine Dame mit einem herrlichen Deutschen Schäferhund gesehen.
Seit mehreren Tagen herrscht eine drückende Hitze. Von der Haltestelle der 110 bis zum Grab der Großeltern und Papas ist es ein beträchtliches Stück. Ich kam mit heraushängender Zunge und durchgeschwitztem Hemd dort an. Zu allem Überfluss liegt der Grabstein voll in der Sonne. Er ist aus ungeschliffenem Granit, und in der Reihenfolge der Bestattung stehen darauf die Namen von Großvater Faustino, von Großmutter Asunción und von Papa. Sie liegen Sarg auf Sarg, und der nächste wird im kommenden Jahr meiner sein. Wir haben ein Nutzungsrecht für die Dauer von neunundneunzig Jahren, von denen an die fünfzig bereits abgelaufen sind.
Ich habe mich auf den Grabstein gelegt. Ich wollte mal fühlen, wie es ist, auf dem Friedhof zu liegen. Mir ist schon klar, dass das kindisch ist; aber es sieht mich ja keiner. Ich kenne jetzt schon die beiden Daten, die auf meinem Grabstein stehen werden. Das können wenige Menschen von sich sagen. Die Hitze des Steins drang mir durch die Kleidung. Über mir war die Welt von einem makellos blauen Himmel bedeckt und seltsamerweise nicht von den weißen Streifen der Flugzeuge beschmutzt. Dann glaubte ich, näher kommende Stimmen zu hören. Ich bin sofort aufgestanden und gegangen. Man soll mich ja nicht für kauzig halten.
12
Es fiel mir schwer, zuzugeben, dass Papa nicht ganz lupenrein war. Noch immer, nach so vielen Jahren, durchfährt mich wie ein Messerstich der Wunsch, einige der Gerüchte über sein Verhalten in der Fakultät, die vor langer Zeit an meine Ohren drangen, möchten unwahr sein. Ich kenne das Gerede, dass er seinen Studentinnen gegen Sex bessere Noten versprach, und auch andere Vorteile hinsichtlich ihrer universitären Laufbahn; welche das genau waren, habe ich nie erfahren. Ich habe auch keine Bestätigung über den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte; doch die Tatsache, dass sie aus unterschiedlichen Quellen stammten und in zeitlichen Abständen immer wieder auftauchten, lässt mich das Schlimmste annehmen.
Als Kind dachte ich immer, Mama wäre die Böse. Heute versuche ich diesen Irrtum durch liebevolle Gesellschaft wettzumachen. Einen halben Irrtum, denn Mama ist weit davon entfernt, eine Heilige zu sein. Zu ihrer Entlastung muss man aber wohl anführen, dass sie oft in Notwehr handelte. Dennoch weiß ich, dass die Aggression nicht selten von ihr, einer Meisterin der Verstellung, ausging, auch wenn sie gar nicht streitsüchtig wirkte. Nachdem ich ausgiebig darüber nachgedacht habe, komme ich zu dem Schluss, dass ihre Schuld nicht ganz so groß wie seine war.
Amalia und ich merkten bald, dass wir zu viel Zeit und Energie darauf verwandten, uns zu zermürben. Alle sentimentalen Skrupel hinter uns lassend, ließen wir unsere Ehe nach dem Express-Scheidungsgesetz von 2005 lösen. Meine Eltern hatten keine solche Wahl. Das Scheidungsgesetz des Jahres 81 hatte administrative Hürden errichtet, die hochgradig abschreckend wirkten in einer Zeit, das darf man nicht vergessen, als den Spaniern die Ehe als unauflöslich galt. Das Gesetz schrieb vor, dass nur ein Richter die Trennung vollziehen konnte. Außerdem forderte es als unabdingbare Voraussetzung für eine Scheidung, dass die Ehepartner mindestens ein Jahr lang getrennt gelebt hatten. Papa und Mama zogen es aus Bequemlichkeit vor, oder um sich nicht dem auszusetzen, was die Leute sagten, in diesem Ehe genannten Bürgerkrieg zu zweit durchzuhalten, bis der Tod sie scheide, und genau das passierte dann auch. Als wir Papa beerdigten, war er vier Jahre jünger, als ich jetzt bin.
Heute, Jahrzehnte später, ist es mir egal, was meinem Vater nachgesagt wird. Ich spreche ihn nicht frei, und ich verurteile ihn nicht. Ich weiß, wenn er wiederauferstünde, würde er angelaufen kommen und mich in seine Arme schließen. Da er aber nicht zu mir kommen kann, werde ich also zu ihm gehen. Es liegt wahrscheinlich an dem Cognac, den ich heute Abend beim Schreiben trinke, aber es ist mir ein tröstlicher Gedanke, mit ihm zusammen in einem Grab zu liegen.
13
Mit meinen Freunden von damals war ich auf einem Fest in der Uni. Nachdem wir gerade angekommen waren, zogen wir zusammen ein paar Linien Koks. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine große Wirkung auf mich gehabt hätte. Von Kokain hatte das Zeug wohl nur den Namen. Knapp bei Kasse, wie ich damals war, trank ich danach ein paar Bier, von denen ich nicht einmal ansatzweise betrunken wurde. In einer Zimmerecke alberte ich mit einer Französin herum, die gewisse Hoffnungen in mir weckte. Mit einem entzückenden Akzent sagte sie, sie verschwände mal eben auf die Toilette. Ich brauchte zwanzig Minuten, um zu begreifen, dass sie nicht wiederkommen würde. Wahrscheinlich war sie nicht einmal Französin.
Irgendwann frühmorgens kam ich nach Hause. An die genaue Zeit erinnere ich mich nicht mehr. Angesichts der Dunkelheit und Stille nahm ich an, die ganze Familie läge in tiefem Schlaf. Seit ich an der Uni war, kontrollierte niemand mehr mein Kommen und Gehen. Man erwartete von mir, dass ich mein Examen machte; über alles andere (meine Vorlesungen, meinen Umgang, meine Neigungen) musste ich keine Rechenschaft ablegen. Meine Mutter, die einen leichten Schlaf hatte, war möglicherweise noch wach und hoffte auf ein Zeichen, das ihr meine gesunde Heimkehr verriet. Bei diesen Gelegenheiten bewegte ich mich stets mit großer Vorsicht, da ich der Meinung war, dass, so wie ich ein Recht auf mein eigenes Leben hatte, meine Familie ein Anrecht auf ungestörten Schlaf besaß. Ich wusste genau, wo jedes Möbelstück stand, und konnte das Wohnzimmer im Dunkeln durchqueren. Ich ging gleich zu Bett, ohne das Bad zu benutzen und ohne Licht zu machen, weil ich Raulito nicht aufwecken wollte, mit dem ich mir, da unsere Wohnung klein war, immer noch das Zimmer teilte.
Gleich darauf spürte ich seinen Atem an meinem Gesicht. Er fragte mich flüsternd und ein bisschen ängstlich, ob ich ihn gesehen hätte. Gesehen, wen? Papa, im Wohnzimmer, mit einer Wolldecke zugedeckt. Das Problem ist, dass ich meinen Bruder nicht immer ganz ernst genommen habe. Er war dick, trug eine Brille und hatte eine kieksende Stimme. Ich antwortete ihm, ich hätte niemand im Wohnzimmer gesehen und wolle jetzt schlafen. Da sagte er wie zu sich selbst: «Dann ist er wohl wieder ins Schlafzimmer zurückgegangen.» Bevor er sich von mir abwandte, packte ihn die Neugier, und er wollte noch wissen, ob ich ein Mädchen rumgekriegt hätte. «Aber sicher», sagte ich. Hinter einem Gebüsch hätte ich es mit einer Französin getrieben. Und ich könne nur hoffen, dass sie die Pille genommen hatte, denn ich sei literweise in sie gekommen. So wie Raulito damals aussah, kam er an kein Mädchen heran und musste sich mit Onanieren und meinen Geschichten zufriedengeben. Er nahm mir das Versprechen ab, ihm am nächsten Tag die Geschichte in allen Einzelheiten zu erzählen. Ich versprach es ihm, und das war alles, bis Mama bei Tagesanbruch ins Zimmer kam und uns weckte.
Papa lag tot auf dem Wohnzimmerteppich, auf dem Rücken, die Augen offen, die Lippen ein wenig geöffnet und, wie Raulito mir schon gesagt hatte, mit einer Wolldecke bedeckt. Die Wolldecke, erfuhr ich später, hatte Mama ihm um elf Uhr nachts übergeworfen, damit er nicht fröre, da sie überzeugt war, dass Papa, der kurz vorher nach Hause gekommen war und mit dem sie sich gestritten hatte, sturzbetrunken war und sich auf den Teppich gelegt hatte, um seinen Rausch auszuschlafen.
Einen Moment lang schauten wir uns alle drei an und wussten nicht, was wir tun sollten. Mir kam in den Sinn, dass Papa vielleicht gar nicht tot sei. Vielleicht war er nur ohnmächtig geworden. Ich schlug sogar vor, ihm ein Glas kaltes Wasser ins Gesicht zu schütten. Mama war die Einzige, die sich dem liegenden Körper zu nähern wagte, und bewegte mit der Spitze ihres Pantoffels den Kopf hin und her, um mir die unabweisbare Wirklichkeit vor Augen zu führen. «Jetzt seid ihr Halbwaisen, und ich bin Witwe.» In ihren Worten lag eine Kälte, die jeden Hauch von Schmerz ausschloss. Obwohl wir wussten, dass es nutzlos war, beschlossen wir, den Notarzt zu rufen.
Vier Tage später begruben wir Papa in einem haselnussfarbenen Sarg. Ich versuchte, der Feier fernzubleiben, indem ich eine wichtige Prüfung vorschob, doch Mama ließ nicht mit sich reden. Ich weiß nicht, warum ich ihrem Blick nicht standhalten konnte. Es war, als hätte sie sich die Augen von jemand anderem eingesetzt. Vielleicht war das die Art, wie sie Papa ansah, wenn sie beide allein waren, und jetzt war es an mir, diesen harten Blick auszuhalten. Heute habe ich den Verdacht, dass sie Schuldgefühle hatte und die Art, wie sie ihren zwanzigjährigen Erstgeborenen anschaute, eine Warnung sein sollte, dass sie nicht bereit war, sich andere Vorwürfe anzuhören als die, die sie sich selber schon machte. Möglicherweise hat sie aufgrund einer Indiskretion von Raulito erfahren, dass ich Nachforschungen angestellt hatte. Bevor wir zum Friedhof aufbrachen, pflanzte Mama sich vor mir auf und sagte, sie habe für Papa aus dem einfachen Grund nicht mehr getan, weil ihr der Ernst der Lage nicht klar gewesen sei. «Noch Fragen?» Nein. «Umso besser.» Mit diesen Worten kehrte sie mir den Rücken.
14
In letzter Zeit habe ich bei allem, was ich tue, ein starkes Gefühl von Abschied. Ich sage mir, jetzt habe ich zum letzten Mal einen Pfirsich gegessen, zum letzten Mal die Plaza Mayor überquert, eine Aufführung im Teatro Español gesehen. Ich fühle mich wie ein Sterbender, der kerngesund ist. Ich glaube, früher war ich vernünftiger. Oder pragmatischer. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nur ein wenig allein im Leben, gerade jetzt, da mein bester, mein einziger Freund verreist ist.
Während ich durch die Straßen bummelte und darauf wartete, Pepa vom Hundefriseur abholen zu können, fiel mir die Jesuitenkirche ins Auge, und aus einer Laune heraus bin ich hineingegangen, um ein bisschen mit der Figur des Gekreuzigten zu sprechen, die hinter dem Altar an der Wand hängt. Es ist schon viele Jahre her, dass meine Schritte mich in das Haus des Herrn geführt haben.
Als Raulito und ich klein waren, spielte Religion zu Hause keine große Rolle. Wir wurden getauft, empfingen die Erstkommunion als reine Formsache, den Großeltern mütterlicherseits zu Gefallen, die in Glaubens- und anderen Dingen reichlich beschränkt waren, und um eventuelle Diskriminierungen in der Schule zu vermeiden. Da Papa und Mama nie zur Messe gingen, gingen mein Bruder und ich auch nicht. Großvater Faustino brüstete sich bekanntermaßen damit, Atheist zu sein. Nikita haben wir nicht taufen lassen. Amalia vertrat die Meinung, der Junge solle, wenn er erwachsen war, selbst entscheiden, ob er getauft werden wollte oder nicht. Mir war es, ehrlich gesagt, egal.
Ich habe mich in die dritte Bankreihe gesetzt. Ich habe nämlich mal gelesen, dass Admiral Carrero Blanco da immer gesessen hat, wenn er die tägliche Messe in dieser Kirche besuchte. Vielleicht hat er auch an dem Tag hier gesessen, an dem er nicht weit von hier mit einer Bombe in die Luft gejagt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob er links oder rechts vom Mittelgang gesessen hat.
Der gekreuzigte Christus ist von beträchtlicher Größe. Ich stelle mir vor, dass der Admiral ihm Stoßgebete zugeflüstert hat. «O Herr, lass die Einheit Spaniens erhalten bleiben; hilf mir, den Kommunismus aufzuhalten und das Freimaurertum zurückzudrängen; dann lass mich vor Dein Angesicht treten. Amen.» Und tatsächlich hat der Herr ihn – unter Mithilfe der ETA – in den Himmel auffahren lassen, derweil die Sache mit Spaniens Einheit sozusagen immer noch in der Luft hängt; und was das Übrige angeht, wird man sehen, wie das Volk und die Geschichte sich entscheiden.
Der Christus in der Kirche San Francisco de Borja hat sein Gesicht zur Seite gedreht. Ich konnte ihn nicht dazu bringen, mich anzusehen. Ich habe ihm mit diesen oder ähnlichen Worten zugeflüstert: «Sende mir ein Zeichen, und ich gebe mein Vorhaben auf. Dann hast du einen Jünger hinzugewonnen. Es reicht mir schon, wenn du mir das Gesicht zuwendest, mir zuzwinkerst, einen Fuß bewegst, was du willst; im Gegenzug verzichte ich auf meinen Selbstmord.»
Die Kirche füllt sich jetzt mit Gläubigen. Wahrscheinlich beginnt bald ein Gottesdienst. Ich habe dem Christus an der Wand drei Minuten gegeben. Keine Sekunde mehr. Nach Ablauf dieser Zeit hat er mir kein Zeichen gegeben, und ich bin gegangen.
15
Es vergeht kein Tag, ohne dass Humpel mir von seinem Handy ein Foto, manchmal zwei, von seinem Urlaubsort an der Küste in der Nähe von Cádiz schickt. Er hält sein Handy immer in der gleichen Position, sodass die Hälfte des Bildes von seinem Gesicht ausgefüllt ist und die andere Hälfte von dem Ort, an dem er sich gerade befindet. Humpel grinsend am Strand; Humpel grinsend vor einer Reihe weißer Grabsteine; Humpel grinsend vor dem Eingang eines Tanzlokals oder Ähnlichem. Ich hätte große Lust, ihn zu bitten, mir keine weiteren Beweise seines Urlaubsglücks zu schicken, möchte ihn aber nicht verärgern.
Ich weiß noch, wie Amalia und ich ihn im Gregorio Marañón besucht haben. Mit der Infusionsflasche an der Stange und seiner unter Laken verborgenen körperlichen Beschädigung lag er im Bett und sagte uns, er hielte sich für einen vom Glück begünstigten Menschen. In der Gewissheit, außer Gefahr zu sein, ließ er seiner Spaßvogelseite die Zügel schießen und scheute auch vor makabren Scherzen nicht zurück. Er gab sich enttäuscht, weil sein Name nicht in der Zeitung genannt worden war. «Dazu», antwortete ich ihm mit der Unbefangenheit, die Freundschaft verleiht und die Amalia nicht verstand, «hättest du einer der Toten sein müssen.»
Wir erfuhren, dass er den rechten Fuß verloren hatte. Seine anderen Verletzungen waren kaum erwähnenswert. Die fröhliche Miene, die unser Freund machte, führte Amalia, die ihm nur mit wenig oder gar keinem Respekt begegnete, zu der Annahme, dass er womöglich auf Anraten des Psychologen versuchte, positive Energie aus dem zu ziehen, was ihm zugestoßen war. Ich glaube, dass er, als wir ihn besuchten, unter der Wirkung von Schmerzmitteln stand und sich noch kein genaues Bild von der langen, schwierigen Genesungszeit machte, die ihn erwartete.
Es hat lange gedauert, bis ich ihn wiedergesehen habe. Wir haben aber oft miteinander telefoniert, und eines Tages rief er mich an und erzählte, er sei wieder in seiner Wohnung in der Calle O’Donnell, zu der es damals für mich weiter war als jetzt. Ich verabredete mich mit ihm, und als ich ihn dann sah, machte er mir einen wirklich guten Eindruck. Angezogen und mit Schuhen sah man nicht, dass er eine Prothese trug. Er scherzte schon wieder und tat so, als würde er an einen imaginären Fußball treten. Er gestand mir, dass es nicht leicht gewesen war, sich daran zu gewöhnen; doch nach und nach habe er den Dreh rausgekriegt. Er konnte gehen, ohne dass jemand von seiner Behinderung etwas merkte. Er hatte sich sogar getraut, wieder mit seinem Auto zu fahren. Er ist wirklich ein Glückskind, dachte ich. Er musste laut lachen, als ich ihn fragte, ob er in Erwägung gezogen habe, bei den nächsten Paralympics mitzumachen. Als ich ihn so lachen sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er sich in psychiatrischer Behandlung befand. Als Vergleich fielen mir diese stets lächelnden Blinden ein, die für ihr Unglück auch noch dankbar sind. Nach so vielen Wochen des Leidens wieder Treppen steigen, das Gras riechen, Wolken und Baugerüste sehen und baldmöglichst seinen Arbeitsplatz in der Immobilienfirma, den man ihm frei gehalten hatte, wieder einnehmen zu können; mit einem Wort also, wieder unter den Lebenden zu weilen, musste Humpel mit unermesslichem Glück erfüllen. Ich frage mich heute, ob etwas Ähnliches nicht auch der Lastwagenfahrer empfindet, der seinen Wagen auf der Morandi-Brücke in Genua zum Stehen bringen konnte, die ein paar Meter vor ihm eingestürzt war. Unten Betontrümmer, zerschellte Fahrzeuge und über vierzig Tote; oben er, unverletzt, seinen ganzen Vorrat an Lebensjahren knapp gerettet. Das müsste gefeiert werden, doch dazu wird er wohl warten müssen, bis er den Schock überwunden hat.
Ich kam schnell zu der Überzeugung, dass Humpels mutmaßliches Glücksempfinden einer Erholungsfrist geschuldet war, die ihm seine posttraumatische Belastungsstörung gewährt hatte. Hinter seinem Lächeln verbarg sich, genauso wie bei seinen Urlaubsfotos vermutlich, ein geheimer Kern von Verbitterung.
16
Es war fünf oder zehn nach acht Uhr morgens. Das Telefon klingelte, und Amalia machte mir Zeichen, dass ich Nicolás (für mich Nikita) wecken solle, derweil sie den Anruf annahm. Es passierte zwar nicht oft, dass uns jemand so früh anrief; aber es konnte doch sein, dass ein Arbeitskollege von ihr oder mir auf dem Weg zur Arbeit in einem Stau steckte oder sonst in der Klemme saß. Jedenfalls muss meinem Gefühl nach das Klingeln des Telefons um diese Zeit und an einem Werktag nicht unbedingt der Auftakt zu einer Tragödie sein. Allerdings hörte man seit einer Weile schon Sirenen aus der Ferne und einige von nicht so ferne. Mich beunruhigt so etwas nicht. In einer Stadt wie der unseren lärmen die Sirenen von Ambulanzen oder Streifenwagen unablässig.
Amalia aber war erschrocken. Expertin in Vorahnungen und Befürchtungen, machte ihr Instinkt sie auf ein besorgniserregendes Ereignis gefasst, und so rannte sie aus der Küche hin zur Kommode, auf der immer noch das Telefon schrillte. Aus dem Zimmer unseres Sohnes hörte ich mehrere Male das Wort «verstehe». Sie rief mich zu sich. Ich ließ Nikita sich recken und strecken und ging zu ihr in die Küche. Ihre Schwester hatte ihr soeben mitgeteilt, dass ein Attentat verübt worden war. Das sagte sie, ein Attentat, und wir sollten das Radio anstellen. Im Radio sprach man nicht von einem einzelnen Attentat, sondern von mehreren Explosionen an verschiedenen Orten, und man ging davon aus, dass es Tote gegeben hatte, wobei der Sprecher deutlich machte, dass es noch zu früh sei, um wissen zu können, wie viele. Rettungsmannschaften seien unterwegs etc. «Die armen Opfer», sagte Amalia. Und ich schloss mich ihrem Mitleidsgefühl an, ohne zu ahnen, dass mein bester Freund sich unter diesen Opfern befand. Was zum Teufel machte er an einem Werktag um halb acht Uhr morgens in einem Nahverkehrszug, der aus Alcalá kam? Als wir ihn nach einer Zeit schließlich im Krankenhaus besuchen konnten, ging er nur oberflächlich auf die Geschichte ein.
Im Grunde lieferte er uns eine kurz gefasste Rechtfertigung für seine Anwesenheit in einem der Züge vom 11. März. «Zum Glück bin ich nicht verheiratet», scherzte er. Ich vermutete sofort, dass er im Bordell gewesen war und sich das vor meiner Frau nicht zuzugeben traute. Ich stellte mir vor, ich wäre an seiner Stelle. Wie würde ich Amalia erklären, dass ich an einem normalen Donnerstag mit einem Nahverkehrszug frühmorgens in die Stadt zurückkam, nachdem ich die ganze Nacht wer weiß wo verbracht hatte und darüber hinaus doch auch ein Auto besaß?
Humpel, den ich damals noch nicht so nannte, berichtete mir später, als Amalia nicht dabei war, die delikaten Details seiner Geschichte. Er hatte eine intime Beziehung zu einer Rumänin, die in Coslada wohnte, Mutter von zwei kleinen Kindern war, deren Vater, ein Landsmann von ihr, sie verlassen hatte. Eine ganz normale Geschichte so weit, die der Knilch geheim gehalten hatte, weil, sagte er mir später, die Sache noch ganz neu und er nicht sicher war, ob was daraus würde; im Grunde die Geschichte einer körperlich attraktiven Frau, die sich abrackerte, um ihre Brut großzuziehen, und die des Einheimischen, der sich überlegt, eine arme, zerbrochene Familie gegen Sex, oder, wie er es ausdrückte, jede Menge Sex, finanziell zu unterstützen.
Humpel war lange bei der Rumänin gewesen und, wie schon öfter, über Nacht bei ihr geblieben. Wenn er den Zug um kurz nach sieben nahm, konnte er sich zu Hause noch umziehen, bevor er zur Arbeit ging; und das, lachte er, nach einer lustvollen morgendlichen Nummer mit einer Frau, die ihm im Bett keine Grenzen setzte.
Der Zug lief in den Bahnhof Atocha ein. Humpel war auf seinem Sitzplatz eingedöst. Ab da reicht seine Erinnerung nicht mehr zu einer folgerichtigen Erzählung. Es gibt nur unzusammenhängende Bildsplitter. Er ist nicht mehr ironisch und macht auch keine Scherze mehr; aber er muss seine Erinnerungen abladen, mit mir teilen, das hat ihm der Psychiater empfohlen, damit er erleben kann, dass sie, wenn er sie rauslässt, ihm nicht die Nacht zur Hölle machen. In seiner Erinnerung geht alles durcheinander: das Gefühl von Flammeninferno, quellendem Rauch, die plötzliche Stille, der Geruch von verbranntem Fleisch. Und wenn seine Stimme sich zu überschlagen beginnt, weiß ich schon, dass er seinen Bericht unterbrechen muss, für einen Moment, vielleicht bis zum nächsten Tag. Er beharrt darauf, dass er trotz allem Glück gehabt hat. Er weiß nicht, wo im Zug die Bombe explodiert ist. Mit Sicherheit weiß er nur, dass das Loch, das sie in die Decke gerissen hat, fünf oder sechs Meter von ihm entfernt war. Er sieht sich zwischen den herausgerissenen Sitzen am Boden liegen, einen leblosen Körper neben sich, den er anzusprechen versucht, und er hört seine eigene Stimme wie aus weiter Ferne, als wäre sie gar nicht seine. Allmählich begreift er, dass seine Trommelfelle geplatzt sind. Zu dem, der neben ihm lag, sagte er: «Zuerst stehe ich auf, dann helfe ich dir.» Und da, als er auf die Beine zu kommen versuchte, sah er aus seinem rechten Hosenbein einen blutenden Stumpf ragen. Zwei Fremde zogen ihn aus dem Waggon. Er sagt, in diesem Augenblick habe er nur einen einzigen Gedanken gehabt: überleben um jeden Preis. Er blieb die ganze Zeit bei Bewusstsein.
17
Am frühen Nachmittag habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu Mama gefahren. Unterwegs habe ich eine CD von Aretha Franklin eingeschoben, die gestern in Detroit gestorben ist, an Krebs. Chain of Fools, I Say a Little Prayer, Respect und andere wunderbare Titel. Bei manchen Stellen, von denen ich den Text kenne, singe ich mit.
Als ich aus dem Haus ging, hatte ich das Gefühl, durch eine dicke Wand aus Gelatine zu gehen. Eine Wand aus Schläfrigkeit, Überdruss, Benommenheit. Das hat nicht direkt mit meiner