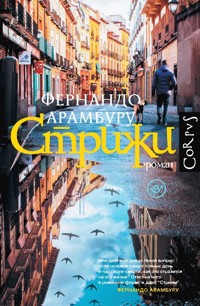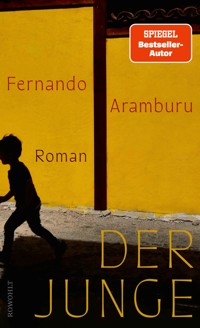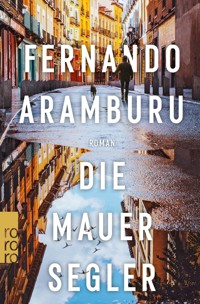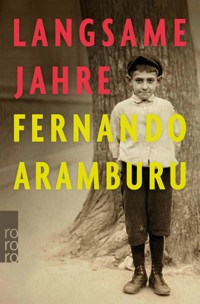
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Langsame Jahre" wird beschrieben, wie die Geschehnisse, die in "Patria" einzelne Familien und schließlich das ganze Land auseinanderbrechen lassen, ihren trägen Anfang nehmen. Ein Junge wächst bei Verwandten in San Sebastián auf, einer typisch baskischen Familie der sechziger Jahre: Die Tante hat das Sagen, ihr Mann kriegt den Mund nicht auf. Ihre Kinder suchen auf verschiedene Weisen neue Freiheiten. Der Pfarrer versorgt die Jugendlichen mit nationalistischem Gedankengut. Die ETA ist im Entstehen. Der Junge beobachtet alles mit staunenden Augen. Und als er seine Chance bekommt, nutzt er sie. Ein berührender Roman über das Schicksal einer Familie, der einem ans Herz geht und gleichzeitig viel darüber erzählt, wie wir zu dem werden, was wir sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Fernando Aramburu
Langsame Jahre
Roman
Über dieses Buch
In «Langsame Jahre» wird beschrieben, wie die Geschehnisse, die in «Patria» einzelne Familien und schließlich das ganze Land auseinanderbrechen lassen, ihren Anfang nehmen.
Ein Junge wächst bei Verwandten in San Sebastián auf, einer typisch baskischen Familie der sechziger Jahre: Die Tante hat das Sagen, ihr Mann kriegt den Mund nicht auf. Ihre Kinder suchen auf verschiedene Weisen neue Freiheiten. Der Pfarrer versorgt die Jugendlichen mit nationalistischem Gedankengut. Die ETA ist im Entstehen. Der Junge beobachtet alles mit staunenden Augen. Und als er seine Chance bekommt, nutzt er sie.
Ein berührender Roman über das Schicksal einer Familie, der einem ans Herz geht und gleichzeitig viel darüber erzählt, wie wir zu dem werden, was wir sind.
Vita
Fernando Aramburu wurde 1959 in San Sebastián im Baskenland geboren. Seit Mitte der achtziger Jahre lebt er in Hannover. Für seine Romane wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Vargas Llosa, Premio Biblioteca Breve, Premio Euskadi, und zuletzt, für «Patria», mit dem Premio Nacional de la Crítica 2017, dem bedeutendsten spanischen Literaturpreis, dem Premio Nacional de Narrativa 2017und mit dem Premio Strega Europeo 2018.
Willi Zurbrüggen, geboren 1949 in Borghorst, Westfalen. Er übersetzte u.a. Antonio Muñoz Molina, Luis Sepúlveda und Rolando Villazón aus dem Spanischen. Ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis des spanischen Kulturministeriums und dem Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «Años lentos» bei Tusquets Editores, Barcelona
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Años lentos» Copyright © 2012 by Fernando Aramburu
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Universal History Archive/Getty Images
ISBN 978-3-644-00245-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Erstes Abendmahl
Ich, Herr Aramburu, habe aus den Ihnen bekannten Gründen als Kind neun Jahre bei Verwandten in San Sebastián verbracht. Und das kam so: Meine arme Mutter war von dem Kerl, der ihr Ehemann war und den in diesem Bericht mit Namen zu nennen ich mich strikt weigere, verlassen worden und konnte mich und meine Brüder nicht allein durchbringen. Sie suchte Hilfe im Dorf, fand dort keine, und infolgedessen blieb ihr nichts anderes übrig, als uns ins Armenhaus von Pamplona zu schicken.
Nur für ein paar Monate, sagte sie unter Tränen, doch wir ahnten, dass sie log, um uns die Gefangenschaft erträglicher zu machen. Wegen der Liebe, die wir für sie empfanden, taten wir so, als glaubten wir, dass wir bald wieder zu Hause sein würden. Da dies aber nicht die Geschichte ist, die Sie für Ihren Roman brauchen, kürze ich sie ab und sage bloß, dass meine Mutter eine Schwester hatte, die als junges Mädchen nach San Sebastián gegangen war, um da in einer Baskenmützenfabrik zu arbeiten. Sie hat auch als Hausmädchen bei einer französischen Familie gearbeitet, und ich weiß nicht, was noch alles.
In San Sebastián hat sie meinen Onkel Vicente Barriola kennengelernt, der von dort stammte und unter dem Spitznamen Visentico bekannt war. Sie heirateten und hatten zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Diese leibliche Tante, María del Puy Aranzábal, für uns Tante Maripuy, bot meiner Mutter an, eines ihrer Kinder bei sich aufzunehmen, keinesfalls alle drei, nur eines, wie gesagt, denn für alle hatte sie keinen Platz im Haus.
Ich war der Jüngste, noch ein Kind, galt als artig und kam aus diesen Gründen als Erster in Frage. Meine Brüder entwickelten daraufhin eine Art Seelenverwandtschaft miteinander, die immer noch anhält und von der ich leider ausgeschlossen bin, obwohl ich mich mit beiden gut verstehe, besser allerdings, wenn ich sie einzeln treffe, als wenn wir alle drei zusammen sind.
Mit dieser Erklärung beende ich die Vorrede zur Familie, die Sie für Ihren Roman ja nicht brauchen. Unnötig war sie aber nicht, denn sie gibt dem, was folgt, einen Sinn; und außerdem finde ich es, eingedenk dessen, was Sie mir gesagt haben, auch besser, wenn die Geschichte meiner Erinnerungen einen Anfang hat, als wenn sie keinen hätte. Sie haben mich ermuntert, mich so auszudrücken, wie mir der Schnabel gewachsen ist; präzise zwar, aber um Struktur und Stil muss ich mich nicht kümmern, denn das ist ja Ihre Sache als der Schriftsteller, der Sie sind.
Also, an einem Nachmittag Anfang 1968 kam ich in einem Autobus, der «die Roncalesa» genannt wurde, in San Sebastián an. Ich war gerade acht Jahre alt geworden. Ein Nachbar aus dem Dorf brachte meine Mutter und mich in seinem Auto nach Pamplona. In Pamplona schien die Sonne, und das einzige Wasser, das ich sah, war das, was meiner Mutter aus den Augen lief. In San Sebastián war der Himmel bedeckt. Es fiel dieser feine Regen, von dem man nicht nass zu werden scheint, der aber genauso nass macht wie jeder andere Regen, und der bei uns sirimiri heißt. Da ich an einem einzigen Nachmittag so verschieden aussehende Himmel erlebte, war mir, als wäre ich sehr weit fortgeschickt worden.
Mein Cousin Julen war von seiner Mutter dazu verdonnert worden, mich abzuholen. An seinem Gesicht konnte ich sehen, wie ihm dieser Auftrag gegen den Strich ging. Er kam viel zu spät zur Bushaltestelle und bereitete mir dann einen so feindseligen Empfang, dass ich dachte, meine Brüder müssten sich geirrt haben, als sie mich einen Glückspilz nannten.
Ich wusste nur, dass irgendein Verwandter kommen und mich abholen würde. Das war gut so, denn ohne Hilfe hätte ich mich nie zurechtgefunden in der Stadt, in der ich nur ein Mal, im Alter von zwei, vielleicht drei Jahren anlässlich einer Familienfeier gewesen war und von der ich nicht mehr wusste als ein paar unwesentliche Dinge, die meine Mutter mir erzählt hatte.
Ich stieg aus dem Autobus, holte mein Gepäck, die Reisenden gingen ihrer Wege, und ich blieb allein auf dem Bürgersteig zurück. Ohne zu wissen, auf wen ich wartete, harrte ich über eine halbe Stunde unter einer Schaufenstermarkise aus. In meinem Dorf gab es damals nichts dergleichen. Gut, wir hatten die Metzgerei von Ceferino Arrastia, mit einem niedrigen Fenster, durch das man die Würste sehen konnte, die drinnen hingen.
Ich war schon fast so weit, einen Polizisten um Hilfe zu bitten, als mit aufgespanntem Schirm mein Cousin Julen auftauchte. Er hielt eine Kippe zwischen die Zähne geklemmt und ließ mich gleich seine Verachtung spüren, indem er fünf oder sechs Meter vor mir eine Bar betrat.
Als er wieder herauskam, war das Erste, was er zu mir sagte:
«Was willst denn du Scheißer aus Navarro hier?»
Darauf folgte als Begrüßung ein angedeuteter Boxhieb von diesem Kraftmeier.
Wir gingen im Regen durch mir gänzlich unbekannte Straßen. Julen war Läufer und Bergwanderer und ließ mich das auch gleich spüren. Er sagte, wir würden zu Fuß gehen, woraus ich naiverweise schloss, dass sich ein öffentliches Verkehrsmittel nicht lohnte, weil es nur eine kurze Entfernung zurückzulegen galt. Den Irrtum spürte ich schon bald in meinen Beinen. Abends erfuhr ich, dass meine Tante ihm Geld für den Trolleybus gegeben hatte. Er sparte sich die Ausgabe, vermutlich weil er sie als Bezahlung dafür ansah, mich abzuholen.
Julen schritt mit seinem schwarzen Regenschirm und einer Hand in der Hosentasche entschlossen voraus; ich hinter ihm her mit einem dieser Koffer von damals, das heißt, ohne Rollen, und der Pappschachtel, in die meine Mutter zwei lebende Hühner als Geschenk für die Verwandtschaft gepackt hatte.
Das war zu schweres Gepäck, um mit meinem Cousin Schritt halten zu können. Aus Angst, zurückzubleiben und mich zu verlaufen, versuchte ich, meinen Nachteil dadurch auszugleichen, dass ich streckenweise rannte, doch mit meinem Gepäck kam ich kaum in seine Nähe und fiel dann auch schon wieder zurück.
So erreichten wir, ich völlig durchnässt vom Schweiß und vom Regen, die herrliche Promenade, hinter der die Bucht beginnt. Es war Flut, und das Wasser stand so hoch, dass nur noch ein schmaler Streifen Sand zu sehen war. An manchen Stellen schlugen die Wellen schon gegen die Mauer. Da und dort spritzte das Wasser gar über die Brüstung.
Julen bemerkte mein staunendes Gesicht. Er wartete, bis ich herangekommen war, und sagte dann verschmitzt:
«Das ist das Meer, das die Navarros uns Basken im Krieg stehlen wollten. Jeder von ihnen kam mit zwei Eimern, und alle zusammen haben sie uns einen Haufen Wasser geklaut.»
Er fragte mich, ob ich wisse, wo meine Landsleute das gestohlene Wasser versteckt hatten. Ich glaubte, er meine es ernst, und versicherte ihm, dass es in meinem Dorf nicht sein konnte, da gäbe es nicht einmal einen Fluss, aber vielleicht hätten sie den Stausee von Alloz damit gefüllt.
Um den Scherz abzurunden, sagte er:
«Du hast hoffentlich daran gedacht, ein paar Liter davon mitzubringen, oder?»
«Nein.»
«Ihr Navarros seid wirklich üble Burschen.»
Auf dem weiteren Weg fand er sogar noch Zeit, mich weiter zu demütigen. Denn als wir durch das Viertel El Antiguo kamen, befahl er mir, unter einer hohen Laterne, die man am Ende der Straße sehen konnte, auf ihn zu warten. Ich tat, wie mir geheißen, brachte mich aber vor dem anhaltenden sirimiri im Eingang einer Apotheke in Sicherheit. Er besuchte unterdessen zwei oder drei Bars, bevor er sich wieder zu mir gesellte.
Wir gingen knapp eine Stunde von der Bushaltestelle bis zum Stadtrand, wo schon die Felder begannen. Dort standen, zusammengedrängt zwischen Hügeln, ein paar weiße Häuser, die größten bis zu drei Stockwerke hoch. Sie gehörten noch zum Viertel von Ibaeta. Es waren Arbeiterwohnungen, die vor Jahren vom gewerkschaftlichen Bauverein «Heim und Architektur» errichtet worden waren. Unter dem Franco-Regime also, wie eine Zementplatte am Eingang des Viertels bestätigte, auf der das Symbol von Joch und Pfeilen prangte, was ich Ihnen, Herr Aramburu, ja wohl nicht erzählen muss, da Sie viele Jahre in der Nummer 4 dieses Fleckens, Vororts oder was immer gewohnt haben. Ich nehme an, dass diese Tatsache es mir erspart, den Ort näher zu beschreiben.
Doch zurück zu meinem Bericht. Julen und ich erreichten das Haus meines Onkels und meiner Tante, als es schon dunkel zu werden begann. Dort angekommen, legte mein Cousin seinen Schirm auf die Erde und forderte mich auf, ihn zu nehmen, wobei er mir den Koffer und den Karton mit den Hühnern abnahm, um damit seiner Familie zu zeigen, dass er mir unterwegs tragen geholfen hatte. Dann stieß er im Treppenhaus einen lauten, recht ungewöhnlichen Pfiff aus, der zur Folge hatte, dass nur seine Mutter im dritten Stock und keiner von den Nachbarn auf den anderen Stockwerken die Tür öffnete, als wir gerade den obersten Treppenabsatz erreicht hatten. Meine Verwandtschaft empfing mich nicht gerade herzlich, mit Ausnahme von Tante Maripuy, die mich an sich drückte, als wolle sie mich mit niemand anderem mehr teilen.
Danach schimpfte sie mit mir wegen meiner durchnässten Kleidung und tadelte meine Mutter wegen der Hühner, die doch nicht nötig gewesen wären. Den Tadel wiederholte sie, als ich ein Paket etwas zerdrückter Feigen sowie ein in Packpapier eingewickeltes Viertel Spanferkel aus dem Koffer holte.
Wir aßen zu fünft in der Küche, saßen alle am Tisch, außer Tante Maripuy, die unentwegt am Herd hantierte und im Stehen aß.
Ich wunderte mich, wie wenig meine Verwandten miteinander sprachen. Jeder starrte auf seinen Teller, als wollte er das, was darauf lag, genau in Augenschein nehmen. Da keine Unterhaltung das Geräusch der kauenden Münder dämpfte, hörte man sie schlucken und schmatzen, ein bisschen so wie Schweine, ich meine, ohne dass gute Manieren für nachsichtiges Überhören sorgten. Die Geräusche ihrer Gefräßigkeit vermischten sich mit dem Klappern von auf Porzellan treffendes Besteck.
Allein in dem Moment, als wir uns an den Tisch setzten, stellten sie mir ein paar Fragen zu meiner Reise und über meine Mutter und meine Brüder; danach wurde nicht mehr gesprochen, bis auf ein paar Gesprächsrudimente, die ihnen zur Verständigung ausreichten.
«Brot?»
«Da.»
Nachdem die Suppe aufgetragen war, sagte mein Onkel:
«Heiß.»
Und meine Tante, ohne ihn dabei anzusehen:
«Puste.»
Im Verlauf dieses ersten Abendmahls tat Julen mir einen Gefallen und zeigte mir damit, dass er mich nicht so blöd fand, wie ich befürchtete. Und das kam so: Meine Tante, die eine großartige Köchin war, wenngleich ihre Gerichte nicht immer meinem Geschmack entsprachen, hatte an diesem Abend gebackenen Seeaal in Soße mit Bratkartoffeln, Muscheln und Petersilie zubereitet, um mir eine Freude zu machen.
Diese Art Fisch hatte ich bis dahin noch nie gegessen. In meinem Dorf kannte man damals nur solche Sorten, wie sie freitags ein Zigeuner auf den Straßen verkaufte: Sardinen, Barben, Makrelen, das heißt, gemeine See- oder Flussfische, nie jedoch Aale, und Meeresfrüchte sowieso nicht.
Kurzum, schon der Anblick der schwarzen Haut genügte, dass mein Magen rebellierte. Meine Tante, die mich für unterernährt hielt und ihrer Schwester in Sachen Kinderernährung unbedingt eine Lektion erteilen wollte, gab mir die zwei größten Stücke aus dem Topf, dazu reichlich Beilagen und eine große Kelle Soße.
Zuerst knabberte ich an den Kartoffelstückchen in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen, wozu, wusste ich nicht, was Kinder sich eben so ausdenken. Und obwohl keiner meiner Verwandten Augen für mich hatte, war mir, als würde jeder meinen Widerwillen bemerken. Irgendwann fragte Tante Maripuy streng:
«Schmeckt’s dir nicht, oder was?»
«Ich habe bloß keinen Hunger.»
Meine Tante war keine nachgiebige und schon gar keine diplomatische Frau.
«Iss!»
Ich nahm ein weißes Stück von dem Fisch in den Mund, und sobald ich das sülzige, gummiartige Aalfleisch zwischen den Zähnen spürte, musste ich würgen. Julen, der mir gegenüber saß, stieß seine Gabel in eines meiner beiden Stücke, teilte es in vier mundgerechte Happen, die er locker verputzte, und genauso schnell wie das erste Stück Aal ließ er danach auch das zweite in seinem robusten Körper verschwinden.
Nach dem Abendessen machten Mutter und Tochter den Abwasch; mein Onkel setzte seine Kappe auf und ging zur Bar Artola hinunter, der einzigen, die es im Viertel gab; mein Cousin traf sich mit seinen Freunden, und ich sagte meiner Tante, ich sei müde und wolle schlafen gehen.
Weil es noch so früh war und man Stimmen von der Straße und aus dem Haus hörte, fand ich keinen Schlaf. Also drehte ich mich mit dem Gesicht zur Wand und weinte, dachte an meine Mutter, mein Dorf, den Regen und den Aal, hörte zwischendurch auf, aber bloß, weil meine Augen trocken waren und eine Weile brauchten, bis sie neue Tränen produzierten.
Irgendwann in der Nacht kam Cousin Julen herein, mit dem ich das Zimmer teilte. Ich tat, als würde ich schon schlafen, aber er hörte mich im Dunkeln schluchzen.
Mein Cousin hatte Käsefüße. In San Sebastián, in der Schule, in die ich geschickt wurde, im Haus meiner Verwandten habe ich mich an vieles gewöhnt, was mir anfangs merkwürdig vorkam. Nie jedoch konnte ich mich an die Marter gewöhnen, neben den bloßen Füßen oder ausgezogenen Schuhen meines Cousins einschlafen zu müssen.
Als er im Bett lag und im Dunkeln die letzte Zigarette des Tages rauchte, sagte er zu mir:
«Wärst du ein Baske, würdest du nicht weinen. Hast du schon mal Eisen weinen sehen? Aber klar, du bist ein Weichei aus Navarro, da bleibt das ja nicht aus. Du bist eine Memme, und außerdem wirst du, weil du nass geworden bist, morgen sicher krank sein.»
In der Nacht wurde ich immer wieder wach und zog mir die Decke über den Kopf, um den Gestank aushalten zu können, den seine zwischen unseren Betten auf den Boden geworfenen Schuhe und Socken verströmten.
Txomin Ezeizabarrena, sechsundvierzig Jahre. Repariert in Straßenkleidung eine Steckdose im Esszimmer. Er arbeitet als Elektriker in der Ford-Werkstatt im Gros-Viertel (überprüfen). Er hat fünf Mäuler und das der Frau zu stopfen, der Ärmsten. Nach der letzten Geburt ist ihr Mund halbseitig gelähmt. Als junge Frau sicher hübsch. Mit so einem Mund kann sie nur schlecht sprechen. Man versteht sie kaum. Die Beschreibung zweitrangiger Figuren besser nicht allzu ausführlich. Vorsicht mit verräterischen Einzelheiten. Die Tapete um die Steckdose herum ist von einem Kurzschluss schwarz verbrannt. Txomin erklärt, als wollte er Maripuy das Handwerk beibringen. Er ist redselig, sympathisch (Beispiel bringen) und gutaussehend. Mit kleinen Reparaturarbeiten im Viertel verdient er sich ein wenig hinzu. Die Gardinen hätten in Brand geraten können, sagt er. Maripuy macht ein erschrockenes Gesicht. Der Verdacht wird nicht weiter erörtert, da es an der Tür klingelt. Eine Nachbarin (Identität nötig?) bringt die Urne mit der Heiligen Jungfrau. Kurzer erklärender Einschub: Sie wird von den Nachbarn reihum weitergegeben etcetera. Die Namen stehen auf einem Zettel, der auf die Rückseite der Urne geklebt ist. Maripuy stellt sie an den üblichen Platz (ich entscheide später, wohin). Vielleicht sollte noch die eine oder andere Einzelheit über die Gipsfigur mitgeteilt werden. Txomin beendet die Arbeit. Immer noch in der Hocke, hört er nicht auf, zu erklären. Maripuy steht neben ihm, bietet ihm einen Kaffee an. Ihr Kleid endet kurz unter den Knien. Gute Figur, volle Brüste, vierzig und noch was Jahre. Txomin lässt seinen Blick unverhohlen an ihren Beinen auf und ab schweifen. Vielleicht ist es besser, wenn Maripuy ihm nichts anbietet, weil das provokant wirken könnte. Was bin ich dir schuldig? Wenn du willst, kannst du in Naturalien bezahlen. (Der Ausdruck ist vielleicht etwas zu gesucht für diese Sorte von Leuten. Über einen weniger literarisch geprägten Ausdruck nachdenken. Ich könnte meine Mutter fragen. Wenn sie ihn kennt, lasse ich ihn.) Maripuy versteht die Anspielung nicht. Wie, in Naturalien? Komm, Kleine, stell dich nicht dumm (weniger abgedroschenes Wort suchen). Das ist ein bisschen grob. Passender wären ein paar Schlüpfrigkeiten, die das Spiel auf amüsante Weise verlängern. Es gibt Dinge (Vergütungen), die mehr wert sind als Geld. Besser noch: Es gibt Dinge (Vergütungen), die einem Mann mehr wert sind als Geld. Sie versteht allmählich (ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass sie einfältig ist). Txomin, bitte Respekt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und dazu einen Neffen, der seit einigen Tagen bei uns wohnt. Maripuy, ich schenke dir ein Paar Strümpfe, wenn du sie dir von mir anziehen lässt; damit gebe ich mich zufrieden, mehr will ich gar nicht, und für die Reparatur der Steckdose berechne ich dir auch nichts. Du bist doch ein verheirateter Mann. Aahhh, wenn du wüsstest … Du hast eine Frau fürs Bett. Du weißt doch, wie die Paquita jetzt aussieht. Gott ist mein Zeuge, ich werde nicht sündigen, was schulde ich dir? Du freudloses Weib, gib mir fünfzehn Peseten (überprüfen, ob der Preis für die Zeit angemessen ist) und hör auf zu weinen, es macht dich hässlich, wenn du so eine Schnute ziehst. Ich weine, wann ich will, ich bin hier in meinem Haus. Im Gehen macht er eine Bemerkung zur Qualität der Strümpfe, die er ihr geschenkt hätte. Die kannst du jetzt vergessen. Oder er findet eine galante Anspielung, mal sehen. Absatz. Visentico kommt von der Arbeit. Immer dasselbe: Er isst ohne Appetit, spricht wenig und ab zur Siesta. Er arbeitet seit über zwanzig Jahren als Handlanger in der Seifenfabrik «Lizarriturry y Rezola», in El Antiguo. Er steht auf. Trinkt Kaffee in der Küche, raucht dabei. Maripuy erträgt keine Sekunde länger das Brennen, von dem sie innerlich zerfressen wird (vielleicht besser aktiv: das sie innerlich zerfrisst). Das hat er zu mir gesagt: Wenn ich mir von ihm die Strümpfe anziehen ließe, würde er mir neue kaufen. Ein Schürzenjäger, ein geiler Bock etcetera. Stell ihn in den Senkel, Vicente; wenn du ihn siehst, stellst du ihn zur Rede. Ja, nur mit der Ruhe, du hast ihm ja schon gezeigt, dass du nicht so eine bist. Maripuy ringt ihm das Versprechen ab, dass er mit Txomin redet. Visentico willigt ein, er hat keine Lust zu streiten. Sie: Das war das letzte Mal, dass mir dieser unverschämte Kerl ins Haus kommt und irgendwas reparieren will. Visentico ist einverstanden. Er soll nicht mehr ins Haus kommen, dann gibt es auch keine Probleme. Irgendeine Nebensächlichkeit beschreiben, die als Übergang dienen kann. Visentico geht wieder zur Arbeit (fährt mit dem Rad), zur Nachmittagsschicht. Sieben (besser acht) Uhr abends. Maripuy beobachtet durch die Jalousie den kleinen Platz vor der Bar Artola. Männer spielen toka (eine kurze Erläuterung für nichtbaskische Leser einfügen, ohne den Erzählfluss zu unterbrechen). Klappern der Steine, wenn sie die Eisenstange treffen. Eine kleine Dosis Lokalkolorit: Abenddämmerung, erdiger Landgeruch, Bauer mit Esel und Sense, rennende Kinder und ein Grüppchen alter Frauen, die schwatzend in einer Toreinfahrt hocken. Txomin wirft. Klack, klack, klack. Er ist schnell und treffsicher, einer der besten Tokalaris im Viertel. Oft genug trifft er mit allen sechs Steinen. Sie spielen um nichts. Später, wenn es dunkel wird und sie nach drinnen gehen, spielen sie Karten um einen oder zwei Krüge Wein. Maripuy beobachtet von ihrer Wohnung aus jede Bewegung von Txomin und ihrem Mann. Einer spricht den anderen an, sie gehen ein Stück beiseite, damit die anderen sie nicht hören, und so weiter. Als Visentico an die Reihe kommt, mehren sich die spöttischen Rufe in der Runde. Visentico wird hier von keinem ernst genommen. Er wirft, als säße er auf einem imaginären Stuhl, die wie ein Raubtier zusammengekniffenen Augen (Gemeinplatz, anderes Bild suchen) starr auf die toka gerichtet. Einen Moment lang hält er die Hand ausgestreckt hinter dem Körper, dann zieht er sie in einem guten Halbbogen nach vorn. Die Folge: Seine Steine fliegen viel zu hoch, und er braucht mehrere Versuche, bis sie wenigstens auf dem Spielfeld und nicht irgendwo im Gebüsch landen. Wenn er irgendwann nach fünf oder sechs Würfen die toka trifft, erhebt sich das unvermeidliche Jubelgeschrei um ihn herum. Perspektivwechsel. Beschreibung, wie die Männer in die Bar gehen, von Maripuys Fenster aus gesehen. Grübeln bei der Zubereitung des Abendessens. Als Visentico im Dunkeln nach Hause kommt (er hat einen sitzen, wie sie es nennt), fragt sie ihn (beim Essen?, später im Bett?), sodass die Kinder es nicht hören, ob er dem Lumpen die Leviten gelesen hat. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich in der Bar Ärger anfange. Solche Dinge muss man unter vier Augen besprechen. Außerdem hatten wir doch schon gesagt, dass wir einen anderen Elektriker holen, wenn es wieder einen Kurzschluss gibt. Maripuy ist der Meinung, ein anständiger Ehemann hat seine Frau zu verteidigen. Visentico entgegnet, so stark, wie du bist, kannst du dich selbst verteidigen. Maripuy macht ihre Nachttischlampe aus. Visentico raucht noch eine Celtas, bevor er seine ausmacht. Kurz darauf schnarcht er schon. Maripuy stellt sich vor, wie es wohl ist, wenn ein Mann, der nicht der Ehemann ist, einem die Strümpfe anzieht. Sie nimmt einen Finger zu Hilfe und besorgt sich ein schönes kleines Beben. Danach bittet sie den lieben Gott flüsternd um Vergebung. Sie schläft ein. Sie wird von Julen geweckt, der Gott weiß wie spät, wer weiß woher nach Hause kommt. Dann schläft sie weiter.
Die Episode mit den Nüssen
Meine Cousine Mari Nieves war zur Zeit dieser Erinnerungen siebzehn Jahre alt, nicht besonders hübsch, gesund und kräftig, ein bisschen mollig, wenn auch noch nicht so dick wie heute; sie hatte einen starken, zu Herrschsucht neigenden Charakter, der sich nicht geändert hat und dem ihrer Mutter gleicht, mit der sie damals immerzu stritt.
Die Natur war so grausam, ihr einen maßlosen sinnlichen Appetit mitzugeben. Mari Nieves hatte reichlich Gelegenheit und war auch ungeniert genug, ihn auf den verschiedenen, nicht nur sexuellen Wegen zu stillen, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Ich allerdings hatte den Eindruck, dass sie diese unaufhörliche Begierde weniger genoss als unter ihr litt, nicht zu reden von den Angehörigen, angeführt von ihrer Mutter.
Besagter Appetit oder Furor, der vielleicht gar kein solcher war, aber ich kann es nicht anders ausdrücken, bestimmte ihr ganzes Tun und vermutlich auch ihr Denken und ihre Träume. Kann aber auch sein, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Nehmen Sie’s nicht allzu wörtlich.
Damit Sie verstehen, was ich meine – einmal habe ich meine Cousine in der Küche überrascht, wie sie sich, da sie sich unbeobachtet fühlte, eine ganze Rispe Weintrauben so lustvoll in den Mund stopfte, wie jemand, der sich erotischen, frivolen oder wie immer Sie es nennen wollen, Freuden hingibt. Das kam so: Ich war gerade im Esszimmer, als ich Geräusche hörte, die mich denken ließen, Mari Nieves hätte Atembeschwerden und könne vielleicht ersticken, weshalb ich zu ihr lief, um ihr nötigenfalls zu helfen, und da sah ich, wie sie sich eine ganze Handvoll Weintrauben in den Mund stopfte und dabei die Augen so verdrehte, dass man nur noch das Weiße sehen konnte.
Außerdem war sie vulgär. Sie nahm nämlich die Bratenschere aus der Schublade, schnippte damit durch die Luft und schrie ärgerlich, die Lippen noch feucht vom Saft:
«Willst du vielleicht, dass ich dir den Pimmel abschneide?»
Und dann kichernd, als müsste sie gleich laut loslachen:
«Da wärst du nicht der Erste.»
Diese Anekdoten, die ich Ihnen hier schriftlich mitteile, sind von hoher Vertraulichkeit. Ich bitte Sie, meine Cousine Mari Nieves in Ihrem Roman respektvoll zu behandeln und ihr, wie Sie mir versprochen haben, einen fiktiven Namen zu geben, egal welchen, sodass die Verwandtschaft, die Nachbarn und sie selbst die benannte Person nicht wiedererkennen können.
Ich war seit zwei oder drei Wochen im Haus meiner Tante, als ich erstmals mitbekam, was meine Cousine mit den Jungs aus dem Viertel trieb. Obwohl Boshaftigkeit bei mir noch ein sehr unterentwickelter Sinn war, argwöhnte ich bald so einiges aufgrund von Mutmaßungen, Gerüchten und Andeutungen sowie dem allmählichen Begreifen dessen, was ich zufällig den Gemeindepfarrer hatte sagen hören.
Und das kam so: An den Samstagen musste ich meine Tante zu dem Altenheim begleiten, das der Stiftung José Matía Calvo gehörte und auf der anderen Seite der Landstraße lag. Im selben Gebäude war die Pfarrei untergebracht, wie Sie wissen, darum erspare ich mir, mich in Einzelheiten zu ergehen.