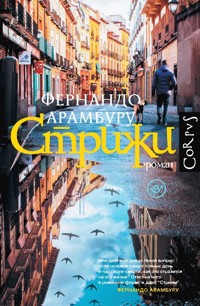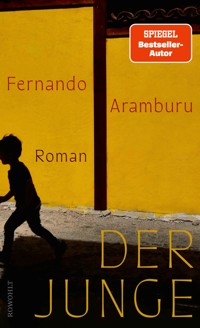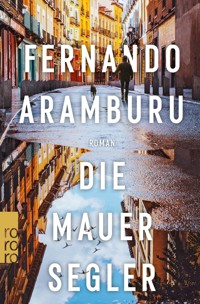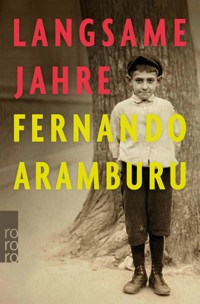9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fernando Aramburus «glücklichstes Buch», wie er selbst sagt, entstand vor dem Bestseller «Patria» und ist ein autofiktionaler Roman: Ein nicht gerade vom Erfolg verwöhnter spanischer Autor begleitet seine Ehefrau Clara auf einer Recherchereise durch Deutschland. Sie soll einen Reiseführer verfassen. Er macht die Fotos dazu. Die Reise beginnt in Bremen und geht weiter nach Worpswede, zum Grab von Paula Modersohn-Becker, zur Arno-Schmidt-Stiftung in Bargfeld, nach Goslar und Berlin. Süddeutschland ist das nächste Ziel. Doch als ihr Hund Goethe erkrankt, kommt alles anders als gedacht. Mit viel Charme und hintergründigem Humor blickt Aramburu auf seine Wahlheimat Deutschland, auf seinen Hund und vor allem auf eine sehr selbständige Frau, die Kerzenlicht beim Abendessen mag, alle Moden beharrlich ignoriert, dafür immer einen Plan hat, auch wenn ihm so mancher spanisch vorkommt. Eine höchst vergnügliche Lektüre über das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Meisterhaft erzählt von einem der bedeutendsten Autoren der spanischen Gegenwartsliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Fernando Aramburu
Reise mit Clara durch Deutschland
Roman
Über dieses Buch
Fernando Aramburus «glücklichstes Buch», wie er selbst sagt, entstand vor dem Bestseller «Patria» und ist ein autofiktionaler Roman: Ein nicht gerade vom Erfolg verwöhnter spanischer Autor begleitet seine Ehefrau Clara auf einer Recherchereise durch Deutschland. Sie soll einen Reiseführer verfassen. Er macht die Fotos dazu.
Die Reise beginnt in Bremen und geht weiter nach Worpswede, zum Grab von Paula Modersohn-Becker, zur Arno Schmidt Stiftung in Bargfeld, nach Goslar und Berlin. Süddeutschland ist das nächste Ziel. Doch als ihr Hund Goethe erkrankt, kommt alles anders als gedacht.
Mit viel Charme und hintergründigem Humor blickt Aramburu auf seine Wahlheimat Deutschland, auf seinen Hund und vor allem auf eine sehr selbstständige Frau, die Kerzenlicht beim Abendessen mag, alle Moden beharrlich ignoriert, dafür immer einen Plan hat, auch wenn ihm so mancher spanisch vorkommt. Eine höchst vergnügliche Lektüre über das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Meisterhaft erzählt von einem der bedeutendsten Autoren der spanischen Gegenwartsliteratur.
Vita
Fernando Aramburu wurde 1959 in San Sebastián im Baskenland geboren. Seit Mitte der achtziger Jahre lebt er in Hannover. Für seine Romane wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Premio Vargas Llosa, dem Premio Biblioteca Breve, dem Premio Euskadi und zuletzt, für «Patria», mit dem Premio Nacional de la Crítica, dem Premio Nacional de Narrativa und dem Premio Strega Europeo. «Patria» wurde als Serie für HBO verfilmt.
Willi Zurbrüggen, geboren 1949 in Borghorst, Westfalen. Er übersetzte u. a. Antonio Muñoz Molina, Luis Sepúlveda und Rolando Villazón aus dem Spanischen. Ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis des spanischen Kulturministeriums und dem Jane Scatcherd-Preis.
Impressum
Die Übersetzung wurde gefördert durch das Programm zur Unterstützung von Übersetzungen Acción Cultural Española, AC/E.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «Viaje con Clara por Alemania» bei Tusquets Editores, S.A., Barcelona.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Viaje con Clara por Alemania» Copyright © 2010 by Fernando Aramburu
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Mark Owen/plainpicture
ISBN 978-3-644-00844-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für die Hübsche
1
Nach dem Abendessen brachten wir Goethe zu Frau Kalthoff. Es hatte seit dem Morgen geregnet und jetzt erst aufgehört, was mich am Nachmittag davon befreit hatte, den Garten zu gießen. So gewann ich mehr Zeit, mich um die Koffer zu kümmern. Wir verschoben das Abendessen, bis wir mit dem Gepäck fertig waren, das Auto beladen und die Wohnung aufgeräumt hatten. Um neun blieb uns dann nur noch, den Hund in seine Unterkunft für die nächsten Monate zu bringen. Auf Claras Wunsch hin nahmen wir die Straßen am Ortsrand, wo wir mit Goethe üblicherweise Gassi gingen; er sollte nicht allzu früh Wind davon bekommen, dass wir auf seine Gesellschaft zu verzichten planten. Trotzdem schien er etwas zu ahnen, denn entgegen seiner verspielten Natur wich er uns den ganzen Weg nicht von der Seite und trottete mit hängenden Ohren, eingeklemmtem Schwanz und dem untröstlichen Ausdruck eines verlassenen Waisen in den Augen neben uns her. Unter unserem Regenschirm verstieg sich Clara zu einem Vortrag über die hellseherische Gabe von Hunden. Ich glaube, sie hielt ihn für sich in der Hoffnung, die eigenen Worte könnten ihr schlechtes Gewissen lindern. Ich hingegen hatte den Eindruck, Goethe erinnere sich an die vorigen Male, die wir ihn in der Obhut von Frau Kalthoff zurückgelassen hatten, entweder weil wir ihn nicht mit in die Ferien nehmen konnten oder weil Clara zu einer Lesereise in Buchhandlungen oder Universitäten des Landes eingeladen worden war und ich sie, wie üblich, begleitete. Wir hegten nicht den geringsten Zweifel, dass Frau Kalthoff Goethe verwöhnte. Vielleicht kümmerte sie sich sogar besser um ihn als wir. Darum konnte ich mir überhaupt nicht erklären, warum unser Hund so offensichtlich traurig war; das ist er nämlich auch immer, wenn wir von unseren Reisen zurückkehren und ihn mit einem Leckerli als Geschenk wieder abholen und er, anstatt sich zu freuen, deutlich zu erkennen gibt, wie sehr es ihn schmerzt, sich von Frau Kalthoff trennen zu müssen. Vielleicht gehe ich aber auch fehl in meinen Vermutungen, da ich mich in Sachen Hundeseelen wenig auskenne, genauso übrigens wie in den menschlichen, falls es ein solches unsichtbares Organ tatsächlich geben sollte.
Frau Kalthoff, die in der Nähe der berühmten Mühle wohnt, kraulte Goethe gleich den Kopf, als wir eintrafen, und begrüßte ihn mit herzlichen Worten. Goethe leckte ihr die Hände und winselte dankbar, als wäre in seinen verängstigten Augen Frau Kalthoff die Scharfrichterin, die ihm das Leben schenkte. Clara und ich gingen nach wenigen Minuten. Goethe hatte sich da schon unter dem Wohnzimmertisch über die Scheibe Mortadella hergemacht, mit der seine Gastgeberin ihn beschenkt hatte. Er ließ uns ungerührt ziehen. Ich glaube, im letzten Moment warf er uns einen kurzen Seitenblick zu, als wünschte er uns eine Reise mit Regen und vielen Unannehmlichkeiten. In der Diele übergab Clara Frau Kalthoff die Schlüssel fürs Haus, für den Briefkasten und das Gartenhäuschen. Sie bat sie, einmal in der Woche die Pflanzen zu gießen, die im Gewächshaus etwas öfter, mit Ausnahme der Kakteen; regelmäßig den Briefkasten zu leeren und nachts immer eine Lampe brennen zu lassen, um Einbrecher zu täuschen. Clara und Frau Kalthoff verabschiedeten sich, wie die Ortsansässigen das hier so taten, mit einem Händedruck, in dem man, selbst wenn man genau hinschaute, keine Spur der tiefen Freundschaft hätte herauslesen können, welche die beiden Frauen schon seit Jahren verband.
Auf dem Heimweg nahmen wir die Abkürzung über die Hauptstraße, die den Ort in zwei Hälften teilt, und Clara richtete ihren Blick auf ein paar blaue Löcher in der dunklen Wolkendecke am Horizont. Sie interpretierte sie sogleich als untrügliches Zeichen für kommendes gutes Wetter. Sie begründete ihre Vorhersage mit der Kenntnis, die sie von den Wetterbedingungen dieser Gegend zu haben behauptete, und fügte – wie um jeden Schatten meiner möglichen Skepsis von vornherein auszumerzen – mit erhobenem Zeigefinger hinzu, und was diese Kenntnis besage, bestätige ihr der weibliche Instinkt. Ich fragte sie, ob sie es nicht für einen allzu großen Zufall halte, dass das Ende des seit Mitte Juli anhaltenden Regenwetters auf den Tag unserer Abreise falle. Worauf sie antwortete, sie habe in sich ein ganz lebhaftes Gefühl, als würde, wenn wir morgen in aller Frühe aufbrächen, eine herrliche Sonne scheinen. Sie habe diese Szene unserer Abreise schon öfter in ihren Träumen gesehen. «Die Wärme», hörte ich sie – taub gegen das Prasseln des Regens auf ihrem Schirm – gedankenverloren sagen. Und die schwarzen Wolken über unseren Köpfen ignorierend, fuhr sie in ihrer phantastischen Beschreibung fort: wolkenloser Morgen; heller Sonnenschein, der sie zwingen würde, im Auto ihre Sonnenbrille aufzusetzen; eine Landschaft im klaren Licht. Sie behauptete, wenn ein Traum sich wiederhole, dann deswegen, weil er uns dringend eine Botschaft übermitteln wolle, darum habe sie diese Art von Träumen stets als unabweisliche Wahrheit betrachtet. Zur Stützung ihrer These führte sie Beispiele von traumhaften Prophezeiungen an, die sich im wirklichen Leben bestätigt hätten, wie die, mich kennengelernt zu haben. Ich verzichtete auf eine Antwort, da ich so eine Ahnung hatte, dass sie im Augenblick keinen großen Wert darauf legte.
Es heißt, ich sei Schnarcher. Ich kann das weder bestätigen noch leugnen, da ich nicht über die Fähigkeit verfüge, mir während des Schlafens zuzuhören. Clara hat es übernommen, mich täglich über diese physiologische Eigentümlichkeit meiner Person auf dem Laufenden zu halten. Manchmal wendet sie sich meiner atemtechnischen Serenaden wegen im Bett vorwurfsvoll von mir ab. Ich sage ihr, wenn ich sie vermeiden könnte, würde ich mich gern zur Verantwortung ziehen lassen. Eine andere Lösung bestände darin, in getrennten Zimmern zu schlafen, doch das will sie nicht. Sie sagt, allein im Bett fühle sie sich schutzlos. Soweit ich dahintergekommen bin, handelt es sich dabei um ein Angstgefühl, das sie schon seit ihrer Kindheit mit sich herumträgt. Ich weiß noch, dass in meiner Familie sehr viel geschnarcht wurde. Meinen Vater – Gott hab ihn selig – haben wir, als ich noch klein war, nachts durch die Wände sägen hören. Meine Mutter verfügte zwar nicht über die gleiche Lautstärke, wusste ihrem Mann aber durchaus Paroli zu bieten, und die Folge war, dass es, soweit ich mich erinnere, wegen des Schlafens nie zu Unstimmigkeiten zwischen ihnen kam. Das Problem besteht also nicht, wie Clara glaubt, darin, dass einer schnarcht, sondern darin, dass der andere es nicht tut. Schnarchten nämlich beide, müsste keiner finsteren Blicks, mit vorwurfsvollem Mund und geröteten Augen schlaflos auf den Morgen warten, vielmehr hätte das Paar gut geschlafen und geruht; in geräuschvoller Harmonie zwar, doch immerhin in Harmonie. Solche Gedanken gehen mir häufiger durch den Kopf, doch ziehe ich es vor, mit Clara nicht darüber zu reden, sondern darauf zu warten, dass sie irgendwann selbst zu schnarchen beginnt und sie dann nachvollziehen und verstehen kann.
Doch zum Thema. An dem für unsere Abreise vorgesehenen frühen Morgen klingelte der Wecker. Im Halbdunkel suchte ich nach Claras warmer, weicher Wange und drückte ihr einen Kuss darauf. Sie ließ mich machen. Solch offensichtliche Willfährigkeit weckte in mir eine zwischen Zweifel und Zuversicht schwankende Hoffnung, sie möge mit einer gewissen, meinen Absichten in die Hände spielenden sinnlichen Neigung aufgewacht sein, aber nein. Diese Sanftmut und hingegossenen Glieder waren keine Anzeichen für das, was ich mir im ersten Moment eingebildet hatte, sondern eine direkte Folge großer Übermüdung. Mit kaum hörbarer Stimme, jedoch in offenkundig anklagendem Ton flüsterte sie mir ins Ohr, dass ich geschnarcht habe; konkret, mehr als gewöhnlich geschnarcht habe. Das nagende schlechte Gewissen bestärkte mich in meinem Wunsch, sie zu entschädigen. Unter solchen Umständen ist die Übernahme häuslicher Verrichtungen als Strafersatz in der Regel das probateste Mittel. Mit ihr kann man seelische Zerknirschung wie guten Willen beweisen. Es funktioniert immer. Clara hat diese, ich weiß nicht ob psychologische oder moralische, Eigenart von mir schon lange erkannt, und manchmal, wenn ich sie durch Taten oder mit Worten beleidigt habe, erspart sie sich – anstatt sich auf ein Wortgefecht mit mir einzulassen – Zeit, Verdruss und Unannehmlichkeiten dadurch, dass sie mich einfach darauf hinweist, wie wir uns schnellstmöglich wieder vertragen können. «Mäuschen», sagt sie dann, «schäl mir doch ein Dutzend Kartoffeln.» Wenn sie mir aus irgendeinem Grund keine Arbeit zuteilt, suche ich mir selbst eine aus, egal welche, da die Wirkung immer die gleiche ist.
Mit diesem Vorsatz stand ich also an dem Morgen auf und zog mich an. Clara blieb im Bett. Während ich in der Küche den Frühstücktisch richtete, hielt ich nach dem fahrenden Bäcker Ausschau. Der Bäcker kommt mit seinem Lieferwagen aus Schortens. Es gibt zwar eine Bäckerei und einen Lebensmittelladen im Ort, aber sie öffnen beide erst spät und liegen auch etwas weit von unserem Haus entfernt. Der Bäcker aus Schortens kündigt sich mit dem Bimmeln einer Glocke an, die er an seinem Fahrzeug angebracht hat. Die Glocke klingelt sehr zurückhaltend, sodass jeder, der Brot kaufen will, sie hört, und wer weiterschlafen will, nicht. Ich wollte ein paar Brötchen und ging nach draußen. Es war schon hell. Ein wahrer Wolkenbruch rauschte nieder, begleitet vom Prasseln auf der Erde zerplatzender Tropfen. Vor der Haustreppe hatte sich eine riesige Wasserpfütze gebildet. Unmöglich, darüber hinwegzuspringen. Ich musste wieder zurück und meine Pantoffeln gegen anderes Schuhwerk austauschen. Da vernahm ich aus dem Schlafzimmer Claras verschlafene Stimme, die fragte, wie spät es war. Meiner Antwort ging ein Blick in den wolkenverhangenen Himmel voraus. Unter anderen Umständen hätte ich mir vielleicht einen Scherz über prophezeiende Träume erlaubt, aber die uns bevorstehende Reise war für sie von großer Wichtigkeit, und mich durchzuckte ein Schauer von Bedauern. Auf dem Rasen wogte eine Nebeldecke, die in manchen Ecken des Gartens mit den Schatten der Sträucher verschmolz und sogar bis an die unteren Äste unserer beiden Apfelbäume reichte. Es roch nach Moos und feuchter Erde. Die Pflanzen hatten sich leicht auf die Seite gelegt, als wären sie vom Gewicht des vielen Regens bedrückt und melancholisch geworden. Wenigstens wehte kein Wind, und das war auch der einzige Trost, den ich Clara übermitteln konnte. Mit dem Gedanken, jede Enttäuschung so lange wie möglich von ihr fernzuhalten, tat ich, als hätte ich die Frage nicht gehört. Ich ging etwa zwanzig Schritte durch den Regen, damit sie mich nicht den Schirm aufspannen hörte. Meinen Morgengruß beantwortete der Bäcker mit einem Scherz über das Wetter. Ich warf einen Blick zu den Wolken hinauf, als rechnete ich mit der Möglichkeit, dass sich in zwei oder drei Minuten ein Wunder ereignete.
Das Wunder ereignete sich nicht. Es donnerte und regnete in Strömen, als wir uns kurz nach sieben Uhr morgens auf den Weg machten. Das war an einem Montag im Juli. Ich saß entsprechend unserer Abmachung, dass ich die ganze Zeit fahren würde, damit sie sich unterwegs Notizen für ihr Buch machen konnte, am Steuer. Die Scheibenwischer schienen in ihrem hektischen Hin und Her wie protestierend nein, nein, nein zu sagen. Ich denke heute ebenso wie damals, dass die Scheibenwischer genau das ausdrückten, was sowohl Clara als auch ich in jenen Momenten empfanden: nein zu den Wolken, nein zu dem Platzregen, nein zu den Pfützen auf dem Asphalt, nein und nochmals nein. Wozu noch überflüssige Bemerkungen bei der Beredsamkeit der Scheibenwischer? Infolgedessen fuhren wir schweigend. Wir konnten schon die ersten Häuser von Wilhelmshaven sehen, als Clara mit vor den Mund geschlagenen Händen die Frage einfiel, ob ich daran gedacht hätte, den Gasherd abzustellen. Worauf ich keine hundert Prozent sichere Antwort geben konnte, obwohl ich der Meinung war, ihn abgestellt zu haben, denn wie ich mich kenne, sagte ich, könne ich mir nicht vorstellen, so unvorsichtig gewesen zu sein, ihn nicht abzustellen. Mit gerunzelter Stirn fragte sie dann, mit wievielprozentiger Sicherheit ich das sagen könne. Wie sollte man so etwas messen? Sie insistierte: «Hundert, achtzig, siebzig Prozent?» Aufs Geratewohl schätzte ich zwischen fünfundachtzig und neunzig Prozent. Und erkannte sofort den Fehler, mich auf eine Antwort eingelassen zu haben. Aber es war schon zu spät. Clara entschied, auf der Stelle umzukehren. Wir kehrten um. Besser jetzt, dachte ich, als später, wenn wir schon sehr viel mehr Kilometer zurückgelegt hätten. Wie ich vermutet hatte, war der Gasherd abgestellt. Trotzdem hatte die überflüssige Rückkehr etwas Tröstliches für Clara. Denn während wir uns noch einmal vergewisserten, dass alle Elektrogeräte ausgestöpselt und alle Fenster fest verschlossen waren, hörte es auf zu regnen. Für Clara war das ein Grund zur Freude, so tief auch die schwarzen Wolken noch am Himmel hingen und abzusehen war, dass jederzeit ein neuer Regenschauer niedergehen konnte. Doch wie auch immer, die Scheibenwischer konnten wir abstellen. Wir waren gerade in die Hauptstraße eingebogen, als Clara sich zu mir drehte und mit sehr zufriedener Stimme sagte: «Habe ich dir nicht gesagt, dass meine Träume niemals irren? Habe ich dir nicht gesagt, dass es am Tag unserer Abreise nicht regnen wird?» Ich mag eine Menge Fehler haben, aber ich weiß, wann ich den Mund zu halten habe. Das tat ich, anstatt die Ungebührlichkeit zu begehen, Clara die detaillierte Vorhersage vom Vortag in Erinnerung zu rufen. Der zugezogene Himmel verhinderte, dass wir in der kompakten Wolkenmasse eine Öffnung entdecken konnten, durch die die Sonne hätte scheinen können, dieser helle Sonnenschein, der, wie sie behauptet hatte, sie dazu zwingen würde, im Auto die Sonnenbrille aufzusetzen. In einem Punkt musste ich Clara natürlich recht geben: Es regnete nicht. Und so behielt ich meine Gedanken für mich und freute mich mit ihr darüber, dass unser Abenteuer unter solch gutem Vorzeichen begonnen hatte.
In Claras Buch bleibt unsere Fahrt nach Wilhelmshaven unerwähnt. Diese und ähnliche Auslassungen sind der Tatsache geschuldet, dass sie sich weigerte, ihr Werk mit privaten Details zu belasten. Mehr als ein Mal hörte ich sie sagen, dass die Wahrheit an sich kein künstlerischer Wert sei. Die Wahrheit muss, wenn sie für die Kunst von Wert sein soll, mit Lügen gefüllt werden. Es könne sogar passieren, sagte sie, dass ein Werk misslinge, weil der Autor es nicht verstanden habe, seine Wahrheitsliebe zu bremsen. Außerdem, ließ sie mich wissen, habe der Verleger, der ihr dieses Buch in Auftrag gegeben hatte, vorgeschlagen, eine zwar detaillierte, aber auch unterhaltsame Erzählung ihrer persönlichen Eindrücke zu liefern; auf keinen Fall solle sie in Vertraulichkeiten schwelgen oder das Buch mit kulturell irrelevanten Bekenntnissen vollstopfen, die nur unnötige Seitenzahlen produzieren. Um nichts in der Welt wollte sie über Orte und Personen schreiben, die sie wie ihr Gesicht im Spiegel kannte. Sie sei nicht zu dieser Reise aufgebrochen, um persönliche Belanglosigkeiten zu referieren. Einmal, als wir über dieses Thema sprachen, sagte sie zu mir: «Hast du ein Glück! Da du dich nicht mit Literatur beschäftigst, könntest du, wenn du ein Buch schreiben wolltest, es ganz nach deinem Gutdünken tun, müsstest dich weder an Normen halten noch Geschmäcker berücksichtigen, noch dich dem Urteil dir völlig fremder Menschen beugen. Schreiben ist eine Form des sich Entblößens. Das Problem dabei ist, dass viele Autoren, die bereit sind, sich von der Verpackung zu trennen, nicht wissen, wo die Kleidung aufhört und die Haut beginnt. Also reißen sie sich alles herunter: die Kleidung, die Haut, das Fleisch. Ohne jede Scham stellen sie ihre schleimigen Organe zur Schau, ihre Knochen und ihre Nerven und noch mehr, falls es mehr gäbe. Das ist grauenvoll und geschmacklos, mein Mäuschen, ich werde das nicht tun. Du, indes, könntest das. Da niemand dich kennt und sich ein Bild von dir macht …!» Da kam mir eine Idee, und ich schlug ihr vor, beim Schreiben nicht sich selbst, sondern die anderen zu entblößen. Diesen Satz schrieb sie gleich in ihr Notizbuch. Ob sie ihn gut finde, fragte ich. Sie antwortete, solche Gedanken kämen in Interviews immer gut an.
Ihren Anweisungen folgend, fuhr ich zu der Schule in Wilhelmshaven, in der sie seit über zehn Jahren Englisch und Deutsch unterrichtet. Auf ihre Bitte hin parkte ich vor dem Haupteingang. Sowohl wegen der frühen Zeit als auch wegen der Schulferien lag der Komplex völlig verlassen da. Sechs oder sieben Krähen pickten auf dem Schulhof zwischen den Pfützen. Verhexte Lehrer? Das war nicht der Typ von Scherz, über den Clara lachen konnte, also verkniff ich ihn mir. Außerdem war bei unserer Ankunft keine einzige der Krähen zur Begrüßung gekommen, vielmehr flogen alle gleichzeitig davon, was nicht passiert wäre, wenn es sich um einen Schwarm gefiederter Berufskollegen gehandelt hätte. Clara wies mich an, den Motor abzustellen. Sie hatte das Seitenfenster heruntergedreht und ergötzte sich an der Betrachtung des Schulgebäudes. Schon als Kind hatte sie Lehrerin werden wollen. Dennoch gibt sie zu, dass die Arbeit ihr schon seit einiger Zeit die Gesundheit und die Nerven ruiniert. Das ist ihre Art, auszudrücken, dass sie unter Stress steht. Sie hat mich schon öfter zu Hause angerufen und mich gebeten, sie von der Schule abzuholen, weil sie Kopfschmerzen hat. Dann hole ich das Fahrrad aus dem Schuppen, radle, so schnell ich kann, nach Wilhelmshaven, und wir fahren in ihrem Auto zurück. Unterwegs legt sie den Kopf auf die Rückenlehne und beginnt, herzzerreißend zu schluchzen. Wüsste ich nicht, wo sie den Vormittag verbracht hat, würde ich denken, sie sei einer Bande gewissenloser Entführer in die Hände gefallen und misshandelt worden. Zu Hause angekommen, wirft sie den einen Schuh hier, den anderen dort von sich und legt sich angekleidet aufs Bett. Ich trage ihr die Aktentasche ins Schlafzimmer nach. Manchmal ist sie so schwer, dass ich sie frage, ob sie Steine hineingepackt hat. «Viel schlimmer als Steine», sagt sie. Es sind Schulhefte, die sie nach Feierabend korrigieren muss.
Während sie die Fassade des Schulgebäudes betrachtete, erschien ein engelhaftes Lächeln auf ihren Lippen. Ein derartiger Ausdruck erblüht nur selten in ihrem Gesicht. Ich verstand nicht ganz, wie ein Stück Funktionsarchitektur mit ihren langweiligen Fensterreihen, dem schmutzigen Putz und Graffiti auf dem unteren Teil der Wände bei einer ästhetisch so anspruchsvollen Person wie Clara derartiges Vergnügen und Behagen hervorrufen konnte. Ehrlich gesagt, hatte ich auch keine Ahnung, was wir beide an einem Ferientag um halb acht Uhr morgens auf diesem asphaltierten Schulhof zu suchen hatten. Ich wartete noch ein wenig, bevor ich mich in ihr Glück einzumischen wagte. «Psst», machte ich, bevor ich sie behutsam fragte, ob sie mir das, was sich gerade abspielte, bitte erklären könne. Sie schaute mich an, als wollte sie sagen: «Ah, du bist ja auch hier. Ich habe dich gar nicht kommen hören.» Sie fand zu ihrem Lächeln zurück, das für eine knappe Sekunde unterbrochen war, und zog mir recht zärtlich das Ohrläppchen lang. Ich kenne diese typische Handbewegung von ihr ziemlich gut; sie bedeutet so viel wie «ganz ruhig, Junge, eines Tages, wenn du groß bist, wirst du es schon verstehen». Sie erklärte mir, sie habe sich in Erfüllung eines alten, bisher geheim gehaltenen Versprechens zu ihrer Schule fahren lassen. Schon vor Monaten war ihr ein Sabbatjahr zugesprochen worden, und sie hatte sich vorgenommen, es vom ersten bis zum letzten Tag für ihr Buch zu nutzen. Was ich nicht wusste, war, dass sie, nachdem sie die schriftliche Bestätigung bekommen hatte, den Vorsatz fasste, am Tag der Abreise vor der Schule anzuhalten und das angenehme Gefühl auszukosten, ein ganzes Jahr lang nicht mehr unterrichten zu müssen. Immer wieder hatte sie dieses Versprechen erneuert, und wie es schien, hatte es ihr Trost gespendet und über den täglichen Stress in der Schule hinweggeholfen. Da Clara vom Wesen her zur Ernsthaftigkeit neigt, erschien mir diese Laune doppelt sympathisch. Ich strahlte sie genauso an wie sie mich, und sie belohnte mich dafür mit einem Kuss auf den Mund. Da auch überströmende Herzlichkeit kein Wesenszug von ihr ist, muss man wertzuschätzen wissen, was sie einem gibt. Sie war jetzt schier euphorisch. Plötzlich schüttelte sie auf eine komische Art die Hände. War das Flattern ein unbeholfener Versuch, sich in eine Krähe zu verwandeln? Mit vor Zufriedenheit leuchtendem Gesicht fragte sie mich, ob ich mir vorstellen könne, was es für sie bedeute, keine Hausaufgaben und Arbeiten mehr korrigieren zu müssen; nicht mehr bis Mitternacht oder ein Uhr nachts den Unterricht für lustlose Schüler vorbereiten zu müssen; nicht mehr die Inkompetenz des Direktors, die Boshaftigkeiten des Hausmeisters und die Intrigen einiger Kollegen ertragen zu müssen; nicht neben dem Unterricht an ebenso zähen wie nutzlosen Lehrerversammlungen teilnehmen zu müssen; sich nicht mehr mit Schülereltern auseinandersetzen zu müssen, für die alle Probleme der Menschheit gelöst wären, wenn Lehrer nicht so viele Ferien hätten; nicht mehr zu Unzeiten oder am Wochenende auf Anrufe antworten zu müssen wie: «Würde es Ihnen was ausmachen, wenn meine Tochter zum Montag das Gedicht von Schiller nicht oder nur die erste Strophe auswendig lernt? Wissen Sie, die Psychologin, zu der sie geht, ist nämlich der Meinung, dass wegen der Pubertät so ein Übermaß an Hausaufgaben sich negativ auf ihre Entwicklung auswirken könnte»; nicht mehr auf Exkursionen gehen zu müssen, bei denen sich die Schüler schon betrinken, noch bevor sie im Bus sind, weil sie noch auf die zwei, drei, vier oder fünf warten müssen, die immer zu spät kommen; nicht mehr während des Unterrichts die Klingeltöne von Mobiltelefonen hören zu müssen; nicht mehr Christians Provokationen, Jens’ dauernde Witzeleien und Lukas’ finstere Blicke ertragen zu müssen; keine schlechten Jungs im Grunde, die nach der Scheidung ihrer Eltern nur die Orientierung im Leben verloren haben; sich schließlich und endlich nicht mehr Johannas Frechheiten anhören zu müssen, die, weil sie die Tochter der Vizerektorin ist, nur so behutsam und diplomatisch gescholten werden darf, dass es sich anhört, als würde sie für ihr schlechtes Benehmen noch gelobt.
Mit dieser Litanei hatte sich Clara einen ersten Haufen Ärger und Frustration von der Seele laden können. Als sie damit fertig war, hatten sich ihre Gesichtszüge merklich aufgehellt. Ihre Augen wirkten jetzt blauer, größer, heiterer. Aus ihrem Gesicht waren die Anzeichen von Schlafmangel, die Sorgenfalten und die Angespanntheit wegen ihres unablässigen Ärgers in der Schule wie ausradiert. An ihrer Stelle breitete sich nun Anmut aus, die Frucht der Erleichterung, die sie jünger und schöner machte. Letzteres sagte ich ihr. Dafür bekam ich einen Kuss mit geschlossenen Augen, eine Umarmung und Streicheleinheiten im Nacken. Danach fragte ich sie, ob es nicht an der Zeit sei loszufahren. Sie wolle ihre Abschiedszeremonie, sagte sie, mit einem passenden Schlussakt beenden. Sie habe den starken Wunsch, ihrer Schule den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen. Ein Anflug von Scham bewog sie, mir diese perverse Tat, die zu begehen sie im Begriff stand, näher zu erläutern. Ihr Stinkefinger sollte ein symbolischer sein, da ihrer Meinung nach die anderen, die normalen also, die alle Welt kennt, nur von groben, ungeschliffenen Menschen gezeigt würden. Außerdem gab sie zu, um ihren guten Ruf zu fürchten, falls jemand, der sie kannte, sie dabei zufällig aus einem der Fenster beobachtete. Vermutlich befand sich kein Mensch in dem Gebäude. Trotzdem, man konnte nie wissen. Ihr Stinkefinger würde in Gestalt einiger Zeilen von Heinrich Heine daherkommen, die ihr für die Gelegenheit wie geschaffen schienen. Sie hatte sie extra dafür auswendig gelernt. Ich warf wie unabsichtlich einen Blick auf meine Uhr. Aus Erfahrung weiß ich, dass dieser Trick bei vielen Menschen wirkt, ohne dass sie sich dessen bewusst werden; ein blitzartiger Reflex, der sie bewegt, ihre Erklärungen und Ausführungen zu unterbrechen oder wenigstens abzukürzen. Clara begann, in fröhlichem Ton Heines Verse aufzusagen. Bei einem Wort schien sie jedoch nicht sicher zu sein. Sie begann von neuem und stockte wieder an derselben Stelle. Da entnahm sie ihrer Handtasche ein kleines Reclamheft der Harzreise, das sie zusammen mit Goethes Italienische Reise und zwei oder drei ähnlichen Büchern für den Fall mitgenommen hatte, dass sie nach Inspiration suchte oder nach Zitaten für ihr eigenes Buch. Sie schlug es vorne auf und las in parodistischer Manier, das Lachen unterdrückend:
Lebet wohl, ihr glatten Säle!
Glatte Herren! Glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf Euch niederschauen.
2
Die erste Etappe unserer Reise war ein Familienbesuch und wird deshalb in Claras Buch auch nicht erwähnt. Das hatte sie so beschlossen, schon bevor wir losgefahren waren. Da sie also offenbar nicht die Absicht hatte, sich über den Verlauf des ersten Tages näher auszulassen, schlug ich ihr am Vorabend vor, der Einfachheit halber die Autobahn zu nehmen, die über Oldenburg nach Bremen führt, und hinter Bremen die 27 direkt nach Cuxhaven, wo Tante Hildegard wohnt. Auf der Landkarte ist zu sehen, dass diese Strecke damals einen tiefen Bogen beschrieb, da der Tunnel unter der Weser noch nicht fertig war. Und da es, wie ich Clara erklärte, zwischen Bremen und der Wesermündung keine Brücken gab, war die von mir vorgeschlagene Strecke tatsächlich die schnellste und bequemste. Sie zuckte nur die Achseln. Ich sei der Fahrer, war alles, was sie darauf antwortete. Und so verließen wir am Morgen, nachdem die komische Vorstellung auf dem Schulhof beendet war, Wilhelmshaven in Richtung Autobahn. Bis nach Oldenburg ist es eine der am wenigsten befahrenen Strecken, die ich kenne. Und dann noch zu so früher Stunde und während der Schulferien! Es herrschte so wenig Verkehr, dass wir streckenweise kein Auto vor uns und keines hinter uns sahen. Der Himmel war immer noch grau, der Asphalt feucht, aber es regnete nicht. Clara hatte ein Notizbuch auf dem Schoß liegen, einen Kugelschreiber in der Hand, den Blick auf die Landschaft gerichtet, und wartete auf eine Gelegenheit, sich Notizen zu machen. Sie sagte, über diese Gegend Deutschlands gedenke sie zwar nicht zu schreiben, wolle sich aber einen wachen Blick für Szenerien bewahren, die für ihr Buch nützlich sein könnten. Diese könne sie später an Stellen verwenden, die ihr am geeignetsten schienen. Ihre Haltung beschrieb sie mit einem für sie typischen Satz: «Ich bin ein Schwamm, den danach dürstet, sich mit Wirklichkeit vollzusaugen.» Manchmal liest sie solche Sätze in einem Buch, lässt sie aber so oft hören, dass sie darüber vergisst, dass sie nicht von ihr sind.
Die leere Autobahn ließ Zweifel in ihr aufkommen, ob wir die beste Strecke gewählt hatten. Autobahnen sahen für sie alle gleich aus. Kannte man eine, kannte man alle. Nur die Namen auf den Verkehrsschildern änderten sich. Zu der Unvorteilhaftigkeit des Eintönigen gesellte sich ihrer Meinung nach noch die der Schallmauern und -wälle, die den Autofahrern den Blick auf die Landschaft verstellten. Sollte sie etwa ein Buch über Straßenbegrenzungen schreiben? «Du könntest den Rastplätzen ein paar Absätze widmen», sagte ich. Sie warf mir vom Beifahrersitz einen finsteren Blick zu. Ich möge sie bitte ernst nehmen. Begreifen, dass es vom Erfolg ihres Buches abhänge, ob sie bis zur Pensionierung als Lehrerin arbeiten müsse. Um jeden Preis brauchte sie Abenteuer, Erlebnisse, Emotionen. Wie sollten wir auf der Autobahn, lamentierte sie, sehenswerte, malerische Dinge zu Gesicht bekommen, die typisch für einen Ort waren und nicht für alle gleich? Ich erinnerte sie daran, dass wir übereingekommen waren, auf einfachstem Weg nach Cuxhaven zu gelangen. Sie gab mir recht und schwieg; doch wie ich sie kenne, führte sie unseren Dialog in Gedanken weiter, wo sie mir aller Wahrscheinlichkeit nach Argumente unterschob, die sie leicht entkräften konnte und die für mich zu einer schmerzlichen dialektischen Niederlage führen mussten. Schon bald gelangte sie zu der Überzeugung, dass ihre Sichtweise in der stillen Diskussion obsiegt hatte. Und die Folge des Ganzen war, dass sie ungefähr auf der Höhe von Varel in nicht unbedingt gebieterischem Ton, aber doch so kurz angebunden, dass mir jede Widerrede im Moment deplatziert erschien, darum bat, bei nächster Gelegenheit die Autobahn zu verlassen. Sie erwartete meine Zustimmung, damit ihre Entscheidung gerechtfertigt wäre. Am Straßenrand hatte sie einen toten Vogel gesehen. Sie wusste nicht, was für ein Vogel es gewesen war. «Ein kleiner», sagte sie und hielt Daumen und Zeigefinger ein ungefähres Stück auseinander. Das war ihre ganze Erklärung. Ich bat sie, mir zu helfen, eine mehr oder weniger logische Verbindung zu erkennen zwischen einem toten Vogel am Straßenrand und ihrem Wunsch, auf Bundesstraßen nach Cuxhaven und mit der Fähre über die Weser zu fahren, was uns Zeit und Geld kosten würde. «Mäuschen», antwortete sie, «ich wäre dir dankbar, wenn du beim Sprechen die Augen auf der Straße halten würdest.» Ich wiederholte meinen Wunsch, ohne den Kopf zu drehen, obwohl wir auf der Hauptstraße von Varel vor einer roten Ampel standen. «Wenn es dir so wichtig ist», sagte sie, «möglichst schnell bei Tante Hildegard zu sein, dreh um und fahr wieder auf die Autobahn.» Die Ampel hatte auf Grün geschaltet. Die Bewegung von Autos in ein und dieselbe Richtung riss uns mit wie ein Stück Holz in der Strömung eines Flusses; ohne Möglichkeit, diesem Druck zu widerstehen. Ich antwortete Clara, es sei mir egal, welche Strecke wir führen. Letztlich sei es ihre Reise, ihr Buch, ihr Projekt. Sie bestimme die Strecke und die Halte. Zu der Zeit hatten wir Varel verlassen und fuhren auf der Landstraße, die am Rande des Jadebusens entlangführt.
Der Anblick des Vogels hatte Clara aufs äußerste beunruhigt. Nicht der Vogel selbst und auch nicht der Umstand, dass er tot gewesen war, sondern weil, wie sie es sah, das Schicksal sich des Vogels bedient hatte, um uns eine Warnung zukommen zu lassen. Ich konnte nicht anders, als für einen Moment den Blick von der Fahrbahn zu nehmen und in ihrem Gesichtsausdruck zu lesen, ob sie diese nach Hexerei klingenden Worte wirklich ernst meinte. Sie musste mein Vorhaben erraten haben und lächelte. In dem Glauben, ihr Lächeln enthalte eine Einladung zum Blödeln, schlug ich vor, in einem Kapitel ihres zukünftigen Buches der Theorie nachzugehen, dass anscheinend das Schicksal sich neuerdings in Form von toten Vögeln äußere. Clara, so scharfsinnig sonst, erfasste die Ironie nicht; im Gegenteil, sie fand meinen Vorschlag ganz treffend und schrieb ihn gleich auf. Um ihr noch ein wenig nach dem Mund zu reden, fragte ich, worin die Warnung denn bestehe, die das Schicksal uns hatte zukommen lassen. Ihrer Meinung nach bedeutete der Vogel, dass wir auf derselben Straße fuhren wie der Tod, vielleicht nur wenige Minuten hinter ihm. «Und da du für meinen Geschmack viel zu schnell fährst, siehst du vielleicht auch ein, dass wir Gefahr laufen, ihn einzuholen.» Als hätte sie meine Gedanken erraten, fügte sie sogleich hinzu, es gehe nicht darum, recht oder unrecht zu haben oder um Aberglauben, sondern die Vorahnung, die ihr beim Anblick des toten Vogels gekommen sei, habe nur ihr Unbehagen verstärkt, weiter auf der Autobahn zu fahren. Sie drängte mich, ihr zu sagen, was ich an ihrer Stelle getan hätte. Ich sagte, was sie zweifellos zu hören wünschte. Zum Lohn zupfte sie mir zärtlich am Ohrläppchen; zum zweiten Mal an diesem Tag. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie sich zufrieden in ihren Sitz schmiegte.
Zu unserer Linken weiteten sich die stillen Wasser des Meerbusens, der so grau war wie der Himmel. Der Frühnebel verwischte seine fernen Ufer, sodass die breite Ausbuchtung der See, ohne Horizont, ohne Ufer, ohne Schiffe in Sicht, einem über die Erde ausgegossenen Wolkenmeer glich. Näher bei konnte man eine Reihe Windräder erkennen, deren Flügel stillstanden, weil kein Wind wehte. Ein Dichter hätte der diesigen Landschaft lyrischen Nutzen abringen können; doch wohl nur, wenn er das prosaische Detail der äolischen Maschinen weggelassen hätte. Ich interessierte mich mehr für den Straßenbelag, war ich doch überzeugt, dass wir über kurz oder lang auf ein weiteres überfahrenes Tier stoßen würden. Ich musste innerlich lächeln, als ich mir die hilfsbereite Argumentation der Frau Schriftstellerin vorstellte. Auf einer der vielen Geraden sah ich etwa hundert Meter vor uns auf der Gegenfahrbahn eine Krähe, die zum Frühstück an einem Fleischfetzen herumpickte. Victory! Mich überkam ein Hallelujahgefühl, und um das Stück noch besser auskosten zu können, verlangsamte ich unsere Fahrt. Kurz bevor wir die Stelle erreichten, flog die Krähe davon. Ich war versucht, neben der blutigen Masse anzuhalten, doch da ich im Rückspiegel ein Auto sah, das in geringer Entfernung hinter uns fuhr, entschied ich mich gegen diese Unvernünftigkeit. Clara schrieb in ihrem Notizbuch. «Hast du gesehen?», fragte ich sie. «Was?» «Den überfahrenen Igel. Ich glaube, der Tod ist auch von der Autobahn abgefahren und hat nur noch wenige Minuten Vorsprung. Das ist der Grund, warum ich langsamer fahre. Was meinst du, was sollen wir jetzt tun?» Diesmal entging Clara mein spöttischer Unterton nicht. Sie schaute mich empört an und warf mir vor, ihre bösen Vorahnungen wiederzubeleben, von denen sie sich gerade erst beruhigt hatte. Hatte ich ihr in den Tagen vor unserer Abreise nicht versprochen, alle Probleme, Arbeit und Sorgen unterwegs von ihr fernzuhalten? Hatte ich irgendein besonderes Interesse daran, sie nervös zu machen? War das etwa meine Art, ihr zu helfen? Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, als würde das Lenkrad in meinen Händen größer werden und ich müsste den Hals recken, um die Straße noch sehen zu können. Mein Körper schrumpfte infolge der Kombination aus Klage, Vorwurf und Standpauke, die Clara mir verpasste. Ärgerlich über mich selbst, bat ich sie um Verzeihung. Ihre Miene hellte sich auf. Mit triumphierendem Lächeln sagte sie, schließlich und endlich habe der Igel ja auf der Gegenfahrbahn gelegen. Also hatte sie ihn doch gesehen! Der Tod fuhr nicht in unsere Richtung, daher gab es auch keinen Grund zur Sorge. Das schien mir ein unschlagbares Argument zu sein. Ich beglückwünschte sie dazu und erkannte damit meine Niederlage an. Eine gute Zahl von Kilometern weiter, schon auf der anderen Seite der Weser, kurz bevor wir wieder auf die Autobahn nach Cuxhaven kamen, fuhren wir durch ein kleines Dorf, dessen Namen ich nicht in Erinnerung behalten habe, als wir mitten auf der Straße den aufgeplatzten Balg einer Katze liegen sahen. Ich musste mir auf die Lippen beißen, um mir die Bemerkung zu verkneifen, die mir auf der Zunge lag. Clara warnte mich: «Sag lieber nichts.»
Vorher, noch auf Höhe des Jadebusens, hatte Clara einen ihrer Anfälle von Morgendepression bekommen. Morgens praktiziert Clara Niedergeschlagenheit, wie andere eine Joggingrunde durch den Park oder ihre tägliche Gymnastik machen. Ein vorbeifahrender Militärkonvoi hatte ihre Mutlosigkeit ausgelöst. Wir hatten gerade die Brücke über die Jade hinter uns, die man kaum einen Fluss nennen konnte. Etwas weiter kamen wir an die Abzweigung einer Nebenstraße. Ein paar Soldaten, die aus einem Geländewagen ausgestiegen waren, hielten direkt vor uns den Verkehr an, um eine lange Lastwagenkolonne vorbeizulassen. Auf den Ladeflächen saßen dicht gedrängt Soldaten mit Kampfuniform und Helmen. Sie hatten geschwärzte Gesichter, als wären sie mitten aus der Arbeit in einem Bergwerk heraus rekrutiert worden. Keine zwei- oder dreihundert Meter weiter bog der Konvoi nach rechts auf die Nebenstraße ab. Er war unseren Blicken gerade entschwunden, als ich Clara missbilligend den Kopf schütteln sah. Ich ahnte Grübelei, Verdruss, Probleme. Um zu vermeiden, dass aus dem Dampftopf ihrer Gedanken etwas überquoll und mich bespritzte, enthielt ich mich der Frage, was mit ihr sei. Die bei anderen Gelegenheiten ganz brauchbare Taktik konnte diesmal nicht verhindern, dass Clara über die für den literarischen Schaffensprozess ungünstige Zeit zu jammern begann, in die sie, wie sie sagte, hineingeboren sei. Ihrer Meinung nach lebten wir in einer Zeit, der es an Größe fehlte. In einer Zeit der Dicken und Faulen. Einer Schickimicki-Zeit. In einer solchen Zeit half es einem Schriftsteller wenig, wenn er mit Talent gesegnet war. Ihre Verbitterung besiegelte sie mit einem ihrer gewohnten Sprüche: «Wer kann mit schlechtem Mehl schon gutes Brot backen!» In der Folge erfuhr ich, dass das Mehl, mit dem Schriftsteller ihre Werke kneten, dadurch entsteht, dass die Realität und der historische Augenblick, in dem sie leben, zusammen gemahlen werden. Ihre – also unsere – Realität bezeichnete Clara als langweilig, trivial, glatt, fade, grau. «Oh ja, vor allem grau», sagte sie und schwenkte die Hände, was wahrscheinlich das Schwerwiegende der Aussage unterstreichen sollte. Ich merkte, wie sie sich erregte, und senkte meinen Blick auf die Tankanzeige, bereit, den Stand der Nadel mit meinem Geduldsvorrat gleichzusetzen. Der Tank war fast noch voll, und ich war mir nicht sicher, ob ich so viel Geduld aufbringen konnte, den Monolog zu ertragen, der sich neben mir ankündigte, besser gesagt, mit seinem neuen Adjektivhagel schon in vollem Gange war. «In Deutschland», fuhr die Frau Schriftstellerin in diesen oder ähnlichen Worten fort, «erleben wir die Tyrannei des Graus. Glaubst du, jemand protestiert oder lehnt sich dagegen auf? Niemand. Deutschland ist ein graues Land. Die Deutschen sind graue Leute. Ihre derzeitige Kultur ist grau. Ihre Politik: Grau; was die Farbe der Asche, des Staubes, des Verhärmten ist. Wohin du auch schaust, überall siehst du nur Grau in diesem Land, weil alles verschlissen, alt und verbraucht ist. Und schau dir das Land selbst an! Das sieht, verdammt noch mal, aus wie mit der Dampfwalze gemacht. Kein schneebedeckter Gipfel weit und breit als Symbol für was weiß ich. Ich kann es nicht wissen, denn schon als Kind war ich gezwungen, sehr weit zu fahren, wenn ich Höhe, Größe, Bemerkenswertes sehen wollte. Sieh dir die Landschaft an, Maus. Alles flach und langweilig wie seine Bewohner.» Jedes Mal, wenn sie das Wort Grau aussprach, senkte und hob Clara den Kopf, so wie die Pferde es machen. Ich beugte mich zur Windschutzscheibe vor und schaute mir die Wolken an. Ich sah, dass Clara recht hatte. «Du hast recht», sagte ich, um ihre Stimmung zu heben, indem ich zu dem meist unfehlbaren Mittel griff, mich ihrer Meinung anzuschließen. Der Himmel, der Straßenbelag, die Nebelfetzen im Geäst der Bäume, alles um uns herum war grau. Auch unser Auto war grau. Clara hatte diese Farbe vor knapp zwei Monaten gegen meinen Willen ausgewählt, denn ich war von Anfang an für ein schwarzes Modell derselben Marke. Ich sah mein Gesicht lieber in einer schwarzen Karosserie gespiegelt als in einer grauen. Wir konnten uns jedenfalls nicht einigen. Der Verkäufer betrachtete uns schon weit zurückgelehnt, als genieße er das Ehespektakel, das wir ihm boten. Clara bediente sich des alten Tricks, die Geduld zu verlieren. Sie zog mich am Arm in eine Ecke des Verkaufsraums und quetschte nahe an meinem Ohr die Worte hervor: «Mäuschen, wir kaufen das Auto doch nicht für ein Beerdigungsinstitut. Komm, sei lieb und hör auf, vor diesem Kerl da meine Nerven zu strapazieren.» So entschieden wir uns für die Farbe, die sie wollte. Ich war versucht, ihr das in Erinnerung zu rufen, als wir in Richtung Cuxhaven fuhren und sie ihre Tirade gegen das Grau der deutschen Wirklichkeit losließ; doch dann hielt ich es für gescheiter, den Mund zu halten, zum einen, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, dass sie bis zum Abend weiterlamentierte, und zum Zweiten, weil, wenn man es recht bedachte, weder Schwarz noch Grau eine Farbe der Freude, des Glücks und der Zuversicht war.
Wir hatten mittlerweile die Weserfähre erreicht. In der Warteschlange waren wir die Ersten, da die Fähre gerade abgelegt hatte und wir uns nun in Geduld üben mussten. Es hatte wieder heftig zu regnen begonnen, sodass wir im Auto sitzen blieben. Ich war neugierig, zu erfahren, ob sie bei den Dicken und Faulen an mich gedacht hatte. Sie hörte nicht zu. Sie besitzt nämlich die Fähigkeit, Geräusche zu filtern, sodass sie selbst entscheidet, was ihr Gehör erreicht und was nicht. Taub für meine Frage, fuhr sie mit ihrer Leier fort: «Und was war mit den Soldaten auf den Lastwagen, Maus? Aus welchem Krieg kamen sie? Aus keinem. In welchen Krieg zogen sie? In keinen. Siehst du, vor welche Herausforderung ich mich gestellt sehe? Ich soll ein interessantes Buch über ein Land und eine Zeit schreiben, die nichts zu bieten haben. Denk nur, was für ein Unterschied das ist, über die Ruhmestaten und Schändlichkeiten eines Weltkriegs mit seinen Schlachten, Bombenhageln und Zerstörungen zu schreiben, die ihren Eingang ins nationale Gedächtnis gefunden haben, oder, wie mir nichts anderes übrig bleibt, von Soldaten zu berichten, die ins Manöver fahren. Schon bevor ich die erste Zeile geschrieben habe, weiß ich, dass mein Buch dieser enormen Beschränkung unterliegt, und ich weiß auch, dass ich nichts daran ändern kann, sosehr ich mich ins Zeug lege, und ich weiß, dass mein Buch zum Scheitern verurteilt ist und ich wieder in die verdammte Schule zurückmuss, Hausaufgaben und Klassenarbeiten korrigieren und dauernd Kopfschmerzen haben.» Der Regen trommelte aufs Autodach. Ich versuchte vergebens, durch die regenverhangene Windschutzscheibe die Fähre irgendwo auf dem breiten Fluss zu entdecken. Wir konnten nicht einmal den Fluss sehen. Ich fragte Clara, ob sie zum Wohl der Literatur einen Krieg in Deutschland haben wolle. «Spinnst du?», empörte sie sich. Eine Weile schwieg sie und sagte dann, verhalten lächelnd: «Keinen Krieg; aber ein paar Erlebnisse auf dieser Reise kämen mir ganz gelegen, meinst du nicht, Maus?» Aus ihrer entspannten Miene, der faltengeglätteten Stirn und ihren glänzenden Augen schloss ich, dass sie die morgendliche Sitzung der Niedergeschlagenheit für beendet erklärte. Kurz darauf rief sie auf dem Mobiltelefon Tante Hildegard an, um ihr mitzuteilen, dass wir unterwegs waren. Danach sprach sie mit Frau Kalthoff, die sie beruhigte und ihr mitteilte, dass Goethe ganz entspannt auf seinem Lieblingsplatz im Wohnzimmer schlief.
3
Kaum waren wir in der Diele und die Haustür hinter uns noch nicht geschlossen, brach Tante Hildegard in bittere Tränen aus. Ich fand nicht einmal Zeit, sie zu begrüßen. Clara, die sie in die Arme genommen hatte, und ich warfen uns verstörte Blicke zu, da wir den Grund für diesen plötzlichen Kummer nicht verstanden. Mir kam es komisch vor, dass die Tante unsere Anwesenheit als belastend empfand, da sie uns doch erwartet und Clara sie von unterwegs sogar zweimal angerufen hatte; einmal, um ihr zu sagen, dass wir unterwegs waren, und dann, um ihr unsere ungefähre Ankunftszeit mitzuteilen. Nach dem ersten Gespräch beschlossen wir aufgrund ihrer Klagen über ich weiß nicht welches Obst man ihr verkauft hatte, ihr die Last zu ersparen, für uns zu kochen. Auf einem Rastplatz hielten wir an und verzehrten unter dem Dach eines öffentlichen Wartehäuschens unsere Brote und die schon gewaschenen und geviertelten Pfirsiche, die wir zu Hause eingepackt hatten. Später unternahmen wir aus dem gleichen Grund und bei besserem Wetter einen Spaziergang in der Umgebung des Cuxhavener Hafens, und gegen zwei oder halb drei waren wir bei ihr. Noch immer die Tante im Arm, machte Clara mir verstohlene Zeichen, bloß nicht das Geschenk aus der Tasche zu holen, als hätte es wirklich eines Hinweises bedurft, dass dies nicht der passende Moment war, einer alten Dame, die wie ein geohrfeigtes kleines Mädchen so laut schluchzte, dass sie kein Wort herausbekam, ein floristisches Gebinde (in Wahrheit ein Blumenstrauß in Zellophanverpackung mit gelbem Bändchen und kitschigen Tonfigürchen dekoriert, den wir bei der Einfahrt in der Stadt an einer Tankstelle gekauft hatten) in die Hand zu drücken.
Nach einer Weile stammelte sie endlich ein paar verständliche Worte. Denen konnten wir entnehmen, dass ihr Bruder, Claras Vater, die Schuld an ihrem Weinkrampf trug, da er sie schon so lange nicht mehr angerufen hatte, obwohl er doch wusste, dass sie letzten März auf dem rechten Auge am Grauen Star operiert worden war und mit dem linken nur noch Licht und verschwommene Schatten erkennen konnte. Hinterher hatte Tante Hildegard den Augenarzt gefragt, ob die Möglichkeit bestünde, dass sie blind werden könne. Woraufhin dieser ihr anscheinend die Ohren mit seinem Fachchinesisch verstopfte, das sie tief beunruhigte, obwohl sie nichts davon verstanden hatte. Und da sie von dem Augenarzt keine eindeutige Antwort bekommen hatte, lebte die Tante jetzt in der Sorge, demnächst mit Blindenstock und schwarzer Brille auf die Straße zu müssen. Erschüttert von dieser Überzeugung, hatte sie vor einigen Tagen einen Katalog für orthopädische Artikel durchgeblättert. Was sie auf keinen Fall wollte, war ein Blindenhund. Noch nie hatte sie Tiere im Haus geduldet und gedachte dies auch in Zukunft nicht zu tun, und wenn sie noch so blind wurde. Der Hauptgrund war, wenn ich das richtig verstand, dass sie überall ihre Haare ließen. Das hatte sie bei einer Bekannten in Cuxhaven erlebt. Sie verstand sich nach wie vor gut mit ihr, aber sie besuchte sie nicht mehr, weil sie sich davor ekelte, in Sesseln zu sitzen, die voller Hundehaare waren. Sie waren sogar auf dem Tisch, auf dem ihre Freundin die Tassen und Teelöffelchen platzierte. Außerdem war der Hund einer dieser unsympathischen Gesellen, die immer bellen, wenn es klingelt, und denen manchmal ein Sabberfaden aus dem Maul trieft. Nein, sie wollte keinen Hund bei sich haben und war uns daher auch dankbar, dass wir Goethe zu Hause gelassen hatten. Nachdem dieses Thema durch war, kam sie wieder auf ihren Bruder zu sprechen. Sie war der Meinung, er hätte sich in den vergangenen Monaten mehr für ihren Gesundheitszustand interessieren müssen, den sie schlicht als katastrophal bezeichnete, so wie sie, als er in Wilhelmshaven am Fuß operiert worden war, ihn sofort im Krankenhaus besucht hatte, obwohl sie damals kaum zum Schlafen kam wegen der Probleme, die einer ihrer Mieter ihr machte. Mein Schwiegervater hatte ihr beim letzten Telefonat offenbar versprochen, sie öfter mal anzurufen, doch seitdem waren schon Monate, oder vielleicht Wochen, vergangen. Ich weiß es nicht mehr, weil ich auch nicht so genau hingehört habe.
Clara kannte die Wehleidigkeit ihrer Tante seit Kinderzeiten; die Komische, wie ihre Mutter sie zu Lebzeiten immer genannt hatte. Die Tante und mein Schwiegervater sind die einzigen Überlebenden einer Familie, die die Hälfte ihrer Angehörigen im Krieg verloren hat. Claras Großvater starb in einer Straße in Wilhelmshaven bei einem Bombenangriff. Der Großmutter, die hinter ihm her zu einem Luftschutzkeller lief, trennte ein Bombensplitter die linke Hand ab. Bis zu ihrem Tod mit fast neunzig Jahren in einem Altenheim trug sie eine Prothese, die sie unter einem Handschuh versteckte. Die beiden älteren Brüder – die Zwillinge – wurden an die Ostfront nach Russland geschickt und kamen nie zurück. Von einem weiß man, dass er in der Nähe von Bobruisk gefallen ist. Der andere galt als vermisst, und als solcher wird sein Name neben dem seines Bruders und anderer Gefallener aus der Gegend auf einer Gedenktafel geführt, die auf dem Friedhof seiner Heimatstadt aufgestellt worden ist. Tante Hildegard vermutet, da sie schon als Kinder unzertrennlich waren, dass sie Seite an Seite gestorben sind.
Während unseres Spaziergangs in der Umgebung des Hafens, den wir unternahmen, bis wir bei der Tante vorstellig werden konnten, beschwor Clara mich, bei unserer Ankunft nicht den sympathischen Ehemann zu spielen und mich auf keinen Fall bei der Tante nach deren Befinden zu erkundigen. «Wenn du sie fragst», warnte sie mich, «glaubt sie, dass dich ihre Leiden wirklich interessieren. Dann kann es späte Nacht werden, und sie ist immer noch nicht damit fertig, uns zu erzählen, was sie alles erdulden muss, wie einsam sie ist und wie sie nicht mehr leben mag, obwohl es ihr eigentlich gut geht und sie auch keine Geldsorgen hat. Also, Mäuschen, wenn wir im Haus sind, sag ihr nur guten Tag und gib ihr, wenn du willst, einen Kuss. Ich spreche schon für uns beide.» Ich schlug vor, dass wir dem Jammern der Tante vielleicht zuvorkommen könnten, indem wir selbst über das schlechte Wetter, den schlechten Zustand der Straßen oder sonstige tatsächliche oder erfundene Dinge klagten, etwa dass Clara sich beim Aussteigen aus dem Auto den Knöchel verstaucht hätte. Wenn wir uns beim Klagen gegenseitig überböten, könnten wir Tante Hildegards Gejammer vielleicht neutralisieren oder wenigstens ausdünnen und abkürzen. Clara betrachtete mich mit ernstem Blick. «Weißt du», sagte sie, «manchmal glaube ich, dass du eine böse Ader hast.»
Inmitten der tränenreichen Szene gelang es mir, den Schlüssel zum Hoftor zu finden, der mit seinem beschrifteten Etikett an einer an die Wand genagelten Holzleiste mit Haken hing. Ich ging nach draußen, um unser Auto im Innenhof des Hauses zu parken, in dem die Tante, wie jeder andere Bewohner des Gebäudes, einen aufgemalten Parkplatz besitzt. In den zehn Minuten meiner Abwesenheit war es Clara gelungen, die alte Frau zu trösten, und als ich wieder in die Wohnung kam, fand ich die beiden angeregt plaudernd in der Küche. Vorher hatte ich mir die Schuhe ausgezogen und sie neben Claras auf eine Matte gestellt, die zu diesem Zweck in der Diele liegt. In Tante Hildegards Wohnung und auch in der von Frau Kalthoff ist es üblich, dass Besucher sich – wie in einer Moschee – am Eingang die Schuhe ausziehen und dann auf Strümpfen in der Wohnung herumlaufen, es sei denn, sie haben ihre eigenen Pantoffeln mitgebracht. Auf dem mit einem verschlissenen Wachstuch bedeckten Küchentisch sah man etliche Gläser unterschiedlicher Größe, die alle kopfüber auf dem Deckel standen, was offenbar für die Konservierung ihres Inhalts wichtig war. Ich erfuhr, dass Tante Hildegard bis kurz vor unserer Ankunft Johannisbeermarmelade eingekocht hatte. So begeistert, wie sie davon sprach, nahm ich an, dass Clara auf den alten Trick verfallen war, Interesse für dieses Thema zu heucheln, was der Tante Gelegenheit gegeben hatte, ihren Kummer zu vergessen und sich nun über die große Leidenschaft ihres Lebens – Küchenrezepte – zu verbreiten.
Unbemerkt von beiden, ging ich ins Wohnzimmer. Von dem großen Fenster aus sah man auf ein Hafenbecken, in dem die dort festgemachten Schiffe gewöhnlich einen dichten Wald von Masten bilden. Das mit dem Wald von Masten habe ich, ehrlich gesagt, einem kurzen Text von Clara entnommen, der vor einigen Jahren in ihrer Schulzeitung veröffentlicht wurde. Als ich ihr damals half, den Text am Computer ins Reine zu schreiben, empfahl ich ihr, diese Metapher zu streichen. Da sie ihrerseits in einem Roman einer von ihr geschätzten deutschen Autorin darauf gestoßen war, setzte sie sich gegen eine Streichung empört zur Wehr und fragte mich, für wen ich mich hielte, ihr Ratschläge über das Schreiben zu erteilen. Hielt ich mich etwa für berufen? Hatte ich schon mal ein Buch veröffentlicht? Aus Trotz war ich kurz versucht, sie an eine Rezension ihres ersten Romans in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu erinnern; ich verbiss es mir jedoch, weil sie das schlimmer getroffen hätte als ein Schlag mit dem Hammer auf den Kopf. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Metapher des Mastenwaldes ein Kitsch sondergleichen ist, den ich mir allerdings – im Unterschied zu Clara – durchaus leisten könnte. Denn die Schreibübungen, denen ich mich in meiner freien Zeit hingebe, damit mir die Muttersprache nicht einrostet, wer sollte sie lesen! Die Kritiker der Zeitungen, die Clara fürchtet wie giftige Skorpione, selbstverständlich nicht.
Hinter dem Hafenbecken sieht man Frachter und das eine oder andere Passagierschiff in entgegengesetzter Richtung die Elbemündung passieren, die vor Cuxhaven so breit ist, dass man nicht weiß, ob die bleigraue Fläche, die sich vor den Augen ausdehnt, Fluss oder Meer ist. Aus den Karten geht das nicht eindeutig her-vor, und ich bin, ehrlich gesagt, wenig versucht, ans Ufer zu gehen und es am Geschmack des Wassers herauszufinden. Meistens fahren die Schiffe in großen Abständen vorbei, doch manchmal sieht man drei oder vier von ihnen hintereinander langsam und schwerfällig vorüberziehen und eine ganze Weile später im fernen Dunst verschwinden. In der Regel überholen kleine Schiffe die großen, jedoch nicht immer. Bojen mit roten und grünen Lichtern markieren ihnen den Weg. Manchmal sieht es aus, als würden zwei dieser Stahlkolosse frontal aufeinanderstoßen, und im letzten Moment erkennt man, dass sie auf parallelen Routen fahren. Einige fahren Elbe aufwärts Richtung Hamburger Hafen; andere streben aufs offene Meer, um unterschiedlichste Fracht bis an wer weiß welches Ende der Welt zu bringen. Tante Hildegard mag ihre Stimmungen haben; aber sie hat auch eine Fensteraussicht, für die es sich lohnt, sie hin und wieder zu besuchen.
Ihre Stimme im Flur riss mich aus meiner angenehmen Betrachtung. Ich hörte meinen Namen inmitten eines fragenden Wortschwalls und gleich darauf Claras kategorische Antwort: «Keinen Alkohol! Er muss noch fahren.» «Und Kaffee?» «Mach dir keine Mühe, Tante. Wir haben unterwegs schon welchen getrunken.» Gelogen. Als wir in Cuxhaven ankamen, blies ein kalter Wind, und ich schlug vor, uns in der Fußgängerzone in eine Cafeteria zu setzen. Clara hielt jedoch mit dem doppelten Argument dagegen, dass es sinnvoll sei, die Reisekosten niedrig zu halten, und dass Tante Hildegard uns mit Sicherheit Kaffee und Kuchen aufdrängen werde, und wollte lieber, dass wir einen Spaziergang unternahmen. Um zwei Uhr saßen wir also im Wohnzimmer, und Tante Hildegard, die offenbar Mitleid mit mir hatte, weil ich an ihrem gastronomischen Geplauder nicht beteiligt war, bot mir an, den Fernseher einzuschalten. Nun gibt es montags am frühen Nachmittag, soweit ich weiß, keine Sendungen, die mich interessieren konnten. Da aber immer die Möglichkeit besteht, irgendwo auf ein Sportprogramm zu stoßen, schien mir die Idee der Tante gar nicht so verkehrt. Clara machte sie allerdings zunichte, indem sie meiner Antwort zuvorkam: «Tante Hildegard, wir sind doch nicht gekommen, um fernzusehen, sondern um dich zu besuchen.» Nachdem ihre Angebote eines nach dem anderen zurückgewiesen worden waren (wenn auch nicht von mir, der ich jedes einzelne gerne angenommen hätte), haderte die Tante wohl damit, mir nichts Gutes tun oder wenigstens irgendeine Art von Unterhaltung bieten zu können, während sie und Clara sich bestens unterhielten. Letzteres war mit Sicherheit der Grund, dass sie mich einlud, mir das Familienalbum anzusehen, wobei sie offenbar vergaß, dass sie es mir auch bei früheren Besuchen schon gezeigt hatte. Nichts behagte mir weniger, als mich wieder durch die vergilbten Seiten dieses Fotoalbums zu quälen. Bevor die Tante Zeit fand, es aus dem Wohnzimmerschrank zu holen, suchte ich daher nach passenden Worten, um mich diesem faden Zeitvertreib zu entziehen. Ich wollte schon den Mund aufmachen, da kreuzte ich zufällig Claras Blick. Sie hatte in einem Sessel der Sitzgruppe Platz genommen, und ihre strenge Miene ließ keinen Zweifel zu. Dies war die Stunde der Familienfotos.
Ich setzte mich aufs Sofa und warf einen raschen Blick auf die vom Fenster eingerahmten Wolken, gleichsam als stillen Abschied von ihnen. Und dann lag auch schon das Album mit den grünen Einbanddeckeln vor mir auf einem niederen Tischchen mit gläserner Tischplatte, das in der Mitte des Wohnzimmers stand, und gleich darauf die Seite mit den verblichenen Fotos der Zwillinge, Gefreite in einem Pionierbataillon, mit Tellermütze, Uniform und Rangabzeichen, und Tante Hildegard saß an meiner Seite und erzählte mir, als wäre es das erste Mal, die nur allzu bekannten Familiengeschichten. Auf den ersten Seiten gab es kein einziges Foto, auf dem nicht die Zwillinge in den verschiedenen Phasen ihres kurzen Lebens zu sehen waren, für sich oder in einer Gruppe, aber stets zusammen, einer an der Seite des anderen. Zwillinge in Kinderkleidung, Zwillinge in Konfirmationsanzügen, sportlich gekleidete Zwillinge, Zwillinge in Uniform. Auf allen Fotos, ob als Kinder oder als junge Männer, machten sie einen gesunden Eindruck mit kurzgeschnittenen Haaren und abstehenden Ohren. Kein Zweifel, dass sie nach so vielen Jahren immer noch einen bevorzugten Platz in Tante Hildegards Erinnerung einnahmen. Clara ist gleichfalls der Meinung, dass die Tante immer noch die gleiche glühende Bewunderung für ihre beiden älteren Brüder empfindet wie zu deren Lebzeiten, was an ihrer bebenden Stimme, den feierlichen Gesten und anderen Details zu erkennen ist, wenn sie von ihnen spricht. Ganz im Gegensatz zu meinem Schwiegervater, der, da er sechs Jahre alt war, als die Zwillinge an die Front mussten, sich nur durch das an sie erinnert, was seine Mutter und seine Schwester ihm erzählten. Ihn habe ich auch einmal sagen hören, dass die Zwillinge bestimmt zusammen begraben sind, da sie unzertrennlich waren.
Wie schon bei meinen früheren Besuchen fragte Tante Hildegard, nachdem sie das Denkmal «für die zur Ehre des geliebten Vaterlands Gefallenen» erwähnt hatte, unter deren Namen auch die ihrer Brüder (natürlich nebeneinander) in den Gedenkstein gemeißelt sind, ob meine Eltern und Großeltern auch die Geißel des Krieges zu spüren bekommen hätten. Ich beschloss, ihr eine knappe Erklärung über den letzten kriegerischen Konflikt anzubieten, der in meinem Land stattgefunden hatte, und mir dazu ein paar Schulerinnerungen zusammenzusuchen. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich mich nicht in Einzelheiten ergehen musste. Selten habe ich mehr als drei Sätze an die Tante loswerden können. Entweder versteht sie mich nicht oder hört mir nicht zu, oder sie ist taub, oder ich spreche die Wörter in ihrer Sprache nicht so aus, wie das Gehör einer alten Dame es erfordert. Sei es, wie es sei, ich nehme es ihr nicht übel; ich halte den Mund und Punkt. Ich begann mit allgemeinen Worten über die Epoche zu sprechen, die ich zum Glück nicht selbst erleben musste. Kaum hatte ich den Mund aufgemacht, da schlug sie – ohne zu merken, dass ich mit meiner Erzählung begonnen hatte – die nächste Seite im Album auf und brachte angesichts der folgenden Fotos eine belanglose Anekdote über ihren Vater zu Gehör. Clara blätterte unterdessen ganz entspannt in der Fernsehzeitung, die bei der Tante immer aufgeschlagen auf dem Wohnzimmertisch liegt. Ich fand es ungerecht, dass sie mich mit den Erzählungen und dem Tratsch der Tante allein ließ. Mit einer Reihe von Mund- und Rachengeräuschen konnte ich unbemerkt ihre Aufmerksamkeit erregen, und kaum hatte sie mir das Gesicht zugewandt, traf sie mein messerscharfer Blick. Sie verstand die Botschaft sofort. Sie legte die Zeitschrift an ihren Platz zurück und kam mir zu Hilfe, indem sie der Tante vorschlug, mich allein im Album weiterblättern zu lassen und mit ihr in die Küche zu gehen, wo es noch ich weiß nicht welche komplizierten Krankenversicherungsformulare auszufüllen gebe. Beim Aufstehen bot die Tante mir an, ich könne mich vertrauensvoll an sie wenden, falls ich Fragen zu den Fotos hätte. «Du kannst gern in die Küche kommen und mich fragen», sagte sie. Clara ging hinter ihr, und auf ihren Lippen spielte ein schadenfrohes Lächeln. Sie besaß sogar die Dreistigkeit, vorzuschlagen, ich könne eventuelle Fragen ja aufschreiben. Ihre Tante, die von dem Spiel nichts mitbekam, antwortete ernst, das sei gar nicht nötig. Kaum waren die beiden aus dem Zimmer, schlich ich zum Barschrank, doch ein quietschendes Scharnier verriet mich. Sofort hörte ich Clara aus der Küche meinen Namen rufen. «Was ist passiert?», fragte die Tante besorgt. Clara flüsterte ein paar gewiss beruhigende Worte, die ich nicht verstehen konnte. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder dem Fenster zuzuwenden, dem Wald von Schiffsmasten, den Möwen, den vorbeiziehenden Frachtern.