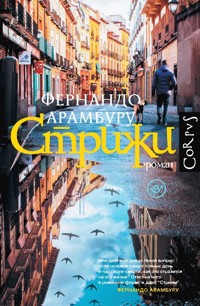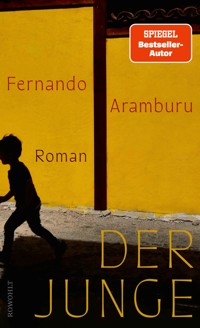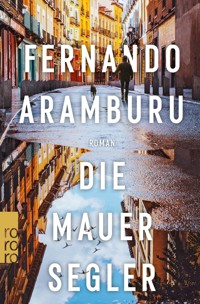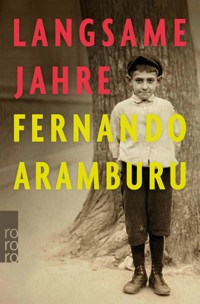9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser epochale Roman über Schuld und Vergebung, Freundschaft und Liebe zeigt eindringlich, wie der Terrorismus den inneren Kern einer Gemeinschaft zerstört und wie lange es dauert, bis Menschen wieder zueinander finden. Ein Bestseller in Spanien, der die Abgründe des baskischen Konflikts und die Narben, die er in Familien und einer ganzen Gesellschaft hinterlässt, schonungslos offenlegt. «Patria» erzählt die Geschichte zweier baskischer Familien, deren Freundschaft durch den Terror der ETA zerstört wird. Nach dem Mord an ihrem Mann Txato kehrt Bittori in ihr Heimatdorf zurück, um die Wahrheit über die Vergangenheit zu erfahren. Ihr Auftauchen stört die fragile Ruhe und konfrontiert sie und ihre ehemalige Freundin Miren, deren Sohn als ETA-Terrorist im Gefängnis sitzt, mit alten Wunden. Aramburus preisgekrönter Roman beleuchtet eindringlich, wie Terrorismus Familien und Gemeinschaften spaltet und stellt die Frage nach Schuld, Vergebung und dem, was Heimat bedeutet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 950
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Fernando Aramburu
Patria
Roman
Über dieses Buch
«Patria» heißt Vaterland, Heimat. Aber was ist Heimat? Die beiden Frauen und ihre Familie, um die es in Fernando Aramburus von der Kritik gefeierten und mit den größten spanischen Literaturpreisen ausgezeichneten Roman geht, sehen ihre Heimat mit verschiedenen Augen.
Bittori sitzt am Grab ihres Mannes Txato, der vor über zwanzig Jahren von Terroristen erschossen wurde. Sie erzählt ihm, dass sie beschlossen hat, in das Haus, in dem sie wohnten, zurückzukehren. Denn sie will herausfinden, was damals wirklich geschehen ist, und wieder unter denen leben, die einst schweigend zugesehen hatten, wie ihre Familie ausgegrenzt wurde. Das Auftauchen von Bittori beendet schlagartig die vermeintliche Ruhe im Dorf. Vor allem die Nachbarin Miren, damals ihre beste Freundin, heute Mutter eines Sohnes, der als Terrorist in Haft sitzt, zeigt sich alarmiert. Dass Mirens Sohn etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat, ist Bittoris schlimmste Befürchtung. Die beiden Frauen gehen sich aus dem Weg, doch irgendwann lässt sich die lange erwartete Begegnung nicht mehr vermeiden …
Ein Bestseller in Spanien, monatelang auf Platz 1 der Bestsellerliste, ein epochemachender Roman über Schuld und Vergebung, Freundschaft und Liebe, der zeigt, wie Terrorismus den inneren Kern einer Gemeinschaft angreift und wie lange es dauert, bis die Menschen wieder zueinander finden.
Vita
Fernando Aramburu, geboren 1959 in San Sebastián im Baskenland, hat in Spanien schon mehrere Romane veröffentlicht. Er lebt seit vielen Jahren in Hannover. Für sein umfassendes Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Premio Vargas Llosa, Premio Biblioteca Breve, Premio Euskadi, zuletzt, für «Patria», mit dem Premio Nacional de la Crítica 2017 und auch mit dem bedeutendsten spanischen Literaturpreis, dem Premio Nacional de Narrativa 2017.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Patria» bei Tusquets Editores, Barcelona.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Patria» Copyright © 2016 by Fernando Aramburu
Covergestaltung bürosüd, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: Filiep Colpaert/EyeEm/Getty Images
ISBN 978-3-644-00126-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Stöckelschuhe auf Parkett
Da geht sie, die Arme, um an ihm zu zerbrechen. So wie eine Welle an der Klippe bricht. Ein bisschen Gischt und tschüs. Sieht sie denn nicht, dass er sich nicht einmal die Mühe macht, ihr die Tür aufzuhalten? Unterwürfig, mehr als unterwürfig.
Und diese Stöckelschuhe und die rot geschminkten Lippen mit ihren fünfundvierzig Jahren, wozu? Bei deiner Klasse, Kind, bei deiner Position und deiner Bildung; was musst du dich da wie ein junges Ding aufführen? Würde der aita dich so sehen …
Beim Einsteigen ins Auto warf Nerea einen Blick zum Fenster hinauf, hinter dessen Jalousie vermutlich ihre Mutter stand und sie wie gewohnt beobachtete. Und ja, wenngleich sie von der Straße aus nicht zu sehen war, Bittori betrachtete sie voller Mitleid und mit gerunzelter Stirn, sprach im Flüsterton mit sich selbst, da geht sie hin, die Arme, mit der dieser eingebildete Kerl sich schmückt, der nie auch nur daran gedacht hat, jemand anderen als sich selbst zu beglücken. Ist ihr nicht klar, dass eine Frau schon arg verzweifelt sein muss, wenn sie ihrem Mann nach zwölf Ehejahren noch verführerisch kommen will? Im Grunde ist es ja gut, dass sie keine Kinder haben.
Nerea winkte kurz zum Abschied, bevor sie ins Taxi stieg. Ihre Mutter, im dritten Stock hinter der Jalousie, ließ den Blick schweifen. Über den Dächern war ein breiter Streifen Meer zu sehen, der Leuchtturm auf der Insel Santa Clara, in der Ferne blasse Wolken. Die Wetterfrau hatte Sonnenschein angekündigt. Und sie – ach, wie alt ich geworden bin – schaute wieder auf die Straße hinunter, und das Taxi war bereits verschwunden.
Sie richtete den Blick in eine Ferne jenseits der Dächer, jenseits der Insel und der blauen Linie des Horizonts, noch über die fernen Wolken hinaus in eine für immer verlorene Vergangenheit, auf das Hochzeitsfest ihrer Tochter. Und sah sie wieder in der Kathedrale zum Guten Hirten, ganz in Weiß, mit ihrem Blumenstrauß und überglücklich, und wie sie sie so aus der Kirche kommen sieht, schlank, lächelnd und wunderschön, da überkam sie eine dunkle Vorahnung. Nachts, als sie allein in ihr Haus zurückkehrte, hätte sie sich beinahe vor Txatos gerahmtes Foto gesetzt und ihm ihre Befürchtungen gebeichtet. Aber sie hatte Kopfschmerzen, und außerdem wurde Txato, wenn es um die Familie und vor allem um seine Tochter ging, gern sentimental. Er war nah am Wasser gebaut, der Mann, und wenn Fotos auch nicht weinen, weiß ich doch, was ich meine.
Die Stöckelschuhe sollten Quiques Appetit wecken; nicht unbedingt den, den man durch essen befriedigt. Tack, tack, tack, hatte sie sie eben noch übers Parkett klappern hören. Dass sie mir bloß keine Löcher rein macht. Um des lieben Friedens willen hatte sie nichts gesagt. Sie waren nur auf einen Sprung vorbeigekommen, um sich zu verabschieden. Und er hatte schon um neun Uhr morgens nach Whisky gerochen oder nach sonst einem der Schnäpse, die er verkauft.
«Ama, kommst du auch wirklich allein zurecht?»
«Warum nehmt ihr denn nicht den Bus zum Flughafen? Das Taxi von hier nach Bilbao kostet doch ein Vermögen.»
Er:
«Mach dir darüber mal keine Sorgen.»
Das Gepäck, so unbequem, so langsam, wandte sie ein.
«Ja, aber ihr habt doch reichlich Zeit, oder?»
«Ama, hör auf damit! Wir haben das Taxi schon bestellt, es ist viel bequemer.»
Quique wurde ungeduldig.
«Es ist das Einzige, was bequem ist.»
Und fügte hinzu, er gehe nach draußen, eine Zigarette rauchen während ihr quatscht. Er roch stark nach Parfüm, dieser Mann. Aus dem Mund roch er aber nach Schnaps, und das schon um neun Uhr morgens. Er verabschiedete sich und betrachtete dabei sein Gesicht im Garderobenspiegel. Lackaffe. Dann – befehlsgewohnt? freundlich, aber kurz angebunden? – zu Nerea:
«Beeil dich.»
Fünf Minuten, versprach sie. Am Ende waren es fünfzehn. Allein mit ihrer Mutter: Diese Reise nach London bedeute ihr viel.
«Ich kann mir schwer vorstellen, dass du bei den Gesprächen deines Mannes mit den Kunden irgendwas zu sagen hast. Oder hast du es mir verschwiegen und arbeitest jetzt in seiner Firma?»
«In London will ich einen ernsthaften Versuch unternehmen, unsere Ehe zu retten.»
«Noch einen Versuch?»
«Den letzten.»
«Und welche Taktik verfolgst du dieses Mal? Du bleibst an seiner Seite, damit er dich nicht mit der Erstbesten betrügt, die ihm über den Weg läuft?»
«Ama, bitte. Mach es mir nicht noch schwerer.»
«Du siehst schön aus. Hast du den Friseur gewechselt?»
«Nein, ist immer noch derselbe.»
Nerea senkte die Stimme. Bei den ersten geflüsterten Worten schaute die Mutter wieder zur Tür, als fürchte sie, irgendein Fremder könne sie belauschen. Nein, nichts, die Idee, ein Kind zu adoptieren, hatten sie jetzt aufgegeben. Und was hatten sie nicht alles überlegt! Ob ein kleiner Chinese, Russe oder Brauner. Ob Junge oder Mädchen. Nerea hegte zwar noch Hoffnung, aber Quique hatte einen Rückzieher gemacht. Er will einen eigenen Sohn, Fleisch von seinem Fleisch.
«Hat er’s jetzt mit Bibelworten?»
«Er hält sich für modern, dabei ist er altmodischer als eine gestopfte Socke.»
Nerea hatte sich heimlich über die Formalitäten für eine Adoption informiert, und ja, sie erfüllten sämtliche Bedingungen. Geld war auch nicht das Problem. Sie war bereit, bis ans Ende der Welt zu fahren, um Mutter zu werden, auch wenn sie dem Kind nicht selbst das Leben schenken konnte. Aber Quique hatte die Diskussion abrupt beendet. Nein, nein und nochmals nein.
«Ein wenig unsensibel, der Bursche, findest du nicht?»
«Er will einen Jungen, der von ihm ist, der ihm ähnlich sieht, der eines Tages bei Real spielt. Er ist besessen, Ama. Und er wird ihn bekommen. Wenn der sich einmal was vorgenommen hat! Ich weiß nicht, mit wem. Mit irgendeiner, die sich dafür hergibt. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Er wird sich einen Bauch mieten und bezahlen, was dafür zu bezahlen ist. Was mich angeht, ich würde ihm helfen, eine gesunde Frau zu finden, die ihm seinen Wunsch erfüllt.»
«Du bist ja verrückt.»
«Gesagt habe ich ihm davon noch nichts. Ich hoffe, dass ich in diesen Tagen in London eine Gelegenheit finde. Ich habe es mir gut überlegt. Ich kann doch nicht von ihm verlangen, dass er unglücklich ist.»
Sie streiften Wangen an der Wohnungstür. Bittori: Ja, sie komme schon allein zurecht, gute Reise auch. Nerea – auf dem Treppenabsatz, wo sie auf den Fahrstuhl wartete – sagte etwas von Pech im Leben, dass wir aber die Freude nicht von uns weisen dürfen. Dann empfahl sie ihrer Mutter noch, sich eine neue Fußmatte zuzulegen.
Goldener Oktober
Vor der Sache mit Txato war sie gläubig, jetzt glaubte sie nicht mehr. Dabei war sie als Mädchen so fromm gewesen. Hätte beinahe sogar das Gelübde abgelegt. Sie und die Freundin aus dem Dorf, an die man sich besser nicht mehr erinnert. In letzter Minute hatten sie ihren Vorsatz aufgegeben, mit einem Bein bereits im Noviziat. Heute hält sie das von der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben, dem Lieben Gott und dem Heiligen Geist für ausgemachten Schwindel.
Sie ärgerte sich über einige Worte des Bischofs, der so tat als. Einem so wichtigen Herrn die Hand zu verweigern, traute sie sich jedoch nicht. Seine fühlte sich feucht und kleberig an. Aber sie schaute ihm fest ins Gesicht und gab ihm still – nur mit lodernden Augen – zu verstehen, dass sie nicht mehr gläubig war. Beim Anblick von Txato im Sarg war ihr Glaube an Gott wie eine Blase zerplatzt. Sie hatte es sogar körperlich gespürt.
Trotzdem geht sie hin und wieder zur Messe. Die Macht der Gewohnheit vielleicht. Sie setzt sich in eine der hinteren Bänke, schaut auf die Rücken und Hinterköpfe der Gläubigen, spricht mit sich selbst. Im Haus ist es schon sehr einsam. Und sie ist keine, die in Bars oder Bistros geht. Einkäufe? Das Notwendige. Aus Äußerlichkeiten macht sie sich nicht mehr so viel – noch eine Blase? –, wie sie es vor der Sache mit Txato getan hat. Nur weil Nerea darauf besteht, dass, sonst würde sie Tag für Tag die gleichen Sachen tragen.
Statt in Läden zu gehen, sitzt sie lieber in der Kirche und praktiziert ihren stillen Atheismus. Gotteslästerlichkeiten und Verachtung der dort versammelten Gläubigen hat sie sich verboten. Sie schaut die Statuen an und sagt/denkt: nein. Manchmal sagt/denkt sie es und schüttelt dabei leicht den Kopf zum Zeichen der Ablehnung.
Wird eine Messe gefeiert, bleibt sie länger. Dann widerspricht sie bei sich allem, was der Priester vorträgt. Lasset uns beten. Nein. Dies ist der Leib Christi. Nein. Und so weiter die ganze Zeit. Gelegentlich, wenn die Müdigkeit sie übermannt, macht sie unauffällig ein Nickerchen.
Sie kam aus der Jesuitenkirche in der Calle Andía, als es schon dunkel wurde. Es war Donnerstag. Die Temperatur war angenehm. Am Nachmittag hatte sie gesehen, dass die Leuchtziffern an einer Apotheke zwanzig Grad anzeigten. Verkehr, Fußgänger, Tauben. Ein bekanntes Gesicht kam ihr entgegen. Ohne zu zögern, wechselte sie die Straßenseite. Durch den abrupten Richtungswechsel konnte sie nicht anders, als in die Plaza de Guipúzcoa einzubiegen. Sie überquerte sie auf dem Weg, der am Teich vorbeiführte. Dort betrachtete sie die Enten. Wie lange war sie nicht mehr hier gewesen! Wenn sie sich recht erinnerte, zuletzt mit der kleinen Nerea. Sie erinnerte sich an schwarze Schwäne, die man jetzt nicht mehr sieht. Ding dong ding. Das Glockenspiel am Rathaus riss sie aus ihren Gedanken.
Zwanzig Uhr. Milder Abend, goldener Oktober. Mit einem Mal musste sie an die Worte denken, die Nerea am Morgen gesagt hatte. Sie sollte sich eine neue Fußmatte zulegen? Nein, man dürfe die Freude nicht von sich weisen. Pah, Geschwätz für alte Leute, um sie bei Laune zu halten. Bittori hatte gar kein Problem damit, diesen Tag als großartig zu empfinden. Um Freudensprünge zu vollführen, hätte sie jedoch anderer Anreize bedurft. Zum Beispiel? Ach, was weiß ich. Dass man eine Apparatur erfindet, mit der die Toten wieder zum Leben erweckt werden und ich meinen Mann zurückbekomme. Sie fragte sich, ob sie nach so vielen Jahren nicht vielleicht ans Vergessen denken sollte. Vergessen? Was ist das denn?
In der Luft lag ein Geruch wie von Algen und Meeresfeuchtigkeit. Es war kein bisschen kalt, es wehte kein Wind, und der Himmel war klar. Gründe genug, sagte sie sich, zu Fuß nach Hause zu gehen und sich den Bus zu sparen. In der Calle Urbieta hörte sie ihren Namen. Sie vernahm ihn klar und deutlich, wollte sich aber nicht umdrehen. Sie ging sogar etwas schneller, doch es half nichts. Eilige Schritte näherten sich von hinten.
«Bittori, Bittori.»
Die Stimme klang schon viel zu nah, um noch so tun zu können, als hörte sie sie nicht.
«Hast du’s mitgekriegt? Sie wollen mit den Attentaten aufhören.»
Bittori musste an die Zeit denken, als diese Nachbarin ihr tunlichst aus dem Weg gegangen, sogar an der Straßenecke – die Einkaufstüte zwischen den Beinen – im Regen stehen geblieben war, um bloß nicht am Hauseingang mit ihr zusammentreffen zu müssen.
Sie log:
«Ja, ich hab’s eben gehört.»
«Ist das nicht eine gute Nachricht? Endlich kriegen wir Frieden. Wurde auch Zeit.»
«Na, wir werden sehn …»
«Ich freue mich vor allem für euch, die ihr so Schlimmes durchgemacht habt. Das soll jetzt alles aufhören, und sie sollen euch in Ruhe lassen.»
«Was soll alles aufhören?»
«Dass sie sich an Leuten vergreifen, sie sollen endlich anfangen, für ihre Sache einzustehen, ohne zu morden.»
Da Bittori schwieg und keine Absicht erkennen ließ, das Gespräch fortzuführen, verabschiedete sich die Nachbarin, als habe sie es plötzlich eilig.
«Ich muss weiter. Ich habe meinem Sohn zum Abendessen Rotbarben versprochen. Die mag er so gern. Wenn du auch auf dem Heimweg bist, begleite ich dich.»
«Nein, ich bin hier ganz in der Nähe verabredet.»
Um der Nachbarin aus den Augen zu kommen, überquerte sie die Straße und bummelte eine Weile ziellos durch die Gegend. Denn, klar, wenn die Schlampe, während sie für ihren Sohn – der mir immer wie ein Trottel, ein ausgemachter Blödmann vorgekommen ist – die Fische säubert, mich kurz nach ihr nach Hause kommen hört, denkt sie natürlich, aha, die wollte nichts mit mir zu tun haben. Bittori! Was? Du ertrinkst in Verbitterung, und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass. Schon gut, lass mich in Ruhe.
Später, auf dem Heimweg, legte sie eine Hand an den rauen Stamm eines Baumes und murmelte: Danke für deine Menschlichkeit. Danach legte sie die Hand an eine Hauswand und wiederholte ihre Worte. Dasselbe tat sie – im Vorübergehen – bei einer Mülltonne, einer Parkbank, einer Straßenlaterne und weiterem Mobiliar des öffentlichen Raums, an dem sie vorbeikam.
Der Hauseingang, im Dunkeln. Sie war versucht, den Fahrstuhl zu nehmen. Vorsicht. Der Lärm könnte mich verraten. Sie beschloss, die drei Stockwerke auf Strümpfen hochzugehen. Da blieb noch Zeit für einen geflüsterten Dank ans Treppengeländer: für deine Menschlichkeit. So leise wie möglich schloss sie die Tür auf. Was hat Nerea bloß gegen diese Fußmatte? Ich verstehe das Kind einfach nicht; ich glaube, ich habe es noch nie verstanden.
Kurz darauf klingelte das Telefon. Ikatza schlummerte auf dem Sofa, eine Kugel aus schwarzem Fell. Ohne sich zu bewegen, die Augen nur halb geöffnet, verfolgte sie den Weg ihres Frauchens zum Telefon. Bittori wartete, bis das Klingeln aufhörte, las die Nummer auf dem Display und wählte sie.
Xabier, aufgeregt. Ama, ama. Sie solle den Fernseher einschalten.
«Ich hab’s schon gehört. Von wem? Von der von oben.»
«Ah, ich habe gedacht, du wüsstest es noch nicht.»
Er schickte ihr einen Kuss und sie ihm einen zurück, mehr sprachen sie nicht und legten auf. Ich mache den Fernseher nicht an, sagte sie sich. Doch dann siegte ihre Neugier. Auf dem Bildschirm erschienen drei Kapuzen unter Baskenmützen, nebeneinander an einem Tisch, Ku-Klux-Klan-Ästhetik, weiße Tischdecke, patriotische Poster, ein Mikrophon, und sie dachte: Ob die Mutter dessen, der spricht, seine Stimme erkennt? Sie empfand heftigen Abscheu beim Anblick der Bilder, und außerdem bekam sie Magengrimmen davon. Unfähig, sie länger zu ertragen, schaltete sie den Fernseher aus.
Für sie war der Tag zu Ende. Wie spät war es? Gleich zehn. Sie stellte der Katze frisches Wasser hin und ging früher als gewohnt zu Bett, ohne Abendessen, ohne einen Blick in die Zeitschrift zu werfen, die auf dem Nachttisch lag. Im Nachthemd blieb sie vor Txatos Foto an der Schlafzimmerwand stehen und sagte:
«Morgen komme ich dich besuchen und berichte dir. Ich glaube zwar nicht, dass du dich freuen wirst; aber es ist immerhin die Nachricht des Tages, und du hast ein Recht darauf, sie zu erfahren.»
Sie löschte das Licht und versuchte, ihren Augen eine Träne abzupressen. Nichts. Trocken. Und Nerea hatte nicht angerufen. Sie hatte es nicht einmal für nötig gehalten, ihr mitzuteilen, ob sie gut in London angekommen waren. Klar, sie hat wohl genug damit zu tun, ihre Ehe zu retten.
Beim Txato in Polloe
Es ist schon ein paar Jahre her, dass sie zu Fuß nach Polloe hinaufgegangen ist. Können könnte sie, aber es ermüdet sie. Müde zu werden macht ihr nichts aus; aber wozu, hm, wozu? Außerdem gibt es Tage, da spürt sie so ein Stechen im Bauch. Also fährt Bittori mit dem Neuner, der hält nur ein paar Schritte vom Friedhofseingang entfernt. Nach Hause geht sie hinterher zu Fuß. Bergab ist ja was anderes.
Sie stieg hinter einer anderen Frau aus, sie beide die einzigen Fahrgäste. Freitag, Stille, schönes Wetter. An dem Bogen des Eingangstors las sie: BALD WIRD MAN VON EUCH SAGEN, WAS MAN VON UNS HEUTE SAGT: SIE SIND GESTORBEN! Mit finsteren Worten könnt ihr mich nicht beeindrucken. Sternenstaub (im Fernsehen hatte sie das gehört) sind wir. Ob wir leben oder die Radieschen von unten betrachten, völlig egal. Doch obgleich sie die unsympathische Inschrift verabscheute, konnte sie den Friedhof nie betreten, ohne sie zu lesen.
Mädchen, den Mantel hättest du zu Hause lassen können. Der war überflüssig. Sie hatte ihn nur angezogen, um Schwarz zu tragen. Ein Jahr lang hatte sie Trauer getragen, dann hatten beide Kinder darauf bestanden, dass sie wieder ein normales Leben führte. Ein normales Leben! Die haben ja keine Ahnung, wovon sie reden, diese naiven jungen Dinger. Aber da sie nur in Ruhe gelassen werden wollte, ließ sie sich darauf ein. Das heißt jedoch nicht, dass es ihr nicht respektlos erscheint, in farbiger Kleidung unter Toten zu wandeln. Also öffnete sie am frühen Morgen ihren Kleiderschrank, suchte etwas Schwarzes aus, das die übrige Kleidung in verschiedenen Blautönen überdeckte, sah den Mantel und zog ihn an, obwohl sie wusste, dass ihr heiß werden würde.
Txato teilt sich das Grab mit seinen Großeltern mütterlicherseits und einer Tante. Das Grab liegt in einer Reihe mit anderen ähnlichen an einem leicht abschüssigen Weg. Auf dem Grabstein stehen Name und Vorname des Verstorbenen, sein Geburtsdatum und das Datum, an dem er ermordet worden ist. Der Rufname nicht.
Vor der Beerdigung hatten Angehörige aus Azpeitia Bittori geraten, Anspielungen, Hinweise oder Zeichen auf der Grabtafel zu vermeiden, die Txato als Opfer der ETA kennzeichneten. Sonst könnte sie Ärger bekommen.
Sie protestierte:
«Na, hört mal! Sie haben ihn schon umgebracht. Ich glaube nicht, dass sie ihn noch einmal ermorden.»
Nicht, dass Bittori daran gedacht hätte, irgendeine Erklärung über den Tod ihres Mannes eingravieren zu lassen; aber man muss nur versuchen, sie von irgendetwas abzubringen, dann setzt sie alles daran, es umzusetzen.
Xabier stimmte den Verwandten zu. So wurden nur Namen und Daten eingraviert. Nerea, die aus Saragossa anrief, hatte die Stirn vorzuschlagen, das zweite Datum zu fälschen. Ungläubig: was?
«Ich habe mir gedacht, auf dem Grab sollte der Tag vor oder nach dem Attentat stehen.»
Xabier zuckte die Achseln. Bittori sagte von wegen.
Jahre später, als die Grabtafel von Gregorio Ordóñez beschmiert wurde, der etwa hundert Meter von Txato entfernt liegt, kam Nerea unnötigerweise auf die Angelegenheit zurück, die eigentlich alle schon vergessen hatten. Mit Blick auf das Zeitungsfoto zu ihrer Mutter:
«Hier siehst du, dass es besser war, den aita ein wenig abzusichern. Dies jedenfalls ist uns erspart geblieben.»
Da knallte Bittori die Gabel auf den Tisch und sprang auf.
«Wo willst du hin?»
«Mir ist der Appetit vergangen.»
Mit finsterem Blick und wütenden Schritts stürmte sie aus der Wohnung ihrer Tochter. Quique, der sich gerade eine Zigarette anzündete, verdrehte die Augen.
Die Gräber liegen in einer langen Reihe entlang des Weges. Das Gute für Bittori ist, dass sich der Rand des Grabes zwei Handbreit über dem Boden erhebt und sie sich so problemlos auf den Stein setzen kann. Klar, wenn es regnet, nicht. Auf jeden Fall hat sie, da der Stein meistens kalt ist (und bedeckt mit Moos und dem Schmutz der Jahre), immer ein aus einer Einkaufstüte ausgeschnittenes Rechteck aus Plastik und ein Halstuch in der Handtasche und benutzt sie als Kissen. Darauf setzt sie sich und erzählt dem Txato, was sie ihm zu erzählen hat. Wenn Leute in der Nähe sind, spricht sie in Gedanken; ist niemand da – was meistens der Fall ist –, spricht sie so, wie man sich unterhält.
«Die Tochter ist schon in London. Nehme ich wenigstens an; sie hat’s ja nicht mal für nötig gehalten, mich anzurufen. Hat sie dich etwa angerufen? Mich jedenfalls nicht. Da im Fernsehen nichts von einem Flugzeugabsturz gesagt wurde, gehe ich davon aus, dass die beiden in London sind und vollauf damit beschäftigt, ihre Ehe zu kitten.»
Im ersten Jahr stellte Bittori vier Blumentöpfe auf das Grab. Sie goss sie regelmäßig. Sah schön aus. Dann ging sie eine Zeitlang nicht mehr zum Friedhof. Die Blumen vertrockneten. Die nächsten hielten bis zum ersten Frost. Sie kaufte einen großen Kübel. Xabier transportierte ihn auf einer Schubkarre und half ihr, einen Buchsbaum hineinzupflanzen. Eines Tages war der Kübel umgekippt und zerbrochen, die Erde auf dem Grabstein verstreut. Seitdem ist Txatos Grab ohne Schmuck.
«Ich rede, wie es mir passt, und lass mir nicht den Mund verbieten, von dir schon gar nicht. Ob ich Witze mache? Ich bin nicht mehr so wie früher, als du noch lebtest. Ich bin böse geworden. Na ja, nicht böse. Kalt, abweisend. Wenn du auferstehst, erkennst du mich nicht wieder. Und auch wenn du es nicht glaubst: Deine Tochter, dein Liebling, trägt die Hauptschuld daran, dass ich mich so verändert habe. Sie raubt mir den letzten Nerv. Genau wie schon als Kind. Mit deinem Segen, klar. Weil du sie immer verteidigt hast. Du hast mir die Autorität genommen, und sie hat nie gelernt, mich zu respektieren.»
Drei oder vier Gräber weiter oben gab es einen Streifen Sand neben dem asphaltierten Weg. Bittori beobachtete ein Spatzenpaar, das sich dort niedergelassen hatte. Mit gespreizten Flügeln nahmen die Vögel ein Sandbad.
«Dann wollte ich dir noch erzählen, dass die Bande bekannt gegeben hat, mit dem Morden aufzuhören. Noch weiß man nicht, ob die Ankündigung ernst gemeint ist oder ob es sich nur um einen Trick handelt, damit sie Zeit gewinnen und sich neu organisieren und bewaffnen können. Morden oder nicht mehr morden, dir nutzt das nicht viel. Mir auch nicht, glaub das bloß nicht. Ich muss nur unbedingt erfahren, was gewesen ist. Die ganze Zeit wollte ich das wissen. Und ich lasse mich nicht davon abhalten. Niemand kann mich davon abhalten. Auch die Kinder nicht. Wenn sie überhaupt was merken. Ich werde es ihnen nicht sagen. Du bist der Einzige, der es weiß. Unterbrich mich nicht. Der Einzige, der weiß, dass ich wieder zurückgehe. Nein, ins Gefängnis kann ich nicht. Ich weiß ja nicht einmal, in welchem der Schuft sitzt. Aber die anderen sind bestimmt noch alle im Dorf. Außerdem will ich wissen, in welchem Zustand sich unser Haus befindet. Ganz ruhig, Txato, Txatito; Nerea ist im Ausland, und Xabier lebt – wie immer – nur für seine Arbeit. Die merken davon nichts.»
Die Spatzen waren verschwunden.
«Glaube mir, ich übertreibe nicht. Ich muss es unbedingt wissen, um mit mir selbst ins Reine zu kommen, mich hinsetzen zu können und zu sagen: Gut, es ist vorbei. Was ist vorbei? Tja, Txato, genau das muss ich herausfinden. Und die Antwort – falls es überhaupt eine gibt – findet sich nur im Dorf, und deshalb gehe ich da heute Abend noch hin.»
Sie stand auf. Faltete das Tuch und das Plastikrechteck zusammen und steckte beides ein.
«So, jetzt weißt du Bescheid. Und bleibst, wo du bist.»
Im Haus der anderen
Neun Uhr abends. In der Küche steht das Fenster offen, damit der Geruch von gebratenem Fisch nach draußen ziehen kann. Im Fernsehen beginnen die Nachrichten mit der Meldung, die Miren schon am Vortag im Radio gehört hat. Schluss mit dem bewaffneten Kampf. Nicht mit dem Terrorismus, wie die es nennen; mein Sohn ist kein Terrorist. Und an ihre Tochter gewandt:
«Hast du gehört? Sie hören wieder auf. Mal sehen, wie lange diesmal.»
Arantxa wirkt, als kriegte sie nichts mit; aber sie nimmt alles wahr. Sie bewegte ihr auf die Seite gesunkenes Gesicht – oder ist es der Hals, der verdreht ist? –, als wollte sie etwas äußern. Sicher sein konnte man sich bei ihr nie; aber wenigstens wusste Miren, dass ihre Tochter sie verstanden hatte.
Mit der Gabel teilte sie zwei Stücke vom panierten Seehecht ab. Die Stücke nicht zu groß, damit sie sie ohne Schwierigkeiten hinunterschlucken kann. So empfiehlt es die Physiotherapeutin, ein patentes Mädel. Keine Baskin, aber gut. Arantxa muss üben. Ohne Üben gibt es keinen Fortschritt. Die Gabelkante, als sie auf den Tellerboden traf, verursachte ein entschiedenes Geräusch wie von verärgertem Porzellan, und für einen Moment, als die Panadenkruste aufbrach, quoll aus dem weißen Fischfleisch ein dampfendes Wölkchen hervor.
«Bin gespannt, welche Ausrede sie sich jetzt einfallen lassen, um Joxe Mari weiter festhalten zu können.»
Sie setzte sich an den Tisch, neben ihre Tochter, ließ sie nicht aus den Augen. Bei ihr musste man immer wachsam sein. Schon mehr als ein Mal hatte sie sich verschluckt. Das letzte Mal im Sommer. Da hatten sie den Krankenwagen rufen müssen. Sirenengeheul im ganzen Dorf. Mein Gott, was für eine Aufregung. Als die Sanitäter eintrafen, hatte sie sich schon selbst ein Stück Filet aus ihrem Hals gezogen, so einen Klumpen.
Vierundvierzig Jahre. Die Älteste von dreien. Danach Joxe Mari, in Puerto de Santa María I. Bis nach da unten haben sie uns geschickt. Die Schweine. Und schließlich der Kleine. Der ist eigen. Den kriegen wir nicht mal zu Gesicht.
Arantxa griff nach dem Glas Weißwein, das die Mutter ihr eingeschenkt hatte. Sie hob es an und führte es mit der Hand, derer allein sie sich bedienen konnte, zitternd an die Lippen. Die Linke ist eine tote Faust. Sie hielt sie wie immer in Höhe der Taille an die Seite gedrückt; aufgrund eines spastischen Krampfes war sie nicht zu gebrauchen. Sie nahm einen ordentlichen Schluck aus dem Weinglas, was – wie Joxian meint – eine wahre Freude ist, wenn man bedenkt, dass Arantxa bis vor kurzem noch mit einer Sonde ernährt werden musste. Ein bisschen Flüssigkeit rann ihr am Kinn hinunter, aber das macht nichts. Miren war sogleich mit der Serviette zur Stelle und tupfte ab. So ein hübsches Mädchen, so gesund, mit glänzender Zukunft, Mutter zweier Kinder, und dann das.
«Und, schmeckt’s?»
Arantxa schüttelte den Kopf, als wollte sie sagen, dass der Fisch schon mal besser geschmeckt hatte.
«Na, hör mal, der war nicht billig. Ganz schön verwöhnt.»
Im Fernsehen folgten die Kommentare. Politiker, pah. Wichtiger Schritt zum Frieden. Wir fordern die Auflösung der Terroristenbande. Ein langer Weg liegt vor uns. Ein Weg der Hoffnung. Ende eines Albtraums. Weg mit den Waffen.
«Sie stellen den Kampf ein und kriegen dafür was? Haben sie die Befreiung von Euskal Herria vergessen? Und die Gefangenen sollen weiter im Gefängnis schmachten. Feiglinge. Was man angefangen hat, muss man auch zu Ende bringen. Kommt dir die Stimme von dem, der das Kommuniqué verlesen hat, bekannt vor?»
Arantxa kaute langsam auf einem Stück Seehecht. Sie schüttelte den Kopf. Wollte etwas sagen und streckte den guten Arm aus, bat die Mutter, ihr das iPad zu reichen. Miren reckte den Hals, um zu lesen, was sie geschrieben hatte: «Es fehlt Salz.»
Joxian kam kurz nach elf in der Nacht mit einem Bündel Lauch nach Hause. Er hatte den ganzen Tag im Garten zugebracht. Das Hobby des Rentners. Der Garten liegt unten am Fluss. Wenn der über die Ufer tritt – das letzte Mal Anfang des Jahres –, leb wohl, Garten. Gibt Schlimmeres, sagt Joxian. Früher oder später geht das Wasser wieder zurück. Er reibt die Gartengeräte trocken, kehrt das Gartenhäuschen, kauft wieder junge Kaninchen, erneuert die fortgespülten Beete. Der Apfelbaum, der Feigenbaum und die Mandelbäume halten das Hochwasser aus, das ist alles. Alles? Da das Hochwasser Industrieabfälle mit sich führt, liegt hinterher ein penetranter Geruch auf dem Land. Von Fabrik, sagt er. Miren sagt zu ihm:
«Von Gift. Eines Tages winden wir uns hier vor Bauchschmerzen und sind alle tot.»
Joxians anderes Hobby ist das Kartenspiel am Nachmittag. Die vier Freunde spielen Mus um einen Krug Wein. Weiter unten, wenn man auf die Plaza kommt, in der Bar Pagoeta. Ob es zu viert bei einem Krug bleibt, man wird sehen.
So wie er den Lauch hielt, wusste Miren gleich, dass er einen sitzen hatte. Sie sagte ihm, er kriege schon genauso eine rote Nase, wie sein seliger Vater eine hatte. Es gibt ein untrügliches Zeichen dafür, dass er getrunken hat: wenn er sich die rechte Seite kratzt, als würde es ihn jucken, da, wo die Leber sitzt. Dann kann man sicher sein. Aber er läuft nicht schwankend über die Straße, das nicht. Ihn juckt es auch gar nicht. Sich zu kratzen ist eine Marotte von ihm, so wie andere sich bekreuzigen oder auf Holz klopfen.
Er kann nicht nein sagen. Das ist das Problem. In der Bar schluckt er, weil die anderen auch schlucken. Wenn einer von denen sagen würde: «Kommt, wir springen in den Fluss», würde Joxian ihnen folgen wie ein Lamm.
Jedenfalls kam er mit glänzenden Augen nach Hause, die Mütze schief auf dem Kopf, kratzte sich das Hemd, da, wo die Leber sitzt, und wurde sentimental.
Im Esszimmer gab er Arantxa einen langen, zärtlichen, beinahe schmatzenden Kuss auf die Stirn. Um ein Haar wäre er auf sie gefallen. Miren aber schob ihn von sich.
«Hör auf, verschwinde, du riechst nach Kneipe.»
«Frau, sei nicht so hart.»
Sie streckte beide Arme aus, um ihn auf Abstand zu halten.
«In der Küche ist noch Fisch. Ist sicher schon kalt. Musst ihn dir eben aufwärmen.»
Eine halbe Stunde später rief Miren ihn, damit er ihr half, Arantxa ins Bett zu bringen. Sie hoben sie aus dem Rollstuhl, indem er sie unter einen Arm nahm, sie unter den anderen.
«Hast du sie?»
«Hä?»
«Ob du sie hast. Sag mir, ob du sie hast, bevor wir beide anheben.»
Ein Klumpfuß hindert Arantxa am Gehen. Manchmal geht sie ein paar Schritte. Wenige, unsichere. Mit Handstock oder fremder Hilfe. Durchs Haus gehen, allein essen, wieder sprechen können, das sind auf mittlere Sicht die Hoffnungen der Familie. Auf lange Sicht wird man sehen. Die Physiotherapeutin macht ihnen Hoffnung. Ein patentes Mädel. Sie spricht zwar kaum ein Wort Baskisch; das macht in diesem Fall aber nichts.
Vater und Mutter hoben sie vor dem Bett auf die Füße. Sie hatten das schon oft getan. Hatten Übung darin. Und außerdem, Arantxa, was wog sie denn zu der Zeit? Etwas über vierzig Kilo. Mehr nicht. Wo sie doch so stark gewesen war in ihren guten Zeiten! Ihr Vater hielt sie, während Miren den Rollstuhl an die Wand schob.
«Lass sie nicht fallen.»
«Ich werd doch meine Tochter nicht fallen lassen!»
«Du bist zu allem fähig.»
«Quatsch.»
Sie schauten sich grimmig an, feindselig, er mit zusammengebissenen Zähnen, als müsste er ein schlimmes Wort im Mund zurückhalten. Miren schlug die Decke auf, dann hoben sie Arantxa vorsichtig – langsam, hast du sie? – aufs Bett.
«Du kannst gehen, ich ziehe sie jetzt aus.»
Joxian beugte sich vor und gab seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn. Er wünschte ihr eine gute Nacht. Und sagte: «Bis morgen, polita», wobei er mit einem Fingerknöchel über ihre Wange strich. Dann ging er, sich die Seite kratzend, zur Tür. Er war schon fast aus dem Zimmer, da drehte er sich um und sagte:
«Auf dem Heimweg habe ich im Haus von denen Licht gesehen.»
Miren war gerade dabei, ihrer Tochter die Schuhe auszuziehen.
«Wird wohl jemand sauber gemacht haben.»
«Um elf Uhr nachts?»
«Mich interessieren diese Leute nicht.»
«Jedenfalls hab ich dir gesagt, was ich gesehen habe. Vielleicht kommen sie ja zurück ins Dorf.»
«Vielleicht. Jetzt, wo der bewaffnete Kampf aufgehört hat, werden sie womöglich frech.»
Umzug im Dunkeln
Ein paar Wochen nachdem sie Witwe geworden war, fuhr Bittori für ein paar Tage nach San Sebastián. Hauptsächlich, um den Gehweg nicht mehr sehen zu müssen, auf dem sie ihren Mann umgebracht hatten, und auch nicht die finsteren Blicke der Nachbarn, die jahrelang immer freundlich gewesen waren und dann, plötzlich, das Gegenteil davon; und auch, um nicht jeden Tag an den Wandschmierereien vorbeigehen und vor allem nicht die Schmierereien am Pavillon auf der Plaza sehen zu müssen, eine der letzten, eine Zielscheibe über dem Namen des Getöteten, und wenige Tage später, tschüs.
In Wirklichkeit hatten die Kinder sie unter einem Vorwand nach San Sebastián gebracht. Jesus, Maria und Josef, in einen dritten Stock! Sie war daran gewöhnt, zu ebener Erde zu wohnen.
«Schon, ama, aber mit Fahrstuhl.»
Nerea und Xabier waren übereingekommen, sie um jeden Preis aus dem Dorf zu bringen, dem Dorf, in dem sie ihr Leben verbracht hatte, in dem sie geboren war, in dem sie getauft worden war und geheiratet hatte, und ihr dann die Rückkehr schwer zu machen, sie ihr sogar auszureden. Jedenfalls steckten sie Bittori in eine Wohnung mit Balkon, von dem aus man das Meer sehen konnte. Die Familie versuchte sie schon seit einiger Zeit zu verkaufen. Sie hatten in der Zeitung annonciert. Mehrere Leute, die Interesse an der Wohnung hatten oder zumindest den Kaufpreis erfahren wollten, hatten schon angerufen. Txato hatte sie einige Monate, bevor er ermordet wurde, gekauft, weil er einen Zufluchtsort außerhalb des Dorfes haben wollte.
In der Wohnung gab es Lampen und ein paar Möbel. Die Kinder sagten zu Bittori, sie würde da nur vorübergehend wohnen müssen. Du konntest sie ansprechen, und sie reagierte nicht. Sie war wie weggetreten. Apathisch. Sie, die eigentlich so ein Plappermaul war. Und jetzt wie aus Stein gemeißelt. Man könnte meinen, sie vergäße sogar zu blinzeln.
Xabier und ein Kollege aus dem Krankenhaus brachten ihr ein paar Sachen. Gegen Abend kamen sie mit einem Lieferwagen ins Dorf, als es schon dunkel wurde, damit es nicht so auffällig war. Sie unternahmen ungefähr ein Dutzend Fahrten, stets nach Sonnenuntergang. Mal holten sie dieses, beim nächsten Mal jenes, viel Platz war im Lieferwagen ja nicht.
Das Ehebett ließen sie im Haus im Dorf, denn Bittori weigerte sich, ohne ihren Ehemann darin zu schlafen. Die wichtigsten Habseligkeiten holten sie jedoch heraus: Geschirr, den Teppich aus dem Esszimmer, die Waschmaschine.
Eines Tages, unter der Woche, wurden sie beschimpft, als sie ein paar Sachen holten. Die typische Bande, alte Bekannte von Xabier, ein paar Schulkameraden. Einer sagte mit zornknirschender Stimme, ihr Kennzeichen hätten sie sich gemerkt.
Auf dem Weg nach San Sebastián bemerkte Xabier, dass sein Freund eine Art Panikattacke bekam und sie einen Unfall bauen würden, wenn er in diesem Zustand weiterfuhr. Er bat ihn, am Straßenrand anzuhalten.
Der Kollege:
«Ich kann nicht noch ein weiteres Mal mit dir fahren. Tut mir leid.»
«Nur mit der Ruhe.»
«Tut mir leid, ehrlich. Tut mir leid.»
«Wir müssen nicht mehr fahren. Wir haben jetzt alles. Meiner Mutter reicht das, was wir ihr bis jetzt gebracht haben.»
«Verstehst du mich, Xabier?»
«Ja, klar. Mach dir keine Gedanken.»
Ein Jahr verging, ein weiteres, mehrere. Und Bittori ließ sich in der Zeit einen Schlüssel ihres Hauses nachmachen, weil, blöd ist sie ja nicht. Und dann? Zuerst Nerea; ein paar Tage später, Xabier. Ama, der Schlüssel vom Haus? Den hast du doch. Nein, ich. Täuschungsmanöver. Sie sagte beiden, sie wisse nicht, wo sie ihn gelassen habe, was ist bloß mit meinem Kopf, sie würde aber weitersuchen, und nach einigen Tagen tat sie dann so, als habe sie ihn doch noch gefunden; aber klar, da hatte sie sich vom Schlosser schon einen Nachschlüssel anfertigen lassen. Den alten gab sie Nerea, die ab und zu (ein-, zweimal im Jahr?) einen Blick ins Haus warf und abstaubte, und danach behielt sie den Schlüssel, und Bittori erwartete auch nicht, ihn jemals zurückzubekommen.
Ein anderes Mal schlug Nerea vor, das Haus im Dorf zu verkaufen. Ein paar Tage später machte Xabier den gleichen Vorschlag. Bittori roch den Braten sofort, diese beiden haben sich hinter meinem Rücken abgesprochen. Deswegen brachte sie selbst das Thema zur Sprache, sobald sie alle drei zusammen waren.
«Solange ich lebe, wird mein Haus nicht verkauft. Wenn ich tot bin, macht damit, was ihr wollt.»
Es gab keinen Widerspruch. Bittori hatte mit harter Miene und einem strengen Glanz in den Augen gesprochen. Die Geschwister wechselten einen raschen Blick. Dann wurde nie mehr über die Angelegenheit geredet.
Und ja, möglichst unauffällig fuhr sie wieder ins Dorf, meistens an regnerischen und windigen Tagen, wenn die Straßen höchstwahrscheinlich leer sind und auch wenn die Kinder beschäftigt oder auf Reisen waren. Bis zum nächsten Mal konnten dann gut und gerne sieben oder acht Monate vergehen. Noch vor dem Dorf stieg sie aus dem Bus. Damit sie mit niemandem sprechen musste. Damit sie nicht gesehen wurde. Über Seitenstraßen erreichte sie ihr früheres Haus. Dort verbrachte sie eine Stunde, zwei Stunden, manchmal mehr, betrachtete Fotos, wartete auf das Läuten der Kirchenglocken zu einer bestimmten Zeit, und nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sich in der Nähe des Hauses niemand aufhielt, kehrte sie zurück, woher sie gekommen war.
Zum Friedhof ging sie nie. Warum auch? Txato war in San Sebastián beerdigt worden, nicht im Dorf, obwohl dort seine Großeltern väterlicherseits in einem Familiengrab beigesetzt sind. Aber das hatte nicht sein dürfen, man hatte ihr lebhaft abgeraten, wenn du ihn im Dorf begräbst, werden sie das Grab verwüsten, wäre nicht das erste Mal, dass so etwas passiert.
Beim Begräbnis auf dem Friedhof von Polloe hatte Bittori Xabier etwas ins Ohr geflüstert, was dieser nie vergessen hat. Und was? Nun, dass sie den Eindruck habe, der Txato solle eher versteckt als begraben werden.
Txato, entzun
Der Autobus ist ja so langsam. Viel zu viele Haltestellen. Da, schon wieder. Die zwei Frauen – charakteristische Gesichter – saßen nebeneinander. Sie fuhren mit dem letzten Bus ins Dorf zurück. Sie sprachen beide gleichzeitig, hörten einander gar nicht zu. Jede für sich, aber sie verstanden sich. Jetzt stieß die, die am Gang saß, die am Fenster verstohlen mit dem Ellenbogen an. Als diese reagierte, deutete sie mit einem kurzen Ruck des Halses zum vorderen Teil des Busses.
Flüsternd:
«Die im dunklen Mantel.»
«Wer ist das?»
«Sag bloß, du erkennst sie nicht!»
«Ich sehe ja nur ihren Rücken.»
«Die vom Txato.»
«Den sie umgebracht haben? Die ist aber alt geworden.»
«Die Zeit vergeht, was glaubst du?»
Sie schwiegen. Der Bus setzte seine Fahrt fort. Fahrgäste stiegen aus und ein, und die beiden Frauen schauten schweigend geradeaus. Eine von ihnen flüsterte nach einer Weile, die arme Frau.
«Wieso?»
«Was sie durchgemacht hat.»
«Was wir alle durchmachen.»
«Ja, aber sie hat es doch besonders schlimm getroffen.»
«Der Konflikt, Pili, der Konflikt.»
«Ja, ich sag ja auch gar nichts.»
Kurz darauf die, die nicht Pili hieß:
«Wetten, dass sie im Industriegebiet aussteigt?»
Sie wandten den Blick ab, sobald Bittori aufstand. Sie war die Einzige, die ausstieg.
«Was habe ich gesagt?»
«Wie hast du das erraten?»
«Sie steigt hier schon aus, damit niemand sie sieht, und dann – piano, piano – schleicht sie zu ihrem Haus.»
Der Bus setzte seinen Weg fort, und Bittori – glauben die etwa, ich hätte sie nicht gesehen? – ging zwischen Fabriken und Werkstätten in dieselbe Richtung; nicht mit hochmütiger, das nicht, aber mit ernster Miene, zusammengepressten Lippen und erhobenen Hauptes, denn verstecken muss ich mich vor niemand.
Das Dorf, ihr Dorf. Schon beinahe Nacht. Die Fenster erleuchtet, der Pflanzengeruch umliegender Felder, wenige Fußgänger auf der Straße. Sie überquerte die Brücke mit hochgeschlagenem Mantelkragen und sah unter sich den stillen Fluss mit den Gärten am Ufer. Kaum war sie zwischen den Häusern, überkam sie so etwas wie Atemnot. Ein Erstickungsanfall? Nicht direkt. Eine unsichtbare Hand drückt ihr jedes Mal, wenn sie ins Dorf geht, die Kehle zu. Nicht hastig, aber auch nicht langsam ging sie auf dem Bürgersteig, erkannte Einzelheiten wieder: In diesem Hauseingang hat mir ein Junge die erste Liebeserklärung gemacht; wunderte sich über Neuerungen: Diese Laternen kommen mir fremd vor.
Es dauerte nicht lange, da vernahm sie ein Raunen hinter sich. Wie das Summen einer Fliege, die vor einem Fenster oder in einer dunklen Toreinfahrt herumschwirrt. Ein auf ato endendes Gemurmel. Das reichte ihr schon, um den ganzen Satz erraten zu können. Vielleicht hätte sie später kommen sollen, wenn die Leute schon in ihren Häusern waren. Mit dem letzten Bus. Du bist gut. Und wie zurück? Phh, ich bleibe einfach und schlafe hier. Ich habe ein Haus, und ich habe ein Bett.
Vor dem Pagoeta standen ein paar Raucher zusammen. Bittori war versucht, ihnen auszuweichen. Wie? Umdrehen und auf der anderen Seite um die Kirche herumgehen. Einen Moment hielt sie inne, schämte sich aber, stehen geblieben zu sein. Also ging sie mit gezwungener Natürlichkeit mitten auf der Straße weiter. Und ihr Herz schlug so heftig, dass sie einen Moment lang fürchtete, die Männer könnten es pochen hören.
Ohne sie anzusehen, ging sie an ihnen vorbei. Es waren vier oder fünf mit dem Glas in der einen und der Zigarette in der anderen Hand. Als sie auf ihrer Höhe war, mussten sie sie erkannt haben, denn ganz plötzlich wurde es still. Ein, zwei, drei Sekunden. Als Bittori das Ende der Straße erreichte, nahmen sie ihre Unterhaltungen wieder auf.
Ihr Haus mit heruntergelassenen Jalousien. Unten an der Hausmauer klebten zwei Plakate. Eines, das relativ neu aussah, kündete ein Konzert in San Sebastián an, und das andere, verblasst und zerrissen, den Großen Zirkus der Welten genau da, wo eines Morgens eine der vielen Schmierereien gestanden hatte: TXATO ENTZUN PENG PENG BUM.
Bittori trat in das Haus, und es war, als betrete sie die Vergangenheit. Die Lampe seit Kindertagen, die knarrenden alten Treppenstufen, die Reihe der klapprigen Briefkästen, in denen der ihre fehlte. Xabier hatte ihn irgendwann abgeschraubt. Um Probleme zu vermeiden, sagte er. Als er ihn von der Wand nahm, sah man ein Rechteck von der Farbe, die die Wand vor langer Zeit gehabt hatte, als Nerea noch nicht geboren war und auch der Sohn dieser Miren nicht, dieser ruchlose Kerl. Das ist der einzige Grund, warum ich will, dass es eine Hölle gibt; damit die Mörder da ihre ewige Verdammnis verbüßen.
Sie atmete den Geruch von altem Holz ein, von frischer, eingeschlossener Luft. Und dann merkte sie, dass die unsichtbare Faust ihren Hals losließ. Schlüssel, Schloss: Sie trat ein. Wieder stieß sie auf Xabier, ein ganzes Stück jünger, im Flur, der mit Tränen in den Augen zu ihr sagte, ama, lassen wir nicht zu, dass der Hass uns das Leben verbittert, er macht uns nur klein, oder so was in der Art, genau erinnerte sie sich nicht mehr. Und ihr Ausbruch an derselben Stelle, so viele Jahre war das jetzt her:
«O ja, singen und tanzen werden wir.»
«Bitte, ama, reiß die Wunde nicht noch weiter auf. Wir müssen uns bemühen, all das, was passiert ist …»
Sie unterbrach ihn.
«Was sie uns angetan haben.»
«Dass das alles keine schlechten Menschen aus uns macht.»
Worte. Man kann ihnen nicht entgehen. Sie lassen einen niemals wirklich allein sein. Eine Plage von lästigem Ungeziefer, hörst du. Sie sollte die Fenster weit aufreißen, damit sie nach draußen können, die Wörter, die Klagen, die alten traurigen Gespräche, die in den Wänden des unbewohnten Hauses gefangen sind.
«Txato, Txatito, was willst du zu Abend essen?»
Vom Foto an der Wand schenkte ihr Txato das verhaltene Lächeln eines zu meuchelnden Mannes. Man brauchte ihn bloß anzusehen, um zu wissen, dass sie ihn irgendwann umbringen würden. Und diese Ohren! Bittori legte Zeige- und Mittelfinger zusammen, drückte einen Kuss auf die Fingerkuppen und legte sie sanft auf das Gesicht des schwarzweißen Fotos.
«Spiegeleier mit Schinken. Ich kenne dich, als würdest du noch leben.»
Sie drehte den Wasserhahn im Badezimmer auf. Tatsächlich, das Wasser lief, und gar nicht so trübe, wie sie sich vorgestellt hatte. Sie öffnete Schubladen, blies den Staub von Möbeln und anderen Gegenständen, tat dies und tat das, ging nach da und nach dort, und so gegen halb elf lüftete sie die Jalousie des Eheschlafzimmers gerade so weit, dass das Licht im Zimmer nach draußen dringen konnte. Dasselbe tat sie mit der Jalousie im Nebenzimmer, doch ohne dort Licht zu machen. Danach holte sie einen Stuhl aus der Küche, setzte sich ins vollkommen dunkle Zimmer, damit man ihren Schattenriss nicht vor einem hellen Hintergrund sah, und schaute nach draußen.
Ein paar Jungs kamen vorbei. Einzelne Leute. Ein Junge und ein Mädchen gingen die Straße hinauf und stritten sich, er versuchte, sie zu küssen, aber sie wollte nicht. Ein alter Mann mit einem Hund. Sie war sicher, dass sie früher oder später einen von denen vorm Haus sehen würde. Und woher willst du das wissen? Ich kann es dir nicht erklären, Txato. Weibliche Intuition.
Ob die Vorahnung wahr wurde? Ja, wurde sie. Wenn Bittori auch lange warten musste. Die Kirchenglocken schlugen elf. Sie erkannte ihn auf Anhieb. Die Mütze schief auf dem Kopf, den Pullover über den Schultern, die Ärmel auf der Brust verknotet, ein paar Lauchstangen unter dem Arm. Also arbeitet er immer noch in seinem Garten? Und da er im Lichtschein der Straßenlaterne stehen geblieben war, konnte sie seine ungläubig überraschte Miene erkennen. Nur eine Sekunde, länger nicht; dann stapfte er davon, als hätte man ihm eine Nadel in den Hintern gestochen.
«Was habe ich dir gesagt? Jetzt erzählt er seiner Frau, dass er hier Licht gesehen hat. Sie wird sagen: Du hast getrunken. Aber sie wird neugierig, und dann kommt sie, um sich zu überzeugen. Wetten wir, Txato?»
Es schlug zwölf. Nur Geduld. Du wirst sehen, sie kommt. Und sie kam, natürlich kam sie, halb eins war es fast. Sie verweilte nur einen kurzen Moment im Licht der Laterne, schaute weder ungläubig noch überrascht zum Fenster hinauf, sondern mit ärgerlich zusammengezogenen Brauen, dann drehte sie um und ging zurück, woher sie gekommen war, verschwand mit energischem Schritt in der Dunkelheit.
«Gut gehalten hat sie sich, das muss man zugeben.»
Steine im Rucksack
Er stellte das Fahrrad in die Küche. Es ist leicht, ein Rennrad. Miren, eines Tages vor einem Berg abzuspülenden Geschirrs:
«Für so einen Luxusdrahtesel hast du Geld, ja?»
Joxians Antwort:
«Ja, es reicht, was ist los? Ich hab ja auch mein Leben lang wie ein Esel geschuftet, verdammt.»
Er bringt es ohne Schwierigkeiten aus dem Keller nach oben, ohne die Wände zu streifen. Zum Glück wohnen wir im Erdgeschoss. Er hebt es auf die Schulter wie als junger Mann, als er an Crossfahrt-Wettbewerben teilgenommen hat. Es war sieben Uhr morgens, und es war Sonntag. Er hätte geschworen, dass er keinen Lärm gemacht hatte. Trotzdem saß Miren jetzt da im Nachthemd am Küchentisch und erwartete ihn mit vorwurfsvoller Miene.
«Darf man erfahren, was du mit dem Fahrrad im Haus vorhast? Willst du mir den Fußboden schmutzig machen?»
«Ich will die Bremsen einstellen und mit dem Lappen drübergehen, bevor ich losfahre.»
«Und warum machst du das nicht draußen?»
«Weil man draußen fast nichts sieht und sich den Arsch abfriert, verdammt noch mal. Und du, warum bist du um diese Zeit schon auf?»
Zwei Nächte hintereinander wach gelegen, da brauchte man nichts zu sagen. Die Augenringe verrieten alles. Der Grund? Das Licht hinter der Jalousie in deren Haus. Nicht nur am Freitag, auch gestern, und wenn du mich fragst, wird das jetzt immer so weitergehen. Damit es hinterher heißt, die armen Opfer, und wir gehen grinsend neben ihnen her. Das Licht, die Jalousie, die Leute, die Bittori auf der Straße gesehen und die nichts Besseres zu tun gehabt hatten, als ihr alles brühwarm zu berichten, hatten alte Gedanken lebendig werden lassen, schlimme Gedanken, sehr schlimme.
«Unser Sohn hat uns das Leben versauert.»
«Na, wenn man dich im Dorf tönen hört, geht es uns doch gut.»
«Ich sage es zu dir. Mit wem soll ich denn reden, wenn nicht mit dir?»
«Du bist doch die abertzale von uns beiden. Immer die Erste, die Lauteste, die Revolutionärin auf den Barrikaden. Und als mir beim Besuch im Gefängnis die Tränen kamen, gab es gleich Ärger.»
Sei nicht so ein Weichling, hatte sie ihn gescholten; vor dem Jungen zu weinen, du ziehst ihn ja völlig runter.
Jahre zuvor, wie viele?, über zwanzig, war ihnen der erste Verdacht gekommen, entdeckten sie, begriffen sie. Arantxa eines Tages in der Küche:
«Sagt mal. All die Plakate in seinem Zimmer. Und die Holzfigur auf seinem Nachttisch. Die um eine Axt sich windende Schlange, was ist damit?»
Eines anderen Tages war Miren ganz beunruhigt, verstört, nach Hause gekommen. Sie hatten Joxe Mari in San Sebastián in einen Straßenkampf verwickelt gesehen. Wie, wer ihn gesehen hat?
«Na, wer schon? Bittori und ich. Oder glaubst du, ich gehe mit jemand anderem aus?»
«Nur mit der Ruhe. Er ist jung und heißblütig. Das gibt sich wieder.»
Miren nahm ein paar Schlucke Lindenblütentee, den sie sich hastig zubereitet hatte, rief den heiligen Ignatius um Rat und Beistand an. Und während sie Knoblauch schälte, den sie in das Fleisch eines Karpfens stecken wollte, bekreuzigte sie sich, ohne das Messer aus der Hand zu legen. Beim Abendessen hörte sie nicht auf, im Kreis der schweigenden Familienmitglieder zu monologisieren, von bösen Scherereien zu unken und Joxe Maris Abwege seinem schlechten Umgang zuzuschreiben. Sie gab dem Sohn der Manoli die Schuld, dem Sohn des Fleischers, der ganzen Bande.
«Er läuft herum wie ein Penner. Bei diesem Äußeren und dem Ohrring kriege ich schon Zustände. Er hatte sich ein Taschentuch vor den Mund gebunden.»
Damals waren Bittori und sie, Freundinnen? Mehr, Schwestern. Wie immer man es nannte, es war unzureichend. Fast wären sie zusammen ins Kloster gegangen, doch dann tauchte Joxian auf, tauchte Txato auf, Kartenspieler in der Bar, samstags im Kochverein, sonntags Rennradfahrer. Und beide heirateten sie in Weiß in der Dorfkirche, mit aurresku vor der Kirchentür, die eine im Juni, die andere im Juli desselben Jahres, 1963.
Zwei Sonntage mit blauem Himmel, wie bestellt zu den Anlässen. Sie luden sich auch gegenseitig ein. Miren und Joxian hatten ihr Hochzeitsessen etwas außerhalb des Dorfes in einer Sidrería, die wirklich nicht schlecht war; aber eben preisgünstig, und dazu Landgeruch nach Pferdeäpfeln und gemähtem Gras. Bittori und Txato feierten in einem piekfeinen Restaurant mit befrackten Kellnern, denn Txato, der als Kind mit ausgefransten Bastsandalen durchs Dorf gelaufen war, besaß ein gutgehendes Fuhrunternehmen.
Miren und Joxian verbrachten ihre Flitterwochen in Madrid (vier Tage, billige Pension, ganz in der Nähe der Plaza Mayor); Bittori und Txato besuchten – nach einem Aufenthalt in Rom mit Gruß des neuen Papstes und Segnung der Menge – mehrere italienische Städte. Miren, während sie dem Reisebericht ihrer Freundin lauschte:
«Du hast wirklich eine gute Partie gemacht.»
«Ach was, davon habe ich doch gar nichts gewusst. Ich hab ihn wegen seiner Ohren geheiratet …»
Die Freundinnen kamen am Nachmittag aus einer Churrería in der Altstadt von San Sebastián, als die Unruhen begannen. An einer Straße, die auf den Boulevard mündete, blieben sie stehen. Ein Linienbus stand quer auf der Straße und brannte. Schwarzer Qualm quoll an einer Hausfassade hoch, schlug auf die Fenster. Der Busfahrer ist offenbar verprügelt worden. Der Mann dort, fünfzig, fünfundfünfzig Jahre, der mit blutendem Gesicht auf der Erde sitzt und den Mund aufreißt, als ob er keine Luft bekommt. Neben ihm zwei Fußgänger, die ihm beistanden und trösteten, und ein ertzaina, der – nach seinen Gesten zu urteilen – ihnen klarzumachen versuchte, dass sie da nicht bleiben konnten.
Bittori:
«Da gibt’s Radau.»
Sie:
«Wir nehmen besser die Calle Oquendo und machen einen Bogen bis zur Bushaltestelle.»
Bevor sie um die Ecke bogen, warfen sie noch einen Blick zurück. Im Hintergrund erkannten sie eine Reihe von Mannschaftswagen der Ertzaintza, die neben dem Rathaus geparkt waren. Polizisten – rote Helme, die Gesichter hinter Skimützen verborgen – hatten Stellung bezogen. Sie feuerten mit Gummigeschossen auf die jungen Burschen, die sich vor ihnen zusammengerottet hatten und das übliche Repertoire an Beschimpfungen skandierten: Handlanger, Mörder, Schweine, auf Baskisch einiges, einiges auf Spanisch.
Und der Linienbus stand immer noch da, brannte mitten in der Straßenschlacht stoisch vor sich hin. Und immer noch der schwarze Qualm. Und der Gestank von verbrannten Reifen, der bis in die umliegenden Straßen drang, die Schleimhäute und Augen reizte. Miren und Bittori hörten, wie andere Fußgänger mit gedämpfter Stimme ihren Unmut äußerten: Wir sind es doch, die die städtischen Busse bezahlen; wenn das damit gemeint ist, für die Rechte des Volkes zu kämpfen, dann gute Nacht. Eine Frau zischte ihrem Mann zu:
«Schhhh, wenn dich jemand hört …»
Und dann erkannten sie ihn. Einer unter vielen Vermummten, den Mund hinter einem Taschentuch verborgen. Hey, Joxe Mari. Was macht er bei denen? Beinahe hätte Miren ihn gerufen. Der Junge war aus derselben Altstadtgasse gekommen wie sie beide einige Minuten zuvor. An der Ecke des Fischgeschäfts blieben sechs oder sieben stehen, darunter auch der Sohn des Fleischers und der von der Manoli. Und Joxe Mari war einer von denen, die einen Rucksack unterm Arm trugen, den sie auf dem Gehweg abstellten. Einige von ihnen und weitere Hinzukommende langten hinein und holten Miren wusste nicht was heraus. Bittori hatte bessere Augen und sagte es ihr: Steine. Tatsächlich, es waren Steine. Sie schleuderten sie wütend auf die ertzainas.
Vor langer Zeit
Das Aufblitzen einer Felge rüttelte an Mirens Aufmerksamkeit. Ein schwacher Strahl Morgenlicht auf Joxians Rennrad reichte, um ihr die lang vergangene Episode ins Bewusstsein zu rufen. Das Szenario? Diese Küche hier. Als Erstes brachte ihr die Erinnerung das Zittern ihrer Hände bei der Zubereitung des Abendessens zurück. Allein bei der Erinnerung daran bekam sie eine Anwandlung von Atemnot, die sie damals der aus der Pfanne aufsteigenden Hitze und dem Qualm zugeschrieben hatte. Nicht einmal bei offenem Fenster kam genügend Luft herein.
Halb zehn, zehn, schließlich hörte sie ihn kommen. Der unverwechselbare Klang seiner Schritte auf der Treppe. Diese Manie, die Stufen hinaufzustürmen. Der kriegt was zu hören.
Er kam herein, groß, neunzehn Jahre alt, die Haare bis zu den Schultern und der verdammte Ohrring. Joxe Mari – gesundes, robustes Kind, großer Esser – war zu einem Hünen herangewachsen. Er war zwei Handbreit größer als alle in der Familie mit Ausnahme des Kleinen, der auch groß geraten war, doch von anderer Statur; Gorka war schmal, hatte mehr Hirn nach Joxians Meinung.
Die Brauen finster zusammengezogen, ließ er sie nicht zu einem Kuss heran.
«Wo kommst du her?»
Als ob sie das nicht wüsste. Als ob sie ihn am Nachmittag nicht auf dem Boulevard von San Sebastián gesehen hätte. Seitdem sah sie ihn im Geiste mit versengter Kleidung, mit einer klaffenden Wunde auf der Stirn ins Krankenhaus eingeliefert.
Und er – zu Anfang – wich mit seinen Antworten aus. Er war eigen geworden. Man musste ihm die Worte schier aus der Nase ziehen. Und da er nichts sagte, sagte sie es ihm. Die Uhrzeit, den Ort, den Rucksack voller Steine.
«Du bist doch wohl keiner von denen, die den Bus angezündet haben? Mach uns hier bloß keinen Ärger.»
Scheiß auf Ärger, er begann zu schreien. Und Miren? Schloss zuerst einmal das Fenster. Das ganze Dorf hört ihn ja sonst. Besatzungsmacht, Freiheit für Euskal Herria. Und sie nimmt den Stiel der Pfanne in die Hand, zu allem bereit, denn wenn ich’s ihm zeigen muss, zeig ich’s ihm. Doch dann wurde sie des heißen Öls gewahr, und klar, das ging zu weit. Joxian kam nicht. Joxian im Pagoeta und sie allein mit ihrem wahnsinnig gewordenen Sohn, der herumbrüllte von Freiheit, von Kampf, von Unabhängigkeit, so aggressiv, dass Miren unwillkürlich dachte: Der schlägt mich gleich. Dabei war er doch ihr Sohn, ihr Joxe Mari, sie hatte ihn geboren, hatte ihm die Brust gegeben und jetzt, eine Mutter so anzubrüllen.
Sie knotete ihre Schürze auf, knüllte sie zu einem Ball, warf sie – voller Wut, voller Angst? – auf die Erde, mehr oder weniger dort, wo Joxian jetzt mit seinem Fahrrad zugange ist; auch so ein Einfall, das Ding mit ins Haus zu nehmen. Der Grund war, dass sie nicht wollte, dass ihr Sohn sie weinen sah. Deshalb rannte sie aus der Küche. Die Augen zwei schmale Schlitze, die Lippen geschürzt, das ganze Gesicht von unterdrücktem Weinen verzerrt, auch noch als sie in Gorkas Zimmer eintrat/gestürzt kam und ihm sagte, geh und hol den aita. Und der über seine Bücher und Hefte gebeugte Gorka fragte, was ist los. Seine Mutter drängte ihn zur Eile, und der Junge, sechzehn Jahre alt, rannte so schnell er konnte zum Pagoeta.
Kurz darauf – die Partie unterbrochen – kam Joxian übelgelaunt nach Hause.
«Was hast du deiner Mutter angetan?»
Als er ihn ansprach, musste er zu ihm aufschauen, wegen des Größenunterschieds. Im Lichtstrahl der Fahrradfelge sah Miren die Szene wieder vor sich, ohne groß die Erinnerung strapazieren zu müssen. Da waren im verkleinerten Maßstab die Kacheln bis zur halben Höhe der Wand, die Neonröhren des Arbeiterhaushalts, die ihr bescheidenes Licht auf die Resopalmöbel warfen, der Geruch von altem Bratfett in der ungelüfteten Küche.
Viel hätte nicht gefehlt, und er hätte ihn geschlagen. Wer? Der Muskelprotz von Sohn den Tropf von Vater. So hatte er ihm noch nie gegenübergestanden. Rechnungen zu begleichen hatten sie keine. Joxian war nie ein prügelnder Vater gewesen. Der und prügeln! Er war eher einer, der klein beigab und sich in die Kneipe verdrückte, wenn Ärger drohte. Immer war ich für alles zuständig, die Erziehung der Kinder, die Krankheiten, den häuslichen Frieden.
Beim ersten Schütteln flog ihm die Mütze vom Kopf und landete nicht auf dem Boden, sondern auf dem Stuhl, als hätte man ihr befohlen, sich hinzusetzen. Joxian wich zurück, traurig/verblüfft, eingeschüchtert/verzagt, das wenige graue Haar, das ihm geblieben war, wirr durcheinander und die Stellung als Vorstand der Familie, die – zumindest bis zu diesem Augenblick – so uneinig gar nicht war, für immer dahin.
Als Arantxa einmal zu Besuch kam, sagte sie zu ihrer Mutter:
«Ama, weißt du, was das Problem in unserer Familie ist? Dass wir immer zu wenig miteinander gesprochen haben.»
«Bah.»
«Ich glaube, wir kennen uns gar nicht.»
«Na, ich kenne euch alle. Viel zu gut kenne ich euch.»
Und auch dieses Gespräch überdauerte in der Felge, festgehalten im Aufblitzen zwischen zwei Rädern, zusammen mit der alten Szene, ach, die ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde. Da konnte sie den armen Joxian sehen, wie er mit gesenktem Kopf aus der Küche schlich. Er legte sich vor der gewohnten Zeit ins Bett, ohne gute Nacht zu sagen, und sie hörte ihn auch nicht schnarchen. Der Mann hat die ganze Nacht kein Auge zugetan.
Mehrere Tage lang hat er kein Wort gesprochen. Er hat nie viel gesprochen. Aber jetzt noch weniger. Joxe Mari genauso; er schwieg, schwieg die ganzen vier oder fünf Tage, die er noch zu Hause wohnte. Machte den Mund nur zum Essen auf. Dann, an einem Samstag, packte er seine Sachen und ging. Damals war uns noch nicht klar, dass er für immer gegangen war. Ihm selbst womöglich auch nicht. Auf dem Küchentisch ließ er uns einen Zettel zurück: barkatu. Nicht einmal unterschrieben hat er. Muss man sich mal vorstellen: barkatu, auf einem Stück Papier, das er aus einem Heft seines Bruders herausgerissen hatte, und sonst nichts. Kein muxus, kein wohin, kein adiós.
Nach zehn Tagen kam er mit einem Beutel Wäsche zum Waschen und einem Sack zurück, in den er weitere Sachen packte, die er in seinem Zimmer zurückgelassen hatte, und seiner Mutter schenkte er einen Strauß Calla.
«Für mich?»
«Für wen sonst?»
«Woher hast du die Blumen?»