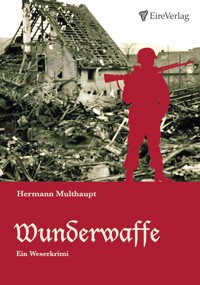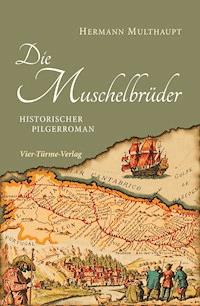
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser historische Roman von Hermann Multhaupt spielt im 14. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von einem hinkenden Fährmann, der sich auf den Weg nach Santiago de Compostela macht. Zusammen mit zwei Gleichgesinnten begibt er sich auf den abenteuerlichen Weg ans damalige Ende der Welt. Eine Reise, die sein Leben verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hermann Multhaupt
Die Muschelbrüder
Historischer Pilgerroman
Vier-Türme-Verlag
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Der Traum an der Fähre
~
Wer das Elend bauen will,
der mach sich auf und zieh dahin
wohl auf St. Jakobs Straßen!
Zwei Paar Schuch die muss er han,
ein Schüssel bei der Flaschen.
Ein breiten Hut den soll er han
und ohne Mantel soll er nit gahn
mit Leder wohlbesetzt;
es schnei
oder regn oder wehe der Wind,
dass ihn die Luft nicht netzet.
Das Wasser stieg kräuselnd vom Kiel an der dunklen Bootswand empor, vergrößerte seine Kreise, bis der Strudel einen leichten Sog entstehen ließ, so als würde das Wasser in sich beschleunigenden Drehungen in einen unsichtbaren Trichter gesogen. Der Fährmann blickte, den Stangenbaum in der Hand, dem Wasserwirbel nach, während sein Schiff flussab und zugleich quer über den Strom schoss, dem unbefestigten Ufer zu, wo das Wasser breiig und brackig in Tümpeln und Schlammmulden stand.
»Der Hakemann«, brummte er, »der Hakemann zieht Kinder an.«
Angst vor dem Geist des Flusses saß ihm noch im Blut. Mit ihr war er groß geworden, seit die Eltern wie alle Erwachsenen des Dorfes den Kindern den Aufenthalt am Fluss mit den unheimlichen Geschichten vom Hakemann zu vereiteln trachteten. Es waren Erzählungen, die sich auf nebulöse Geschehnisse beriefen, auf eine dunkle, unausgegorene Mär, auf im Zwielicht keimende undurchsichtige Ereignisse, die, wie aus grauer Vorzeit überliefert, von Generation zu Generation weitererzählt, ausgeschmückt und vertieft wurden. Es gab niemanden, der nicht an sie glaubte. Es war ein verwunschenes Geschöpf, das da unten hauste, drunten, in der Tiefe der Weser. Von Zeit zu Zeit schnellte es an die Oberfläche empor, sich ein Opfer zu suchen, von dessen Blut es eine Weile seine quälende Lebensgier stillte. Nicht mal »Sünt Clawes« schien gegen den Flussgeist etwas ausrichten zu können, St. Nikolaus, den man gern in Wassersnot und bei Schiffbruch anrief.
Es gab Leute, die den Hakemann gesehen hatten, wie er in mondbeschienenen Nächten seinen runzeligen Kürbiskopf mit dem Tanghaar aus den Fluten gestreckt und nach einem Gefährten der Tiefe Ausschau gehalten hatte. Manch einer wollte auch den Enterhaken gesehen haben, der ihm am Armstumpf gewachsen war als Ersatz für die von einem mutigen Fischer abgetrennte Hand. Andere meinten, der Hakemann bediene sich einer langen Stange ähnlich der des Fährmanns, um kleine Kinder, die am Ufer spielten, in die Tiefe zu ziehen. Man wusste nichts genau, nicht verbindlich, aber es reichte, um die Angst zu schüren und Generationen von Menschen mit Schreckensmeldungen zu füttern.
Im Grunde war ihnen auch der Fährmann verdächtig. Ein Mann, der sich ins Totenreich des Flussgeistes wagte, konnte kein gewöhnlicher, kein normaler Mensch sein. Stand er am Ende mit dem Hakemann im Bunde, oder war er gar ein durch heimlich verspritztes Blut ihm untrennbar verbundener Vasall? Und doch ging es nicht ohne diesen Mann, den das Misstrauen umlauerte wie eine Katze das Vogelnetz, musste jemand aus der Dorfgemeinschaft den Dienst der Fähre übernehmen, die wenigen Reisenden ans andere Ufer übersetzen oder von dort herüberholen. Die Aufgabe war Kretz zugefallen. Kretz mit dem Hinkefuß, der seit Geburt missgebildet und nicht in eine normale Form zu bringen war.
Ohne die Verbindung zum anderen Ufer brach die Welt zusammen, der bescheidene Handel mit Kurzwaren, mit der Feldfrucht, mit selbstgewobenem Leinen und irdenem Geschirr, Kretz sorgte gewissenhaft dafür, dass der Austausch vonstattenging, nicht erlahmte oder zum Erliegen kam. Bei Wind und Wetter, unter sengender Sonne und in frostklaren Abendstunden stand er am Ufer, im Schilf, auf dem Steg, hielt er die Hand über die Augen und wartete auf Kundschaft. Freilich, es gab noch die Furt unterhalb der Dörfer Heristal und Wirigisen. Dort war das Wasser so flach, dass es die Karrenräder in trockenen Sommern gerade überspülte, aber das Übersetzen dauerte seine Zeit, länger jedenfalls als die Kahnfahrt mit Kretz. Gern hatte Kretz diesen Fährdienst nicht übernommen, nicht freiwillig, nicht ohne Widerspruch. Aber nach dem frühen Tode der Mutter und dem Unglück des Vaters konnte er dem Paten nicht über das Firmalter hinaus auf der Tasche liegen. So blieb ihm keine Gelegenheit, das verantwortungsvolle, aber auch umstrittene Amt auszuschlagen.
Der Wasserwirbel hatte sich verflüchtigt, aufgelöst – keine Spur vom Hakemann. Kretz pfiff erleichtert durch die Zähne, zugleich stieß er die lange Stange mit aller Kraft in den schlammigen Grund. Sein Körpergewicht ruhte sekundenlang auf dem dünnen, astlosen Baum, und während das längliche Boot unter seinen Füßen davonzuschnellen drohte, eilte er zwei, drei Schritte gegen die Fahrtrichtung, riss die Stange aus der morastigen Tiefe und stakte sie mit einer schnellen, weit ausladenden Bewegung am Bug des Bootes abermals in das Flussbett. Der Arbeitsgang wiederholte sich einige Male, dann zog er den Baum ein, das Schiff setzte im seichten Wasser auf. Das Schilf bebte und raschelte, als die Bootsspitze es berührte und auseinanderfaltete. Letzte Fahrt für heute, dachte Kretz. Es dunkelte. Er vertäute das Fahrzeug an einem tief in die breiige Erde gerammten Pflock und war mit zwei linkischen Sprüngen am Ufer. Kretz sah zum Himmel auf, aber es waren keine Sterne zu sehen. Das Tal gab nur ein Stück des Firmamentes preis. Schweigend standen die Wälder beidseitig des Stromes. Ihre endlosen schwarzen Linien verloren sich in der Dunkelheit. Weh dem, der sich hier jetzt verirrte oder im Schein eines Wachslichtes seinen Weg zur nächsten Herberge nicht fand. Kretz bekreuzigte sich. Es kamen in letzter Zeit manchmal Fremde, einzeln, in kleinen Gruppen. Fromme Leute, hergelaufenes Gesindel, ein Ritter sogar zu Pferd. Kretz hatte sie über den Fluss gesetzt. Nur das Pferd fand keinen Platz in dem schmalbauchigen Boot; es schwamm ihm widerwillig nach.
Die Leute erzählten seltsame Dinge. Von einem Grab des Apostels Jakobus, den man den Älteren nannte, das im Galicischen entdeckt worden sei, am Ende der Welt, wo das Meer steil abfällt bis in die Hölle. Dorthin waren sie alle auf dem Weg, die Fremden, die frommen Pilger – und sie wussten im Grunde nicht warum. Einer hatte von wundersamen Lichterscheinungen erzählt, aber er hatte sie nicht selbst gesehen, nur davon gehört, und sein Gerede hatte andere angesteckt. Es ging das Gerücht, wer das Grab des Apostels Jakobus aufsuche, werde gerettet, dem sei der Himmel gewiss, dem würden die Sünden abfallen wie die Läuse aus einem gereinigten Pelz. Man wusste nichts Genaues, nichts Bestimmtes. Aber viele, so hörte man, waren aufgebrochen, einfach losgezogen, um endlich die Angst vor dem ewigen Verderben abzuschütteln, dem Feuer zu entfliehen, das die Dominikaner in ihren Predigten entfachten als Strafe für die übergroße Schuld der von Gott verworfenen Menschheit.
Kretz sah zu dem Bergrücken auf, der vor ihm lag. Auf seiner Spitze blinkten vereinzelte Lichter. Dort lag das Dorf. Sein Dorf. Heristal, das einstige Heristallum Saxonicum. Karl, der Frankenkaiser, hatte es kurz vor seiner Krönung in Rom gegründet. Dort oben wartete eine warme Suppe auf ihn, die die Nachbarin auf dem offenen Feuer kochte: Lauch, ein paar Beeren, Wurzelgemüse und aufgeweichtes Brot, dazu an den Festtagen ein paar Bröckchen Schweinefleisch oder einen geräucherten Fisch in Meerrettichsoße. Kretz freute sich, bildete sich ein, den Geruch des Feuers zu spüren, während er mit ungleichen Schritten den Hang hinaufging, und den beißenden Qualm, der dem Strohdach entquoll. Er würde sich auf die Holzbank neben der Feuerstelle setzen, seine bescheidene Abendmahlzeit einnehmen, beiläufig den Worten der Witwe Lene lauschen, die vor Redseligkeit übersprudelte, nicken, verneinen, seine Pfeife stopfen und den Rauch gegen die schwarze Decke stoßen, die Augen schließen, die Bilder an sich vorüberziehen lassen, die ihn seit Tagen bedrängten ...
Kretz kam von den Pilgern nicht los, die er über die Weser gebracht hatte. Vom Kloster Bursfelde her waren sie stromab gewandert, den trägen Windungen des Flusses nach, der eine halbe Stunde oberhalb der Fährstelle das Flüsschen diesmal aufnahm und zugleich seine Richtung änderte. Ihrer seltsamen Verklärtheit war nicht viel zu entlocken gewesen; es schien, als hätten einige ein Schweigegelübde getan. Ihr nächstes Ziel war das Dorf Haddenberg auf rauer Hochfläche, wo man seit kurzem den hl. Jakobus verehrte. Der Mund eines versprengten Pilgers aus dem Hessischen hatte – so bekundeten sie – geheimnisvolle Wunderberichte verbreitet: Er sei bis in Galicische gekommen und habe den Strom der Männer und Frauen mit eigenen Augen gesehen, die sich betend und singend dem Grab des Apostels näherten. Einige hätten freilich auch geflucht – der Blasen an ihren Füßen wegen und wegen der Lumpen, in denen sie steckten. Das Kleingeld sei ihnen schon lange ausgegangen, und bei den Bauern und Wirten sei nichts oder nur gegen Wucherpreise etwas zu holen gewesen.
Kretz spuckte aus. In seiner Tasche klimperten die Münzen, die er sich heute durch den Fährdienst verdient hatte. Sieben Personen hatte er ans andere Ufer befördert oder von dort abgeholt. Unter sich die Strudel, die Launen des Wassers, über die der Wind dahinstrich, das Gluckern und Gurgeln, das Schmatzen und Plätschern, dessen Ursache nicht zu erkennen war. In der Tiefe lauerte der Hakemann. »Der Hakemann zieht Kinder an, wenn er sie nur kriegen kann.« Vielleicht war Kretz ihm heute über das Tanghaar gefahren, hatte er seinen Scheitel mit dem Kiel seines Bootes berührt und musste morgen die Rache fürchten? Vielleicht hatte er, Kretz, ihm den Stangenbaum ins rechte Auge gestoßen und beschwor nun die Vergeltung des Wassergeistes herauf? Jeder Tag war eine Herausforderung, eine Fahrt ins Ungewisse. Dabei durfte man keine Angst haben, keine Furcht kennen – jeder Mensch stand unter Gottes Schutz, der seine Hand über Gerechte und Ungerechte hielt. So lehrte es der Pfarrer sonntags von der Kanzel, und dazu hob er seine breiten, schwieligen Hände, die die Arbeit auf dem Feld gebräunt und gefurcht hatte, und schlug das Kreuz. Das Kreuz über Rechtschaffene und Sünder.
Ein schwerer Entschluss
~
Sack und Stab ist auch darbei.
Er lug, dass er gebeichtet sei,
gebeichtet und gebüßet!
Kummt er in der Welschen Land,
er findt kein deutschen Priester.
Ein’ deutschen Priester findt er wohl:
er weiß nit, wo er sterben soll
oder sein Leben lassen;
stirbt er in dem welschen Land,
man gräbt ihn bei der Straßen.
Im Pfarrhaus brannte noch Licht. Kretz zögerte, wie so oft in den letzten Tagen, ob er direkt an Lenes Abendbrottisch hinübergehen oder dem Geistlichen den immer wieder verschobenen Besuch abstatten sollte. Der Gedanke an die Pilger, die nach Galicien unterwegs waren, nahm wieder überhand, und Kretz beschloss, den Pfarrer zu fragen, was er von ihrer Wallfahrt ans Ende der Welt halte. Der Fährmann äugte durch das verhangene Fensterloch und sah ihn am Tisch, ein abgegriffenes Buch vor sich und die flackernde Kerze, die ihre Schatten auf die Buchstaben und die gekalkten Wände warf.
Kretz klopfte und trat gleichzeitig ein. Der Pfarrer hob den Kopf und blickte müde zur Tür. Er trug sein Werktagsgewand, und die Latzschürze verriet, dass er soeben aus dem Stall gekommen war, wo er die Kuh versorgt hatte.
»So spät noch, Kretz?«
»Entschuldigt, Herr«, sagte Kretz und drehte die Mütze in der Hand.
»Du weißt, dass die Nacht des Teufels ist.«
»Ich weiß. Aber ich hatte einen späten Gast und komme gerade von meiner Arbeit heim. Ich möchte etwas mit Euch bereden.«
Der Priester wies auf einen klobigen Stuhl an der oberen Tischseite.
»Komm, setz dich, Kretz.«
Kretz gehorchte wortlos, drehte weiter verlegen die Mütze. Er sah in die erwartungsvollen Augen des Pfarrers, die unter buschigen Brauen auf ihn gerichtet waren.
»Es lässt mich nicht los, Herr.«
»Was, Kretz?«
»Das Bild von den Pilgern. Vor zwei Monden und vor einigen Tagen setzte ich einige über den Fluss. Und heute stand wieder einer auf der anderen Seite des Stromes.«
Der Pfarrer schloss das Buch und legte es an die Seite, ohne den Blick von seinem abendlichen Besucher abzuwenden.
»Du meinst die Wallfahrer, die auf dem Wege nach Santiago de Compostela sind.«
Kretz nickte. »Ich weiß nicht, wie der Ort heißt, wohin sie sich auf den Weg machen. Aber es muss in Galicien sein.«
»Es tut auch nichts zur Sache, Kretz, wie man den Ort nennt. Ob Galicien, ob Santiago de Compostela – wir wissen nicht genau, wo das ist, und niemand von uns wird je dorthin gelangen.«
Kretz schluckte, er legte die Mütze auf den Rand des Tisches.
»Herr, es mag ja stimmen, dass wir nicht genau erfahren, wohin die Pilger auf der Reise sind. Aber ich möchte mich ihnen anschließen. Ich will mit ihnen gehen.«
Kretz duckte sich, als erwarte er einen Peitschenhieb. Sein Kopf saß tief zwischen den Schultern, und aus dieser Haltung blickte er den Priester verstohlen an.
»Habe ich recht gehört, Kretz? Weißt du auch, was du sagst?« Die sonst so milde Stimme des Geistlichen hob sich.
»Ich habe es mir seit acht Tagen überlegt, was ich sage«, erwiderte Kretz.
»Närrisches Geschwätz«, wehrte der Pfarrer ab. »Jemand hat dir einen Floh ins Ohr gesetzt, und schon spielst du verrückt. Du bist unentbehrlich – am Fluss. Wer sollte denn Fährmann sein, wenn nicht du, Kretz?«
»Sie haben am Sonntag nach Pauli Bekehrung selbst gesagt, dass jedermann ersetzbar ist, Herr.«
Der Pfarrer schluckte. Es kam nicht oft vor, dass sich jemand seiner Pfarrkinder eine Predigt über einen so langen Zeitraum merkte.
»Du siehst das nicht im Zusammenhang, Kretz. Ich habe von allgemeinen Aufgaben gesprochen, die von jedermann wahrgenommen werden können – aber nicht vom Dienst des Fährmannes.«
Der Geistliche spürte, dass diese späte Auslegung seines Predigtwortes selbst einem einfachen Mann wie Kretz wie eine Notlüge oder Ausrede erscheinen musste.
»Wer hat dich nur auf den Gedanken gebracht?«, fragte er. »Einer dieser Pilger muss dir doch den Kopf verdreht haben.«
»Ich habe in ihre Gesichter gesehen«, sagte Kretz. »Es lag ein so merkwürdiger Glanz darin.«
Der Pfarrer stand auf und ging ein paar Schritte unruhig auf und ab. Der gestampfte Lehmboden verschluckte den Laut der Holzschuhe. Schließlich blieb er vor Kretz stehen, musterte ihn, legte ihm die Hand auf die Schulter. Kretz sah zu ihm auf. Sein Gesicht war hohlwangig, Bartstoppeln bedeckten Oberlippe und Kinn, auf der linken Stirnseite verlief eine Narbe, die von einem Sturz oder Schlag herrührte, bis an den Ansatz des dichten schwarzen Haares. Er könnte es schaffen, dachte der Priester. Er könnte das Ende der Welt erreichen – mit diesen bittenden und flehenden Augen. Die Augen sind alles. Nicht die Muskeln, die stämmigen Waden. Auf die Augen kommt es an. Aber dann sah der Pfarrer auf den verkrüppelten rechten Fuß des Fährmanns, der seit Kindestagen verunstaltet war.
»Nein, es hat keinen Sinn, Kretz. Schlag dir den Gedanken aus dem Kopf. Jemand, dem die Kinder ›Hinkefuß‹ nachrufen, hat am Ende der Welt nichts verloren.«
Kretz riss sich empor und stand wie ein Schrank. »Sie werden nicht mehr ›Hinkefuß‹ rufen, wenn ich zurück bin.« In seinen Augen standen Fackeln. Das Feuer des Fanatikers, des Besessenen, dachte der Geistliche und wich unwillkürlich zurück.
»Und wer, meinst du, sollte Fährmann sein?«
Kretz nannte ein paar Namen, aber der Pfarrer schüttelte den Kopf. Kretz schien für das Amt unentbehrlich.
»Ich bitte Sie, Herr, lassen Sie mich gehen – um des Friedens meiner Seele willen.«
Jetzt horchte der Geistliche auf. Abenteuerlust und Selbstbestätigung also schieden bei der Motivsuche aus? Kam hier eine andere Überlegung ins Spiel? Die Sehnsucht des Herzens, Bedürfnisse der Seele? Von dieser Seite kannte er die ihm anvertrauten Menschen zu schlecht, das gab er unumwunden zu. Und er gestand sich auch, dass er sich nicht immer genug Mühe gab, sie im Alltagsgeschäft nach Gefühlen und Empfindungen, nach Träumen und Sehnsüchten zu befragen. Die Tagen zogen sich träge dahin wie der Fluss, randvoll mit der Sorge um das tägliche Brot, das meist nur dürftig ausfiel, mit der Beschäftigung im Stall beim Vieh, mit der Knochenarbeit auf den Feldern, bei der Saat und der Pflege der Feldfrucht, bis die nicht verhagelte und nicht verseuchte Ernte in die Scheunen gefahren werden konnte – bescheidener Vorrat für einen kalten, stürmischen Winter unter den windschiefen Dächern des Dorfes auf dem Berg.
Jeder Tag hatte seine Mühe und Plage. Gab es am Sonntag eine Verschnaufpause, so schliefen ihm die Bauern und Fuhrleute, die Fischer und Gerber, die Holzschuhmacher und Korbflechter, die Knechte und Tagelöhner unter der Kanzel ein, die schwieligen Hände wie vertäute Boote im Schoß, während die Frauen auf der linken Seite des Kirchenschiffes unter den Worten des Pfarrers, die Köpfe gesenkt, das Strafgericht Gottes auf sich hereinzubrechen glaubten. Kleingeistig, ängstlich, sündig, gedemütigt, gefallen – das war der Mensch, der sich das Paradies verscherzt hatte und nun im Schweiße seines Angesichtes die Ursünde der Stammeltern sühnte bis ans Ende seiner Tage. Er war Wegweiser, Weggeleiter, Seelsorger – er, der Pfarrer, und er wusste außer aus den Schriften und der Hoffnung seines Herzens zuweilen auch nicht, wie es weiterging, wohin der Weg führte aus der Zeit in die Ewigkeit. Wie oft hatte er sich selbst der Kleingläubigkeit geziehen, gehadert, gezweifelt, seinen Unglauben angeprangert angesichts der Krankheiten, der Seuchen, der Unglücksfälle, die das Dorf trafen. Wie konnte er im Angesicht eines oft unvorhersehbaren, qualvollen oder plötzlichen Todes, der nicht mehr schließbare Lücken zurückließ, verzweifelte Eheleute und wehklagende Anverwandte, immer wieder von den Freuden künftiger Herrlichkeit reden, von göttlicher Barmherzigkeit und Geduld, von der Liebe des Schöpfers zu seiner Kreatur? Wer das Elend sah, das aus den Häusern kroch oder die Familien heimsuchte, durfte seinen priesterlichen Worten nicht trauen, musste hellhörig, misstrauisch sein gegenüber dem, was gelehrt, was verordnet, was von oben als wahr und richtig erkannt wurde.
Der Pfarrer erschrak. Welche häretischen Gedanken! Aus welchem Sumpf abgrundtiefer Verderbtheit stieg der Widerspruch auf, machte sich Widerstand gegen die Wahrheit breit? Er machte das Zeichen des Kreuzes, die Einflüsse und Einflüsterungen des Teufels zu bannen. Kretz stand noch immer vor ihm, aufmerksam, abwartend, den verkrüppelten Fuß an dem gesunden Bein reibend. Seine Augen loderten.
»Es wird mir nicht gelingen, dir die Idee auszureden, Kretz«, seufzte der Geistliche. »Aber du wirst es schwer haben. Vielleicht nie wiederkommen.« Der Pfarrer deutete auf den missgestalteten Fuß seines Gastes. »Begeisterung und Sehnsucht sind nicht genug, Kretz. Und mag dein Herz randvoll sein von diesem Wunsch, ans Ziel des Weges zu gelangen, nach Galicien, ans Grab des Apostels, es kommt darauf an, dass man durchhält.«
»Ich werde es schaffen«, beharrte Kretz. »Nie wieder wird jemand ›Hinkefuß‹ zu mir sagen.«
»So geh, in Gottes Namen. Jedoch zuvor bedenke dein Testament. Viel hast du ja nicht zu vermachen. Aber du solltest die Lene nicht ohne ein Goldstück lassen und auch nicht ohne das Linnen, das du von deiner Mutter noch in der Truhe hast. Für den Fall, dass dir etwas geschieht und du nicht wieder heimkommst. Vor allem aber schließe Frieden mit deiner Seele. Komm morgen um diese Zeit in die Kirche, damit ich dir vor dem Altar des hl. Nikolaus, deines Standespatrons, die Beichte abnehme. Ich setze inzwischen die Papiere auf.«
Als Kretz gegangen war, griff der Geistliche seufzend nach Feder und Pergament. Er dacht eine Weile nach, dann begann er bedächtig zu schreiben: