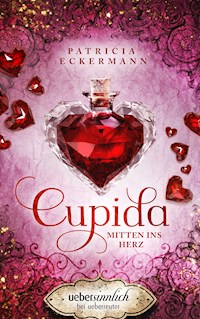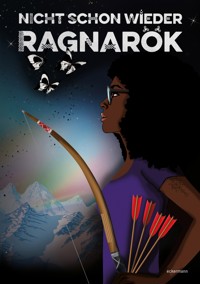12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die mutige Rebellin« | Historischer Roman über die Menschenrechtlerin Rosa Parks, die mit ihrem Mut eine Revolution auslöste Rosa Parks – Sie weigerte sich, ihren Platz im Bus aufzugeben, und wurde zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung »Jeder Mensch sollte sein Leben als Vorbild für andere leben.« Rosa Parks Montgomery, Alabama, in den 1950ern: Seit Jahrzehnten kämpft Rosa Parks für die Bürgerrechte Schwarzer Menschen, doch immer wieder scheitert sie an dem brutalen rassistischen System der USA. Auch wenn Rosa nur noch wenig Hoffnung auf Veränderung hat, ist ihr Widerstand ungebrochen. Als sie am 1. Dezember 1955 in einen Bus steigt, ahnt sie nicht, dass sie damit die Welt verändern wird. Rosas Weigerung, ihren Platz für einen Weißen zu räumen, wird endlich die Bewegung auslösen, für die sie und ihre Verbündeten all die Jahre gekämpft haben. Es ist der Beginn einer Revolution. Patricia Eckermann und James A. Sullivan über die Ikone der US-Bürgerrechtsbewegung Rosa Parks (1913–2005), ein Vorbild bis heute: Rassismus und Frauenfeindlichkeit gewinnen wieder an Boden. Wie gehen wir mit diesen Rückschlägen um? Wie wirken wir der Erschöpfung entgegen? Die Antworten finden wir bei Rosa Parks. Denn ihre Bedeutung besteht nicht in dem vermeintlich einfachen Akt des Widerstands, sondern in ihrem lebenslangen Einsatz dafür, allen Rückschlägen zum Trotz, mit Beharrlichkeit die Verhältnisse zu verändern. Die Welt stand auf, als Rosa Parks sitzen blieb. Über die Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern«: Mit den historischen Romanen unserer Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern« entführen wir Sie in das Leben inspirierender und außergewöhnlicher Persönlichkeiten! Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panorama aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser starken Frauen. Weitere Bände der Reihe: Laura Baldini, Lehrerin einer neuen Zeit (Maria Montessori) Romy Seidel, Die Tochter meines Vaters (Anna Freud) Petra Hucke, Die Architektin von New York (Emily Warren Roebling) Laura Baldini, Ein Traum von Schönheit (Estée Lauder) Lea Kampe, Der Engel von Warschau (Irena Sendler) Eva-Maria Bast, Die aufgehende Sonne von Paris (Mata Hari) Eva-Maria Bast, Die vergessene Prinzessin (Alice von Battenberg) Yvonne Winkler, Ärztin einer neuen Ära (Hermine Heusler-Edenhuizen) Agnes Imhof, Die geniale Rebellin (Ada Lovelace) Lea Kampe, Die Löwin von Kenia (Karen Blixen) Eva Grübl, Botschafterin des Friedens (Bertha von Suttner) Laura Baldini, Der strahlendste Stern von Hollywood (Katharine Hepburn) Eva-Maria Bast, Die Queen (Queen Elizabeth II.) Agnes Imhof, Die Pionierin im ewigen Eis (Josephine Peary) Ulrike Fuchs, Reporterin für eine bessere Welt (Nellie Bly) Anna-Luise Melle, Die Meisterin der Wachsfiguren (Marie Tussaud) Petra Hucke, Die Entdeckerin des Lebens (Rosalind Franklin) Jørn Precht, Die Heilerin vom Rhein (Hildegard von Bingen) Elisa Jakob, Die Mutter der Berggorillas (Dian Fossey) Eva-Maria Bast, Queen Mum Yvonne Winkler, Kämpferin gegen den Krebs (Mildred Scheel) Lena Dietrich, Die Malerin der Frauen (Artemisia Gentileschi) Laura Baldini, Die Pädagogin der glücklichen Kinder (Emmi Pikler)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die mutige Rebellin« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Entdecken Sie noch weitere Bücher unserer Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern« unter https://www.piper.de/starke-frauen-der-geschichte.
In diesem Roman wird »Schwarz« dort großgeschrieben, wo es auf eine soziale Kategorie verweist. Es handelt sich dabei um eine selbstbestimmte Bezeichnung von Schwarzen Menschen, die u. a. die gemeinsame Rassismuserfahrung zum Ausdruck bringen soll. Dadurch wird auch vermieden, dass »Schwarz« als Beschreibung der Hautfarbe verstanden wird.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Redaktion: Nora Bendzko
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Covermotiv: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com und Bettmann/Getty Images
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Im Bus
Raymond
Leona
Montgomery Fair
Mittagspause
Die Versammlung
Jugendtreffen
Die Durrs
Krankheit
In der Fremde
Seminare
Abschied von Monteagle
Wieder zu Hause
Emmett Till
Ettas Geburtstag
Mittagstisch
Mary Louise Smith
Die Bibliothek
Zwischen Aktivismus und Angst
Wo ist die Hoffnung?
Die Busfahrt
Verhaftet
Auf freiem Fuß
Der Morgen danach
Der Alltag, der keiner war
Im Kirchenkeller
Samstag
Montag – der Busboykott beginnt
Das Gerichtsverfahren
Die Versammlung der MIA
Der Boykott geht weiter
Das neue Jahr beginnt
Bedrohliche Wochen
Das Ende eines Monats
Gemeinschaft
Verhaftungen
Zwischen Heim und Öffentlichkeit
Eine neue Perspektive
Die erste Flugreise
Detroit
Ein Interview
Heimweh
New York City
Ella Baker
Madison Square Garden
Beim Arzt
San Francisco
Heimkehr
Bei Georgia Gilmore
Wieder auf Reisen
Virginias Angebot
Rückkehr nach Monteagle
Rosa und Parks
Rosa fährt Bus
Nachwort
Wie es weiterging
Zur Recherche
Künstlerische Freiheiten
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Im Bus
Juni 1955, Montgomery/Alabama
Hallo, Mrs Parks! Haben Sie einen kurzen Moment für mich?« Claudette Colvin, ein eigenwilliger Teenager mit wachen Augen, ließ sich auf den freien Platz in der hintersten Sitzreihe des Busses neben Rosa fallen. Mit gerade mal fünfzehn Jahren war Claudette ungewöhnlich selbstbewusst. Im Gegensatz zu den meisten Schwarzen Frauen trug sie die Haare nicht geglättet, sondern naturkraus und zu Cornrows geflochten, was viele, die sich den Schönheitsidealen der Weißen unterwarfen, hässlich und ungepflegt fanden. Dazu hatte sie sehr dunkle Haut, ein hübsches Gesicht und das gewinnendste Lächeln, das man sich vorstellen konnte.
»Aber sicher, Claudette. Wie kann ich dir helfen?«
Vor einigen Monaten war Claudette kurzzeitig verhaftet worden, weil sie sich den Befehlen eines weißen Busfahrers widersetzt hatte. Seitdem wurde sie vom lokalen Zweig der NAACP betreut, der National Association for the Advancement of Colored People, in der Rosa sich seit Jahren für die Rechte und die Förderung der Schwarzen engagierte. Die NAACP vertrat Claudette nicht nur juristisch, sie übernahm auch die Gerichtskosten, denn die Colvins lebten, wie so viele Schwarze Familien, in ärmlichen Verhältnissen. Dazu gab es die örtliche Jugendgruppe, in der Rosa sich um die politische Bildung der Heranwachsenden kümmerte.
Das Leben in den Südstaaten war hart für Schwarze Menschen, besonders in der Wiege der Konföderation in Montgomery, Alabama. Hier herrschte eine strikte Trennung von Schwarzen und Weißen. Ein übermütiger Teenager, der sich diesen Regeln widersetzte, zog den Zorn der Rassisten auf sich. Und das war lebensbedrohlich. Umso wichtiger, Kindern und Jugendlichen schon frühestmöglich beizubringen, welche Rechte sie hatten und wie sie sich in Konfrontationen mit Rassisten verhalten konnten.
»Kann sein, dass ich morgen wieder nicht zum Jugendtreffen komme.« Claudette sah Rosa düster an. »Mein Vater hat keine Zeit, mich danach abzuholen.«
Rosa nickte verständnisvoll. Auch wenn Claudettes Widerstand jetzt schon einige Monate zurücklag, waren sie und ihre Familie noch immer in Gefahr. Es konnte passieren, dass ein wütender Ku-Klux-Klan-Mob in weißen Kapuzengewändern vor dem Haus der Colvins aufmarschierte, um es niederzubrennen und Claudette umzubringen. Oder dass man ihr auf offener Straße auflauerte. Hier in den Südstaaten waren Lynchmorde an der Tagesordnung – und die Täter kamen meist ungestraft davon. Einige bewaffnete junge Männer der NAACP unterstützten deshalb Claudettes Vater, der seit dem Vorfall nachts mit dem Gewehr auf dem Schoß Wache hielt. Dass die Colvins ihre Tochter abends nicht allein durch die Stadt laufen lassen wollten, war nicht nur unter diesen Umständen mehr als nachvollziehbar.
»Du kannst jederzeit bei uns übernachten. Hast du das deinen Eltern ausgerichtet?«
»Meine Mutter glaubt mir das nicht«, antwortete Claudette. »Könnten Sie sie vielleicht noch mal anrufen? Und ihr sagen, dass ich bei Ihnen und Mr Parks sicher bin?«
»Ich kann es gern probieren«, antwortete Rosa, zögerlicher, als ihr lieb war, denn sie dachte an ihren Großvater Sylvester, einen kämpferischen und mutigen Mann, der noch als Sklave geboren worden war. Auch er war sehr misstrauisch gewesen und hätte niemals jemand anderem zugetraut, seine Familie zu verteidigen. Wie oft hatte Rosa als kleines Kind nachts in der Dunkelheit beobachtet, wie er auf der Veranda bewaffnet gewacht hatte, um sie, ihren Bruder, ihre Mutter und Großmutter vor den Angriffen der Rassisten zu schützen. Von ihrem Großvater hatte Rosa gelernt, dass Schwarze Menschen ebenso viel wert waren wie Weiße. Seinem Vorbild verdankte sie es, dass sie sich für die Bürgerrechte engagierte und Mitglied in der NAACP Montgomery war.
Als der Bus an der nächsten Haltestelle hielt, sprang Claudette auf.
»Also rufen Sie bei mir zu Hause an, Mrs Parks? Ja?«
Rosa lächelte. Das Mädchen hatte eine mitreißende Energie. »Das mache ich gern.«
Claudette nickte zufrieden. »Dann hoffentlich bis zum Jugendtreffen!« Sie bahnte sich eilig den Weg durch die in den Bus drängenden Menschen nach draußen. Kurz darauf schlossen sich die Türen wieder, und der Bus fuhr weiter. Jetzt, im Sommer, war es um diese Uhrzeit noch hell. Es würde noch Stunden dauern, bis der Schatten der Nacht über die breiten Straßen fiel. Und mit der Dunkelheit wuchs auch die Gefahr.
Von ihrem Platz in der letzten Reihe hatte Rosa einen guten Überblick. Inzwischen waren sämtliche Plätze im Bereich der Schwarzen belegt, ebenso der Mittelbereich davor, in dem Schwarze ebenfalls sitzen durften. Doch sobald eine weiße Person hier einen Sitz beanspruchte, mussten Schwarze nach hinten ausweichen, sofern dort noch etwas frei war.
Einige Schwarze Männer und Frauen standen im Gang. Vorn, in dem Bereich, der nur für Weiße reserviert war, gab es dagegen noch einige freie Sitzplätze. Wie so oft ärgerte sich Rosa über diese strikte Trennung. Die Segregation war nicht im Sinne Gottes, und mit seiner Hilfe würde sie hoffentlich bald ein Ende finden.
»Entschuldigung?« Die Frau, die jetzt neben Rosa saß, sah sie neugierig an. Sie war etwa gleich alt, um die vierzig, mit einem Gesicht voller Sommersprossen auf hellbrauner Haut. »Darf ich Sie fragen, woher Sie dieses schöne Kostüm haben? Es steht Ihnen beneidenswert gut!«
Rosa lächelte. Es kam öfter vor, dass sie auf ihre Kleidung angesprochen wurde. Als Schneiderin legte sie großen Wert darauf, gut angezogen zu sein, und orientierte sich dabei immer an den aktuellen Modetrends. Durch ihren Job im Kaufhaus bekam sie die neuesten Kollektionen immer sehr früh zu Gesicht.
»Vielen Dank, das habe ich selbst genäht.«
»Wie schade, ich hatte gehofft, dass ich es nachkaufen kann. Ich bin neu in der Stadt und kenne mich noch nicht so gut aus. Ich heiße übrigens Henrietta Stern.« Henrietta hielt Rosa die Hand entgegen. »Sagen Sie gern Etta.«
»Freut mich, Etta!« Rosa schlug ein. »Rosa Parks.«
»Ich wünschte, ich hätte auch so ein Händchen fürs Nähen wie Sie.« Etta grinste verschmitzt. »Aber das, was bei meinen Versuchen herauskommt, würde nicht mal eine Vogelscheuche tragen.«
Rosa musste lachen. Henrietta gefiel ihr.
Der Bus hielt an der nächsten Haltestelle. Während die weißen Fahrgäste durch die vordere Tür einstiegen, ihr Ticket zahlten und sich einen Platz vorn im Sitzbereich der Weißen suchten, war es den Schwarzen nicht erlaubt, durch diesen Bereich in den hinteren Teil des Busses zu gehen. Nach dem Ticketkauf mussten sie den Bus wieder verlassen und durch die Hintertür einsteigen.
Eine alte Schwarze Frau, weit über achtzig und in der ganzen Stadt als Miss Maddie bekannt, legte ihre schweren braunen Einkaufstüten auf dem Boden des Busses ab und klammerte sich beim Aussteigen unsicher an der Tür fest. Während eines ihrer vogeldürren Beinchen versuchte, auf dem Gehsteig Tritt zu fassen, kam ihr eine junge Frau aus Rosas Nachbarschaft zu Hilfe. Kaum stand die alte Dame sicher auf dem Trottoir, wollte Rosas Nachbarin auch die Einkaufstüten aus dem Bus holen. Doch der Busfahrer schloss die Türen. Ganz offensichtlich genoss er die Macht, die er über die Schwarzen hatte.
»Halt!«, rief Etta aufgebracht. »Die Tüten!« Sie wollte aufspringen, doch Rosa legte ihr beschwichtigend eine Hand auf den Unterarm.
»Er wird die Tür nicht wieder öffnen«, sagte sie mit leiser Stimme. »Gewöhnen Sie sich schon mal daran. Viele Busfahrer lieben es, uns zu demütigen.«
Etta sah sie fassungslos an. »Diese Trennung von Schwarzen und Weißen ist schon schlimm genug. Aber das … warum sagt denn keiner was?«
»Die meisten Busfahrer sind bewaffnet. Wer sich wehrt, spielt schnell mit seinem Leben. Die Einzigen, die gefahrlos aufbegehren könnten, sind die Weißen. Aber die meisten sind zu bequem – oder stehen hinter der Segregation.«
»Man hat mich vor den Zuständen hier im Süden gewarnt. Aber dass es so schlimm ist, daran hab ich nicht im Traum gedacht. Die arme alte Frau!«
»Keine Angst, Etta. Die Einkaufstüten landen sicher noch vor dem Abendessen bei Miss Maddie. Die Schwarze Gemeinde hier in Montgomery hält zusammen. So etwas passiert nicht zum ersten und leider auch nicht zum letzten Mal.«
Zwei ältere Schwarze Männer, die den Bus kurz vorm Schließen der Türen betreten hatten, standen im Gang. Der Größere, mit breiter Nase, Brille, Halbglatze und Aktenkoffer, nickte Rosa ausdruckslos zu. Dann steuerte er die zwei frei gewordenen Plätze in der ersten Sitzreihe im Mittelbereich an, direkt hinter dem Bereich für Weiße. Der zweite Mann, deutlich kleiner, mit kurz geschorenen weißen Haaren, Brille und tiefen Falten im Gesicht, ignorierte Rosa einen Tick zu offensichtlich und folgte ihm. Rosa schüttelte unmerklich den Kopf.
»Wer sind die denn? Die fahren nicht oft mit dem Bus, oder?« Etta sah Rosa neugierig an.
»Ich kenne sie von der NAACP Montgomery, normalerweise fahren sie tatsächlich mit dem Auto«, antwortete Rosa. Sie mochte die beiden nicht sonderlich. Es waren erfolgreiche Geschäftsmänner, die nichts von engagierten Frauen hielten und sie am liebsten hinter dem Herd sahen. »Die zwei tun sich etwas schwer mit mir.«
»Lassen Sie mich raten: Beide sind geschäftlich erfolgreich dank ihrer Sekretärinnen und Ehefrauen. Aber wenn es um Frauenrechte geht, sind sie strikt dagegen.«
»Sie glauben nicht, wie oft ich in den letzten Jahren mit ihnen aneinandergeraten bin«, sagte Rosa. »Und das nur, weil ich verlangt habe, dass unser Kampf für die Gleichberechtigung zwischen Weißen und Schwarzen natürlich auch die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einschließen muss.«
»Diese Diskussionen haben wir auch in Detroit geführt«, erwiderte Etta düster. »Apropos: Montgomery hat eine eigene Zweigstelle der NAACP? Zu Hause war ich auch Mitglied!«
»Sie ziehen von Michigan nach Alabama? Freiwillig? Mein Bruder lebt in Detroit. Er erzählt mir seit Jahren, wie viel besser das Leben für Schwarze dort ist.«
»Was macht man nicht alles für die Liebe!« Etta stöhnte.
Rosa lachte. »Ein Verlust für Detroit, ein Gewinn für Montgomery. Wir können jede starke Frau gebrauchen.«
Beim nächsten Halt stieg Etta aus.
»Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder«, sagte sie zum Abschied.
»Kommen Sie doch mal zu einem Treffen der NAACP.«
Etta sah Rosa zögerlich an. »Zum Kampf gegen unbelehrbare Männer?« Sie winkte ab. »Ich find’s toll, dass Sie sich das antun. Aber ich hab dafür keine Geduld mehr.«
»Schade. Aber ich verstehe das gut«, antwortete Rosa. Die Arbeit in der Organisation war nicht einfach, denn immer ging es auch darum, für die Rechte der Frauen einzutreten. Die kräftezehrenden Auseinandersetzungen mit uneinsichtigen Männern nahm sie nur deshalb auf sich, weil sie die NAACP, die viel mehr Macht hatte als andere Vereinigungen von Schwarzen, von innen heraus verändern wollte.
»Es war schön, Sie kennenzulernen, Rosa.«
»Geht mir genauso, Etta. Bis bald!«
Durch die Heckscheibe des Busses beobachtete Rosa, wie Etta die Hauptstraße entlangging und dann in eine Seitenstraße abbog.
Plötzlich verstummten die Gespräche um Rosa herum. Alarmiert drehte sie sich nach vorn. Im Gang, direkt vor den beiden Schwarzen Geschäftsleuten, stand ein recht junger weißer Mann. Er sah die älteren Männer auffordernd an. Hinter ihm näherte sich bereits der Busfahrer. Rosa umschloss die Griffe ihrer Tasche mit eisernen Fäusten. Hoffentlich passierte kein Unglück.
»Aufstehen. Lasst den Mann sitzen«, forderte der Busfahrer die zwei Männer mit herrischer Stimme auf. Dazu nahm er das Schild ab, das die erste Sitzreihe des Mittelbereichs markierte, und befestigte es an der Sitzreihe dahinter. Damit erweiterte er willkürlich den Sitzbereich der Weißen.
Rosas Herz pochte. Niemand im Bus sagte ein Wort. Aber die Blicke, die sich die Schwarzen Fahrgäste zuwarfen, sprachen Bände. Da waren so viel Wut und Angst, Verbitterung und Ratlosigkeit zu sehen. Im Grunde hatte der Fahrer kein Recht, die Männer von ihren Plätzen zu vertreiben. Laut Verordnung der Stadt durften sie dort sitzen, wenn es im hinteren Teil, der ausschließlich für Schwarze bestimmt war, keine freien Plätze mehr gab. Doch wie so oft standen die Männer widerspruchslos auf, ebenso die zwei Frauen, die in derselben Reihe auf der anderen Seite des Ganges saßen. Der Busfahrer verzog seinen Mund zu einem zufriedenen Lächeln. Vier Schwarze standen, ein Weißer saß – die heile Welt der Trennung zwischen Schwarzen und Weißen war wiederhergestellt.
Als der Bus sich in den Feierabendverkehr einfädelte, brandeten die Gespräche um Rosa herum erneut auf. Ihr Herz pochte immer noch. Was hier passierte, war falsch. Und konnte nicht so weitergehen. Es musste sich endlich etwas ändern.
Raymond
Rosa näherte sich dem schmalen Reihenhaus aus roten Ziegelsteinen, das zu den Sozialwohnungen von Cleveland Court gehörte und über eine moderne Küche und ein eigenes Bad verfügte. Hier wohnte sie zusammen mit Leona, ihrer Mutter, und Raymond, ihrem Mann, den alle – auch Rosa – Parks nannten.
Kaum hatte Rosa die Haustür geöffnet, empfing sie der Duft von Gebratenem. Sie betrat das Wohnzimmer und schaute nach hinten in den Küchenbereich, wo sich der ruhige Schatten von Parks bewegte. Wie am Morgen summte er ein verspieltes Lied. Es schien ein guter Tag auf dem Militärstützpunkt gewesen zu sein.
Rosa stellte ihre Tasche auf dem Sessel ab, legte ihre Jacke über die Lehne und ging direkt zu ihm. Die Küche öffnete sich zur Linken, und da stand Parks über der Pfanne und briet die Putenfilets, die ihre Mutter, Leona, vorbereitet hatte. In einem Topf dampften Bohnen, und Rosa wettete darauf, dass die Kartoffeln, deren Schalen mit anderen Abfällen in einer Schüssel auf der Arbeitsfläche lagen, nach dem Braten im Backofen waren – so wie Parks es mochte.
»Hallo, Rosa«, sagte er und lächelte sie an.
»Deine Laune hat gehalten«, sagte sie, streichelte seine Schulter und küsste ihn auf die Wange.
»War ein guter Tag«, erwiderte er. »Und bei dir?«
Sie seufzte. »Das Übliche.«
»Ich wünschte, du könntest wieder auf der Air Base arbeiten.«
Während des Krieges war Rosa dort als Schneiderin angestellt gewesen. In dieser Phase war die Maxwell Air Force Base wie viele andere Militäreinrichtungen nach und nach desegregiert worden: Schwarze und Weiße wurden nicht länger voneinander getrennt, sondern arbeiteten Hand in Hand. Rosa hatte dort eine weiße Frau kennengelernt, mit der sie gemeinsam auf dem Stützpunkt Bus gefahren war. Diese hatte ihren Sohn, kaum älter als neun, dabeigehabt. Solange sie auf der Air Base gewesen waren, hatten sie nebeneinandergesessen und geplaudert. Doch sobald sie außerhalb des Stützpunktes in einen Stadtbus gewechselt waren, hatte die Frau mit ihrem Sohn vorne Platz genommen und sie hinten. Der befremdete Blick, mit dem der Junge zu Rosa nach hinten geschaut hatte, ließ sie bis heute nicht los.
»Seien wir froh, dass wenigstens du dort arbeiten kannst.« Sie schaute zur Tür von Leonas Zimmer. »Wie geht’s meiner Mutter?«
»Besser, aber sie hat keinen Hunger. Ich hab sie ins Bett geschickt.«
»Wie hast du das geschafft?«
»Hab gesagt, dass sie ohne Schlaf ganz sicher nachher nicht in der Lage sein wird zu nähen.«
Rosa und ihre Mutter schneiderten abends oft zusammen. Es brachte Geld, wenn sie für andere Reparaturen und Änderungen machten oder sogar ganze Kleider für sie nähten. Vor allem aber war es Zeit, die sie zusammen verbrachten.
»Wir sollen ihr was übrig lassen«, sagte Parks. »Besonders von den Kartoffeln.«
Parks holte die selbst gemachte Paprikasoße aus dem neuen Kühlschrank. Der alte hatte seinen Geist aufgegeben, so hatten sie ein gebrauchtes Modell gekauft. Er war erschwinglich gewesen, weil alle die neuen, größeren Schränke haben wollten. Rosa schaute zur Außenwand, wo hinter einem kleinen Tisch noch die Klappe war, durch die früher der Eisblock für ihre Kühlbox geliefert wurde, und sie war froh, dass diese Zeit vorbei war.
Als sie endlich gemeinsam am Tisch saßen, lächelte Parks sie an. Dieses unnachgiebige Lächeln, in das sie sich einst verliebt hatte, war nach all den Jahren ebenso geblieben wie sein klarer Blick auf die Verhältnisse. Aber sein Tatendrang hatte nachgelassen. Er war ermüdet und enttäuscht – ermüdet durch all die Widerstände, auf die sie gestoßen waren; enttäuscht, weil der Rückhalt in der Schwarzen Gemeinde in entscheidenden Augenblicken nicht da gewesen war. Doch trotz aller Enttäuschung war er an Tagen wie diesen ein wahrer Sonnenschein.
Kaum hatte er ihr die Bohnen und die Bratkartoffeln auf den Teller gehäuft, strich Rosa ihm über die Hand. Er zwinkerte ihr zu. Wer ihn so erlebte, konnte nicht glauben, wie in sich gekehrt er sein konnte. Sie genoss Augenblicke wie diese, denn sie erinnerten sie daran, wie ungeheuer lebensfroh Parks gewesen war, als sie sich kennengelernt hatten.
»Danke, dass du heute Morgen Frühstück gemacht hast«, sagte sie. Er hatte sie mit dem Geruch von Kaffee und Bacon geweckt. Nun fasste sie seine Hände und sprach das Tischgebet. Seine Lippen bewegten sich nicht, aber er schaute sie an, als würde er durch sie das Gebet sprechen.
Kaum hatte sie den ersten Bissen des Filets genossen, sagte Parks: »Wir haben einige neue Schwarze Unteroffiziere aus dem Norden. Hab mich heute mit einem von ihnen über die Segregation unterhalten. Jedenfalls fiel mir da was ein, das du mal gesagt hast: Die Mauer der Segregation ist keine gewöhnliche Mauer. Sie bleibt nur bestehen, solange die meisten von uns glauben, dass sie uns aufhalten kann. Aber wenn wir an ihr zweifeln, zweifeln auch die Weißen bald an dieser Mauer, und dann bekommt sie Risse und beginnt zu bröckeln.«
»Das habe ich gesagt? Klingt eher nach dir in jungen Jahren.«
»Das hast du in etwa so gesagt, nachdem du Recy Taylor geholfen hattest.«
Rosa dachte oft an Recy, die in Abbeville auf dem Heimweg von der Kirche von sechs Weißen entführt und vergewaltigt worden war. Wie so oft war die Klage abgewiesen worden. Rosa hatte den Fall damals im Namen der NAACP in Abbeville dokumentiert. Sie hatte selten so viel Angst in ihrem Leben gehabt; aber dennoch war sie fest entschlossen gewesen, auf Recys Schicksal aufmerksam zu machen.
»Da war ich so niedergeschlagen«, sagte Rosa. »Wahrscheinlich habe ich mich deswegen an einen Strohhalm geklammert. Kann also gut sein, dass ich das gesagt habe.« Sie aß etwas von den Bohnen, bei denen sich Schärfe und Süße abwechselten. Dann fragte sie: »Wie siehst du das? Kann wachsender Zweifel die Mauern zwischen Schwarzen und Weißen brechen?«
»Solange wir an diese Mauer glauben, wird sie leider Bestand haben.«
»Du bist manchmal wirklich ein Pessimist, Parks.« Das manchmal war inzwischen untertrieben. Leider hatte er sich die Vorurteile, die manche ihm nachsagten, zu Herzen genommen – insbesondere das, wonach Parks, der beinahe weiß aussah und ihr bei ihrem ersten Treffen zu weiß erschienen war, nicht mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein konnte. Was würden sie sagen, wenn sie ihn in den Dreißigerjahren erlebt hätten? Damals war er in ihrem gemeinsamen Aktivismus die treibende Kraft gewesen. Nun war sie es, und Parks unterstützte sie, ohne dabei gesehen oder dafür gelobt werden zu wollen.
Rosa genoss den würzigen Geschmack der Bratkartoffeln. »Deine Kartoffeln und Mutters Hühnchen – dafür lohnen sich die Strapazen des Tages.« Sie streckte ihre Hand aus und fasste Parks’ Fingerspitzen. »Kommst du morgen mit zur NAACP?«
Er seufzte. »Willst du mich wirklich dabeihaben?«
Sie lächelte ihn an. »Es ist kein normales Treffen. Jo Ann und das Women’s Political Council werden da sein. Wir wollen über die Lage in den Bussen sprechen. Ein guter Zeitpunkt, um dabei zu sein.«
Parks nickte. »Na gut, Rosa. Aber du weißt, dass ich nicht so mitmachen kann wie früher.«
»Natürlich. Aber manchmal sagst du was, und das sind Augenblicke, die ich sehr genieße.«
Leona
Im Radio lief leise Gospelmusik. Rosa saß im Wohnzimmer auf ihrem Lieblingssessel und kontrollierte den Saum des eleganten Kleides, das sie im Auftrag von Virginia Durr nähte. Eigentlich hätte Rosa sich lieber an die Nähmaschine gesetzt und ein weiteres Kleid genäht, doch sie wollte keinen Lärm machen und Leona schlafen lassen.
Virginia, die Ehefrau des Rechtsanwalts Clifford Durr, hatte sicher kein Problem damit, wenn sie ihre Kleider etwas später bekam. Die Durrs gehörten zu den wenigen weißen Menschen in Montgomery, die keinen Unterschied machten, wenn jemand weiß oder Schwarz war, und Clifford unterstützte die NAACP ehrenamtlich mit seiner Fachkompetenz. Im Lauf der Zeit waren Rosa und Virginia so etwas wie Freundinnen geworden. Deshalb wusste Rosa, dass die Durrs sich auch um das Wohlergehen ihrer Mutter sorgten. Leona gab nur selten zu, wenn es ihr nicht gut ging. Dass sie das gemeinsame Abendessen mit Tochter und Schwiegersohn ausgelassen hatte, sprach Bände. Sollte sie auch auf den Kirchenbesuch am Sonntag verzichten, würde Rosa sie zu einem Besuch beim Arzt überreden müssen.
Draußen vor dem Fenster dämmerte es. Nicht mehr lange, dann würde auch das letzte Licht am Horizont verschwunden sein. Ob Parks einen schönen Abend hatte? Er war gut gelaunt aus dem Haus gegangen und würde sicher nicht vor Mitternacht zurückkommen. Rosa hoffte, dass seine Freunde ihn von den düsteren Grübeleien ablenken würden, die ihn in letzter Zeit immer öfter überkamen.
Als sie ihn vor dreiundzwanzig Jahren kennengelernt hatte, sprühte er nur so vor Optimismus und Tatendrang. Auch damals engagierten sich die wenigsten Schwarzen Männer für die Bürgerrechte, denn wenn es bekannt wurde, waren ihre Leben in Gefahr. Trotzdem war Parks sehr aktiv in der NAACP. Er engagierte sich besonders für die Scottsboro Boys, neun Jungen im Alter von dreizehn bis neunzehn Jahren aus dem Norden Alabamas, von denen acht für eine angebliche Vergewaltigung zum Tode verurteilt worden waren. Jeder, der sich mit dem Fall näher beschäftigte, wusste, dass die Aussagen der zwei weißen Frauen, auf denen die Anklage beruhte, gelogen waren. Die Solidaritätsbekundungen waren groß. Sogar in Europa, in Deutschland, in Frankreich und der Schweiz protestierten Menschen gegen das Urteil und für Gerechtigkeit.
Das Telefon im Flur klingelte. Rosa legte eilig das Kleid zur Seite und stand auf, doch auf halbem Weg verstummte es. Unschlüssig blieb sie stehen. Sollte ihre Mutter jetzt noch schlafen, würde sie spätestens dann aufwachen, wenn es erneut klingelte. Hatte vielleicht Parks versucht anzurufen? Hoffentlich konnte er den Abend mit seinen Freunden genießen.
Das Schicksal der Scottsboro Boys hatte ihn stark verändert. Dabei kam es immer wieder vor, dass Schwarze Jungen und Männer für einen harmlosen Blick, eine arglose Bemerkung und oft sogar aufgrund von Lügen wegen Vergewaltigung angeklagt und zum Tode verurteilt wurden. Oder dass ein wütender Mob sie lynchte. Doch Parks hatte sich nicht mit dieser Ungerechtigkeit abfinden können. Er hatte die Jungen regelmäßig im Gefängnis besucht und ihnen Essen gebracht, dabei geholfen, die Verteidigung zu organisieren, und ihnen Halt und Hoffnung gegeben. Obwohl der Ku-Klux-Klan ihm und seinen Mitstreitern mit dem Tod gedroht hatte und Polizisten zur Einschüchterung auf ihren Motorrädern vor dem Haus auf und ab gefahren waren.
Als wäre es gestern gewesen, konnte Rosa sich an die Angst erinnern, die sie um Parks gehabt hatte, wenn er zu seinen geheimen Treffen aufgebrochen war. Sie liebte und bewunderte sein gutes Herz ebenso wie seinen starken Gerechtigkeitssinn und den Mut, mit dem er für seine Überzeugungen eintrat.
Doch dann waren zwei seiner Mitstreiter ermordet worden. Und nach einigen Jahren und mehreren Prozessen kam nur ein Teil der Scottsboro Boys frei. Drei der Jungen erhielten hohe Gefängnisstrafen, einer sogar die Todesstrafe. Für Parks war das kein Sieg gewesen. Und auch wenn alle Jungen inzwischen längst auf Bewährung aus der Haft entlassen worden waren: Das, was sie im Gefängnis erlebt hatten, hatte sie nachhaltig traumatisiert. Ihre Leben waren zerstört, ebenso wie Parks’ Vertrauen darauf, dass am Ende die Gerechtigkeit siegen würde und es mit rechtsstaatlichen Mitteln tatsächlich möglich war, den Rassismus in den USA zu überwinden.
»Rosa, mein Schatz. Geht es dir nicht gut?«
Leona stand vor Rosa, eingehüllt in einen flauschigen dunkelbraunen Morgenmantel, den Rosa ihr zum letzten Geburtstag genäht hatte. Ihre Mutter sah angegriffen aus, mit dunklen Ringen unter den Augen und trockener Haut. Wenn Rosa sie ansah, war es ein wenig, als sähe sie in den Spiegel: die gleiche helle Haut, die gleiche schmale, spitze Nase, das gleiche dunkle, nur leicht gewellte Haar, die gleiche schlanke, feingliedrige Figur.
»Alles gut, Mama. Ich habe nur an Parks gedacht.«
Leona nickte bedeutungsschwer. Dass sie ihren Schwiegersohn mochte, war deutlich zu spüren. Ähnlich wie Rosa schätzte sie Parks’ Idealismus und seine Fürsorge für die Menschen, die er liebte.
»Mach dir keine Sorgen um ihn, mein Kind.« Sie setzte sich auf das Sofa neben Rosas Sessel und faltete die Hände im Schoß.
»Findest du nicht, dass er sich verändert hat? Früher musste ich ihn nicht fragen, ob er zu einem Treffen mitkommt. Die NAACP war ihm mal genauso wichtig wie mir.«
Leona lachte und winkte ab. »Parks ist zehn Jahre älter als du. Mit zweiundfünfzig Jahren wirst du auch ruhiger sein als heute.«
Hatte Leona recht? War Rosa zu streng – und Parks nur deshalb weniger feurig als zu Beginn ihrer Ehe, weil er langsam alt wurde?
»Ich habe das Gefühl, dass ihn etwas bedrückt«, sagte Rosa zögernd.
»Mein Liebes, wir leben in düsteren Zeiten. Parks hat viele Jahre alles gegeben. Weißt du noch, wie schwer sie es ihm gemacht haben, nur weil er keinen Schulabschluss hat? Und dann diese Mutlosigkeit! Manchmal hatte er das Gefühl, dass er der Einzige war, der sich traute, neue Wege zu gehen.« Leona griff zum Wasserglas und zu der Karaffe, die auf dem kleinen Sofatisch standen, und schenkte sich ein. »Dabei hätte er es sich auch einfach machen können. So hell, wie seine Haut ist, hätte er es vielleicht geschafft, sich irgendwo im Norden als weißer Mann durchzuschlagen. Stattdessen hat er hier im Süden sein Leben riskiert. Für uns alle. Dass er sich jetzt etwas zurückzieht und die jüngere Generation kämpfen lässt, ist in meinen Augen eine kluge Entscheidung.« Sie sah Rosa eindringlich an. »Damals, während der Scottsboro-Boys-Prozesse, wäre er um ein Haar ermordet worden. Sei froh, dass er sich nicht weiter in Gefahr begibt.«
Rosa legte das Kleid zur Seite. Der Saum war perfekt vernäht, Virginia würde sicher sehr zufrieden sein.
»Du hast ja recht«, gab sie zu. »Es ist nur so ungewohnt, dass er nicht der Stärkere von uns beiden ist. Am Anfang unserer Ehe hatte er so viel Energie! Ohne ihn hätte ich meinen Schulabschluss nie nachgeholt. Erinnerst du dich, wie er mich unterstützt hat, als ich versucht habe, als Wählerin registriert zu werden? Das hab ich nur dank ihm geschafft. Und auch, dass ich heute in der NAACP bin, verdanke ich zu einem großen Teil seinem Vorbild.«
»Aber zur rechten Hand des Vorsitzenden hast du es aus eigenem Antrieb geschafft«, warf Leona ein. »Denn du bist nicht nur klug, sondern auch fleißig und ausdauernd.«
Rosa lächelte. Es war herzergreifend, wie stolz ihre Mutter auf sie war.
»Ich wäre jedenfalls nicht die, die ich heute bin, ohne Parks«, sagte sie mit Nachdruck.
Leona nickte verständig. »In guten und in schlechten Zeiten, das habt ihr euch vor Gott geschworen. Nirgendwo steht geschrieben, dass immer nur der Mann stark sein muss. Ihr stützt euch gegenseitig. Ihr inspiriert einander. Ihr seid immer füreinander da.« Sie lächelte. »Für dieses Geschenk solltest du jeden Tag dankbar sein.«
Leona hatte recht. Und Rosa war Gott jeden Tag dankbar, dass sie Parks damals eine Chance gegeben hatte. Dabei standen die Zeichen anfangs gar nicht danach, dass aus ihnen ein Paar werden würde. Erst als Rosa herausgefunden hatte, dass er ein mutiger Aktivist war, hatte es bei ihr gefunkt.
»Zum Glück habe ich damals auf dich gehört und ihm eine Chance gegeben.« Rosa stand auf. »Magst du etwas essen? Parks hat dir was zur Seite gestellt.«
»Gern.« Leona zog die Decke von der Sofalehne und breitete sie über ihren Beinen aus. »Ich wusste sofort, dass Parks ein guter Ehemann sein würde«, sagte sie, während Rosa in die Küche ging. »Er erinnert mich an meinen Vater. Und das nicht nur, weil er auch so helle Haut hat.«
»Die beiden hätten sich sicher gut verstanden!«, rief Rosa, während sie das kalte Filet in Streifen schnitt und zusammen mit etwas Toastbrot auf einen Teller legte. Leona liebte es, Reste als Sandwich zu essen. Rosa zerschnitt den Toast in zwei Dreiecke und ging zurück ins Wohnzimmer. Leona nahm ihr den Teller mit einem dankbaren Lächeln ab und probierte einen winzigen Bissen.
»Was hältst du davon, wenn ich dich morgen zum Arzt begleite?«, fragte Rosa.
Leona schüttelte energisch den Kopf. »Mir geht es doch schon viel besser. Du wirst sehen, morgen kann ich wieder Bäume ausreißen.«
Rosa ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit ihren siebenundsechzig Jahren wirkte ihre Mutter zwar noch sehr vital, aber sie war immer häufiger abgeschlagen und appetitlos. Da Leona das selbst nicht sehr ernst nahm, sorgte sich Rosa umso mehr.
»Wir beobachten das noch eine Weile, einverstanden? Wenn du bis zum Wochenende nicht wieder ganz gesund bist, gehen wir am Montag zum Arzt. Versprochen?«
»Meinetwegen.« Leona lächelte wieder. »Aber jetzt lass uns nicht mehr über mich reden. Was hast du heute erlebt?«
Leona sprach nicht gern über sich. Wie Rosa hielt sie sich lieber im Hintergrund und ließ die anderen reden. Rosa fragte sich manchmal, ob sie diese Eigenschaft von ihrer Mutter geerbt hatte oder ob es ihr anerzogen worden war.
»Ich habe im Bus eine nette Frau kennengelernt. Sie heißt Henrietta und ist aus Detroit hierhergezogen.«
Leonas Blick wurde glasig. Sicher dachte sie an Rosas Bruder Sylvester. Der hatte im Krieg ebenso wie die weißen Soldaten für die Vereinigten Staaten gekämpft. Als er danach in die Südstaaten zurückgekehrt war, hatte er die strikte Trennung zwischen Schwarzen und Weißen nicht mehr ausgehalten. Jetzt war er in Detroit zu Hause und versuchte seitdem, Leona, Rosa und Parks davon zu überzeugen, zu ihm in den Norden zu ziehen.
»Dein Bruder fehlt mir«, sagte Leona. Sie legte das angebissene Sandwich zurück auf den Teller und stellte ihn auf dem Sofatisch ab. »Ich hoffe, ich kann ihn bald mal wieder besuchen.«
Rosa schwieg. Sie vermisste Sylvester auch. Aber obwohl sie seine Entscheidung, den Süden zu verlassen, nachvollziehen konnte, wollte sie ihre Heimat in Alabama nicht aufgeben. Sie hatte noch Hoffnung, dass sich etwas ändern würde. Und sie wollte ihren Teil dazu beitragen.
***
Rosa lag im Bett und starrte in die Dunkelheit. Es war weit nach Mitternacht, und Parks war noch immer nicht wieder da. Sicher ging es ihm gut. Vermutlich hatte er einfach eine schöne Zeit mit seinen Freunden und würde bald nach Hause kommen. Doch sooft sie sich das auch einredete, das Sorgenkarussell in ihrem Kopf rotierte weiter.
Erschöpft setzte sie sich auf, machte Licht und griff zur Bibel, die auf dem Stuhl neben dem Bett lag. Leona hatte ihr das Exemplar geschenkt, und Rosa hütete es wie einen kostbaren Schatz. Sie schlug es beim Lesezeichen auf und las immer wieder ihren liebsten Psalm:
»Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum stillen Wasser.
Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.«
Rosa klappte die Bibel wieder zu. Heute half ihr nicht mal die Heilige Schrift, zur Ruhe zu kommen. Was war nur los mit ihr?
Eigentlich war es ihr nie besser gegangen. Ihre Ehe war glücklich. Im Gegensatz zu vielen anderen Männern in seinem Alter unterstützte Parks sie bei allem, was sie tat. Auch wenn er zu Beginn ihrer Ehe aus Angst um sie nicht gewollt hatte, dass sie sich in der NAACP engagierte, war er heute sogar stolz darauf, wie sie zwischen all den engstirnigen Männern ihre Frau stand. Er sorgte sich zwar immer noch um sie, aber er hatte gelernt, dass ein Leben in Angst und Unterwürfigkeit nicht das Leben war, das sie führen wollte.
Mit seiner sicheren Arbeit als Friseur auf dem Luftwaffenstützpunkt, ihrem Gehalt, das sie als Näherin im Kaufhaus verdiente, und dem zusätzlichen Geld, das sie abends und an den Wochenenden mit Näharbeiten verdiente, kamen sie gut über die Runden und mussten nicht jeden Cent umdrehen. Eigentlich war also alles gut, abgesehen davon, dass Parks sich zu verändern schien und Leona häufig kränkelte.
Rosa legte die Bibel zurück auf den Stuhl und machte das Licht aus.
Sie hatte Vertrauen in die Wege des Herrn. Was auch immer geschehen würde, sollte geschehen. Trotzdem betete sie vor dem Einschlafen, dass Parks und Leona ihr noch lange und gesund erhalten bleiben würden.
Montgomery Fair
Mit einem Zischen schlossen sich die Türen in Rosas Rücken, und der Bus fuhr zur nächsten Haltestelle weiter. Wie so oft war sie froh, dass sie nicht hatte laufen müssen, denn die Strecke von der Wohnung bis zum Montgomery-Fair-Kaufhaus kostete sie morgens eine halbe bis dreiviertel Stunde. Trotzdem nahm sie den Weg auf sich, wenn dieser eine Busfahrer am Steuer saß. Sie mied ihn jetzt schon seit zwölf Jahren wie das Lamm den Wolf.
Damals war er einfach losgefahren und hatte sie im Regen stehen lassen, nachdem sie die zehn Cent für ihr Ticket gezahlt hatte und wieder ausgestiegen war, um durch den Hintereingang einzusteigen. Seine persönliche Rache, weil sie es gewagt hatte, die Segregation infrage zu stellen und nach dem Bezahlen des Tickets durch den Bereich der Weißen zu den hinteren Sitzplätzen zu gehen.
Dieser Mann verkörperte das hässliche Gesicht des weißen Amerikas: Er verabscheute Schwarze, er liebte es, Macht auszuüben, und er war – wie alle Busfahrer in der Stadt – bewaffnet. Eine tickende Zeitbombe für jede Schwarze Person in seiner Nähe. Auch Parks zuliebe hatte Rosa deshalb den Vorsatz gefasst, nie wieder mit ihm zu fahren. Wenn er am Steuer saß, ging sie zu Fuß, bei schlechtem Wetter leistete sie sich auch mal ein Taxi.
Rosa sah die Dexter Avenue entlang, die morgens zu dieser Uhrzeit noch ungewöhnlich leer war. Nur wenige Autos standen am Straßenrand, und die wenigen Schwarzen und weißen Menschen, die den Gehweg bevölkerten, eilten mit verschlossenen Gesichtern zu ihren Arbeitsplätzen. Der historische Kern Montgomerys mit dem State Capitol und dem Court-Square-Brunnen bildete das Zentrum der Stadt. Virginia Durr hatte ihr mal erklärt, dass der Brunnen Statuen der griechischen Mythologie zeige. Rosa fand allerdings viel interessanter, dass schon die Urbevölkerung Alabamas hier eine Wasserstelle gehabt hatte. Und dass Schwarze wie sie während der Zeit der Sklaverei auf dem Gebiet des Court Square wie Vieh gehandelt worden waren. So viele Menschen hatte man hier von ihren Lieben getrennt in ungewisse Schicksale gestoßen, die nicht selten mit einem grausamen Tod geendet hatten. Statt Statuen aus der griechischen Mythologie wünschte sie sich ein Andenken an all die in Alabama versklavten Menschen, zu denen auch ihr Großvater Sylvester einige Jahre seines Lebens gehört hatte. Eilige Schritte auf dem Asphalt rissen Rosa aus ihren Gedanken. Dann tippte ihr jemand von hinten auf die Schulter.
»Rosa?« Die Stimme kam ihr bekannt vor. »So schnell sieht man sich wieder!«
Rosa drehte sich um. »Etta! Wie schön! Sie haben nicht im Bus gesessen. Oder?«
»Nein, ich bin mit dem Auto gefahren.«
Am Straßenrand entdeckte Rosa einen hellblauen Studebaker Champion neben einem roten Ford Fordor. Beides Wagen, die zu Etta passen würden und die, wenn man gut verdiente und eisern sparte, einigermaßen erschwinglich waren.
Etta lachte kopfschüttelnd. »Sie glauben nicht im Ernst, dass ich mir ein Auto leisten kann! Ich bin gefahren worden. Kennen Sie Lucille Times? Wir sind Nachbarinnen.«
Natürlich kannte Rosa Lucille. Ihr und ihrem Mann Charlie gehörte das Times-Café auf der Holt Street, das alle nur Sugar Hill, also Zuckerhügel, nannten. Der Name passte perfekt, denn bei Lucille gab es das süßeste und fluffigste Gebäck der Stadt.
»Ich kenne Lucille von der Arbeit bei der NAACP.«
Etta nickte. »Sie hat mir erzählt, dass sie Mitglied ist. Wussten Sie, dass sie einen Streit mit einem Busfahrer hatte?«
Und ob Rosa das wusste. Es war genau der Busfahrer, um den sie seit Jahren einen großen Bogen machte.
»Der wollte Lucille in ihrem Auto von der Straße drängen!« Etta sah Rosa empört an. »Und als sie angehalten hat, hat er sie geschubst und beleidigt!«
»Ich hab gehört, dass auch die Motorradpolizisten sehr grob mit ihr umgegangen sind.«
»Und ob!« Etta schrie jetzt fast, so aufgebracht war sie.
Rosa wusste, dass Lucille sehr wehrhaft war und sich nicht kleinkriegen ließ. Nachdem klar gewesen war, dass weder die Polizei noch das Busunternehmen eine Stellungnahme abgeben würden, hatte sie Leserbriefe an verschiedene Zeitungen geschickt. Doch alle weigerten sich, sie zu veröffentlichen. Daraufhin hatte sie beschlossen, auf eigene Faust einen Busboykott durchzuführen.
Ihr Plan war, so viele Schwarze wie möglich mit ihrem eigenen Wagen durch Montgomery zu fahren, um dem Busunternehmen einen finanziellen Schaden zuzufügen. Spenden für Benzin konnten diejenigen, die es sich leisten konnten, im Sugar Hill abgeben. Obwohl die NAACP Montgomery diese Aktion abgelehnt hatte, weil sie übereilt, wenig wirksam und nicht bis zum Ende durchdacht schien, zogen Lucille und ihr Mann die Sache offensichtlich durch.
Rosa konnte nicht anders, als Lucille für ihren mutigen Aktivismus zu bewundern. Denn eins war klar: Damit lief sie Gefahr, dass die vielen militanten Rassisten in der Stadt auf sie aufmerksam wurden.
»Wohin müssen Sie?«, wechselte Etta das Thema. »Haben wir vielleicht denselben Weg?«
Rosa deutete nach links, auf ein viergeschossiges modernes Gebäude mit weißen und blauen Glasbausteinen im Art-déco-Stil. »Ich arbeite als Näherin im Montgomery-Fair-Kaufhaus.«
»Da hab ich heute meinen ersten Tag in der Personalstelle!« Etta strahlte. »Ich arbeite halbtags als Stenografin und Mädchen für alles.«
»Wenn Sie möchten, zeig ich Ihnen, wo es langgeht.«
Das ließ Etta sich nicht zweimal sagen. Sie folgte Rosa zur North Perry Street und von dort auf die Monroe Street, zum Hintereingang des Kaufhauses. Bevor sie das Gebäude betraten, blieb Etta abrupt stehen.
»Bevor wir reingehen«, fragte sie mit ängstlichem Unterton, »wie ist die Stimmung im Kaufhaus? Lässt es sich aushalten mit den Chefs? Muss ich irgendwas beachten? Sollte ich …«
»Am besten halten Sie sich erst mal zurück. Beobachten Sie, wie wir anderen Schwarzen uns verhalten. Dann werden Ihnen die ungeschriebenen Gesetze schneller klar.« Rosa sah, dass sie Etta mit ihrem Rat alles andere als beruhigt hatte. »Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie Ihren Job gut machen, immer pünktlich sind und sich den Weißen gegenüber zurückhalten, dann werden Sie sich schnell eingewöhnen.«
»Und wenn ich aus Versehen etwas mache, was uns Schwarzen im Norden erlaubt, hier im Süden aber verboten ist?«
»Zum Glück ist hier im Haus alles klar geregelt. Die Orte, die wir benutzen dürfen, sind beschriftet. Wenn Sie sich bei einer Sache nicht sicher sind, lassen Sie es lieber sein. Wenn Ihnen eine weiße Person einen Auftrag gibt, egal wie sinnlos oder falsch, dann sagen Sie nicht, dass Sie es besser wissen. Machen Sie einfach, was man Ihnen sagt. Und wenn Sie eine weiße Person provoziert, lassen Sie es an sich abperlen und denken Sie an das Geld, das Sie verdienen.« Rosa zögerte. Sie wollte Etta nicht zu sehr frustrieren, aber es war besser, wenn sie vorbereitet war auf das, was sie erwartete. »Ich weiß, wie furchtbar das alles klingt. Im Grunde sind wir Menschen zweiter Klasse, mit vielen Pflichten und wenigen Rechten. Ich weiß oft selbst nicht, wie ich es schaffe, das auszuhalten.«
Etta nickte entschlossen. »Danke, Rosa.« Sie strich ihren Rock glatt und drückte den Rücken durch. »Na, dann los!«
***
Etta staunte nicht schlecht, als Rosa sie durch den etwas verwahrlost wirkenden Hintereingang in den beeindruckend großen Hauptraum des Kaufhauses führte. Rosa konnte das gut nachempfinden. Ihr war es ebenso ergangen, als sie diesen imposanten Saal zum ersten Mal gesehen hatte. Der gepflegte helle Boden und die weißen Wände ließen das Innere umso imposanter erscheinen. Die zweite Ebene, in der sich die Herrenabteilung befand, war offen, sodass man dort, wie von einem Balkon, in die Verkaufsebene für Damen heruntersehen konnte. Zwischen beeindruckenden weißen Säulen, die die Decke zu stützen schienen, standen unzählige Regale und Warentische mit feinster Damenwäsche. Dazu Kleiderstangen mit Röcken, Blusen und Kostümen. Zur Jahreszeit passend, hatte man überall im Raum übergroße Blumenvasen drapiert, die mit Sommerblumen bestückt waren. Dazu duftete es nach teuren Parfüms.
»Ich habe nicht gedacht, dass es so überwältigend ist«, murmelte Etta.
Rosa lächelte. Sie konnte sich gut erinnern, wie sie sich gefühlt hatte, vor gut einem Jahr an ihrem ersten Arbeitstag. Sie war zuvor zwar schon als Kundin im Kaufhaus gewesen, aber ein Teil dieses modernen Einkaufsparadieses zu sein, war etwas ganz Besonderes. Auch wenn es nur schwer zu ertragen war, dass Schwarze Kundinnen und Kunden nur geduldet wurden und es ihnen verboten war, Kleidung oder Schuhe anzuprobieren.
»Sehen Sie die Fahrstühle?« Etta folgte Rosas Fingerzeig. »Die sind nur für Weiße«, erklärte Rosa. »In einem arbeitet der alte Jim. Wenn Sie irgendetwas brauchen oder wissen wollen, sind Sie bei ihm an der richtigen Adresse. Sie glauben nicht, was die Leute im Fahrstuhl für Geheimnisse austauschen, während er still und stumm in der Ecke steht.«
Etta nickte verständig. Dann drehte sie sich wieder zu Rosa. »Und wo ist Ihr Arbeitsplatz? Oben in der Herrenabteilung?«
Rosa schüttelte den Kopf. »Ich sitze unten im Keller. Neben dem Raum mit den weißen Näherinnen. Oben in den Verkaufsabteilungen werden nur die Maße genommen.«
Ein junger Schwarzer Mann mit dünnen Beinen und dicken Brillengläsern kam auf sie zu. Er trug einen dunkelbraunen Anzug und hatte eine auffallend hohe Stirn.
»Hey, Rosa«, grüßte er freundlich.
»Morgen, Isaac. Das hier ist Henrietta. Sie arbeitet ab heute bei dir in der Personalstelle. Nimmst du sie mit nach oben?«
Isaac sah Etta schüchtern an. »Dann sind Sie die neue Stenotypistin?«
»Und Mädchen für alles«, ergänzte Etta. »Kannst Etta sagen.« Die beiden schüttelten Hände. Rosa hatte das Gefühl, dass Etta bei ihm gut aufgehoben war.
»Dann lasse ich euch mal allein.« Sie wandte sich an Etta. »Mit Ihrer Halbtagsstelle machen Sie sicher keine Mittagspause. Aber vielleicht fahren wir morgen früh ja zusammen mit dem Bus?«
»Gern! Falls mich Lucille nicht wieder mit dem Auto mitnimmt.« Lachend folgte Etta Isaac zu den Aufzügen.
***
Rosa zog die Jacke aus und hängte sie an den Kleiderständer. Nebenan waren ihre weißen Kolleginnen noch nicht am Platz, aber sie würden sicher auch gleich eintrudeln. Niemand wagte es, zu spät zu kommen, denn Mr Morrison, der Abteilungsleiter, war streng und duldete keine Unpünktlichkeit.
Sie stellte ihre Handtasche unter den Tisch und setzte sich. Nicht nur, weil John Ball, der Leiter der Schneiderei und ihr direkter Chef, es so vorgab, achtete Rosa penibel darauf, ihren Arbeitsplatz sauber zu halten. Da war nirgendwo ein Faden zu sehen, geschweige denn ein Stückchen Stoff. Jeden Abend fegte sie und polierte die Nähmaschine, die im Vergleich zu ihrer Maschine zu Hause ein futuristisches Wunder war. Mit ihr zu nähen, war so mühelos und einfach und die Zeitersparnis enorm. Aber so eine Nähmaschine kostete ein Vermögen. Bis Rosa sich so etwas leisten konnte, würde sie noch eine ganze Weile arbeiten müssen.
Sie nahm eine Hose, die sie am Tag zuvor gekürzt hatte, aus der Schublade ihres Tisches und kontrollierte ihre Arbeit. Alles war sauber und gerade vernäht. Zufrieden mit dem Ergebnis legte sie die Hose in den Ausgangskorb, wo einer der Springer sie später abholen und hoch in die Herrenabteilung bringen würde. Die Aufträge für den heutigen Tag lagen in einem der Regalfächer im Flur. Wer welches Kleidungsstück bearbeitete, blieb den Näherinnen überlassen, aber da Rosas Talent allgemein bekannt war, übernahm sie gern die etwas komplizierteren Aufgaben. Sie entschied sich für ein graues Jackett und machte sich an die Arbeit.
Seit sie ein Kind war, liebte sie es, zu nähen. Schon als junges Mädchen hatte sie von ihrer Großmutter Rose das Quiltschneidern gelernt. Später, auf der Berufsschule, die leider geschlossen wurde, bevor sie einen anerkannten Abschluss machen konnte, hatte man ihr die wichtigsten Fähigkeiten beigebracht, die Schwarze Frauen brauchten, um einmal einen für sie möglichen Beruf ergreifen zu können. In Stenografie und Büroarbeit war sie sehr gut gewesen – aber das Nähen hatte ihr immer am meisten Freude gemacht.
Dass sie jetzt im Montgomery Fair als Näherin angestellt war und ein sicheres Auskommen hatte, war wie ein Traum, der sich erfüllt hatte. Dazu kam die Arbeit ihrem Charakter entgegen: Sie liebte es einfach, sich mit Hingabe und Fleiß einer Sache zu widmen, sie zu ändern und zu verschönern, bis sie perfekt war.
Mittagspause
Der Mittag kam, und Rosa wollte ihn wie so oft mit dem Anwalt Fred Gray verbringen. Fred war genau das, was Montgomery benötigte – ein Schwarzer Anwalt. Zwar gab es mit Charles Langford bereits einen, aber in diesem Klima konnte niemand alleine die Last tragen. Fred kam frisch vom College und war angetreten, um die Segregation zu bekämpfen, wo auch immer er sie fand.
Am Hinterausgang bestand der Boden lediglich aus blankem Beton, und abgesehen vom Wachpersonal verirrten sich selten einmal Weiße in diesen trüben Winkel. Dennoch gab es hier einen segregierten Wasserspender. Die Regeln galten selbst dort, wo Schwarze unter sich waren. In einer Ecke stand die Tür zu einer Kammer offen – das Reich von Luke, dem Hausmeister. Auf dem groben Tisch, direkt neben dem Werkzeugkasten, stand das Lunchpaket, das Georgia Gilmore wie beinahe jeden Tag für sie und Fred Gray hinterlegt hatte.
»Sie ist gerade weg«, nuschelte Luke und reichte Rosa die schwere Papiertüte.
»Schade«, erwiderte sie.
Georgia arbeitete um die Ecke bei der Lunch Company als Köchin, schräg gegenüber des Haupteingangs des Kaufhauses, und wie viele andere war auch Rosa der Meinung, dass Georgia ein eigenes Restaurant verdient hätte. Aber es war wie so oft: Andere profitierten von ihrem Engagement. Georgias Vorgesetzter ließ sie mit ihren Lieferungen gewähren, denn sie brachten zusätzliches Geld in die Kasse des Restaurants.
»Ich sage Ihnen, Mrs Parks, wenn die Georgia verlieren, können die den Laden dichtmachen.« Er tippte auf sein in Papier geschlagenes Mittagessen und sagte: »Das hebe ich mir für die schweren Nachmittagsstunden auf.«
»Der bleierne Nachmittag«, erwiderte Rosa nickend. Dann verabschiedete sie sich mit einem Lächeln von Luke und ging durch die Hintertür auf die Monroe Street hinaus.
Es war wie eine andere Welt hier hinter dem Kaufhaus. Während vorne auf der Dexter Avenue den Weißen jede Tür offen stand, mussten Schwarze Menschen bei vielen Geschäften auf die Rückseite ausweichen. Hier auf der Monroe Street gab es viele Geschäfte und auch Büros von Schwarzen für Schwarze. Und dennoch – schräg gegenüber lagen das Rathaus und eine Zufahrt zum Parkplatz des Polizeipräsidiums, das im selben Gebäude untergebracht war. Es war, als wollte das Haus aus roten Ziegeln, dessen Haupteingang auf der Perry Street lag, ihnen sagen: »Wir behalten euch im Auge. Und wenn ihr euch zu viel rausnehmt, bekommt ihr Probleme.«
Rosa wollte dem Rathaus nicht zu nahe kommen, deshalb wechselte sie erst am Ende des nächsten Blocks die Straßenseite. In der Monroe Street 113 betrat sie das unscheinbare Gebäude. Im Erdgeschoss befand sich eine alte Autowerkstatt, im Obergeschoss gab es Büros. Reverend Solomon S. Seay Sr. hatte Fred hier einen Platz als Untermieter angeboten, der einigermaßen bezahlbar war.
Oben im Bürotrakt angekommen, wollte Rosa den Reverend grüßen, aber seine Tür war geschlossen. Am Ende des Gangs klopfte sie an Freds Büro. Obwohl sich nichts rührte, trat sie ein. Fred war oft so sehr in irgendwelche Papiere versunken, dass er kaum seine Stimme erhob. Tatsächlich saß er auch nun über einer Akte.
Nach wie vor reichte ein Blick in diesen Raum, um zu erkennen, dass das Geschäft nicht gut lief. Wo bei anderen volle Regale mit Fachliteratur standen, waren bei ihm die meisten leer. Bei der Einweihung des Büros hatte Fred sich Bücher geliehen, damit der Raum etwas hermachte. Inzwischen kam er vor allem deswegen über die Runden, weil er an allen Enden sparte. Er hatte nicht einmal eine Sekretärin. Ab und zu half Rosa ihm aus, indem sie das Telefon hütete, wenn er zu Terminen musste.
»Rosa!«, sagte Fred mit melodischer Stimme. Er war Mitte zwanzig und hatte ein rundes, jungenhaftes Gesicht. Ohne die seriöse Brille hätte er wie ein Teenager gewirkt. Manche unterschätzten ihn wegen dieses Eindrucks.
»Wieder mal der Brown-Fall?«, fragte Rosa und schaute auf die Akte und den danebenliegenden Papierstapel.
Das Urteil des Supreme Court im vorigen Jahr, das die Segregation in Schulen für verfassungswidrig erklärt hatte, war zwar gefällt, aber wie so oft wurde der Unterschied zwischen dem Gesetz und der Umsetzung desselben deutlich. Die Befürworter der Segregation wollten nicht zulassen, dass Schwarz und Weiß zur selben Schule gingen, geschweige denn dieselbe Schulbank drückten.
»Nein, nein«, sagte Fred. »Ich schau mir noch mal den Fall von Viola White an.«
»Oh«, erwiderte Rosa bedauernd und musste an die Frau denken, die Mitte der Vierzigerjahre geschlagen und verhaftet worden war, weil sie ihren Platz im Bus nicht hatte aufgeben wollen. Sie war wegen Verstoßes gegen die Segregationsgesetze verurteilt worden, und nachdem sie in Berufung gegangen war, hatte ein weißer Polizist als Vergeltung ihre sechzehnjährige Tochter vergewaltigt.
»Das ist so deprimierend«, sagte Fred. »Was sie alles durchgemacht haben.«
»Warum hast du den Fall ausgegraben?«, fragte Rosa.
»Weil ich mir das Berufungsverfahren ansehen wollte. Nixon hat recht: Sie haben es einfach im Sande verlaufen lassen. Und dann ist Viola White gestorben.«
»Die Familie war vorher schon arm, aber nach ihrem Tod wurde es schlimmer. Ich sehe Violas Mutter ab und zu in der Kirche.«
»Dann richte ihr bitte aus, dass meine Türen ihnen offen stehen, falls sie mal einen Anwalt brauchen. Sie sollen sich keine Gedanken über die Bezahlung machen.«
»Mach ich«, erwiderte Rosa. »Statt die ermahnende Stimme zu sein, die dir sagt, dass dich das in den Ruin treiben wird, sage ich lieber, dass ich das bewundere.«
»Hab ich von dir und Nixon gelernt.«
»Manche würden das als keine gute Lehre betrachten.«
»Ach, es ist nur eine Frage, wie man die Einnahmen umverteilt.«
»Und was meint deine Verlobte dazu? Wolltet ihr nicht heiraten, sobald du Fuß gefasst hast? Das wird nicht billig.«
»Bernice ist hin- und hergerissen. Sie möchte natürlich, dass wir weiterkommen, aber du solltest ihr Lächeln sehen, wenn ich ihr erzähle, wie ich Leuten geholfen habe.«
»Ich weiß, was du meinst«, sagte Rosa und hatte Parks’ Lächeln vor Augen. Fred schloss die Akte und legte sie zur Seite, ehe Rosa das in Papier eingepackte Sandwich vor ihm ablegte. »Bernice weiß deine Arbeit eben zu schätzen«, fügte sie hinzu.
»Sie meint, ich wäre hier am richtigen Platz.«
Rosa packte nun ihr eigenes Sandwich auf dem Schreibtisch aus. »Sehe ich genau so. Du bist der Albtraum des weißen Montgomery – ein Schwarzer Anwalt.«
Fred lachte, sagte dann aber: »Clifford Durr hat mir erzählt, wie trostlos es war, bevor Langford hier angefangen hat.«
Rosa nickte langsam. »Eine Klassenkameradin von mir hat mal versucht, hier als Schwarze Anwältin Fuß zu fassen. Kennst du Mahala Dickerson?«
»Ja. Eine brillante Juristin.«
»Sie musste irgendwann aufgeben, weil sie nicht genug Klienten fand. Wie weit könnten wir heute sein, wenn sie sich hätte halten können!«
»Wie so oft scheitert es am Rückhalt unserer eigenen Gemeinde.«
»Kommst du heute Abend zum Treffen der NAACP?«, fragte Rosa. »Es geht um die Situation in den Bussen. Mr Nixon hat dazu auch Jo Ann Robinson und einige ihrer Mitstreiterinnen vom Women’s Political Council eingeladen.«
»Und Matthews hat das zugelassen?«
Edgar D. Nixon und Robert Matthews waren Rivalen. Nixon hatte Matthews das Amt des NAACP-Vorsitzenden von Montgomery in den Vierzigern abgenommen, und nun hatte Matthews sich das Amt zurückgeholt.
»Er hatte keine andere Wahl. Die meisten in unserer Gemeinde gehen mit ihren Problemen zu Mr Nixon. Neben ihm möchte Matthews nicht tatenlos erscheinen.«
»Wie stehen denn die Verhandlungen mit der Stadt?«, fragte Fred. »Werden sie fortgesetzt?«
»Das ist noch nicht klar«, antwortete Rosa. »Aber ich glaube, es hat keinen Sinn, an die Güte der Stadtoberen zu appellieren. Mit Sellers als Polizeipräsident sehe ich nur das alte Spiel mit schlimmerer Rhetorik. Ich finde, sie hätten Jo Anns Forderung folgen sollen. Die Wut über das, was Claudette passiert ist, ist genug für einen Boykott der Busse.«
Fred nickte. »Als ich Claudettes Fall annahm, hätte ich gerne mehr gemacht. Ihr Kampfgeist ist erfrischend. Aber Langford meint, dass sie nicht genug Rückhalt in der Gemeinde hat.«
»Wer hat das schon?«, entgegnete Rosa. »Der Kampfgeist, den sie zeigt, ist vielleicht das Wichtigste.« Sie seufzte. »Aber so im Fokus zu stehen – nur, damit die Schwarze Gemeinschaft wieder im entscheidenden Augenblick nicht zusammenhält? Zu viele, die sich mit dem Status quo arrangiert und mehr Angst davor haben, dass die Dinge wieder schlechter werden, als sich zum Besseren zu wenden. Dabei sind wir besser organisiert als je zuvor. Irgendwann muss das doch zum Erfolg führen.«
»Bei all den Streitigkeiten in unserer Gemeinde sehe ich diesen Tag noch nicht so bald kommen.«
»Ja, aber Reverend King hat neulich etwas gesagt, das mich beeindruckt hat.«
»Du meinst Dr. King.«
»Hat er jetzt seinen Doktor?«
»Ja, gerade passiert. Er spricht in letzter Zeit oft von Unausweichlichkeit, dass sich was ändert.«
Rosa nickte. »Das meine ich. Und deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Trotz aller Rückschläge. Auch wenn ich nicht glaube, dass die Veränderung von Montgomery ausgehen wird, sondern von außen kommt, sollten wir auf sie vorbereitet sein. Wenn es so weit ist, werden wir unseren Beitrag leisten.«
Fred grinste. »Ich mag unsere Mittagspausen«, sagte er leise und aß das letzte Stück seines Sandwiches. »Und ich werde zum Treffen kommen. Jo Ann wäre sicherlich enttäuscht, ihren ehemaligen Musterschüler nicht zu sehen.«
Die Versammlung
Die NAACP Montgomery traf sich auch diesmal in einem Nebenraum der Metropolitan Methodist Episcopal Church in der Jeff Davis Avenue. Wie so oft dominierten die Männer die Gespräche, während die Frauen die leiseren Töne anschlugen. Dabei hatte die eigentliche Versammlung nicht mal begonnen. Da einige Aktivisten und Aktivistinnen längere Arbeitszeiten hatten, würde der Vorsitzende Robert Matthews die Versammlung offiziell erst in zehn Minuten eröffnen. Bis es so weit war, stand Rosa mit Parks bei Edgar D. Nixon und Fred und hörte zu, wie Nixon über Lucille Times und ihren voreiligen Busboykott wetterte, der seiner Meinung nach wirkungslos verpuffen würde.
»Parks, was denkst du?« Nixon sah ihn auffordernd an. »Du kennst dich doch bestens aus mit aktivistischer Arbeit.«
»Ich kann Lucille verstehen«, begann Parks zögernd. »Ich hätte das damals auch nicht einfach auf mir sitzen lassen.«
»Mag sein«, gab Nixon zu. »Aber was soll so ein Ein-Frau-Boykott bringen?« Er schüttelte den Kopf. »Eine einzelne Frau kann doch kein ganzes Busunternehmen in die Knie zwingen. Dafür braucht es Durchsetzungskraft – und eine große Portion Mut.«
Fred lachte. »Lucille hat mehr Mut als so mancher Mann. Wenn sie für etwas brennt, kennt sie keine Angst.«
»Ja, alles richtig«, erwiderte Nixon zögerlich. Rosa kannte ihn sehr gut, in seiner Amtszeit als Vorsitzender der NAACP Montgomery hatten sie eng zusammengearbeitet. Daher wusste sie, dass Nixon sich schwertat mit Frauen wie Lucille, die nicht dem klassischen Bild entsprachen. Sie war laut, ordnete sich nicht gern unter und scheute sich auch nicht, sich mit Händen und Zähnen zu verteidigen, wenn sie körperlich angegriffen wurde. »Ich schätze Lucille«, sagte er. »Aber ich finde es nicht richtig, dass sie auf eigene Faust Entscheidungen trifft, die die gesamte Schwarze Gemeinschaft der Stadt betreffen.«
Jetzt wurde es Rosa zu viel. Auch wenn Parks und Fred für Lucille Partei ergriffen, war es nicht okay, wenn Männer darüber verhandelten, was eine Frau tun durfte und was nicht.
»Mr Nixon! Lucille hat die NAACP-Führung gebeten, aktiv zu werden. Trotzdem haben wir nicht angemessen reagiert. Dass sie diesen Vorfall nicht einfach im Sande verlaufen lassen will, ist doch völlig verständlich.«
»Außerdem schadet sie niemandem«, stimmte Fred Rosa zu. »Sollten wir irgendwann die perfekte Person finden, an der wir einen stadtweiten Boykott aufhängen können, wird es egal sein, dass Lucille so etwas schon auf eigene Faust im Kleinen durchgezogen hat.«
Rosa nickte zustimmend, doch Nixon sah ihren Mann an.
»Wir leben in den Fünfzigerjahren«, gab Parks zu bedenken. »Frauen sind heute selbstbestimmter und unabhängiger als zu deiner Jugendzeit.«
Fred legte Nixon die Hand auf die Schulter. »Sie sollten alles tun können, wonach ihnen der Sinn steht. Auch, wenn es uns Männern nicht gefällt.«
Nixon wackelte unbestimmt mit dem Kopf, ein Zeichen, dass er zwar hörte, aber nur widerwillig zustimmte. Rosa seufzte innerlich. Nixon war ein fortschrittlicher Präsident gewesen, der die NAACP in Montgomery weit vorangebracht hatte. Selbst Parks, der zu seiner aktiven Zeit stark mit der Organisation gehadert hatte, weil ihm die Führung zu konservativ, zu mutlos und zu elitär gewesen war, schätzte Nixon. Doch dessen Frauenbild hinkte der Zeit hinterher. Leider war sein Nachfolger Matthews keinen Deut fortschrittlicher.
»Frauen gehören in die Küche«, sagte Nixon und zwinkerte dabei Rosa zu. »Zumindest dachte ich das, bis mich eine gewisse Mrs Parks vom Gegenteil überzeugt hat.« Er lächelte entwaffnend.
Rosa entspannte sich. Sie mochte und respektierte Nixon. Auch wenn seine verstaubte Art manchmal an ihren Nerven zerrte, bewiesen Gespräche wie dieses, dass es richtig war, die NAACP nicht nur den Männern zu überlassen. Wenn Nixon sein Frauenbild über die Jahre hatte ändern können, dann konnten das auch die anderen. Und nur dann war gewährleistet, dass die Organisation auch in Zukunft für die Rechte aller Schwarzen eintreten würde.
Parks warf Rosa einen wissenden Blick zu und verdrehte verschmitzt die Augen. Wie so oft spürte sie in diesem Moment die Liebe, die sie für ihn empfand. Über zwanzig Jahre waren sie jetzt schon verheiratet, sie kannten einander durch und durch. Diese kleine Geste, mit der er ihr zeigte, dass er wusste, was ihr durch den Kopf ging, und, viel wichtiger noch, dass er hinter ihr stand, gab ihr Halt und bestätigte sie in ihrem Vertrauen darauf, dass die Welt fähig war, sich zum Besseren zu verändern. Denn obwohl auch Parks schon in seiner zweiten Lebenshälfte angekommen war, hatte er keine Angst vor starken Frauen.
»Na, worüber diskutiert ihr euch die Köpfe heiß?« Jo Ann Robinson trat plötzlich neben sie. Als Vorsitzende des WPC – des Women’s Political Council – hatte Jo Ann in den letzten Jahren viel bewegt. Sie war Englischdozentin am Alabama State College und wohnte auch in dessen Nähe, südlich vom Oak Park. In ihrem schlichten, aber feinen Kostüm schien sie direkt von der Arbeit gekommen zu sein. Mit ihren hohen Wangenknochen, den kleinen Augen und dem schmalen Mund wirkte es meistens so, als lächelte sie.
»Mrs Robinson«, sagte Nixon feierlich. »Schön, Sie mal abseits von irgendwelchen Verhandlungstischen zu sehen.«
Jo Ann hob die Augenbrauen. »Ich hoffe, Sie haben mich nicht nur hergerufen, um Ihrem Rivalen eins auszuwischen.«
Nixon schaute sich nach Matthews um und grinste schief. »Wäre es so, hätten Sie das sicherlich durchschaut und wären nicht gekommen.«
»Nur wenn ich Ihren Absichten so viel Bedeutung beimessen würde wie unseren Zielen. Das WPC hat nach allem, was geschehen ist, Redebedarf.«
»Falls Sie in die NAACP eintreten wollen, könnten Sie …«
»Netter Versuch, Mr Nixon, aber für