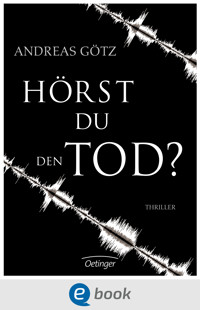9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Karl-Wieners-Reihe
- Sprache: Deutsch
München 1955. Zwischen Aufschwung, Fortschrittsglauben und neuen Feindbildern geraten drei Menschen ins Visier eines mächtigen Gegners – der zweite Band der 1950er-Jahre-Trilogie um den Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und den Privatdetektiv Ludwig Gruber Im Sommer 1955 arbeitet der Journalist Karl Wieners an einer Reportage über Emigranten in München. Seine Nichte Magda ist als Fotografin dabei und freundet sich mit der jungen Agota aus Litauen an, die Karl merkwürdig vorkommt, ohne dass er sagen könnte, weshalb. Und sie ist nicht die Einzige, die Karl und Magda Rätsel aufgibt. Zur gleichen Zeit versucht der Privatdetektiv Ludwig Gruber den angeblichen Selbstmord eines Jugendlichen aufzuklären. Doch womit er es wirklich zu tun hat, ahnt er erst, als sich Verbindungen zu Karls und Magdas Recherche ergeben. Noch bevor sie alle die genauen Zusammenhänge begreifen, geht in einem Schwabinger Postamt eine Paketbombe hoch und tötet zwei Menschen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Götz
Die Nachtigall singt nicht mehr
Kriminalroman
Kriminalroman
Über dieses Buch
München 1955. Der Journalist Karl Wieners arbeitet an einer Reportage über Emigranten in München. Seine Nichte Magda ist als Fotografin dabei und freundet sich mit der jungen Agota aus Litauen an, die Karl merkwürdig vorkommt, ohne dass er sagen könnte, weshalb. Und sie ist nicht die Einzige, die Karl und Magda Rätsel aufgibt.
Zur gleichen Zeit versucht der Privatdetektiv Ludwig Gruber den angeblichen Selbstmord eines Jugendlichen aufzuklären. Doch womit er es wirklich zu tun hat, ahnt er erst, als sich Verbindungen zu Karls und Magdas Recherche ergeben. Noch bevor sie alle die genauen Zusammenhänge begreifen, geht in einem Schwabinger Postamt eine Paketbombe hoch und tötet zwei Menschen ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ursprünglich wollte Andreas Götz seine Kriminalromane in der Nazi-Zeit ansiedeln. Doch bei der Recherche wurde ihm schnell klar, dass sich die 1950er Jahre viel besser eignen. Ein gesellschaftliches Klima von Schuld, Verdrängung und Selbstbetrug, wie es in dieser Zeit herrschte, bringt alle Voraussetzungen mit, die ein fesselnder Roman braucht. Der Handlungsort München hat sich nicht zuletzt deshalb aufgedrängt, weil Andreas Götz ganz in der Nähe als freier Autor lebt und arbeitet und daher Land und Leute gut kennt. »Die Nachtigall singt nicht mehr« ist nach »Die im Dunkeln sieht man nicht« der zweite Band in der 1950er-Jahre-Trilogie um den Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und den Privatdetektiv Ludwig Gruber.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 Andreas Götz
Für diese Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Zitate auf S. 247 und 320 stammen aus Françoise Sagan: Bonjour Tristesse. Übersetzung von Helga Treichl. Edition Büchergilde, Frankfurt am Main/Wien/Zürich 2011, S. 81 und 155. © der deutschen Textfassung: 1955, 2005 by Ullstein Verlag, Berlin.
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Coverabbildung: Vintage Germany und Shutterstock
Redaktion: Ilse Wagner
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490579-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die wichtigsten handelnden Personen
Dienstag, 5. Juli 1955
München
Freitag, 15. April 1955
New York City
München
New York City
Samstag, 16. April 1955
München
New York City
München
Mittwoch, 20. April 1955
M.S. »Berlin«
München
Samstag, 23. April 1955
Montag, 25. April 1955
Mittwoch, 27. April 1955
Samstag, 30. April 1955
Sonntag, 1. Mai 1955
Montag, 2. Mai 1955
Donnerstag, 5. Mai 1955
Freitag, 6. Mai 1955
Samstag, 7. Mai 1955
Montag, 9. Mai 1955
Freitag, 13. Mai 1955
Donnerstag, 19. Mai 1955 Christi Himmelfahrt
Freitag, 20. Mai 1955
Samstag, 21. Mai 1955
Samstag, 28. Mai 1955
Pfingstsonntag, 29. Mai 1955
Pfingstmontag, 30. Mai 1955
Montag, 6. Juni 1955
Mittwoch, 8. Juni 1955
Donnerstag, 9. Juni 1955 Fronleichnam
Dienstag, 14. Juni 1955
Freitag, 17. Juni 1955 Tag der deutschen Einheit
Montag, 20. Juni 1955
Mittwoch, 22. Juni 1955
Samstag, 25. Juni 1955
Sonntag, 26. Juni 1955
Dienstag, 28. Juni 1955
Freitag, 1. Juli 1955
Dienstag, 5. Juli 1955
Mittwoch, 6. Juli 1955
Donnerstag, 7. Juli 1955
Freitag, 8. Juli 1955
Samstag, 9. Juli 1955
Montag, 11. Juli 1955
Dienstag, 12. Juli 1955
Freitag, 15. Juli 1955
Montag, 18. Juli 1955
Mittwoch, 20. Juli 1955
Nachwort
Die wichtigsten handelnden Personen
Karl Wieners, ambitionierter Schriftsteller und Journalist.
Gisela, die Frau, mit der Karl in einer sogenannten »Onkelehe« lebt.
Magda Blohm, die Frau, die er liebt und die seine – vermeintliche – Nichte ist.
Peter, genannt Peterle, Magdas vierjähriger Sohn.
Walter Blohm, Magdas Ehemann, reicher Bauunternehmer mit Vergangenheit und vielen Leichen im Keller.
Veit Wieners, Karls jüngerer Bruder und Nachtclub-Besitzer in Schwabing, der mit Magda ein Geheimnis teilt.
Georg »Schorsch« Borgmann, Chefredakteur des Wochenmagazins Blitzlicht, für das Karl schreibt.
Inge Borgmann, Georgs Frau und zugleich Giselas Schwester.
Ludwig Gruber, Privatdetektiv, Witwer und Vater von Martin, neun Jahre alt, und Hermann, sieben Jahre alt.
Traudl, Ludwigs Verehrerin und Haushaltshilfe, die gern die neue Frau Gruber wäre.
Elvira Skudelny, kratzbürstige Sekretärin aus Ludwigs Bürogemeinschaft.
Zöllner, ehemaliger Polizeikollege.
Hans Daxenhofer, entweder ein Kriegsheimkehrer mit Erinnerungslücken oder ein russischer Spion.
Rosi Daxenhofer, seine loyale Frau.
Rudi Daxenhofer, ihr zehnjähriger Sohn, der nicht glaubt, dass Hans sein echter Vater ist.
Ferdl Daxenhofer, Rudis abgöttisch geliebter, siebzehn Jahre alter Bruder.
Tomáš Čierny, slowakischer Exilpolitiker mit verdeckten Aktivitäten, die ihm zum Verhängnis werden.
Agota Vanagaitė, seine junge litauische Assistentin.
Dienstag, 5. Juli 1955
München
Als Tomáš Čierny das Postamt betrat, ahnte er nicht, dass er auf dem Weg zu seiner Hinrichtung war. Die große Uhr hinter den Schaltern zeigte elf Minuten vor drei, ihm blieben noch acht Minuten zu leben, von denen er zwei damit verbrachte, sein gemietetes Fach aufzusuchen, die Tagespost herauszunehmen und flüchtig durchzusehen. Obenauf hatte ein Zettel mit dem Hinweis gelegen, dass am Schalter zwölf noch eine eingeschriebene Sendung auf Abholung wartete. Er glaubte zu wissen, woher die Sendung kam, und hielt es fälschlich für Glück, dass am Schalter zwölf niemand anstand und er so keine Zeit verlor. Unverzüglich legte er dort den Zettel und seinen Reisepass vor. Da er an jedem Werktag hierherkam, war er bekannt und der Ausweis eigentlich überflüssig. Um der Vorschrift zu genügen, warf der Beamte dennoch einen flüchtigen Blick hinein und verschwand dann in den Raum nebenan. Čierny schaute auf die Uhr. Sieben Minuten vor drei. In Gedanken war er schon bei dem Treffen mit Walter Blohm, zu dem er allerdings ebenso wenig erscheinen würde wie um acht Uhr abends am slowakischen Stammtisch.
Der Schalterbeamte kehrte mit einem Päckchen zurück. »Wenn das Kekse sind, dann ziemlich gehaltvolle«, scherzte er hinter der Glasscheibe und schob die Empfangsbestätigung durch die Luke.
»Kekse wären schön«, antwortete Tomáš Čierny in seinem fast makellosen Deutsch, unterschrieb den Zettel und erhielt im Gegenzug das Päckchen. Es hatte wirklich die Größe und Form einer handelsüblichen Keksschachtel, war mit einer Briefmarke und einer Notopfer-Berlin-Marke beklebt und schwerer, als man erwarten würde. Die ungleichmäßig gezogene Handschrift, in der die Adresse auf das Packpapier geschrieben war, ließ Čierny kurz stutzen, denn er hatte sie noch nie auf einer der Sendungen aus Frankfurt gesehen. Doch der Absender in der linken oberen Ecke beruhigte ihn fürs Erste: Čierny Rechtsanwalt. Tomáš Čierny hatte zwar keinen Verwandten in Frankfurt, doch er wusste, wer sich hinter dieser Angabe verbarg. Oder nahm es zumindest an. Sicher würde er erst sein, wenn auch die Parole stimmte.
Čierny glaubte, er habe alle Zeit der Welt, um sich dessen gleich hier im Postamt zu vergewissern. Blohm erwartete ihn schließlich erst um halb vier. Mit einer leicht nervösen Unruhe im Bauch trat er an eines der beiden Schreibpulte in der Mitte der Halle, riss das Packpapier auf und las auf dem Karton den Satz: Die Nachtigall singt nicht mehr. Er atmete auf. Nur eine Handvoll vertrauenswürdiger Personen aus seinem engsten Umkreis kannte die Parole, die sich zudem alle paar Tage änderte. Neugierig, was man ihm aus Frankfurt schickte – technisches Gerät? Pässe? –, wollte er wenigstens einen kurzen Blick in das Päckchen werfen.
Während er den Deckel anhob, war ihm, als nähere sich jemand, er blickte hastig auf, und in der Tat: Dieser Journalist Karl Wieners kam schnurstracks auf ihn zu. In dem Moment, in dem er ihn erkannte, schoss aus dem Innern der Schachtel eine Stichflamme empor, und im nächsten verwandelte sich das Postamt in einen Ort des Schreckens, wie München ihn seit dem Ende des Bombenkriegs nicht mehr gesehen hatte …
Freitag, 15. April 1955
TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN.
Wie ein spiessbürgerliches Menetekel leuchtete der gestickte Sinnspruch in seinem Silberrahmen auf, als der Lichtschein eines vorbeifahrenden Autos über die Wand wischte. Ludwig konnte kaum glauben, dass er im Dunkeln durch eine fremde Wohnung tapste wie ein Einbrecher. Wobei er genau das war: ein Einbrecher. Denn so nannte man für gewöhnlich jemanden, der mit einem Sperrhaken fremde Türen öffnete, um mit einer Taschenlampe nach gewissen Wertsachen zu suchen. Der einzige, wenn auch entscheidende Unterschied bestand darin, dass er nicht vorhatte, diese Wertsachen zu stehlen.
Es dauerte nicht lange, bis er fündig wurde. In einer Vitrine standen die kleinen, pausbäckigen Kinderfiguren aus Porzellan aufgereiht, die meisten allein, andere zu zweit oder zusammen in kleinen Gruppen. Die Mädel mit neckischen Kleidchen, die Buben in Lederhosen und karierten Hemden. Hummelfiguren. Ludwig hatte nie verstanden, was der Reiz an diesem Kitsch war. Er holte das Heft mit den Katalogabbildungen aus der Tasche und glich sie mit den Figürchen im Schrank ab. Der Skifahrer. Der Bub, der über einen Zaun klettert. Das Mädel mit dem Korb. Brüderchen und Schwesterchen Arm in Arm. Schließlich der Apfeldieb.
Ludwig hatte genug gesehen. Er verließ die Wohnung auf dem Weg, auf dem er gekommen war. Im Treppenhaus kam ihm ein ältliches Paar entgegen, er zog den Hut, wünschte einen guten Abend und ging weiter. Erleichtert hörte er schließlich die Haustür hinter sich ins Schloss fallen.
Eine Böe klatschte ihm Schneeregen ins Gesicht. Der April wurde dieser Tage seinem Ruf mehr als gerecht. Nach sonnigem, mildem Osterwetter zeigte er sich nun nass, windig und kalt. Ludwig zog den Hut tiefer in die Stirn und den Mantelkragen zusammen. Über den Dächern schlug eine Kirchturmuhr zehn. Zur Trambahnhaltestelle brauchte er von hier ungefähr fünf Minuten. Bis er zu Hause war, war es Viertel vor elf. Die Buben würden schon schlafen. Hoffentlich.
Die Hände in die Manteltaschen vergraben, den Kopf tief gesenkt, lief er weiter. Er solle ihn anrufen, wenn er etwas herausgefunden habe, hatte Rosen gesagt. Egal, wie spät es sei. Zu wirklich jeder Tages- und Nachtzeit. Der Mann litt. Das war deutlich zu sehen. Und auch wenn es auf den ersten Blick lächerlich wirkte, konnte man es verstehen, wenn man sich nur ein bisschen in ihn hineindachte. Rosen war Jude und mitsamt seiner Familie nicht mehr rechtzeitig aus Deutschland hinausgekommen. Wie auch und wohin, als kleiner Volksschullehrer ohne jede Verbindung ins Ausland. Bevor sie alle ins Lager gebracht wurden, hatte er seinem Nachbarn Matthias Rauberger, den er als einen verlässlichen Menschen und keinesfalls glühenden Nazi kannte, die Hummelfiguren anvertraut. Zur Aufbewahrung. Alles, alles hatte Rosen verloren: Frau, Kinder, Besitz; eingetauscht, wie er selbst sagte, gegen einen gestreiften Anzug aus Sackleinen. Nur die Hummelfiguren, an denen das Herz seiner Frau so sehr gehangen hatte, waren ihm geblieben. Als er sie nach dem Krieg von Rauberger zurückverlangte, weigerte sich der, sie ihm zu geben. Erst behauptete er, sie seien ein Geschenk gewesen, doch als Rosen nicht lockerließ, hieß es auf einmal, sie seien in den Wirren des Krieges verlorengegangen. Genau so hatte es der Maurermeister Rauberger ausgedrückt: in den Wirren des Krieges. Als seien die Amerikaner bei der Einnahme Münchens mitten durch seine gute Stube marschiert. Dabei war das gesamte Haus völlig unbeschadet durch alle Bombennächte gekommen und nach der Kapitulation nicht einmal für einen Tag requiriert worden. Keine Polizeidienststelle, kein Amt, kein Gericht wollte sich Rosens Sache annehmen. Nicht zuständig, zu niedriger Streitwert, zu geringfügig die Angelegenheit im Ganzen. Als ginge es dem Mann wirklich bloß um die paar kitschigen Porzellanfigürchen. Alles, was er zu hören bekam, war, dass er die Vergangenheit ruhenlassen und nach vorn schauen solle. Oder wie Rauberger es ausgedrückt habe: »Hängen Sie sich nicht an den alten Zeiten auf.« Woraufhin Rosen ihm angeblich erwidert hatte, es wäre ihm, Rauberger, sicherlich lieber, er würde sich, statt an der Vergangenheit, an einem Dachbalken aufhängen, denn dann wären die Scherereien mit dem lästigen Juden ein für alle Mal erledigt.
Vom Rumpeln einer Straßenbahn aufgeschreckt, schaute Ludwig hoch und erblickte hinter einem Schleier aus Schneeregen das Haltestellenschild. Er fing besser an zu rennen, wenn er die Tram noch kriegen wollte. Manche der Fahrer machten sich einen Jux daraus, einem die Tür vor der Nase zu schließen und frech bimmelnd davonzufahren. Der hier bewies zum Glück Anstand. Ludwig konnte gerade noch reinspringen. Er löste bei der Schaffnerin eine Fahrkarte und fiel auf einen leeren Sitz. Erschöpft nahm er den Hut ab, wischte sich mit der Hand den Regen aus dem Gesicht. Nach Hause. Er wollte nur noch nach Hause. Bei allem Verständnis für Rosens Lage, er würde ihn heute nicht mehr anrufen. Ein paar Stunden früher oder später sollten keine Rolle spielen. Auch ein Privatdetektiv hatte schließlich irgendwann Feierabend.
New York City
Sollte sie nicht doch lieber das etwas jugendlichere Kleid anziehen? Kritisch betrachtete Magda ihr Spiegelbild. Blohm schwärmte, das Kostüm habe Klasse und stehe ihr ausgezeichnet. Für ihren Geschmack war es ein wenig bieder, Chanel hin oder her. Dazu auch noch der Hut. Damenhüte fand sie meistens nur albern und diesen ganz besonders. Hier in den States begegnete man dem Kostüm allerdings öfter, zumindest in gewissen Kreisen. Kreisen, zu denen Blohm Anschluss suchte und zunehmend auch fand. Geld öffnete Türen.
Magda schaute auf die Uhr. Kurz vor halb fünf. Sie musste sich beeilen, wenn sie rechtzeitig am Times Square sein wollte. Zu dumm, dass Simon nicht eher Zeit gehabt hatte. Blohm würde sie um halb acht zum Dinner mit neuen Freunden abholen. Bis dahin musste sie zurück im Hotel sein, damit er keinen Verdacht schöpfte. Und das durfte er auf keinen Fall. Auch wenn es fünf Jahre her war und er all die Zeit kein Wort mehr darüber verloren hatte, wusste Magda, dass Simons Verrat weder verziehen noch vergessen war. Denn Verrat verzieh Blohm niemals. Wobei sie nicht einmal wusste, worin Simons Verrat genau bestand. Weil es zeitlich knapp werden konnte, behielt sie das Kostüm an und setzte sogar den dämlichen Damenhut auf. Im Gehen nahm sie noch die lederne Kameratasche mit ihrer Agfa Silette vom Garderobentischchen, hängte sie sich um und verließ das Zimmer.
Elegant, mit maßvollem Hüftschwung, schritt sie den Hotelflur hinab zum Fahrstuhl, sagte zum Liftboy ihr übliches »reception, please«, woraufhin dieser sein übliches »yes, ma’am« hören ließ. Am Empfang gab sie den Schlüssel ab und sagte zu dem Herrn auf der anderen Seite des blank polierten Tresens in fast makelloser Aussprache: »If Mr. Blohm returns early, please tell him, that I’m out for a walk. I will be back on time for dinner.«
»Very well, Mrs. Blohm. Have a nice walk.«
Magda drehte sich um und bemerkte nur noch aus dem Augenwinkel, wie sich ein Gentleman in einem schwarzen Anzug abrupt von ihr wegdrehte und so tat, als studiere er die riesige Uhr in der Mitte des Foyers, die freilich eine Sehenswürdigkeit war. Mit erhobenem Kinn marschierte sie an ihm vorbei zum Ausgang Lexington Avenue.
Magda genoss nichts so sehr wie den Moment, wenn sie durch die breiten Türen aus der europäisch anmutenden Gediegenheit des Waldorf Astoria hinaustrat und beinahe schlagartig erfasst wurde von der energiegeladenen, schrillen Gegenwart der Stadt. Einer Gegenwart ohne Vergangenheit, dafür bis zum Platzen gefüllt mit Zukunft. Autos groß wie Schiffe auf mehrspurigen Avenues, in denen es nach Asphalt, Abgasen und Meer roch. Menschen, immer in Eile, ohne Zeit für Rücksichten und Höflichkeiten. Ein an- und abschwellender, aber niemals endender Strom, in dem man entweder mitschwamm oder ertrank.
Als ein Hotelboy ein Taxi heranwinken wollte, lehnte sie dankend ab. Der kleine Fußweg zum Times Square würde ihr guttun. Und vielleicht würde sie auf das eine oder andere lohnende Fotomotiv stoßen. Es war ja leicht zu finden. Nur eine Straße überqueren, in die nächste – die siebenundvierzigste – rechts einbiegen und dann immer geradeaus bis zur Seventh Avenue. Dort an der Ecke wartete Simon auf sie. Ob er sie in diesem Aufzug überhaupt erkannte?
Nach wenigen Schritten kam ihr der Verdacht, dass jemand ihr folgte, und ein vorsichtiger Blick über die Schulter ergab, dass es der Gentleman im schwarzen Anzug war, der ihr schon im Foyer aufgefallen war. Sie blieb stehen, öffnete die Objektivabdeckung ihrer Kameratasche und tat so, als wolle sie etwas fotografieren. Der Mann blieb auch stehen und zündete sich eine Zigarette an, wobei er ihr den Rücken zudrehte. Mist, dachte sie. Vielleicht ein Aufpasser, den Blohm für sie engagiert hatte. Was sollte sie jetzt machen? Wie konnte sie ihn abschütteln?
Der Mann hatte seine Zigarette angezündet und ging nun zügig weiter. An ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Magda wartete noch ein wenig, dann setzte sie ihren Weg fort, ließ ihn jedoch nicht aus den Augen. Obwohl das eigentlich unnötig war, denn wie sollte der Mann sie beschatten, wenn er vor ihr herlief? Immerhin, sie schienen fürs Erste denselben Weg zu haben, denn er bog ebenfalls in die siebenundvierzigste Straße ein. Vielleicht musste er auch zum Times Square. Dachte sie. Doch dann war er plötzlich weg. Zumindest sah sie ihn nicht mehr. Und war fast ein wenig traurig darüber, so als habe sich ein neuer Bekannter gerade in dem Moment verabschiedet, in dem er interessant zu werden begann.
Magda beschleunigte nun ihre Schritte. In ein paar Minuten würde sie am Treffpunkt sein. Mit einer Verspätung, die einer Frau in einem sündhaft teuren Chanel-Kostüm allerdings auch zustand.
»Hey, Sie, schöne Lady«, rief plötzlich jemand hinter ihr, »nicht so schnell! Und vielleicht kaufen Sie sich mal eine Brille!«
Magda drehte sich um. Erst mit einer gewissen Verzögerung fiel ihr auf, dass sie auf Deutsch angesprochen worden war. Sie erschrak. Es war der Mann aus der Hotelhalle. Und noch einmal brauchte sie ein wenig, bis der Groschen fiel: »Simon!«
»Ja, verdammt, ich dachte schon, du kennst mich nicht mehr!«
So, wie er vor ihr stand, in seinem blitzsauberen Anzug mit Krawatte und dem akkurat gescheitelten Haar, war er ja auch kaum wiederzuerkennen, der Münchner Bursche von früher, mit dem sie das eine oder andere Schwarzmarktgeschäft abgewickelt hatte. Ein richtiger Gentleman war aus ihm geworden, ein Amerikaner wie aus dem Bilderbuch. Nur die Augen, die waren noch genauso frisch und frech wie früher.
Sie boxte ihn in die Schulter. »Depp! Was soll der Unfug! Schleichst um mich rum wie ein Taschendieb.« Dann schlang sie ihm beide Arme um den Hals. »Wie schön, dich zu sehen. Gut schaust du aus. Wie ein richtiger Mann!«
»Hast du mich deshalb nicht erkannt?«
Sie blinzelte. »Schon möglich. Warum hast du nicht wie verabredet am Times Square gewartet?«
»War mir zu fad.«
»Ach, du! Und auch noch ins Hotel kommen. Hast du keine Angst vor Blohm? Er bringt dich um, wenn er dich erwischt.«
»Du nennst ihn wirklich Blohm? Deinen Ehemann?«
»Hat sich so eingebürgert.«
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass du seine Frau bist. Und ein Kind von ihm hast.«
»Musst du ja auch nicht glauben, wenn du nicht willst.«
»Was soll das denn heißen?«
»Gar nichts. Wo gehen wir hin?«
Sie fanden nur einen Platz am Fenster des Diners. Eigentlich hätte Magda lieber einen Tisch im hinteren Bereich gehabt, aus Sorge, Blohm könne ihr jemanden nachgeschickt haben. Doch in dem Fall hätte derjenige sie und Simon längst gesehen, also war es auch egal.
»Hast du solche Angst vor deinem Mann?«, fragte Simon.
»Angst?« Sie winkte ab. »I wo. Einen besseren Ehemann als Blohm könnte ich mir nicht wünschen.«
»Aber einen anderen schon.«
Magda ignorierte die Bemerkung. »Ich habe eher Angst um dich. Mit dir hat Blohm schließlich noch eine Rechnung offen, nicht mit mir. Was war da eigentlich los? Warum bist du so überstürzt fort aus München? Ohne ein Wort. Und deine paar Briefe … also, ich will ja nicht rummeckern, aber …«
Simon packte sie am Handgelenk und drückte es so fest, dass es fast weh tat. »Schluss jetzt!« Er sah ihr tief und ernst, ja beinahe bedrohlich in die Augen. »Wir können gern über alte Zeiten plaudern. Nur nicht über diese Sache. Verstanden?«
»Okay«, sagte Magda auf gut Amerikanisch.
Simon entspannte sich wieder, ließ sich gegen die gepolsterte, mit rotem Leder überzogene Lehne der Sitzbank fallen und nahm Magdas Fotoapparat. »Ist das die Kamera, die ich dir damals in der Möhlstraße besorgt hab?«, fragte er.
»Nein, das ist eine Agfa Silette, die gibt’s erst seit letztem Jahr. Klein und handlich, recht praktisch für unterwegs. Aber die Kine-Exakta von dir hab ich natürlich noch.«
Simon legte die Kamera wieder hin. »Gibt’s die gute alte Möhlstraße noch?«
»Wenn du damit den Schwarzhandel meinst, nein, den gibt es nicht mehr. Noch im Herbst des Jahres, in dem du weg bist, hat die Polizei alle Händler hochgenommen und die Läden aufgelöst.«
Eine Bedienung kam an den Tisch, Simon bestellte einen Erdbeershake für Magda und für sich selbst einen Kaffee.
»Und wovon lebt ihr dann, Blohm und du?«
»Baugeschäft. Immobilien. Blohm ist ehrlich geworden.«
Simon lachte auf. »Im Baugeschäft? Kann ich mir schwer vorstellen. Nirgends geht’s korrupter zu. Aber dumm ist es nicht. Zu bauen gibt’s bei euch genug.«
»Da sagst du was. München ist eine einzige Baugrube. Und wie schnell alles geht. Bis du schaust, steht schon wieder ein Mietshaus fertig da.«
»Und du? Was machst du?«
»Bilder. Ich fotografiere viel.«
»Soso. Immer noch für deinen Onkel?«
Die Erwähnung Karls genügte schon, um ihr den wohlvertrauten feinen Stich zu versetzen. »Kaum«, sagte sie. »Ich mache eigene Sachen. Porträts hauptsächlich. Mich interessieren Menschen.«
»Wie geht’s ihm denn, deinem Onkel? Schreibt er immer noch für diese … was war das noch mal? Eine Zeitung? Ein Magazin?«
»Er schreibt für unterschiedliche Abnehmer Beiträge. Vor allem aber Romane und Drehbücher. Ist wieder ganz gut im Geschäft. Stell dir vor, für einen Roman hat er Anleihen aus meinem Leben genommen. Trümmermädchen. Hat sich wohl ganz gut verkauft. Drum will er jetzt, dass es verfilmt wird. Ob daraus was wird …« Sie lachte in verlegenem Stolz.
»Seh schon, es hat sich alles wieder eingespielt. Good old Germany läuft wieder wie geschmiert.«
Magda hörte den sarkastischen Unterton sehr wohl heraus. Und er war ja auch berechtigt. Von den Nazis und ihren Gräueln las man zwar noch in den Zeitungen, es gab reichlich Bücher und Sendungen im Hörfunk dazu, aber die Leute lebten trotzdem in einer Selbstzufriedenheit, als ginge sie das alles nichts an.
»Und du«, fragte sie, »was machst du? Wie geht es dir?«
»Kann nicht klagen. Obwohl ich eigentlich nur ein Laufbursche bin, wie damals bei Blohm, nur besser bezahlt. Sehr viel besser.«
»In welcher Branche?«
Die Bedienung kam mit einem Tablett an den Tisch, auf dem der Milchshake und der Kaffee standen. Sie stellte beides ab.
»Dienstleistungen aller Art«, antwortete Simon mit Verzögerung auf Magdas Frage.
Das klang merkwürdig vage. Bestimmt wollte er nicht darüber reden, weil seine Dienstleistungen nicht ganz legal waren. So wie damals bei Blohm.
Simon pustete auf seinen Kaffee und nahm einen Schluck, dann fragte er: »Wie gefällt dir Amerika?«
»Großartig. Am liebsten würde ich für immer hier leben!«
»Dann mach es doch einfach. Nimm deinen Sohn, verlass Blohm und fang hier neu an.«
Für einen Moment gab sie sich dem Gedanken hin, sie könne das wirklich tun. Einfach so. Doch rasch holte die Wirklichkeit sie ein. Zu vieles verband sie mit Deutschland. »Ich fürchte, das ist nicht so leicht«, sagte sie.
»Ach was. Alles geht. Das hier ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten!«
»Schon. Aber du weißt auch, dass Verträge mit Blohm auf Lebenszeit geschlossen sind.«
»Na und? Ich bin doch auch hier. Und geht es mir schlecht?«
Magda sah ihn an. Nein, schlecht schien es ihm nicht zu gehen.
München
»Sauwetter!«, schimpfte Karl beim Anblick der dicken, nassen Kleckse auf den Fensterscheiben, die der Fahrtwind sofort quer über das Glas in die Länge zog wie durchsichtige Spagetti. Dahinter eine verwaschene Gouache des nächtlichen Münchens. Nur im Innern des Abteils war noch etwas von der südländischen Wärme aufbewahrt, aus der sie kamen. Doch nicht mehr lange, dann würde auch dieser letzte Rest entweichen und die teutonische Kälte in den Kurswagen der deutschen Bundesbahn Einzug halten.
Gisela saß Karl gegenüber, eine Straßenkarte von Norditalien auf dem Schoß. Mit dem Finger fuhr sie die Route nach, die ihre Rundreise genommen hatte, und flüsterte an jeder Station den italienischen Namen der Stadt: »Venezia, Firenze, Pisa, Roma, Siena, Milano.« Sie schaute auf. Die südliche Sonne hatte ihre Haut leicht gebräunt und ihr blondes Haar noch ein wenig mehr aufgehellt. Es stand ihr gut, das musste er zugeben. »Ostern in Rom«, sagte sie selig. »War das nicht ein einmaliges Erlebnis? Der Segen des Heiligen Vaters. Urbi et orbi. Der Stadt und dem Erdkreis.«
Wenn der wüsste, was er da alles gesegnet hat, dachte Karl mürrisch. Aber der Heilige Vater war wohl, wie seine gesamte Kirche, im Zweifel weniger dogmatisch, sondern eher pragmatisch. Genau wie Gisela, die, obwohl gut katholisch und beflissene Kirchgängerin, die staatlichen Segnungen einer Oberleutnantswitwenrente dem kirchlichen Ehesegen vorzog.
»Was bist du denn so grantig?« Sie neigte sich vor und nahm Karls Hand. »Immer noch wegen dem Anruf von Desch? Lass dir doch von dem nicht die Laune vermiesen.«
Karl brummte nur, ließ sich gegen die Lehne fallen und schaute wieder aus dem Fenster. Gisela schüttelte den Kopf wie über einen bockigen Jungen und faltete die Karte auf ihrem Schoß zusammen. Zu gern hätte er jetzt eine Zigarette geraucht, doch bei geschlossenen Fenstern erlaubte es Gisela nicht, und auf den Gang wollte er sich nicht stellen.
Es war nicht nur die Sache mit seinem Verleger Desch, die an seinen Nerven zerrte. Obwohl es ein Zeichen von grobem Undank und Illoyalität war, den Erscheinungstermin des neuen Romans mit fadenscheinigen Gründen ins Frühjahr zu verschieben und ihn so um die Einnahmen aus dem Weihnachtsgeschäft zu bringen. Ein paar Tage davor hatte ihm Filmproduzent Silbermann signalisiert, dass er für das Drehbuch zu dem Film über den Reichstagsbrand nun doch lieber einen richtigen Journalisten als Autor engagieren wolle, der mehr Erfahrung mit politischen Stoffen hatte. Äußerst ärgerlich, das alles!
Karl warf einen Blick zu Gisela, die in ihrer Handtasche herumkramte, dann griff er nach seinen Zigaretten und schüttelte eine aus der Packung. Sie räusperte sich vernehmlich. »Wir sind eh gleich da«, brummte er und ließ sein altes Wehrmachtsfeuerzeug aufflammen. Tief sog er den Rauch in die Lungen. Entspannt sank er zurück in den Sitz.
»Wir zwängen uns mit den Koffern aber nicht in die Trambahn, oder?«, fragte Gisela, die allmählich anfing, ihre Sachen zu ordnen und einzupacken. »Wir genehmigen uns eine Taxe.«
Karl wünschte, es wären wirklich die Querelen um Desch und Silbermann gewesen, die ihn so nervös und übellaunig aus dem sonnigen Süden ins nasskalte München zurückkehren ließen. Aber es war etwas anderes, das ihn aufbrachte. Jemand anderes. Und schließlich konnte er auch nicht mehr umhin, es auszusprechen, es brach förmlich aus ihm heraus: »Ist doch nicht zu fassen, wie eine Mutter es fertigbringt, ihren Sohn wochenlang allein zu lassen. Wie herzlos muss eine Frau sein?«
Gisela hielt in ihrem Herumkramen inne und schaute ihn an. Verständnislos. Betroffen.
»Also hör mal«, protestierte sie. »Benno ist sechzehn, und dem geht’s bei seiner Tante Inge eher zu gut als zu schlecht. Dem kann ich gar nicht lange genug weg sein.«
»Ich rede doch nicht von Benno und dir, sondern von Magda und Peter. Sechseinhalb Wochen Amerika! Das finde ich ganz schön übertrieben. Großkotzig, ums auf den Punkt zu bringen.«
Giselas Miene wurde abweisend. »Ich glaube nicht, dass Peterle sie groß vermisst«, sagte sie kühl. »Dem wird kaum auffallen, dass sie nicht da ist. Er sieht doch auch sonst das Kindermädchen öfter als die Mutter. Überhaupt, ein Kindermädchen. Als hätte sie viel zu tun. Wer ist sie? Eine Baroness?«
Sie ist Walter Blohms Frau, dachte Karl, sagte aber lieber nichts mehr. Er hatte ohnehin schon zu viel gesagt. Sonst kam noch heraus, dass er sich gar nicht um Peter sorgte. Sondern dass er derjenige war, der Magda vermisste. So sehr, wie man einen anderen Menschen nur vermissen konnte. So sehr, dass es weh tat.
New York City
Mit großen Augen betrachtete Magda die Leuchtreklame am Times Square, dem sich das Taxi gerade näherte. Wohin man auch schaute, überall blinkte und glänzte es wie in einem bizarren Traum. Wenn Peterle das sehen könnte, dachte sie, der würde sich überschlagen vor Glück. Wo er doch schon wegen des weihnachtlichen Lichterschmucks in der Kaufingerstraße ganz außer sich geraten war. Peterle. Wie lange hatte sie nicht mehr an ihn gedacht? Viel zu lange. Sie schämte sich vor sich selbst.
»Morgen geh ich einkaufen«, sagte sie zu Blohm. »Oder hast du andere Pläne für uns?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich brauche Spielsachen für Peterle. Schöne Spielsachen. Und ganz viele.«
»Kauf, was dir gefällt. Auch für dich.« Er schwieg einen Moment, dann fügte er hinzu: »Du warst wundervoll heute Abend. Alle waren hingerissen von dir.«
Magda lächelte verlegen.
»Ich am allermeisten.«
Blohm legte ihr die Hand aufs Knie. Schwer lastete sie dort. Langsam schob er sie auf die Innenseite ihres Schenkels und ließ sie nach oben wandern. Die kurzen gepflegten Finger wie Füße eines Tierchens. Sein Atem ging schwer und roch nach Alkohol.
Im Rückspiegel glänzten die Augen des Taxifahrers, ein Zahnstocher bewegte sich in seinem Mundwinkel auf und ab.
»Nicht, Walter«, sagte Magda sanft wie zu einem übermütigen Kind, »du bist betrunken.«
»Ja, von dir.«
»Wohl eher von den Whiskeys nach dem Essen. Wie viele waren es? Vier? Fünf?«
»Ich will dich …«
»Du vergisst, wo wir sind.« Sie schob den Arm zurück auf die Seite, auf die er gehörte.
Blohm lachte. Aber es war kein heiteres Lachen. Magda zog den Saum ihres Rocks über die Knie und riskierte einen Seitenblick. Statuarisch wie ein kleiner Buddha saß er in dem von diffusem Außenlicht durchwirkten Halbdunkel des Wagens.
»Was waren das eigentlich für Leute, mit denen wir gegessen haben?«, fragte sie.
»Das weißt du doch«, antwortete er. »Hast du nicht zugehört?«
»Ihr habt immer wieder Slowakisch gesprochen. Worum ging es?«
»Geschäfte.«
»Krumme Geschäfte?«
Er schaute sie erstaunt an. »Was interessiert es dich?«
Sie wollte lieber nicht nachbohren und schwieg deshalb, doch dann sagte er auf einmal nebulös: »Wir haben alle unsere Geheimnisse und müssen manchmal Dinge tun, die wir nicht tun wollen, damit sie auch geheim bleiben. Gerade du müsstest das doch am besten wissen.«
»Ich? Wieso?«
»Du bist eine Frau voller Geheimnisse. Genau das macht dich so anziehend. Denn was wären wir schon ohne unsere Geheimnisse? Langweilige Spießer. So wie diese Amerikaner da draußen. Sieh sie dir an, in ihrer Anständigkeit. Sie glauben, sie seien zu keinem Verbrechen fähig. Und gerade deshalb sind sie zu jedem Verbrechen fähig.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du hattest wirklich mehrere Drinks zu viel, Blohm. Du musst dringend ins Bett.«
Der Fahrer bog so scharf rechts ab, dass Blohm auf Magdas Seite geworfen wurde. Oder sich gern auf ihre Seite werfen ließ. Sein Kopf lag an ihrer Schulter, seine Hand landete auf ihrem Schoß. »Hoppla!«, rief sie aus. »Nicht so stürmisch, junger Mann!« Es sollte scherzhaft klingen.
Sein Geruch nach Alkohol und Zigarre stach in ihrer Nase. Magda atmete nur noch ganz flach.
»Das ist gut«, schnaufte er. »Ich will dich. Will dich so sehr …«
Ihr war klar, dass sie ihn nicht noch eine Nacht würde abwehren können. »Ich dich auch«, log sie, »aber ich würde unser Hotelbett der Rückbank eines Taxis vorziehen.«
Er lachte und zog sich wieder auf seine Seite zurück. »Braves Mädchen. So anständig.«
Ihre letzte Hoffnung war, dass der Alkohol ihn bald ausknockte und sie so von seinen Zärtlichkeiten verschont bleiben würde.
Samstag, 16. April 1955
München
Ludwig stieg am Stachus aus der Tram und trat mitten hinein in das Verkehrschaos, das die Großbaustelle am Lenbachplatz seit ein paar Tagen verursachte. Stoßstange an Stoßstange standen die Autos, zwischen ihnen suchten Radfahrer und Fußgänger ihr Durchkommen, und weil die Autos die Schienen blockierten, kam auch die Tram nur im Schneckentempo voran. Es war ein einziges Bimmeln, Hupen und Schimpfen, das Ludwig so schnell wie möglich hinter sich ließ. Im Zickzackkurs überquerte er den Platz und stellte sich taub, wenn eine Hupe ihn von der Seite anblökte. In der Schützenstraße staute es sich auch, wahrscheinlich bis zum Hauptbahnhof. Und das sollte den ganzen Sommer über so bleiben. Prost Mahlzeit, dachte Ludwig bei der Vorstellung.
Vor dem Eingang zu dem Haus, in dem er ein Büro gemietet hatte, sah er einen jungen Burschen. Zehn Jahre alt, schätzungsweise. Er ging auf und ab, so als würde er sich nicht ins Haus trauen. Oder irgendwas aushecken. Man konnte heutzutage nicht mehr sicher sein. Die Jugend, oder zumindest ein Teil davon, geriet außer Kontrolle. Verwahrloste regelrecht. Immer wieder hörte und las man von Vandalismus und Rowdytum.
»Na«, sprach Ludwig den Burschen an, freundlich, aber auch ein wenig streng, damit er gleich merkte, dass er sich nichts herausnehmen konnte.
Das hatte er wohl auch nicht vor, er drehte sich weg und schlurfte in viel zu großen Stiefeln davon. Lausbub, dachte Ludwig. Aus einem unerfindlichen Grund tat ihm der Bursche leid. Vielleicht wegen der kleinen Füße in den großen Stiefeln.
Ein Blick auf die goldglänzende Messingtafel neben dem Eingang brachte ihn auf erhebendere Gedanken. Er hatte sie erst vor kurzem anbringen lassen, unterhalb der beiden Rechtsanwaltstafeln.
Ludwig Gruber
Private Ermittlungen aller Art
II. Stock.
Wenn Annerl das sehen würde, dachte er, die würde glatt der Schlag treffen.
Zu Ludwigs Überraschung wartete Rosen schon im Treppenhaus. Groß und hager, mit tiefliegenden Augen, den Hut in der Hand. Der würde in seinem Leben keinen Anzug mehr ausfüllen. »Entschuldigen Sie die Verspätung«, sagte Ludwig sofort.
»Sie sind nicht zu spät«, antwortete Rosen, »ich war zu früh.«
Ludwig hatte ihn gestern Nacht doch noch angerufen, ihm aber nur mitgeteilt, dass er die Hummelfiguren gesehen hatte und sie das weitere Vorgehen anderntags in seinem Büro besprechen würden. Halb zehn. Ludwig lugte auf seine Uhr. Es war zwanzig Minuten nach neun.
Er schloss auf und ging voraus, Rosen folgte. Sie gelangten in eine Diele, die an einer Doppeltür mit Milchglasscheiben endete. »Bitte einzutreten«, sagte Ludwig, schob die Milchglastüren auf, und sie gingen hinein. »Da können Sie Ihren Mantel aufhängen.« Ludwig deutete auf den Garderobenständer.
Eigentlich waren die Räume für eine Großkanzlei von Anwälten ausgelegt. Zwei große, ein kleineres Büro, ein Vorzimmer für alle. Das Fräulein, das wochentags hier saß, eine Elvira Skudelny, hatte an den Samstagen frei, weil sich auch die Anwälte freinahmen. Fräulein Skudelny arbeitete eigentlich nur für die großen Büros, die sie schließlich auch bezahlten, und guckte jedes Mal pikiert, wenn das kleine Büro sie um eine Gefälligkeit bat, was Ludwig stets ein diebisches Vergnügen bereitete. Er freute sich schon auf den Tag, an dem er genug verdiente, um das Fräulein mit in Dienst zu nehmen. Zurzeit allerdings war er froh, wenn sein Gewerbe über die Miete hinaus genug einbrachte, um über die Runden zu kommen.
Er führte Rosen in sein Büro, wies auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch. »Bitte. Kann ich Ihnen was anbieten? Einen Tee vielleicht?«
»Tee … ja … einen Tee könnte ich jetzt vertragen.«
Ludwig nahm den Topf, ging rüber zum Abort, füllte am Waschbecken Wasser ein und hängte, als er wieder zurück war, den schon ziemlich verkalkten Tauchsieder hinein. Es gab zwar auch eine kleine Küche, in der Fräulein Skudelny für die großen Büros Kaffee kochte, doch die war, wenn die Anwälte und das Fräulein freihatten, stets abgeschlossen, damit das kleine Büro sich nicht an den Vorräten vergriff. »Das dauert jetzt ein bisschen«, sagte er und ließ sich in den Bürostuhl fallen. Nach einer kurzen Pause setzte er an: »Wie ich gestern schon am Telefon sagte, war ich letzte Nacht in Herrn Raubergers Wohnung und habe die Figuren in einer Vitrine gesehen. Es gibt sie also noch, und er hat sie.«
»Und wie geht es jetzt weiter?«
»Das ist das Dumme bei der Sache: Wir können mit dieser Information nichts anfangen. Außer ich gebe zu, dass ich eingebrochen bin. Und das mach ich nicht, weil mich das meine Lizenz kostet. Da sind mir die Hände gebunden.«
»Dann sind wir am Ende.«
»Ich hab gesagt, dass mir die Hände gebunden sind. Aber ich kenne jemanden, der da freier ist. Wenn Sie wollen, fädle ich das ein.«
Rosen nickte.
»Das kostet allerdings was.«
Rosen räusperte sich gleich mehrfach und sagte dann: »Wegen Ihrem Honorar müssen wir eh noch mal reden. Es ist nämlich so …«
»Sagen Sie nichts.« Ludwig unterdrückte ein Seufzen. Er musste aufhören, Ermittlungen anzustellen, die nichts einbrachten. Andererseits saß er dann wenigstens nicht untätig im Büro herum, unter den spöttischen Blicken dieses Fräuleins im Vorzimmer. »Das regeln wir schon irgendwie«, sagte er. »Und wegen den anderen Ausgaben machen Sie sich keine Sorgen. Der Herr schuldet mir noch einen Gefallen, und er soll sich dann halt anderweitig schadlos halten. Ist eh nötig für die Tarnung, denn welcher Einbrecher klaut bloß Hummelfiguren?«
Rosen lächelte verhalten. Er hatte verstanden und nickte dankbar.
Ludwig hörte, wie hinter ihm das Wasser im Topf zu brodeln anfing. Er stand auf und wollte Tassen und Teebeutel holen, aber dann fiel ihm ein, dass der Tee ja ebenfalls in der Küche war. »Mist«, sagte er. »Ich kann Ihnen doch keinen Tee machen. Es ist alles weggeschlossen, und ich hab keinen Schlüssel.«
»Das macht nichts«, sagte Rosen. »Ich habe eh schon zu viel von Ihrer wertvollen Zeit beansprucht.« Er stand auf und streckte Ludwig über den Schreibtisch die Hand entgegen. »Vergelt’s Gott, Herr Gruber, für alles.«
Ludwig ergriff die Hand und hielt sie fest. »Nur noch eins zur Erklärung«, sagte er, »damit sie nicht denken, solche krummen Touren sind bei mir an der Tagesordnung. Normalerweise achte ich sehr auf Recht und Gesetz. Als ehemaliger Kriminaler. Aber in manchen Fällen steht das Recht gegen eine höhere Gerechtigkeit, und wenn die Sache so liegt, dann schlage ich mich auf die Seite der höheren Gerechtigkeit.«
»Da sind sie einer von wenigen.«
Ludwig ließ Rosens Hand los.
»Wenn es gelingt und Sie Ihre Figuren zurückbekommen haben, dürfen Sie aber nicht gleich aufhören, den Rauberger zu bedrängen. Sonst denkt er sich sofort, dass Sie hinter allem stecken, und zeigt Sie an. Und dass die ganze Sache unter uns bleibt, versteht sich hoffentlich von selbst.«
Rosen nickte. »Freilich. Und dem Saukerl geh ich mit Vergnügen weiter auf die Nerven. Auf Wiederschau’n, Herr Gruber. Und nochmals vielen Dank!«
Da kam Ludwig ein Gedanke. »Warten Sie mal, Herr Rosen. Sie sind doch Lehrer, oder?«
»War ich. Jetzt nicht mehr.«
»Aber einen einzelnen Buben könnten Sie doch wohl unterrichten. Wissen Sie, mein Ältester ist im Rechnen ein bisserl schwach. Dem würden ein paar Stunden Nachhilfe nicht schaden. Und dann könnten wir Ihre Stunden mit meinen verrechnen.«
»Das mach ich gern, Herr Gruber.«
Ludwig begleitete Rosen bis ins Treppenhaus und blieb auch noch stehen, als er nach unten ging. Er wollte zurück ins Büro, da bemerkte er auf dem nach oben führenden Treppenstück jemanden: den Buben mit den zu großen Stiefeln. Er schaute herunter, als wolle er irgendwas. Ludwig blieb stehen und schaute zurück.
»Sind Sie ein Detektiv?«, fragte der Bub. »So wie Nick Knatterton?«
»So ähnlich. Warum?«
»Weil ich einen brauch.«
»Du? Um was geht es denn?«
»Um einen Mord.«
Die Türglocke riss Karl mitten aus einem Traum. Der Traum verpuffte im Moment des Erwachens, alles, was in Erinnerung blieb, war ein Bild: ein Fenster mit Regentropfen gesprenkelt, dahinter zwei Mädchen im Backfischalter, die ihm zuwinkten. Sie hatten beide riesige Schleifen im Haar. Gundi und Gerti. Seine Töchter. In einem Alter, das sie nie erreicht hatten.
Die Glocke schrillte erneut, diesmal anhaltender und durchdringender. Karl fuhr hoch. »Herrgott, wer ist denn das?« Er schaute auf den Wecker. Kurz nach halb zehn. »Um diese Zeit.« Er wandte sich zur anderen Seite des Bettes. Sie war leer.
Schnaufend stand Karl auf und schlurfte barfuß in den Flur, wo die Koffer noch genau so dastanden, wie sie sie gestern abgestellt hatten. Aus dem Bad drang das Plätschern der Brause. Da steckte Gisela also. Erneut hämmerte es gegen die Tür. »Wo seid ihr denn?«, rief jemand von draußen. Georg. Hoffentlich ohne Inge, dachte Karl. Vor dem ersten Kaffee vertrug er keine ehelichen Sticheleien. Sicher brachten sie Benno.
»Komm ja schon!« Karl schloss die Tür auf.
Nur Georg und Benno. Keine Inge.
»Im Schlafanzug? Um die Zeit?«, gab Georg sich erstaunt, obwohl er genau wusste, dass Karl ein Langschläfer war. »Ihr habt ein Leben.«
»Servus«, sagte Benno, ohne Karl anzuschauen. Dann schob er sich an Karl vorbei in die Wohnung, stellte Koffer und Rucksack zu denen, die schon dastanden, und verschwand in sein Zimmer.
»Deine Mutter ist im Bad«, rief Karl ihm nach.
»Jaja.« Die Tür am Ende des Flurs knallte zu.
»Danke, dass ihr ihn genommen habt. War er brav?«
»Musst du die Inge fragen. Ich weiß nicht mal, wie es meinen eigenen Kindern geht, weil ich den ganzen Tag in der Redaktion bin und mich mit den Deppen dort rumärgere. Apropos. Hast du ein paar Minuten? Und Kaffee wäre nicht schlecht.«
Karl ging voraus in die Küche. Auf dem Tisch lag ein Päckchen Zigaretten. Chesterfield, die er noch in Italien gekauft hatte. »Darf ich?«, fragte Georg und nahm sich schon eine. Karl holte die neue Kaffeemühle und die Packung Bohnenkaffee.
»Elektrische Kaffeemühle«, sagte Georg, nachdem er sich die Zigarette angezündet hatte. »Nobel geht die Welt zugrunde.«
»Die Welt? Oder du?«
Die Spatzen pfiffen von den Dächern, dass das Blitzlicht nicht besonders gut lief. Sinkende Abonnentenzahlen, sinkender Absatz im freien Verkauf. Wenn das Blatt überhaupt noch Gewinn abwarf, war es sicher nicht viel.
Georg überhörte die Spitze und sagte: »Weißt du noch, wie du hier angekommen bist, Karl? Vor fünf Jahren, aus Berlin? Du warst ein Wrack, seelisch und auch sonst. Und jetzt schau dich an: ein erfolgreicher Schriftsteller. Und wem hast du’s zu verdanken? Wer hat dir als Einziger eine Chance gegeben?«
Karl schaute Georg an. Diese Geschichte hatte er irgendwie anders in Erinnerung. Wenn er jemandem zu danken hatte, dann Magda. Sie hatte Georg für sich eingespannt, um Karl von Berlin nach München zu lotsen, und der hatte sich anfangs seine Ausgaben sogar insgeheim von ihr zurückgeholt. Keinen Pfifferling hatte er auf ihn gesetzt.
»Jetzt wird’s gleich laut.«
Karl drückte auf den Einschaltknopf der Kaffeemühle.
Als der Kaffee gemahlen war, sagte er: »Rück einfach raus mit der Sprache, Schorsch: Was willst du von mir?«
»Du sollst wieder für mich schreiben. Diesmal keinen rührseligen Kram wie sonst, sondern eine Enthüllungsgeschichte. Mit allen Zutaten, die ein richtiger Knüller braucht: Verrat, Spionage, Bestechung. Und das alles spielt sich hier in München ab, vor unserer Nase.«
»Du meinst, was Politisches?«
»Ganz genau.«
Karl hatte den Kaffeefilter auf die Kanne aufgesetzt und holte die Filtertüten aus dem Hängeschrank. »Erzähl mehr.«
»Vielleicht kannst du deine süße Nichte ja auch wieder einspannen«, sagte Georg und klang dabei so zweideutig wie immer, wenn er Magda erwähnte.
Karl hatte alles fertig, um den Kaffee aufzubrühen, und bemerkte erst jetzt, dass er kein Wasser aufgesetzt hatte. Georg lachte. »Normal macht das dein Weiblein, oder? Den Kaffee, meine ich.«
»Jaja. Red weiter über die andere Sache. Worum geht’s da?«
»Aha, hat der Fisch den Köder also geschluckt. Die Sache ist nicht ohne Risiko, das sag ich gleich dazu. Wir legen uns mit jemandem an, der keinen Spaß versteht, wenn’s ihm ans Eingemachte geht. Eine graue Eminenz in der Stadt.«
Karl war allmählich genervt. »Kannst du auch mal einen Namen nennen?«
»Kann ich, alter Freund. Was hältst du von diesem: Walter Blohm.«
»Blohm? Du willst Walter Blohm ans Bein pinkeln?«
Im ersten Moment war Karl erstaunt gewesen, im zweiten nicht mehr. Seit Blohm das Geld, mit dem er vor fünf Jahren in das Blitzlicht-Projekt eingestiegen war, von heute auf morgen wieder rausgezogen und die Zeitschrift damit an den Rand des Ruins gebracht hatte, sann Georg auf Rache. Und nun war auch noch bekanntgeworden, dass Blohm das ganze Areal samt der ehemaligen Schneiderei, in der die Redaktion noch immer untergebracht war, gekauft hatte und alle Gebäude abreißen wollte, um dort mehrere Wohnblocks mit Geschäften zu errichten.
»Ja«, sagte Georg mit mühsam unterdrückter Wut in der Stimme, »ich will diesem Scheißkerl ans Bein pinkeln, bevor er uns begräbt. Mehr noch, ich will ihn vernichten. Will ihn weghaben. Und es gibt in der ganzen Stadt nur einen Menschen, der das noch mehr will als ich.«
»Wer sollte das sein?«
»Na du!«
»Mord«, wiederholte Ludwig, »soso.«
Der Bub warf sich auf den Stuhl, den eben noch der Volksschullehrer Rosen gewärmt hatte, und wischte sich mit dem Ärmel seiner zerschlissenen Jacke den Rotz unter der Nase weg. Genauer gesagt den Teil davon, der sich nicht aufziehen ließ. Neugierig schaute er sich im Büro um, betrachtete alles eingehend: den Rollladenschrank mit den Leitz-Ordnern, in dem alle Ermittlungen dokumentiert wurden; das Regal, in dem ein paar Gesetzbücher sowie Fachliteratur standen, die Ludwig angeschafft, in die er aber so gut wie noch nie einen Blick geworfen hatte; die verkümmerten Topfpflanzen auf dem Fensterbrett. Am Ende seines Rundumblicks zeigte der Bub auf die Bilderrahmen in einer Ecke des Schreibtisches, wo sie einerseits nicht im Weg standen, andererseits aber gut zu sehen waren. »Wer ist das?«
»Das auf dem einen Foto sind meine beiden Buben. Und das auf dem anderen ist meine Frau.«
»Und warum ist an dem Bild von Ihrer Frau ein schwarzes Band?«
»Das schwarze Band nennt man Trauerflor, und es bedeutet, dass die Person auf dem Bild schon gestorben ist.«
»Dann ist Ihre Frau tot?«
»So ist es.« Ehe das Gespräch in diese Richtung weitergehen konnte, fuhr Ludwig fort: »Aber wir reden jetzt nicht über mich, sondern über dich. Wie heißt du überhaupt?«
»Rudi.«
»Und wie noch?«
»Daxenhofer.«
»Und was hat es mit dem Mord auf sich? Wer ist tot?«
»Der Ferdl. Mein Bruder.«
»Das tut mir leid. Was ist denn passiert?«
»Er ist vor vierzehn Tagen von der Brücke runter, die in Großhesselohe meine ich. Und da war er tot, weil das überlebt keiner.«
Die Selbstmörderbrücke, dachte Ludwig. Er fing an zu begreifen.
»Dann war es vielleicht eher ein Unfall und kein Mord.«
»Doch! Das war Mord!« Unter Rudis Nase ließ sich wieder eine Rotzglocke sehen, die der Bub sogleich schwungvoll hochzog.
»Brauchst du ein Schnäuztuch?«, fragte Ludwig.
»Geht schon.« Rudi wischte die Nase an seinem bereits bis zur Armbeuge hinauf verkrusteten Ärmel ab.
»Was sagt denn die Polizei?«, wollte Ludwig wissen. »Die hat die Sache doch bestimmt untersucht.«
»Schon. Die meinen, dass er gesprungen ist. Weil er nimmer leben wollte. Das hat er auch geschrieben.«
»Es gibt einen Abschiedsbrief?«
»Der ist gefälscht!«, schrie Rudi auf. Seine Augen wurden feucht, die Stimme brach, als er fortfuhr: »Warum hätte der Ferdl denn tot sein wollen? Der hat mir doch versprochen, dass er immer für mich da ist, wenn ich ihn brauch. Dass er nach Amerika geht und mich mitnimmt.«
Ludwig wartete, bis sich Rudi wieder beruhigt hatte, dann fragte er: »Und deine Mama, was ist mit der? Was sagt die dazu? Du hast doch eine Mama? Und einen Papa auch?« Das war ja leider nicht selbstverständlich, bei den Verhältnissen, die der Krieg geschaffen hatte. Mütter und Väter, die entweder keine Zeit für ihre Kinder hatten oder ganz fehlten; Kinder und Heranwachsende ohne eine strenge Hand, die sie auf den rechten Weg führte und dort hielt, und die deshalb sittlich verwahrlosten.
»Eine Mama hab ich. Aber die ist nicht mehr normal. Die ist hypnotisiert oder so.«
Hypnotisiert? Jetzt wurde es abenteuerlich. »Warum denn das?«
»Wegen dem Mann. Dem, der sagt, dass er unser Papa ist.« Rudi fasste in eine Innentasche seiner Jacke und holte eine Fotografie heraus, die er Ludwig über den Schreibtisch reichte. Sie zeigte einen Soldaten in Uniform. Auf der Rückseite stand die Einheit, in der er gedient hatte. »Das ist unser echter Papa, er war im Krieg und dann in Russland, in Gefangenschaft. Und da ist er immer noch. Das hat der andere ausgenützt. Er war auf einmal da und hat gesagt, dass er unser Papa ist. Und die Mama, die glaubt ihm das. Obwohl er überhaupt nicht so ausschaut wie auf den alten Fotos. Der Ferdl hat das auch gesagt. Und wenn man ihn vom Krieg was fragt, den falschen Papa, dann weiß er es nicht.«
»Was soll das heißen: Er weiß es nicht?«
»Er sagt, dass er alles vergessen hat. Drum sollen wir ihn nichts fragen, sagt die Mama. Weil alles so schlimm war, dass sein Kopf nicht mehr daran denken kann.«
So was gab es durchaus. Aber für ein Kind war das sicher schwer zu verstehen.
»Und was hat das damit zu tun, dass der Ferdl von der Brücke gesprungen ist?«
»Ja, weil doch der Ferdl rausgefunden hat, dass der falsche Papa in Wirklichkeit ein …« Rudi neigte sich vor und ergänzte im Flüsterton: »… ein Spion ist. Für die Russen. Drum hat er den Ferdl runtergeschmissen.«
Ludwig lehnte sich zurück und rieb sich bedeutungsvoll das Kinn. »Ein Spion für die Russen, sagst du. Hm.« Die Sache war ziemlich klar. Es war die leider fast schon übliche Geschichte, wie sie seit zehn Jahren tausendfach in Kriegsheimkehrerfamilien passierte. Die strahlenden jungen Männer, die in den Krieg gezogen waren, kamen als körperliche und seelische Wracks zurück, daheim hatte sich die Welt weitergedreht, man verstand einander nicht mehr, war sich fremd geworden, bevor man sich richtig kennenlernen konnte. Das Ergebnis waren nicht zuletzt verwirrte Kinder wie Rudi und sein Bruder Ferdl, und manchmal gingen diese verzweifelten Geschichten tödlich aus, weil einer es einfach nicht mehr aushielt. Wie in diesem Fall. Doch wie sollte er das diesem bedauernswerten Buben beibringen, der zugleich recht und unrecht hatte? Denn der Mann zu Hause war sein Vater, und zugleich war er es nicht. Von einem aber konnte man ausgehen: Er war wohl kein Mörder.
»Wenn der Mann wirklich ein Spion ist«, sagte Ludwig, »dann hat die Polizei ihn bestimmt schon im Visier. Die sagen das natürlich nicht, damit sie ihn besser beobachten können. Ein Spion kommt nämlich niemals allein. Und die Polizei will sie alle erwischen. Drum sollten wir die Polizei einfach machen lassen. Am besten ist es, wenn du mitspielst. Wenn du so tust, als wäre der Mann dein Vater. Damit er keinen Verdacht schöpft. Verstehst du das?«
Rudi schaute Ludwig groß an.
»Oder tut er dir weh? Schlägt er dich? Oder deine Mama?«
»Eine Watschn gibt’s hin und wieder schon.«
»Ja, die braucht’s halt manchmal, wenn du gar nicht hörst, oder?«
Rudi zuckte mit den Schultern.
Ludwig stand auf und umrundete den Schreibtisch. »Am besten gehst du heim und sagst keinem, dass du hier warst. Und die Sache mit dem Spion behältst du auch für dich, ja?«
Rudi nickte.
Ludwig griff in die Hosentasche, holte sein Taschentuch heraus und presste es Rudi unter die Nase. »Jetzt blas da mal richtig rein, das ist ja nicht zum Aushalten mit deiner Rotzglocke.«
Nachdenklich stellte Karl die Tasse in die Spüle. Er hatte Georg nicht gezeigt, wie sehr ihn die Idee reizte, mal wieder für eine Zeitschrift zu schreiben. Nicht nur schöngeistigen Feuilletonkram oder alberne Klatschgeschichten, sondern etwas Sensationelles. Aufsehenerregendes. Etwas, das später vielleicht sogar den Stoff für einen neuen Roman abgeben könnte. Wobei der eigentliche Reiz – da hatte Georg schon recht – darin lag, mit Magda auf Recherche zu gehen. Was voraussetzte, dass er sie für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte, und ginge es um etwas anderes, bestünden berechtigte Hoffnungen. Aber wenn Georg glaubte, sie würde ihnen zuliebe ihren eigenen Mann bespitzeln, der zudem ein äußerst einflussreicher, skrupelloser und damit gefährlicher Mann war, war er auf dem Holzweg. Wieso sollte sie das tun? Ihre Ehe war gewiss nicht perfekt, wenn man bedachte, dass sie den Mann, dessen Ring sie am Finger trug, nicht liebte, doch sie wusste den Lebensstil, den sie ihr bot, sehr wohl zu genießen. Villa in Nymphenburg, ein eigenes Mercedes 220 Cabriolet, Reisen, Feste, schöne Kleider, Pelzmäntel. Magda hatte sich ihr Leben lang auf die eine oder andere Weise an Männer verkauft, notgedrungen, doch niemals zu einem so guten Preis. Sie war viel zu klug, um sich für einen allzu durchschaubaren Plan einspannen zu lassen, dessen oberstes Ziel es war, Walter Blohms Ruf als seriöser Geschäftsmann zu beschädigen. Egal, wie viel von diesem Spionagezeug stimmte, und vermutlich stimmte gar nichts – Walter Blohm öffentlich zu beschuldigen, Teil eines kommunistischen Agentennetzes zu sein, war mindestens journalistischer Selbstmord. Andererseits …
Karl kehrte zum Tisch zurück, fischte die letzte Chesterfield aus der Packung und zündete sie an.
Andererseits hatte Georg recht. Karl hätte nichts lieber gesehen, als dass dieser verdammte Großkotz Walter Blohm mit seinen legalen, illegalen und sonstigen Machenschaften für immer aus ihrer aller Leben verschwand. Vor allem aus Magdas Leben. Ja, es stimmte, sie war strahlender und begehrenswerter als je zuvor. Doch glücklich war sie nicht, auch wenn sie sich das selbst weismachte. Sie konnte einfach nicht glücklich sein mit einem Mann wie diesem an ihrer Seite. Es war undenkbar. Unmöglich. Eine Beleidigung von allem, an das Karl glaubte, was ja ohnehin nicht viel war.
»Was ist denn hier los?«
Karl schreckte aus seinen Gedanken auf und drehte sich um. Gisela stand vor ihm, frisch geduscht, die Haare unter einem Handtuchturban verborgen.
»Ich denke darüber nach, wie glücklich es mich macht, mit dir nicht verheiratet zu sein«, scherzte Karl.
»Und mich erst.« Sie zog eine Augenbraue hoch, so wie sie es stets tat, wenn ihr etwas missfiel. »Immer noch im Schlafanzug, aber schon die ich weiß nicht wievielte Zigarette. T-t-t.«
»Rauchen ist gesund. Erst neulich hab ich gelesen, dass Forscher – ich glaube in England – Versuche mit Mäusen gemacht haben, und dabei kam raus, dass es keinen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs gibt.«
»Erstens heißt das noch lange nicht, dass Rauchen gesund ist, und zweitens bist du keine Maus.«
»Deine intellektuelle Brillanz ist einschüchternd und wird nur von deiner Schönheit übertroffen. Ich meine, sieh dich an.«
Sie verkniff sich ein Lächeln. »Sehr witzig. Wieso machst du nicht wenigstens ein Fenster auf?«
Statt zu warten, dass er es tat, ging sie gleich selbst und öffnete das Fenster einen Spaltbreit. Karl schmunzelte. Dann bemerkte er die Regentropfen an der Scheibe, und dabei fiel ihm wieder sein Traum ein. Oder dieses eine Bild, das ihm davon in Erinnerung geblieben war: seine Töchter, winkend hinter einer mit Tropfen gesprenkelten Scheibe. In einem Alter, das sie nie erreicht hatten, weil ihre kindlichen Leiber auf dem Grund der kalten Ostsee lagen. Wilhelm Gustloff war der Name des verfluchten Schiffes gewesen. Er hatte ewig nicht von ihnen geträumt. Nicht einmal an sie gedacht.
Er schüttelte sich, als verscheuche er eine Fliege. »Georg hat Benno gebracht, als du im Bad warst«, sagte er.
»Hab die Sachen im Gang schon gesehen. Hat er was gesagt?«
»Der Benno? Freilich. Servus, hat er gesagt. Und dann ist er in sein Zimmer.«
»Saubub. Liest lieber seine Schundheftl, statt dass er seine Mama begrüßt. Na, dem werde ich einen Empfang bereiten.«
Karl drückte die Zigarette aus, verschwand ins Bad und drehte den Schlüssel um. Magda muss ja nicht wissen, dass es gegen Blohm geht, dachte er, während er seinen Pyjama aufknöpfte, zumindest nicht gleich am Anfang.
New York City
Magda legte immer wieder den Kopf in den Nacken, um zur Spitze des Empire State Buildings zu sehen. Ein Berg von einem Gebäude. Unvorstellbar, dass Menschen etwas so Gewaltiges bauen konnten. Und in nur zwei Jahren, wie sie in ihrem Baedeker gelesen hatte. Sie trat durch eine der Flügeltüren in die Lobby, die vollständig mit auf Hochglanz poliertem, dunklem Marmor – Lahnmarmor, laut Baedeker – ausgekleidet war. Eine Kathedrale der Modernität. Sie stellte sich in die Warteschlange vor der Kasse, um ein Ticket für den Besuch der Aussichtsplattform zu kaufen. Ihr Blick fiel auf eine Uhr. Sie würde ein wenig vor der verabredeten Zeit oben sein. Sollte sie hier unten warten und gemeinsam mit Simon nach oben fahren? Nein, besser, sie hielt sich an das, was verabredet war, sonst verfehlten sie sich am Ende noch. Jedenfalls war der Ort für ein weiteres Treffen mit Simon gut gewählt, denn Blohm hatte Höhenangst und würde sie dort oben bestimmt nicht überraschen.
Die Fahrt nach oben dauerte etwas mehr als eine Minute. Kaum öffneten sich die Aufzugstüren, schon drängte alles nach draußen, hin zu den breiten Glastüren, die zur äußeren Plattform führten. Als Magda ins Freie trat, erfasste sie ein Windstoß, sehr viel kühler als das milde Lüftchen in den Straßen. Sie zog den Mantelkragen enger zusammen. Die Aussicht war trotz des Dunstschleiers überwältigend. Bis hinunter zur Südspitze Manhattans auf der einen und auf der anderen Seite weit über den Central Park hinaus reichte der Blick. Während aus den Häuserschluchten unter ihnen Sirenengeheul heraufdrang – ein Krankenwagen oder ein Polizeiauto –, packte sie ihre Agfa aus und schoss ein paar Bilder.
Wo blieb Simon nur? Er war inzwischen zwanzig Minuten über der Zeit. Sie schaute sich um, drehte mehrere Runden, machte Fotos. Die Aufzüge brachten immer neue Besucher. Doch Simon war nicht darunter. Er würde sie doch nicht versetzen? Es war ihr letztes Treffen für eine sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer.
Weitere zwanzig Minuten später musste sie sich eingestehen, dass sie vergebens wartete. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, das ihn abhält, dachte sie. Zum Beispiel Blohm. Sie ging zum Aufzug.
Wieder unten, suchte sie mit eiligen Schritten all die mit Marmor verkleideten Räume ab, in der Hoffnung, dass er doch hier unten auf sie wartete. An der Stirnseite der Halle, zur Fifth Avenue hin, unter dem alles beherrschenden Relief des Gebäudes, erblickte sie tatsächlich ein bekanntes Gesicht. Aber es war nicht das von Simon. Es war Blohms Gesicht. Also doch er. Den Hut in der Hand, stand er ein paar Schritte von der Information Desk entfernt. Als er sie entdeckte, hellte sich seine Miene auf, und er kam ihr entgegen.
»Da bist du ja«, sagte er.
»Wie … woher weißt du …?«
»Du hast doch gesagt, dass du heute noch auf das Empire State Building willst. Weißt du das nicht mehr? War’s denn schön? Ich wäre zu gern auch da oben gewesen. Muss grandios sein. Wenn ich nur diese verdammte Höhenangst nicht hätte …«
Magda war sicher, dass sie ihm nichts von ihrem Besuch hier erzählt hatte. Und da er vermutlich keine Gedanken lesen konnte, blieb nur die Möglichkeit, dass jemand sie in seinem Auftrag überwachte. Dann wusste er auch, dass sie gestern Simon getroffen hatte. Und heute war Simon nicht gekommen. Was hatte das zu bedeuten?
»Ich dachte, ich hol dich zu einem späten Lunch ab«, sagte Blohm vergnügt. »Was hältst du davon? Hast du Hunger?«
München
Jetzt war es doch wieder elf Uhr geworden, bis er von der Observierung nach Hause kam. Und bloß weil das kleine Flitscherl sich auf einmal geziert hatte. Als wäre nicht von Anfang an klar gewesen, worauf das geheime Stelldichein hinauslief. Dass es nicht beim Händchenhalten und Süßholzraspeln bleiben würde. Das war doch überhaupt der Sinn des Ganzen gewesen. Kopfschüttelnd über so viel menschliche Widersprüchlichkeit schloss Ludwig die Wohnungstür auf und lauschte. Stille, bis auf das Radio aus der Küche. Aus dem Oberlicht über der Kuchentür fiel mattes, friedvolles Licht in die Diele. Wenigstens daheim war wohl alles gut gegangen. Er schlüpfte nach drinnen und legte den Fotoapparat auf das Schuhschränkchen. Ein paar brauchbare Fotos werden schon dabei sein, dachte er. Im Englischen Garten war das Licht gut gewesen. Das Busserl auf dem Monopteros sollte wohl im Kasten sein. Ins Schlafzimmer hatte er vom Garagendach aus zwar dank seines Opernglases einen guten Blick gehabt, weil diese Leute nicht einmal so viel Anstand besaßen, die Vorhänge zuzuziehen, aber es hatte nur das kleine Nachttischlämpchen gebrannt. Viel zu wenig Licht und außerdem viel zu weit weg. Doch er hatte alles genau protokolliert, mit exakter Angabe der Zeit, die er dank einer nahen Straßenlaterne gut von der Uhr ablesen konnte: 21.32 Uhr – Küsse des Herrn Haderer auf Lippen, Wangen, Hals der Frau Mehltretter, von selbiger inniglich erwidert. 21.38 Uhr – Entblößung erst der rechten, anschließend der linken Brust von Frau Mehltretter; vielmalige Küsse auf selbige