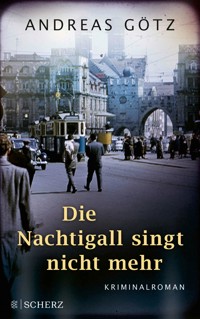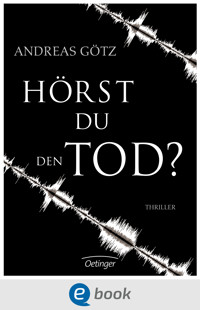9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Karl-Wieners-Reihe
- Sprache: Deutsch
München 1950. Zwischen Stunde Null und Wirtschaftswunder zieht ein altes Verbrechen neue Kreise – Andreas Götz verwebt Kriminal-Ermittlung und Gesellschaftspanorama zu einem packenden zeitgeschichtlichen Spannungsroman Im April 1950 kehrt Karl Wieners, ehemals Schriftsteller, heim nach München, wo Schmuggler gute Geschäfte machen und Gestrandete die letzte Hoffnung verlieren. Karls letzte Hoffnung ist eine Karriere als Journalist. Wenn er herausfände, was aus dem Kunstschatz wurde, der bei Kriegsende aus dem Führerbau verschwunden ist, wäre das die Sensation. Gemeinsam mit seiner Nichte Magda begibt er sich auf die Spur der Bilder. Dabei geraten die beiden nicht nur ins Visier dubioser Schwarzmarktschieber. Sie stören auch die Kreise von Kommissär Ludwig Gruber, der auf der Suche nach einem Mörder fast verzweifelt. Doch womit sie es wirklich zu tun haben, erkennen sie alle erst, als es fast schon zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Götz
Die im Dunkeln sieht man nicht
Kriminalroman
Über dieses Buch
München 1950. Karl Wieners, ehemals Schriftsteller, kehrt heim in eine Stadt, in der Schmuggler gute Geschäfte machen und Gestrandete die letzte Hoffnung verlieren. Karls letzte Hoffnung ist eine Karriere als Journalist. Wenn er herausfände, was aus dem Kunstschatz wurde, der bei Kriegsende aus dem Führerbau verschwunden ist, wäre das die Sensation. Gemeinsam mit seiner Nichte Magda begibt er sich auf die Spur der Bilder. Dabei geraten die beiden nicht nur ins Visier dubioser Schwarzmarktschieber. Sie stören auch die Kreise von Kommissär Ludwig Gruber, der auf der Suche nach einem Mörder fast verzweifelt. Doch womit sie es wirklich zu tun haben, erkennen sie alle erst, als es fast schon zu spät ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 Andreas Götz
Für diese Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und -abbildung: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von Shutterstock und HRath/Timeline Image
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491145-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Die wichtigsten handelnden Personen
Karl Wieners: ehemals Schriftsteller, ehemals Familienvater, ehemals Berliner; versucht einen Neuanfang als Journalist in seiner Geburtsstadt München.
Magda Wieners: die Tochter von Karls im Krieg gefallenem Bruder Alfons; will raus aus Haidhausen.
Veit Wieners: Karls jüngerer Bruder; führt das Gasthaus Kammererwirt und allerhand im Schilde.
Georg Borgmann: alter Schulfreund von Karl und Gründer einer Zeitschrift.
Ludwig Gruber: vielfältig gefährdeter Oberkommissär und Ehemann von Annerl, Vater zweier kleiner Buben.
Emil Brennicke: eigensinniger Ermittler in Sachen Raubkunst.
Zöllner: Polizeikollege und ständiges Ärgernis von Ludwig.
Walter Blohm: Schmugglerkönig; sucht den Übergang ins legale Geschäftsleben.
Herbert Kumpfmayer: ehemaliges Faktotum Blohms; schlägt sich durch und dient jedem, der ihn bezahlt.
Simon Herzberg: ein Freund von Magda Wieners; hat gute Kontakte zum Schwarzmarkt.
Andrew Aldrich: deutsch-amerikanischer Kunstexperte mit Verbindungen zur amerikanischen Unterwelt.
Bernhard Mohnhaupt: Kunsthändler und Galerist.
Charlotte Mohnhaupt: seine attraktive Tochter.
Maria Gronska: polnische Übersetzerin mit einer geheimen Leidenschaft.
Olga Martova: ukrainische Emigrantin und Freundin von Maria.
Janusz Falski: polnischer Hehler.
Lech: Janusz’ Komplize und Schützling.
Dienstag, 24. Januar 1950
Sie hatte etwas Hypnotisierendes, diese helle, von einem Staubrahmen eingefasste Fläche an der Wand. Als wäre sie selbst aufgemalt: weißes Quadrat auf weißem Grund. Hier hatte bis vor kurzem ein Bild gehangen. Vermutlich bis letzte Nacht.
Ludwig Gruber riss den Blick los und wandte ihn wieder der Leiche zu. Auf einem Bürostuhl, der vom Schreibtisch ein gutes Stück nach hinten abgerückt war, saß der Mann, tief eingesunken und gehalten nur von Seilen, wie man sie zum Festzurren von Fracht auf der Ladefläche eines Lastwagens verwendete. Der Fuhrunternehmer Otto Brandl. Er trug nichts als seine Unterwäsche am Leib. Das Gesicht, nur noch ein Brei aus Blut, Haut und Gewebe; Arme und Beine, so schien es, mehrfach gebrochen; sicher gab es innere Verletzungen. Das Folterinstrument, ein simples Eisenrohr, lag neben dem Stuhl auf dem Boden.
»Der Schlag auf den Schädel war wohl einer zu viel«, sagte Dr. Schnellberger und deutete mit dem kleinen Finger auf eine Stelle am Kopf des Toten. Im gleichen Moment drückte Polizeifotograf Kolbenheyer den Auslöser, das Blitzlicht riss die hässliche Wunde noch weiter auf. Kein schöner Anblick.
Er muss geschrien haben wie ein Stier, dachte Ludwig. So ein stämmiger Kerl wie der, mit diesem Brustumfang. Gut möglich, dass die Welt letzte Nacht einen begabten Bass verloren hat.
In die Wand, an der das Bild fehlte, war ein Tresor eingelassen, der weit offenstand. Ein Mann von der Spurensicherung, den Ludwig noch nie gesehen hatte, leuchtete die Vertiefung mit der Taschenlampe aus. Dabei sah man auch so, dass er leer war.
»Schon was gefunden?«, fragte er Hans Baumgartner, den Chef der Spurenleute.
»Dies und das«, grummelte der. »Steht dann alles im Bericht.«
Kollege Zöllner kam aus dem Nebenraum zurück, wo er die Sekretärin, ein altjüngferliches Fräulein mittleren Alters, befragt hatte. Sie hatte ihren Chef so vorgefunden und war bis jetzt erstaunlich gefasst geblieben. Beinahe schon abgebrüht.
»Sie sagt, Brandl hat öfter bis spät in die Nacht gearbeitet«, berichtete Zöllner. »Der war lieber in seinem Büro als zu Hause. Er hat sich wohl nicht so gut mit seiner Gattin vertragen.«
»Soll vorkommen«, murmelte Ludwig. »Was sagt sie zum Tresor?«
»Nur Fahrzeugpapiere, Versicherungspolicen, private Dokumente wie Heirats- und Geburtsurkunden. An bestimmten Tagen auch Lohngelder, weil die Fahrer wöchentlich bar ausbezahlt werden. Aber Zahltag war Freitag, und heute ist erst Dienstag. Außerdem waren Erbstücke drin: Schmuck von der Großtante, eine goldene Taschenuhr vom Uropa, so was. Kein Plunder, aber auch nicht gerade die Kronjuwelen von London.«
Also nichts, was man mit seinem Leben beschützen würde.
»Und was sagt sie zu dem Bild? Das da nicht mehr hängt?«
Er deutete zu dem Quadrat an der Wand.
»Hab ich nicht gefragt.«
Ludwig unterdrückte den spontan aufwallenden Ärger. »Warum nicht?«
»Vergessen.«
»Dann gehen Sie noch mal hin und fragen Sie.«
Zöllner verschwand. Wenn man ihm nicht alles sagte. Am besten zweimal. Aber den Hut vor dem Polizeipräsidenten zu ziehen, das vergaß er nie. Solche Leute brachten es weit.
Eine oder zwei Minuten später kam Zöllner im Laufschritt zurück.
»Und?«
»Zwei Mädchen waren drauf, mit riesigen Schleifen«, sagte er atemlos, als hätte er einen Hundert-Meter-Lauf hinter sich, dabei war er nur im Zimmer nebenan gewesen. »Sah nicht besonders alt aus. Ihr Chef hat immer gesagt, das seien seine unehelichen Töchter, aber das war natürlich bloß Spaß. Dass es was wert war, glaubt sie nicht, weil wenn es was wert gewesen wäre, hätte ihr Chef es sich doch nicht ins Büro gehängt, oder?«
Ludwig wusste es auch nicht. Das Denken fiel ihm zunehmend schwer. Der Gestank von Blut und Urin lähmte ihn. Und Zöllners Kölnisch Wasser tat ein Übriges. Er musste hier schnellstens raus.
Die eisigkalte Januarluft machte seinen Kopf gleich viel klarer. Er zündete sich eine Zigarette an und schob den Hut in den Nacken.
»Und, Kollege? Was denken Sie?«, kam von hinten Zöllners Stimme.
Doch vorher hatte Ludwig ihn schon gerochen.
Er nahm einen Zug von der Zigarette und blies den Rauch in die kristallklare Winterluft. »Entweder in dem Tresor war was, von dem die Sekretärin nichts weiß, wohl aber der Täter, oder …«
»Oder was?«
»Oder es ging bei der Folter nicht um die Kombination des Tresors, sondern um was ganz anderes.«
»Und was könnte das sein?«
Ludwig schnippte die Kippe auf den Hof, sie rollte unter den Tatortwagen der Spurensicherung und glühte dort weiter.
»Denken Sie nach, Zöllner«, sagte er. »Denken hat noch keinem geschadet.«
Montag, 3. April 1950
Geboren aus Sonne, Wind und Wasser, so kommen ihm die beiden kleinen Geschöpfe vor. Wie der Meeresschaum ihre nackten Beinchen umspült. Wie der Wind ihre blonden Löckchen umzärtelt und ihnen das gicksende Lachen von den Mündern pflückt. Mami! Papi! Guckt mal! Sie springen gleichzeitig in die auslaufende Welle, dass es nur so spritzt. Gundi und Gerti – er kann es nicht fassen, seine Mädchen sind wieder da! Etwas löst sich in ihm. Etwas fällt von ihm ab. Heidi, im Strandkorb neben ihm, ihre gebräunten schlanken Beine, die feingliedrige Hand, die locker auf ihrem Knie liegt. Er fasst danach. Spürt sie. Hält sie. Ist alles immer da gewesen? Alles ist gut. Und so bleibt es jetzt. Für immer.
»Mutti, warum weint der Mann?«, flüsterte ein Junge.
Karl wusste nicht, wo er war. Eben noch am Ostseestrand, zur Sommerfrische mit der Familie, aber jetzt …? Sah aus wie ein Zugabteil. Hastig wischte er sich über die Augen. Er vermied es, die Mutter und den Jungen am Fenster anzusehen. Floh in den Speisewagen. Zündete sich eine Zigarette an. Sog gierig den Rauch ein. Wie er diese Träume hasste.
Das Rattern der Räder unter ihm, das Hin und Her der Menschen, die Stimmen, das teils laute, teils verhaltene Lachen – all das machte ihn nervös. Wann waren sie endlich in München? Es war kurz vor halb acht, und sie waren noch nicht einmal in Augsburg. Die Zeit, die sie an der Zonengrenze verloren hatten, holten sie nicht mehr auf. Er war ungeduldig und zugleich dankbar für den Aufschub. Wünschte sich, dass der Zug niemals ankäme. Dass er verlorenginge im Ungefähren zwischen Abfahrt und Ankunft.
Hinter den mit Wassertropfen gesprenkelten Scheiben zog die Landschaft vorüber. Der Himmel hing heute tief. Der Frühling war hier schon weiter als in Berlin. Bäume und Büsche schlugen aus, noch eine oder höchstens zwei Wochen, dann war alles grün.
Er schaute auf die Uhr. Kurz vor acht. Jetzt heizte Tante Frederike den Ofen an oder vielleicht setzte sie bereits Kaffeewasser auf; Onkel Herbert stopfte seine Meerschaumpfeife, die er nach dem Frühstück schmauchen würde. Wilhelm und Rudolf wälzten sich noch in den Federn. Fünf Jahre, so war ihm vor kurzem klar geworden, nächtigte er selbst inzwischen auf dem durchgelegenen Sofa in der Küche, während Heidis Onkel und Tante in seinem Ehebett schliefen und ihre erwachsenen Söhne im Mädchenzimmer, in den viel zu kleinen Betten. Was hatte er mit diesen Leuten zu schaffen, deren Dialekt er bis heute nur mit Mühe verstand? War es nicht seine Wohnung? Nein, es war längst die ihre, und das wussten sie.
Karl holte die Zigaretten aus der Jacketttasche, schüttelte eine heraus, ließ sein altes Wehrmachtfeuerzeug aufschnappen. Knisternd ergriff der Tabak die Flamme. Der Rauch brannte angenehm auf der Zunge. Niemand wusste, dass er heute ankam, nicht mal Georg. Er konnte es sich also immer noch anders überlegen und gleich wieder den Nachtzug zurück nach Berlin nehmen. Dann wäre es fast so gewesen, als hätte er Berlin nie verlassen.
Er kehrte ins Abteil zurück. Die Frau am Fenster lächelte verlegen, der Junge beobachtete ihn aus dem Schutz der mütterlichen Achselhöhle.
Karl zwinkerte ihm zu und ließ die Verschlüsse seines Koffers aufschnappen.
»Will der junge Mann vielleicht ein Stück Schokolade?«
Noch ehe der Zug in den Bahnhof einfuhr, stellte Karl sich mit seinem Koffer in den Gang. Jetzt konnte er es kaum mehr erwarten, eine andere Luft zu atmen. Er zog das Fenster herunter, nahm den Hut ab und steckte den Kopf hinaus. Der Fahrtwind zerzauste ihm das Haar. Einzelne Regentropfen trafen sein Gesicht.
Quietschend und schnaufend kam der Zug im Hauptbahnhof zum Stehen. Karl drängte mit den anderen Fahrgästen nach draußen. Allerlei Volk lungerte auf dem Bahnsteig herum. Kofferträger, Schlepper, Taschendiebe. Einer hatte ihn auch gleich aufs Korn genommen. Ein hagerer Kerl in einem abgewetzten Mantel. Karl vermied Augenkontakt und beschleunigte die Schritte.
»Zimmer?«, redete ihn ein junger Mann von der Seite an. »Zimmer gefällig? Billig!«
»Einen öffentlichen Fernsprecher suche ich«, sagte Karl, doch der junge Mann war schon beim Nächsten.
In der notdürftig geflickten Schalterhalle hingen an der Front zwei meterlange Fahnen: eine weißblaue und eine schwarz-rot-goldene. Von draußen drang der Lärm von Baumaschinen herein: Bagger, Presslufthämmer, Lastwagen. Karl fand ein Telefon. Das Münzgeld hatte er lose in der Hosentasche. Während er sich nach dem Hageren im abgewetzten Mantel umsah, kramte er den Zettel mit Georgs Adresse hervor.
»Bei Borgmann«, meldete sich eine Frauenstimme.
»Hier spricht Karl Wieners. Ist Georg Borgmann zu sprechen?«
»Augenblick, bitte.«
Der Hagere stand jetzt bei einem anderen, sie redeten. Über ihn?
»Karl!«, rief Georg aufgeregt in sein Ohr. »Bist du’s wirklich?«
»Höchstpersönlich.«
»Ich hab nicht mehr dran geglaubt, dass du dich meldest. Kommst du nach München?«
»Ich bin schon da. Eben angekommen.«
»Was? Ja, warum –? Dann gehst du wahrscheinlich erst mal heim zu deinen Leuten, oder?«
Heim? Seltsames Wort. Und wer sollten seine Leute sein?
»Eigentlich hätte ich lieber gleich dich gesehen. «
»So. Na, komm einfach vorbei, dann lernst du auch gleich die anderen kennen. Es ist Schellingstraße 60, genau zwischen der Osteria Italiana und dem Schellingsalon. Aber lass dir Zeit. Wir sind noch in einer Besprechung.«
Karl hängte ein.
Waren die beiden dunklen Gestalten noch da? Er schaute sich nach allen Seiten um. Zu sehen waren sie nicht mehr.
Das Klappern der Schreibmaschine drang bis ins Stiegenhaus. Karl musste ihm nur folgen, es führte ihn vor eine Tür, an der auf einem Schildchen aus Emaille der Name Borgmann stand. Er drückte den Klingelknopf.
»Nur herein«, hörte er von drinnen jemanden rufen, »es ist offen!«
Hinter der Tür tat sich eine großzügige Diele auf. An der Garderobe hingen mehrere Mäntel und Hüte. Eigenes Heim, Glück allein, las er goldgerahmt und hinter Glas. Vor ihm lagen Bauklötze, wie sie auch seine Mädchen gehabt hatten. Die Schreibmaschine verstummte und hob gleich wieder an.
Georg kam ihm entgegen und strahlte übers ganze Gesicht.
»Da bin ich«, sagte Karl verlegen.
Georg klopfte ihm auf die Schulter. »Ja, da bist du. Komm rein, altes Haus.«
In der Küche hing dicker Zigarettenqualm unter der Decke. Zwei Männer saßen an der langen Seite eines Küchentisches, eine Frau an der schmalen, sie tippte etwas ab, das jemand handschriftlich aufgesetzt hatte. Sie hielt kurz inne, schaute hoch und grüßte, dann glitten ihre Finger weiter über die Tasten.
»Die beiden Herren sind« – Georg deutete auf die Männer, die aufgestanden waren – »Hermann Gabler und Reinhard Schollgruber. Meine Mitherausgeber des Blitzlichts. Ich bin in Personalunion auch noch Schriftleiter. Und diese Rose ohne Dornen«, er deutet auf die Frau, »ist Inge, mein Eheweib und bis auf weiteres Redaktionssekretärin.«
Karl hatte den Koffer abgestellt und seinen Mantel, den er auf dem Arm trug, über eine Stuhllehne gehängt. Nun schüttelte er Hände.
»Hier wird noch gearbeitet«, sagte Georg, »da drücken wir uns lieber. Ihr kommt eine Zeitlang ohne mich aus, oder? Hast du Hunger?«
Im gut besuchten Lokal ein paar Häuser weiter ließ Karl sich von Georg noch einmal erklären, was es mit dem Zeitschriftenprojekt auf sich hatte. Das Blitzlicht sollte ein neuartiges illustriertes Wochenmagazin für den Herrn von heute werden, mit Politik, Gesellschaft, Unterhaltung und einer Prise Erotik. »In der Mitte einer jeden Ausgabe wird ein attraktives Fräulein über eine Doppelseite abgebildet, sinnlich, aber geschmackvoll. Das Blitzlicht-Mädel der Woche. Dazu eine kleine Geschichte, niveauvoll, aber mit Schuss, wenn du verstehst.« Georg grinste, und Karl wunderte sich. Bis ihm einfiel, dass Georg ja auch auf dem Schulhof Schmuddelbilder für fünf Pfennige verkauft hatte.
Eine Bedienung brachte eine Porzellanschüssel, in der sechs Weißwürste in dampfendem Wasser schwammen, dazu einen Korb mit Brezen und ein Töpfchen mit süßem Senf. Karl lief das Wasser im Mund zusammen. Die ersten Weißwürste seit zwölf Jahren.
»Dass wir unsere Sitzungen in meiner Wohnung abhalten, ist natürlich nur provisorisch«, erklärte Georg beim Essen. »Wir suchen fieberhaft nach passenden Räumen. Mit einer Druckerei und einem Pressevertrieb stehen wir gerade in Verhandlungen. Sobald das alles geklärt ist, können wir richtig loslegen.«
»Und was mach ich?«
»Reporter. Ich kann dir leider noch keine feste Stelle anbieten. Nur Spesen und, je nach Kassenlage, noch was oben drauf.«
Das ist besser als alles, was ich im Moment habe, dachte Karl, aber nicht ganz das, was Georg versprochen hat. Trotzdem schwieg er und tunkte bloß ein Stück Wurst in den süßen Senf.
Georg dämpfte die Stimme, als er sagte: »Ich hab auch schon eine interessante Geschichte für dich.«
»Da bin ich ja gespannt.«
»Also, pass auf. Stell dir vor: München, Königsplatz, Führerbau. Es ist das Jahr fünfundvierzig, Ende April. Die Nazis sind verduftet, die Amis noch nicht da. Die Stadt liegt da wie eine alte Schlampe und macht die Beine breit. Und was tun die Münchner? Sie stürzen sich natürlich auf sie mit Gebrüll.«
»Sehr plastisches Bild.«
»Es wird geplündert, was das Zeug hält. Auch im Führerbau. Am Ende ist alles weg: Lebensmittel, Möbel, Geschirr. Und außerdem Kunst im Wert von zig Millionen Dollar, die im Keller lagerte. Das meiste davon ist bis heute nicht aufgetaucht. Und die Polizei tappt im Dunkeln.«
»Wahrscheinlich getauscht gegen Lebensmittel und Kohlen.«
»Gut möglich. Aber wart’s ab, es kommt noch besser. Es gibt nämlich Leute, die behaupten, dass vor den Plünderern schon jemand anders da war und den Löwenanteil des Kunstschatzes rausgetragen hat. Ein klassischer Raubzug also.« Georg boxte Karl in die Schulter. »Also, was sagst du? Ist das eine Sache, die dich interessieren könnte?«
Karl hatte eine weitere Weißwurst aus der Schüssel gefischt und legte sie auf den Teller. »Ja, hört sich interessant an. Wirklich. Aber in Berlin klang das noch ein bisschen anders. Von was soll ich leben, wenn du mich nicht bezahlst? Ersparnisse hab ich nämlich keine.«
»Ich lass dich schon nicht verhungern.« Georgs Augen fingen wieder an zu glänzen. »Stell dir bloß mal vor, wir finden den Kunstschatz. Was das für ein Aufsehen gäbe!«
»Ich denk drüber nach«, versprach Karl. »Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet ich was finde, wenn sich schon die Polizei die Zähne ausbeißt.«
»Während du drüber nachdenkst, kannst du ja schon mal mit jemandem reden, oder?«
Karl zögerte, dann sagte er: »Mit wem denn?«
»Einem Deutsch-Amerikaner, der für den Central Collecting Point gearbeitet hat. Andrew Aldrich.«
»Central Collecting Point? Was ist das?«
»Das kann dir Herr Aldrich viel besser erklären als ich. Ich hab ihn kennengelernt, als ich noch bei der Abendzeitung war und selbst mal einen Artikel über Raubkunst geschrieben hab. Ein feiner Mann, wir sind seitdem lose in Kontakt geblieben. Jude zwar, aber einer von den guten. Er hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, über diese Sache was zu machen. Zufällig ist er gerade jetzt wieder in der Stadt. Ich ruf ihn an und verabrede einen Termin für dich.«
»Ach, weißt du … Mein Englisch ist ziemlich eingerostet.«
»Keine Sorge, Deutsch ist seine zweite Muttersprache.«
»Also gut. Aber du musst mir auch einen Gefallen tun, Schorsch.«
»Wenn ich kann.«
»Lässt du mich bei dir übernachten? Auf dem Sofa oder auf dem Boden. Wo immer Platz ist. Nur zwei oder drei Nächte. Ich kann jetzt noch nicht –«
Die Worte lagen ihm auf der Zunge, doch er brachte sie nicht über die Lippen: nach Hause.
Dienstag, 4. April 1950
Andrew Aldrich kam in einem nachtblauen Anzug und einem sandfarbenen Trenchcoat über dem Arm die Hoteltreppe herunter. Das Haar glänzte vor Brillantine, die Oberlippe zierte ein akkurat gestutztes Bärtchen. Anscheinend ein Mann von Welt, der sich in den Foyers exklusiver Hotels bewegte wie ein Fisch im Wasser. Einer von den guten Juden, hatte Georg gesagt. Was sollte das eigentlich bedeuten? Schau an, dachte Karl jetzt, da er ihn sah, ein Heiratsschwindler. So hatte Heidi im Scherz Männer genannt, von denen man nicht wusste, ob sie noch kultiviert oder schon blasiert waren.
Ehe Karl sich überlegen konnte, wo sie das Gespräch führen sollten, hatte Aldrich schon entschieden. »Setzen wir uns dorthin.« Er wies auf eine Sitzgruppe abseits vom Hin und Her vor der Rezeption. Er selbst nahm im Sessel Platz, Karl auf dem Zweiersofa gegenüber.
Aldrich schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. »Wir haben nur zwanzig Minuten, dann muss ich zu meinem Termin. Also sparen wir uns das übliche Vorgeplänkel und kommen gleich zur Sache.«
»Natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich überhaupt –«
»Schon gut. Ihre Fragen, bitte.«
»Sofort.« Karl kramte sein Schreibzeug, das er sich auf dem Weg hierher gekauft hatte, aus der Manteltasche. Der Bleistift fiel zu Boden und rollte unter das Sofa. »Verzeihung«, murmelte er und bückte sich.
Als sei nichts geschehen, begann Aldrich: »Wenn ich Sie am Telefon richtig verstanden habe, geht es um Raubkunst, Führerbau und all diese Sachen. Was wissen Sie denn darüber?«
Karl kniete auf dem Boden, die Hand tastend unter dem Sofa und blickte auf. »Nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich …«
»Verstehe. Dann fange ich besser ganz von vorne an. – Wird das noch was mit Ihrem Bleistift?«
Karl zog die Hand unter dem Sofa hervor. Was mache ich hier eigentlich?, dachte er. »Anscheinend nicht«, sagte er. »Eigentlich muss ich gar nicht mitschreiben. Ich kann mir Sachen ziemlich gut merken.«
Plötzlich brach Aldrich in lautes, ungezwungenes Gelächter aus. Wurde geradezu durchgeschüttelt. Hatte Tränen in den Augen. Da konnte Karl auch nicht mehr an sich halten. Was für eine Szene! Er auf Knien, die Hand unter dem Sofa. Wie aus einer Filmklamotte!
»Entschuldigen Sie«, sagte Aldrich, als der Anfall allmählich abebbte, und wischte sich mit einem Taschentuch die Lachtränen aus den Augen. »Ich wollte Sie nicht … Es sah nur zu komisch aus …«
»Schon gut.« Karl ließ sich auf dem Sofa nieder. »Fangen wir an. Ihr Termin …«
»Danke, dass Sie mich daran erinnern.« Lächelnd steckte Aldrich das Taschentuch ein. Dann begann er zu erzählen. Von Hitler, der unbedingt ein Museum – größer und reicher als der Louvre – brauchte und mit dieser provinziellen Protzerei seine provinzielle Heimstadt Linz beglücken wollte; der dafür Museen und Sammlungen in ganz Europa plündern ließ. Aldrich hob den Zeigefinger. »Aber was heißt plündern. Die meisten Werke wurden offiziell gekauft. Selbstverständlich zu einem Preis weit unter dem Marktwert. Und ebenso selbstverständlich war es den sogenannten Verkäufern unmöglich, über das Angebot zu verhandeln oder es gar abzulehnen.«
Karl fiel eine Locke auf, die sich bei Aldrichs Lachanfall aus dessen mit Brillantine versiegeltem Haarverbund gelöst hatte und sich vor seiner Stirn kräuselte.
»Von welchen Künstlern reden wir hier eigentlich?«, warf er ein.
»Keine Rembrandts, Vermeers und Dürers, falls Sie das erwartet haben sollten. Eher weniger bekannte Namen, alte Flamen und Holländer, aber auch Spitzweg, Defregger, Bürkel. Zugegeben, heutzutage ein bisschen aus der Mode gekommen, trotzdem im Großen und Ganzen feine Kunst von bleibendem Wert.« Aldrich lächelte hintergründig. »Und für Diebe auch leichter zu verkaufen. Versuchen Sie mal, einen gestohlenen Rembrandt zu Geld zu machen. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben drei, vier oder fünf davon.«
»Ich verstehe.«
»Ein großer Teil der Kunstwerke wurde nach München geschafft, gesichtet, katalogisiert und im Keller des Führerbaus verwahrt«, fuhr Aldrich fort. »Wenn Hitler hier war, ließ er sich die Neuerwerbungen vorführen und entschied, wie damit weiter zu verfahren sei. Später, als die Alliierten heranrückten, wurde vieles nach Altaussee in Österreich verfrachtet und dort in einem alten Salzstollen versteckt. Doch es war einfach zu viel, ein großer Teil der Kunstwerke musste in München zurückbleiben. Nach den Plünderungen waren die meisten dieser Werke weg. Etliches wurde im Lauf der letzten Jahre zwar mehr oder weniger freiwillig zurückgegeben, aber der große Rest ist bis jetzt nicht wiederaufgetaucht.«
»Georg hat was von einem Collecting Point erzählt«, wandte Karl ein. »Was ist das?«
»Eine Sammelstelle für geraubte Kunst. Die Amerikaner haben mehrere davon eingerichtet, die größte in München, im Gebäude neben dem Führerbau. Die Werke mussten ja erst identifiziert, ihre Eigentümer ausfindig gemacht werden, damit man ihnen ihren Besitz zurückgeben konnte. Was keineswegs immer möglich ist. Viele waren Juden und sind mit all ihren Angehörigen in den Lagern umgekommen. Wem gehören diese Werke also? Es war eine Sisyphusarbeit, zu der ich ein paar Jahre lang einen bescheidenen Beitrag leisten durfte.«
Karl wunderte sich, wie ungerührt Aldrich von den Lagern sprach. Vielleicht, weil er als Amerikaner weit weg gewesen war. Aber konnte man auch als Jude weit weg sein? Gott sei Dank hatte ich damit nie was zu tun, dachte Karl.
»Was sagen Sie zu dem Gerücht«, fragte er nun, »dass vor den Plünderern schon jemand anderes im Führerbau war und gezielt Kunst gestohlen wurde?«
»Was ich dazu sage?« Aldrich neigte sich vor und fuhr mit gedämpfter Stimme fort: »Eine Menge Leute wussten von dem Kunstschatz im Keller: Naziprominenz, Kunsthändler, aber auch einfache Angestellte und Wachleute. Gelegenheit macht bekanntlich Diebe.« Er rückte weiter vor, saß nur noch auf der Kante des Sessels. »Die Türen zu den Depots waren gut gesichert, es brauchte schon Spezialwerkzeug, um sie aufzubrechen. Zumindest, wenn man die Schlüssel nicht hat.« Er zwinkerte. »Augenzeugen wollen Lastkraftwagen vor den Gebäuden gesehen haben und Männer, die sie mit großen Kisten beluden.« Aldrich schaute auf seine Uhr. »Oh, schon!« Er richtete sich auf. »Es tut mir leid, Herr Wieners, ich muss los. Eigentlich bin ich schon zu spät.«
Sie standen beide auf, und Karl sah zu, wie Aldrich in den Trenchcoat schlüpfte. Doch er verfehlte immer wieder den Ärmel. »Sie verlieren Ihren Bleistift«, scherzte er, »und ich finde nicht in den Ärmel. Was wohl der gute alte Freud dazu sagen würde? Seien Sie doch so gut und helfen Sie mir.«
Karl ließ sich kein zweites Mal bitten.
»Wir können noch einmal reden, wenn ich mehr Zeit habe«, schlug Aldrich vor. »Auf Wiedersehen.« Ein kurzer, aber fester Händedruck, dann war er auch schon fort Richtung Ausgang. Doch auf halbem Weg blieb er stehen, kehrte um und sagte: »Eben fällt mir ein: Es gibt hier in München einen Galeristen, der Ihnen vielleicht mehr über den aktuellen Stand dieser Geschichte erzählen kann. Mohnhaupt ist sein Name. Bernhard Mohnhaupt. Die Adresse hab ich gerade nicht im Kopf, aber er steht sicher im Telefonbuch.«
Mohnhaupt, echote es in Karls Kopf. Wo hatte er den Namen schon einmal gehört?
Donnerstag, 6. April 1950
»Wenn ich die Akten richtig lese«, sagte Dr. Meilhammer und lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück, »dann haben wir nichts.«
»Nicht nichts«, antwortete Ludwig und wischte sich Asche vom Knie, »nur … zu wenig Etwas. Oder vielleicht auch zu viel.«
Meilhammer lachte auf. »In Ihnen steckt ja ein Sophist!«
»Wenn Sie mir jetzt noch sagen, was das ist, stimme ich gerne zu.«
»Machen Sie nicht auf dumm. Sie wissen ganz genau, was das ist.«
Ludwig hatte eine Ahnung, ließ es aber auf sich beruhen.
Meilhammer deutete auf Ludwigs Zigaretten, die dieser vorsorglich auf den Tisch gelegt hatte. »Darf ich?«
»Freilich.«
Seiner Frau zuliebe hatte Meilhammer mit dem Rauchen aufgehört. Doch eigentlich hatte er nur aufgehört, sich Zigaretten zu kaufen. Dafür schnorrte er bei jeder Gelegenheit.
»Haben Sie’s gehört?«, fragte Meilhammer, nachdem er sich die Zigarette angezündet hatte. »In der Goldschieberaffäre gibt’s jetzt einen Verhandlungstermin. Im Juni. Man darf gespannt sein, was da noch alles herauskommt.«
Ludwig seufzte leise. Die Goldschieberaffäre. Ein Skandal und zugleich eine Posse wie aus dem Kintopp. Wenn er es richtig wusste, hatten ein paar Hochstapler prominenten Münchner Persönlichkeiten Gold und Waren angeboten, die es gar nicht gab, und dafür deftige Vorauszahlungen kassiert, die dann bei der Geldübergabe angeblich geraubt worden waren. Die Krönung: Der ehemalige Polizeipräsident Pitzke war anscheinend auch verwickelt. Bestechlichkeit und Begünstigung im Amt lautete die Anklage.
»Wir leben in der Zeit der Hochstapelei.« Meilhammer blies genüsslich Rauch in die Büroluft. »Die Leute haben Angst, aber sie haben auch Hoffnungen. Keiner will was verpassen. Da haben Betrüger immer Hochkonjunktur.«
Ludwig mochte Meilhammer, auch wenn der sich für seinen Geschmack ein bisschen zu gerne reden hörte. Wenn man ihn nicht rechtzeitig einfing, bevor er sich warmgeredet hatte, nahm es kein Ende. »Sprechen wir lieber darüber, wie wir mit unserem Fall weitermachen«, sagte Ludwig.
»Schießen Sie los.«
Ludwig zündete sich auch eine Zigarette an. Was sollte er zu der Ermittlung sagen? Er hatte auf eine Eingebung von Meilhammer gehofft.
Otto Brandl hatte einfach zu viele Feinde. Seine Ehe war zerrüttet gewesen, seine Frau hasste ihn. Dito die Kinder, alle erwachsen. Seine Lkw fuhren für Schmuggler, und was man hörte, gab es dauernd Streit ums Geld. Wie man außerdem hörte, wäre Brandl wohl gerne viel größer ins Geschäft eingestiegen, aber die alten Platzhirsche ließen ihn nicht. Vielleicht wollte er es am Ende ein bisschen zu sehr. Unter den Nazis hatte er fleißig denunziert, vor allem Konkurrenten und wer ihm sonst in die Quere gekommen war. Er hatte sich an jüdischem Besitz bereichert, und die Fremdarbeiter, die man ihm zugeteilt hatte, hatte er übel schikaniert. Das einzig Gute, was sich über ihn sagen ließ, war, dass er dem katholischen Waisenhaus, in dem er selber seine Kindheit und Jugend verbracht hatte, jedes Jahr großzügig spendete. So viel wussten sie, und trotzdem gab es keine heiße Spur. Die Kollegen begannen schon, den Fall als brutalen Raubmord abzuhaken und den oder die Täter unter den verrohten Ausländern zu vermuten, von denen es viel zu viele in München gab.
»Offen gesagt«, gestand Ludwig schließlich, »ich hab keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen. Und ich weiß – das ist ein Armutszeugnis.«
»Unsinn. Sie leisten alle hervorragende Arbeit in der Morddienststelle. Sie ganz besonders, Herr Gruber.«
Ludwig seufzte. Wie konnte Meilhammer sagen, dass sie gute Arbeit leisteten, wenn nichts dabei herauskam? War es nicht das Ergebnis, das am Ende darüber Auskunft gab, ob man gut genug gewesen war? Ihn jedenfalls konnte das bloße Gefühl, das Beste gegeben zu haben, immer weniger zufriedenstellen. Und sogar wenn er und seine Kollegen ein Verbrechen aufklären konnten, blieb ein Rest an Unzufriedenheit zurück.
»Ihre Aufklärungsquote ist gut bis sehr gut«, lobte Meilhammer bedenkenlos weiter, »da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und was die Mordsache Brandl angeht: Wir bleiben natürlich dran. Gut’ Ding will Weile haben, und Justitia hat einen langen Atem. Nur tun uns die anderen Mörder und Totschläger in der Stadt leider nicht den Gefallen, mit ihren Taten zu warten, bis wir die Altfälle abgearbeitet haben. Sie wissen ja selbst …«
Nur zu gut. Das alte Lied. Personalmangel. Das fing schon bei den Sekretärinnen an. Und wenn man endlich jemanden bekam, dann war es einer wie Zöllner: versetzt aus einer Verwaltungsabteilung, fachfremd und auf die Schnelle angelernt.
»Ja, ja«, sagte Ludwig. »Ich muss dann auch wieder.«
Als er seine Zigaretten vom Tisch nahm, sagte Meilhammer mit einem honigsüßen Lächeln: »Ach, Herr Gruber, seien Sie so gut und lassen Sie mir eine da. Oder zwei.«
Dienstag, 11. April 1950
Magda prüfte ein letztes Mal, ob die Nähte ihrer Nylons richtig saßen, dann warf sie den Mantel über, nahm die Handtasche und verließ das Zimmer. Von unten drängte Lärm herauf, dazu Bierdunst und der Geruch von Zigaretten und Zigarren. Im Hinterzimmer ging es hoch her, eine Versammlung der Bayernpartei zu den Landtagswahlen im Herbst. Aus der Wirtsstube dagegen waberte die gedämpfte Behäbigkeit eines gewöhnlichen Wochentags in den Flur. Munter klackerten ihre Absätze auf der Treppe. Die Schuhe waren brandneu, italienisch, aus nicht ganz legaler Quelle, aber das sah und hörte man ihnen ja nicht an. Das Etuikleid aus schwarzem Satin, das sie unter dem Mantel trug, hatte sie selbst genäht. Es war schlicht, aber elegant, nach dem Vorbild des kleinen Schwarzen von Chanel. Sie freute sich schon auf die neidischen Blicke ihrer neuen Bekannten, mit denen sie sich gleich einen Film in der Schwabinger Filmburg ansah, und noch mehr auf das, was danach kam: die schmissige Musik in der Zelt Bar, die Cocktails und die attraktiven Herren.
Da vernahm sie hinter sich ein anerkennendes Pfeifen. Sie blieb stehen, drehte sich jedoch nur halb um. Veit stand am Ende des Gangs.
»Fesch«, sagte er. »Wo geht’s heute hin?«
Obwohl sie so tat, als sei es ihr unangenehm, dass er sie taxierte, fühlte sie sich von seinen Blicken geschmeichelt.
»Hauptsache hier raus«, antwortete sie.
»Du hast es gut. Du bist frei wie ein Vögelchen.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Man ist so frei, wie man sich fühlt.«
Damit stöckelte sie davon.
Die frische Abendluft ließ sie frösteln. Es schien, als wolle der Winter zurückkehren. Wenigstens hatte der böige Wind nachgelassen. Wenn sie sich beeilte, schaffte sie die Tram am Wiener Platz noch. Gut, dass die sowieso meist zu spät war. Sie zog die Lederhandschuhe über.
»Magda! Warte!«, rief jemand von der anderen Straßenseite herüber.
Georg Borgmann eilte auf sie zu. Wie jeden zweiten Dienstagabend im Monat traf er sich mit dreien seiner alten Schulfreunde zum Schafkopfen. Schnaufend kam er neben ihr zum Stehen, sein warmer Atem streifte ihre Wange. Es war ihr unangenehm, dass er sich immer so an sie herandrängte.
»Ich soll’s dir eigentlich nicht sagen«, begann er mit gedämpfter Stimme, »aber …«
»Was denn?«
Er trat noch näher und ergriff ihre Hand. »Er ist da.«
Sie wusste sofort, von wem die Rede war, doch sie wollte es erst glauben, wenn er den Namen aussprach und fragte deshalb: »Wer?«
»Dein Onkel Karl.«
Ihr Herz raste mit einem Mal. »Wieso das …? Ich dachte …« Sie konnte nur stammeln.
»Ich hab auch gedacht, dass er nicht angebissen hat. Aber auf einmal war er da. Ohne Vorankündigung.«
Magda versagte die Stimme.
Georg Borgmann trat von einem Bein aufs andere. »Es ist bloß so …«, druckste er herum, »wie soll ich sagen … der verlorene Sohn will nicht heim zu seiner Familie. Er hat mir sogar verboten, einem von euch zu sagen, dass er hier ist. Aber wenigstens du solltest es wissen. Schließlich bist du schuld.«
Magda überhörte den leisen Vorwurf. Dass Karl sich von seinen Verwandten fernhielt, verstand sie nur zu gut. »Wo ist er?«
»Bei mir. Schläft auf dem Sofa in der Küche. Bloß die ersten paar Nächte, hat er gesagt, vor Ostern wollte er weg sein. Aber Ostern ist rum, und er ist immer noch da, und es sieht nicht so aus, als würde er bald umsiedeln. Ich glaub, bevor er zu euch kommt, geht er lieber wieder zurück nach Berlin.«
Magda erschrak. Das durfte nicht passieren. »Ich lass mir was einfallen«, versprach sie.
»Und noch was. Dass ich ihn als Reporter für die Raubkunstsache haben will, nimmt er mir nicht ab. So leicht lässt sich der gute alte Karl nicht hinters Licht führen.«
»Wieso? Sie brauchen doch wirklich jemanden, der die Geschichte für Sie schreibt. Haben Sie selbst gesagt.«
Borgmann setzte ein herablassendes Lächeln auf. »Ja, schon, aber – Verzeihung – keinen Autor von Liebesromanen und Feuilletons.«
»Er ist der richtige Mann!«, brauste sie auf.
»Woher willst du das wissen, Madl? Du hast deinen Onkel einmal gesehen, da warst du wie alt? Neun?«
»Zehn.«
Seine Augen verengten sich. »Was willst du eigentlich von ihm? Er ist doch bloß ein Fremder für dich.«
Die Spitze traf. Doch sie ließ es sich nicht anmerken. »Was beschweren Sie sich überhaupt? Sie kriegen ihn für umsonst, sogar die Spesen ersetze ich Ihnen.«
Georg Borgmann nickte mit einem milden Lächeln, so als kenne er ihr junges Herz in Tiefen, die sogar ihr selbst fremd waren. Er setzte gerade an, etwas zu sagen, als jemand dazwischenrief: »Machst du dich schon wieder an die Jugend ran, Schorsch? Du alter Schwerenöter, du!«
Ludwig Gruber, auch ein Mitglied der Schafkopfrunde, näherte sich, im Sonntagsanzug, so wie stets, wenn er von der Probe des Kirchenchors kam. Die Mappe mit den Noten klemmte unter seinem Arm.
Borgmann wich einen Schritt von Magda zurück und schob beide Hände in die Hosentaschen. Er sagte noch irgendetwas Belangloses, vermutlich Witziges, weil er sein kehliges Lachen folgen ließ, aber Magda achtete nicht mehr darauf, rief bloß noch »Muss zur Tram« und war weg. Im Kopf nur einen einzigen Gedanken: Er ist da! Endlich ist er da!
»Er ist da«, sagte Kumpfmayer, der neben dem Wagen stand und eine Zigarette nach der anderen rauchte. Anscheinend machte es ihn nervös, seinem alten Chef nach so langer Zeit wieder unter die Augen zu treten. Verständlich, wenn man wusste, dass die ungeschriebenen Dienstverträge mit Walter Blohm eigentlich auf Lebenszeit geschlossen wurden und keine Kündigungsklausel enthielten. Ein wenig nervös war Emil auch. Er beschäftigte sich schon lange mit Walter Blohm, aber er war ihm noch nie zuvor begegnet.
Kumpfmayers Hinweis war völlig überflüssig. Die Scheinwerfer des nahenden Wagens waren in der pechschwarzen Dunkelheit nicht zu übersehen. Früher war das hier mal ein Lagerhaus gewesen, heute waren es nur noch ein paar verkohlte Mauern ohne Dach. Was es zum idealen Ort für ein konspiratives Treffen wie dieses machte.
Emil schaltete die Scheinwerfer des Horch ein, um sich zu erkennen zu geben. Nach einer Weile sah er den unverkennbaren Mercedes-Kühlergrill zwischen den nahenden Lichtern glänzen und darüber den Stern. Auch wenn er das Modell im Dunkeln nicht bestimmen konnte, war ihm doch bewusst, dass es sicher ein noch schönerer Wagen war als sein Horch.
Der Mercedes hielt ein Stück versetzt vor dem Horch, die Lichtkegel strahlten in verschiedene Richtungen und gingen dann kurz nach dem Motor des Mercedes aus. Danach wirkte die Dunkelheit noch ein wenig dunkler.
Emil stieg als Erster aus. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam wieder an die tiefe Finsternis. In weiser Voraussicht war er schon tagsüber hier gewesen, hatte sich das ganze Areal angesehen und genau eingeprägt. Er hörte, wie auch die Tür des Mercedes sich öffnete. Knirschende Schritte. Ein Schattenriss mit Hut. Er ging darauf zu. Man traf sich in der Mitte.
»Freut mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind«, sagte Emil höflich, aber ohne jede Unterwürfigkeit.
»Sie sollten daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen«, entgegnete Walter Blohm.
Die Sichel des abnehmenden Mondes schob sich in eine Wolkenlücke, so dass Emil in dem Hauch von Licht, den sie spendete, etwas mehr von Blohm erkennen konnte. Er war kleiner als Emil. Gedrungen, schien es ihm.
»Na, Herbert«, rief Blohm Kumpfmayer zu, »lange nichts von dir gehört. Bist du mir etwa untreu geworden?«
»Nein, Herr Blohm«, erwiderte Kumpfmayer eilfertig, ohne näherzukommen, »hat sich nur so … ergeben …«
War das ein Lächeln auf Blohms Lippen?
»Immer noch Ihr Mann, wenn Sie ihn brauchen«, versicherte Emil.
»Kommen wir zur Sache«, sagte Blohm. »Was haben Sie anzubieten?«
»Ein Geschäft, bei dem Sie aus zwei oder drei Millionen D-Mark fünfzig oder sechzig Millionen US-Dollar machen können«, erwiderte Emil kühl. »Vielleicht auch mehr.«
Emil glaubte auf Blohms Gesicht Staunen zu erkennen. Jedenfalls blieb es ein paar Sekunden lang still, bis Blohm fragte: »Wie soll das gehen?«
»Mit Kunst. Genauer gesagt mit den Beständen, die bei Kriegsende aus dem Führerbau verschwunden sind. Ich nehme an, Sie wissen davon.«
»Soll das heißen, Sie haben die Bilder?«
»Ich? Nein. Ich bin nur der Vermittler. Der Makler. Mein Auftraggeber will aus verständlichen Gründen im Hintergrund bleiben. Nicht einmal ich kenne seinen Namen. Es hat also keinen Sinn, mir Daumenschrauben anzulegen. Er ruft mich an, schickt Boten – so läuft das. Es geht zunächst nur um eine Anzahlung von hunderttausend D-Mark. Der Restbetrag wird später in Raten fällig, mit der schrittweisen Übergabe der Kunstwerke. Über die Modalitäten können wir noch verhandeln. Im Moment will mein Auftraggeber nur wissen, ob Sie grundsätzlich interessiert sind. Es gibt nämlich weitere Interessenten. Und leider sind nicht alle bereit, sich an die Regeln eines gepflegten Geschäftsgebarens zu halten.«
»Was meinen Sie?«
Mit dieser Frage zog sich die Mondsichel hinter eine Wolke zurück, nahm ihr bisschen Licht mit und ließ die Männer wieder in tiefster Schwärze zurück.
»Haben Sie vom Mord an Otto Brandl gehört? Natürlich haben Sie das. Jemand wollte so Druck ausüben. Und den Preis bestimmen.«
»Was hatte Otto Brandl mit der Sache zu tun?«
»Solche Dinge dürfen Sie mich nicht fragen. Ich weiß nur so viel: Er soll damals wohl beim Abtransport der Kunstwerke aus dem Führerbau geholfen haben. Mein Auftraggeber möchte am liebsten an einen seriösen Geschäftsmann wie Sie verkaufen, statt an skrupellose Menschen, für die Mord und Totschlag alltägliche Geschäftspraktiken sind. Und die zudem aus dem Ausland kommen.«
Blohm horchte auf. »Ausland? Woher?«
»Amerika, heißt es. Chicago.« Emil ließ die beiden Worte einen Moment wirken, ehe er fortfuhr: »Das Geschäft steht aufgrund dieser Situation unter einem gewissen Zeitdruck. Darf ich also Ihr Interesse übermitteln?«
»Unbedingt!«, erklärte Blohm.
Emil lächelte still. Auf Blohms Geltungssucht war Verlass. Dass er die amerikanischen Gangsterlegenden der Vorkriegszeit bewunderte – Leute wie Al Capone und Lucky Luciano, oder eher die Kinofassungen von ihnen –, war kein Geheimnis. Und auch dass er den Gedanken nicht ertrug, jemand anders könne ein besseres Geschäft machen als er. Er wollte als Visionär gelten, als der Mann mit dem besonderen Näschen.
»Dann ist das auch schon alles, was wir heute zu besprechen haben«, schloss Emil die Unterredung. »Ich melde mich wieder bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.«
»Ich habe zu danken.«
Die ausgestreckten Hände verfehlten sich in der Dunkelheit zuerst, ergriffen sich danach aber umso entschlossener.
Donnerstag, 13. April 1950
Karl wusste selbst, dass er schon viel zu lange so tat, als betrachte er das großformatige Bild im Schaufenster. Vielleicht musste man in einer gewissen Stimmung sein, um es würdigen zu können. Einer Stimmung, in der er gerade nicht war. Vor fünf Jahren hätte man es wohl noch als entartet im Keller verschwinden lassen oder gleich im Hinterhof verbrannt. Das Werk entstehe erst im Auge des Betrachters, hatte Heidi ihm mal die moderne Kunst erklärt. Das hatte er verstanden. Er betrachtete sein Spiegelbild in der Scheibe: ein Mann dünn wie ein Bleistift, in einem zerknitterten Mantel, die Krawatte schief, der Hut auf dem Kopf alt und verdrückt. Die Krawatte rückte er gerade, der Rest musste so gehen. Das Werk entsteht im Auge des Betrachters, dachte er mit einem Lächeln.
Er betrat die Galerie. Da nicht sofort jemand kam, schlenderte er ein wenig umher und sah sich die Bilder an. Eines zeigte eine dunkelhaarige Frau in einem blauen Kleid, mit einer Gießkanne in der Hand. Der Titel lautete: Gärtnerin. Der Name des Künstlers: Leonhardt Wüllfarth.
»Kann ich helfen oder wollen Sie sich nur umschauen?«
Karl erschrak und wandte sich um. Er hatte die adrette junge Rothaarige in dem enganliegenden Kostüm nicht kommen hören. Ihre Haut war leuchtend weiß wie Alabaster.
»Zwar nicht mehr ganz jung, der Künstler«, sagte sie, um das Schweigen zu brechen, in dem er verharrte, »aber man wird noch viel von ihm hören. Er hat beim ersten Deutschen Kunstpreisausschreiben einen zweiten Platz gemacht. Das heißt: Er wird im Wert steigen.«
»Schön für ihn«, gab Karl zurück. »Ich bin aber nicht wegen Ihrer Exponate hier. Mein Name ist Karl Wieners, ich würde gerne mit Herrn Mohnhaupt sprechen. Ist er da?«
»In welcher Angelegenheit?«
»Nun … wir kennen uns … flüchtig … aus Berlin.«
»Wenn Sie kurz warten wollen.«
Während die Rothaarige verschwand, betrat noch jemand die Galerie. Eine junge Frau. Offene schwarze Haare, große bernsteinfarbene Augen unter schmalen bogenförmigen Brauen, volle Wangen und Lippen. Vielleicht jüdisch, dachte er sofort. Und genau sein Fall. Sie trug ein schlichtes Wollkleid, darüber einen hellblauen Mantel, gepunktet von ein paar verirrten Regentropfen. Er musste sich zwingen, sie nicht länger als schicklich anzusehen, so attraktiv war sie. Das intensive Rot auf den Lippen der Vielleicht-Jüdin stach ins Auge. Wenn nicht alles täuschte, waren auch ihre Wimpern getuscht. War es denn schon wieder üblich, dass Frauen sich an einem gewöhnlichen Wochentag derart auffällig schminkten? Als sie ihn anlächelte, auf eine beinahe schon routinierte Art, drehte er sich abrupt weg.
Gerade da kam Bernhard Mohnhaupt herein. Halbglatze, Kugelbauch. Ein Ausbund großzügig besonnter Selbstzufriedenheit. Sein Anzug war gewiss maßgeschneidert. Feiner englischer Tweed. In seinen besten Tagen hatte Karl auch so etwas getragen. Anscheinend florierte der Kunsthandel schon wieder.
»Herr Wieners?«, fragte Mohnhaupt mit geschäftsmäßiger Freundlichkeit. »Wir kennen uns? Verzeihen Sie mir, wenn es mir nicht einfällt, aber im Moment …«
»Sie kennen weniger mich als meine Frau. Adelheid Wieners. Sie hat für das Berliner Auktionshaus Hambach gearbeitet. Friedrich Hambach war ihr Chef.«
»Natürlich! Und wann sind wir uns …?«
»Ich habe meine Frau zu einer Feierlichkeit begleitet, und dabei sind wir beide ins Gespräch gekommen. Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, am Tag zuvor einen alten Meister ersteigert. Das war kurz vor dem Krieg.«
»Ja, ja, ja«, sagte Mohnhaupt und legte die Stirn in Falten. »Ein alter Niederländer. Jan van Goyen, wenn ich nicht irre. Irgendeine Flusslandschaft. Sie sind Schauspieler?«
»Schriftsteller. Ich habe Ihnen für Ihre Gattin ein Buch signiert.«
»Richtig!«
»Wie geht es ihr übrigens? Und den Kindern? Ich hoffe …«
»Alle wohlauf. Unkraut vergeht nicht. Das ist meine Tochter.« Er wies auf die junge Frau im Kostüm. »Ganz die Mutter, zum Glück. Und wie geht es der werten Frau Wieners?«
»Nun …« Karl senkte den Blick. Sein Schweigen, das alles sagte, riss ein Loch in die Atmosphäre routinierter Fröhlichkeit, mit der sich der Kunsthändler umgab.
»Das tut mir leid. Schrecklich, schrecklich. Der Krieg. Es trifft immer die Falschen …« Ein paar Gedenksekunden lang rang er noch die Hände, dann kehrte Mohnhaupt auf trittsicheres Gelände zurück. »Was kann ich heute für Sie tun?«
»Es ist ein wenig heikel. Ich interessiere mich für verschwundene Kunst. Um genau zu sein: die Werke, die Ende April fünfundvierzig aus dem Führerbau gestohlen wurden. Sie haben ja sicher davon gehört.«
Bernhard Mohnhaupts Miene verhärtete sich beinahe schlagartig, alle freundliche Verbindlichkeit verflog. »Und wieso kommen Sie damit zu mir?«, fragte er vorsichtig. »Die Provenienz aller Werke in meinen Räumen ist lückenlos belegt.«
»Oh, nein!«, wehrte Karl ab. »Ich will damit nicht sagen, dass Sie … Ich hab nicht den leisesten Verdacht gegen Sie. Ich habe mit einem Amerikaner gesprochen, einem Mister Aldrich. Er hat mir Ihren Namen genannt. Er meinte, Sie hätten vielleicht … nun ja, Dinge gehört.«
»Ich? Wie kommt er denn darauf? Ich habe zu diesem Herrn schon seit Jahren keinen Kontakt mehr.«
»Kann ja sein. Aber Sie kennen viele Leute hier. Sammler. Händler. Sie können mir vielleicht sagen, wo ich suchen soll.«
Mohnhaupt sah Karl prüfend an. »Wofür brauchen Sie das? Sind Sie unter die Reporter gegangen?«
Karl wollte das schon bejahen, doch dann fiel ihm ein, dass er Mohnhaupt damit vielleicht nur weiter verschreckte. »Wo denken Sie hin. Ich recherchiere für einen neuen Roman. Er soll im Kunstmilieu spielen. Eine Kriminalgeschichte, frei nach wahren Begebenheiten. Sehr frei. Es geht lediglich um Hintergrundinformationen. Nichts davon wird veröffentlicht.«
Karl hatte die Erfahrung gemacht, dass viele Leute nur zu gerne an der Entstehung eines belletristischen Werkes beteiligt waren. Doch Bernhard Mohnhaupt schien nicht zu dieser Sorte Mensch zu gehören. Er blieb verschlossen wie ein zugeklapptes Buch. »Ich glaube nicht«, sagte er, »dass ich Ihnen dazu viel erzählen kann. Mir fehlt auch gerade die Zeit. Bei Fragen zu den hier ausgestellten Werken wenden Sie sich bitte an mein Fräulein Tochter. Sie wird Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Einen schönen Tag noch.«
Damit war er verschwunden. Karl stand unentschlossen da. Als Fräulein Mohnhaupt sich ihm näherte, entschied er sich, einen letzten Versuch zu unternehmen. »Ich bin wirklich Schriftsteller«, versicherte er. »Es geht nur um einen Roman.« War da etwa ein Anzeichen von Interesse auf ihrem Gesicht? »Sie können es sich ja überlegen«, sagte er, holte Block und Bleistift hervor und fing an zu schreiben. »Unter dieser Nummer bin ich zu erreichen. Das ist der Anschluss von Georg Borgmann. Dort wohne ich vorerst. Verlangen Sie einfach nach mir oder hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe zurück.« Er riss das Blatt heraus und reichte es ihr. Sie betrachtete das Geschriebene und faltete den Zettel zusammen, behielt ihn aber in der Hand. »Dann hoffentlich auf ein Wiedersehen«, verabschiedete er sich und wandte sich zur Tür.
Sein Blick fiel im Hinausgehen noch einmal auf die Vielleicht-Jüdin. Sie stand vor der Gärtnerin, sah jedoch ihn an, so als wolle sie etwas sagen. Er zögerte kurz, sie lächelte aber nur verlegen und drehte sich dem Bild zu. Darauf verließ er die Galerie.
Obwohl der frische Wind kühn unter ihren Mantel fuhr, ließ Magda ihn offen. Sie konnte etwas Abkühlung gebrauchen. Wo war Karl hin? Hatte sie ihn verloren? Nein. Keine hundert Meter vor ihr überquerte er gerade die Straße. Sie musste unbedingt an ihm dranbleiben, auch wenn sie nicht wusste, wohin das alles führen sollte. Was sie sich erhoffte. Er hatte nicht einmal auf ihre Briefe geantwortet, zumindest die nach dem Krieg nicht. Erst hatte sie befürchtet, dass er vielleicht tot sei, aber wären ihre Briefe dann nicht als unzustellbar zurückgekommen? Offensichtlich wollte er keinen Kontakt. Wieso hatte sie das nicht akzeptiert und die Sache auf sich beruhen lassen?
Sie ging ein wenig schneller, schloss zu ihrem Onkel auf. Er bog ab. Wo wollte er hin? Zur Tram? Nein, er passierte die Haltestelle. Bog wieder ab. Noch einmal. Hatte er überhaupt ein Ziel? Da vorne ist schon die Prinzregentenstraße, dachte sie. Will er in den Englischen Garten? Zu einem Spaziergang lud das nasskalte Wetter eigentlich nicht ein.
Sie sah ihn hinter der Ecke verschwinden und beschleunigte ihre Schritte. Ihr Herz pochte wild. Sie wünschte, sie hätte ihn schon in der Galerie angesprochen, so wie sie es eigentlich vorgehabt hatte. Seit wann war sie so feige? Er war nur ihr Onkel.
Ein feiner Stich fuhr ihr bei dem Gedanken ins Herz. Wen wollte sie eigentlich belügen? Selbst Georg Borgmann wusste, was los war. Heute Morgen, als er ihr mitteilte, dass Karl in die Galerie Mohnhaupt ging, hatte er das eine Gelegenheit für ein unverhofftes Rendezvous genannt, mit diesem gewissen Unterton. Nein, Unsinn! Georg Borgmann wusste überhaupt nichts. Ihre Gefühle waren viel komplizierter, als jemand wie er es sich vorzustellen vermochte.
Sie bog in die Prinzregentenstraße ein, erschrak und blieb stehen. Ihr Onkel Karl stand da, als warte er auf jemanden, und das tat er auch, wie seine Haltung ihr unzweifelhaft zeigte.
Und zwar auf sie.
All die Zickzackwege, wurde ihr klar, hatte er nur gemacht, um zu testen, ob sie ihm folgte.
Er trat auf eine Armeslänge an sie heran.
»Wieso laufen Sie mir nach?«, fragte er. »Wer sind Sie?«
»Magda«, antwortete sie mit belegter Stimme, räusperte sich, wiederholte: »Ich bin Magda. Deine Nichte.«
Magda. Die kleine Magda mit den bernsteinfarbenen Augen und den pechschwarzen Zöpfen. Er konnte es noch immer nicht fassen, dass sie es war, die neben ihm her spazierte. Ihre Augen waren noch so lebhaft wie früher, doch Zöpfe hatte sie keine mehr. Aus ihr war eine strahlende junge Frau geworden. Schweigend ging er an ihrer Seite durch den Englischen Garten und überließ ihr das Reden. Das meiste von dem, was sie erzählte, wusste er schon von Georg: ihr Vater Alfons, sein Bruder: in Russland gefallen; ihre Mutter, seine Schwägerin: auch tot; ihr Opa, sein Vater: gefallen im Volkssturm, der alte Narr; Onkel Veit, sein deutlich jüngerer Bruder: natürlich am Leben und wohlauf, Unkraut vergeht nicht, wie Galerist Mohnhaupt vorhin gesagt hatte. Veit arbeitete im Gasthaus, das, wie hätte es anders sein können, die Oma, seine Mutter, aus dem Hintergrund dirigierte.
Er hörte all dem nur mit einem Ohr zu, dachte lange Zeit an gar nichts, bis ihm an einer Brücke über den Schwabinger Bach einfiel, dass er hier zum ersten Mal ein Mädchen geküsst hatte. Er schaute sich um. War es nicht dort hinten gewesen, zwischen den Bäumen? Er wusste sogar noch den Namen des Mädchens: Erika Schüttler. Bäckerstochter aus der Au, ihr Haar roch nach Brot und ihre Haut nach Kümmel. Oder hatte er sich das bloß eingebildet, weil eine Bäckerstochter eben so riechen müsse? Den Kuss aber, den hatte er sich nicht eingebildet. Nicht die ungestüme Unbeholfenheit dabei und nicht den schamhaften Stolz danach.
»Ich muss dir ein Geständnis machen«, sagte Magda.
Er ging noch ein, zwei Schritte, bis er bemerkte, dass sie stehengeblieben war. »Was denn?«
»Ich war nicht zufällig in der Galerie. Herr Borgmann hat mich angerufen und mir gesagt, dass du hingehst. Er ist einmal im Monat bei uns zum Schafkopfen.«
Karl lächelte. »Ich hab schon so was geahnt.«
»Er hat mir auch erzählt, warum du hier bist. Und an was für einer Geschichte du für ihn arbeitest.«
»Ob daraus was wird …« Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin kein Reporter. Du hast ja selbst gesehen, wie dilettantisch ich mich in der Galerie angestellt hab.«
»Das hast du gar nicht! Und es war ja erst der Anfang. Nur Mut!« Sie lächelte ihn an. Nach einer Weile verblühte dieses Lächeln. »Ich weiß, was du verloren hast. Wir wissen es alle.«
Karl hatte es sich schon gedacht. Lange bevor Georg ihn in Berlin aufgesucht hatte, hatte er unverhofft in einer Eckkneipe einen anderen Bekannten aus der Haidhausener Zeit getroffen, Bier und Schnaps hatten beiderseits die Zunge gelöst und sie mehr erzählen lassen, als sie eigentlich wollten. Neben dem Kater am nächsten Morgen war da auch dieses schale Gefühl im Bauch gewesen, das er immer hatte, wenn er zu viel über Dinge redete, die besser unter tonnenschwerem Schweigen begraben liegen sollten.
»Wir haben alle was verloren«, sagte er vage.
»Die einen mehr, die anderen weniger.«
»Das macht keinen Unterschied. Das Leben muss weitergehen. Was es ja auch tut … irgendwie.«
»Und wann kommst du mal –« Sie brach ab, doch er wusste, was sie sagen wollte: nach Hause. Stattdessen vollendete sie: »zu uns?« Aber das sollte wohl heißen: zu mir.
Freitag, 14. April 1950
Es war noch dunkel, als Karl sich vom Sofa erhob. Er hatte kaum geschlafen. Die Begegnung mit Magda gestern hatte allerhand in ihm aufgewühlt. Bei ihrer Geburt hatte er noch in München gewohnt, doch er erinnerte sich nur an ein schreiendes Bündel in einer Wiege oder einem Kinderwagen. Der junge Kerl, der er damals war, hatte keinen Sinn für Säuglinge. Trotzdem war ihm jetzt, als habe er das kleine Ding manchmal auf seinem Schoß gehabt oder in seinen Armen gewiegt. Die einzige Begegnung, die man auch so nennen konnte und an die er sich bestens erinnerte, war 1938, kurz nach dem Anschluss, als er für einige Tage seine Familie in München besuchte. Er wusste noch, wie glücksbesoffen alle waren über die Heimkehr Österreichs ins Reich – nur Magda nicht. Sie war zehn, sie wusste nichts über Politik und doch so viel mehr als all die angeblich Erwachsenen, die sich in zügellose, grausame Kinder verwandelt hatten. Sie hatte eine natürliche Abneigung gegen Disziplin, brüllende Männer und die Farbe Braun. Das imponierte ihm. Und er imponierte ihr. Nein, sie verehrte ihn. Noch bevor sie ihn persönlich kennengelernt hatte, ihren Onkel aus Berlin, hatte sie ihn schon verehrt. Was sie nicht alles in ihm sah. Einen Künstler. Einen Abenteurer. Einen Helden. So wie die männlichen Hauptfiguren seiner Romane. Nichts davon war er wirklich, schon gar nicht so, wie sie dachte. Dennoch ließ er sie in dem Glauben. Heidi neckte ihn damit, dass er allzu anfällig sei für Schmeicheleien und Applaus, und was den Mann betraf, der er damals war, hatte sie recht. Magda und er schrieben sich ein ganzes Jahr lang, bis der Krieg begann. Dann schrieb sie noch ein paarmal, doch er antwortete nicht mehr.
Ob sie ihn immer noch so verehrte wie damals, nach all den Jahren? Lächerlich, das auch nur eine Sekunde zu glauben. Sie war eine erwachsene Frau, und wenn das stimmte, was Georg über sie erzählte, dann war sie kein Kind von Traurigkeit. Sein Glanz dagegen war verloschen. Ja, sie hing an ihm, aber wohl eher so, wie man an alten Erinnerungen hängt.
Karl fischte seine Zigaretten aus der Tasche seines Jacketts, das über dem Stuhl hing. Nur noch eine drin. Als sich der bläuliche Rauch Richtung Zimmerdecke schlängelte, holte er ein mit grobem Bindfaden zusammengehaltenes Bündel von fünf Briefen aus dem Koffer. Die Briefe, die Magda ihm nach dem Krieg geschrieben hatte. Alle ungeöffnet.
Leise knarrte die Tür in den Angeln. Georg stand neben ihm, in Schlafanzug und Pantoffeln, die Augen noch ganz klein.
»Schon auf?«, fragte er.
»Ich bin weg, bevor Inge aufwacht.«
»Das musst du nicht.«
»Ich will aber. Sie wird froh sein, und du hast einen entspannten Morgen.«
Karl drückte seine Zigarette im übervollen Aschenbecher aus, den er vergessen hatte zu leeren. Dann erhob er sich.
»Ich will diese Geschichte schreiben, Georg«, sagte er. »Ehrlich. Hab ein bisschen Geduld mit mir, du wirst es nicht bereuen.«
»Sicher. Vielleicht redest du mal mit Ludwig.«
»Ludwig? Welchem Ludwig?«
»Der Gruber Wig. Letzte Reihe, Reißzwecken auf dem Stuhl vom alten Anschütz?«
»Ach, der Ludwig.«
»Heute singt er im Kirchenchor. Er ist ein Kriminaler durch und durch. Kripo. Mord zwar, aber er kennt auch die Leute aus den anderen Abteilungen.«
Ludwig Gruber. Als Buben hatten sie und die anderen Haidhausener dauernd irgendeinen Unsinn ausgeheckt. Hatten den Großen die Luft aus den Reifen gelassen und Silvesterkracher in die Plumpsklos der Herbergshäuser geworfen.
Der Ludwig.
Karl versuchte, sich sein Gesicht vorzustellen. Es gelang ihm nicht.
Der Wind trieb den Regen unter den überdachten Querbahnsteig vor den Gleisen. Ludwig machte das nichts aus, aber er sah, wie Zöllner, der zusammen mit Gärtler die Seite zur Bayerstraße sicherte, seinen Mantelkragen hochklappte und die Hände in die Hosentasche schob. Und was für ein Gesicht er dabei machte! Der hätte am liebsten den ganzen Tag im warmen Büro gesessen und telefoniert. Oder wenn es sein musste, sogar Protokolle und Berichte getippt. Jetzt schaute er herüber. Ludwig gab ihm verstohlen ein Zeichen, dass er sich wieder näher an den Ausgang bewegen sollte, damit er alle, die kamen und gingen, besser im Blick hatte. Aber da war es ihm wahrscheinlich zu zugig.
Wo blieben die Zielpersonen bloß? Der Spitzel war sich sicher gewesen, dass der Verkauf der Wertsachen heute über die Bühne gehen würde. Wertvoller Schmuck, hatte es geheißen. Juwelen. Weil wegen zu vieler Krankmeldungen in der Fahndungsabteilung noch ein paar Männer gefehlt hatten, hatte Ludwig sich und Zöllner als Aushilfe angeboten. Natürlich ohne Zöllner vorher zu fragen. Leider sah es nicht so aus, als würde heute noch was passieren. Entweder die Hehler hatten Lunte gerochen oder ihnen war irgendwas dazwischengekommen. Eine halbe Stunde noch, schätzte Ludwig, dann brach Einsatzleiter Lutz die Aktion ab.
Ludwig ließ den Blick über die Bahnsteige und Gleise schweifen. Im Dunst dahinter schwebte die provisorisch geflickte Hackerbrücke wie ein Luftschiff. Man gewöhnt sich viel zu schnell an alles, dachte er. Vergisst, wie es war. Erst im letzten Jahr hatten sie die eiserne Überdachung über den Gleisanlagen abgebaut; oder besser das, was die Bomben davon übrig gelassen hatten. Heute wusste man kaum noch, wie die Halle ausgesehen hatte. Selbst die Mauertürme, die das Dach getragen hatten und jetzt nutzlos in die Höhe ragten, schienen ihren früheren Zweck bereits vergessen zu haben. Die kämen auch bald weg, hieß es.
Obacht! Ludwig schüttelte sich. Unnützes Sinnieren. Das war die Gefahr, wenn so ein Einsatz sich ewig hinzog. Man stand sich die Beine in den Bauch, und weil nichts passierte, lenkten einen alle möglichen Gedanken ab. Man musste aufmerksam bleiben. Immerzu. Sonst war man es im entscheidenden Moment nicht.
Plötzlich kam Hektik auf. Ludwig erschrak.
Was war da los? Ein Mann rannte zur Bahnhofshalle. »Halt«, schallte es, »stehen bleiben!«; und jemand rief: »Polizei!« Ahnungslose Passanten stoppten abrupt, die einen schauten verdutzt, andere traten zur Seite. Abseits dieses Geschehens bemerkte Ludwig einen Mann mit Ballonmütze und aufgeschnalltem Rucksack, der anfing zu rennen, und zwar genau in die andere Richtung, auf einen Bahnsteig zu. Es waren zwei Männer! Wo wollte der zweite hin? Über die Gleise und weg? Ludwig schaute sich nach den Kollegen um. Er sah niemanden. »Zöllner, hierher!«, schrie er noch, und schon rannte er los.
Er hetzte den Bahnsteig hinab, im Slalom zwischen den wartenden Leuten hindurch, manchmal stand ihm ein Koffer im Weg oder eine Tasche, er sprang in der Art eines Hürdenläufers einfach darüber hinweg. Seine Mantelschöße flatterten wie Flügel. Den Mann mit der Ballonmütze behielt er die ganze Zeit fest im Blick. Den kaufte er sich. Koste es, was es wolle!
Der andere war am Ende des Bahnsteigs angekommen. Er blieb kurz stehen und drehte sich um. Ein Ausländer, das sah Ludwig sofort, selbst auf diese Entfernung. Jetzt wusste er nicht, was er tun sollte, der Lump. Ludwig verlangsamte sein Tempo und griff unter sein Sakko, wo die Waffe im Halfter steckte. »Stehen bleiben!«, rief er. »Polizei!« Der Ausländer ließ sich auf die Bahnsteigkante hinab und rutschte hinunter auf das Gleisbett.
Ludwig hatte die Hand an der Dienstwaffe. Wenn er sie zog, musste er auch schießen. Er ließ die Waffe stecken. »Halt!«, befahl er dem Flüchtenden noch einmal. »Polizei!«
Der Ausländer rannte einfach weiter. Quer über die Gleise.
Ohne nachzudenken, sprang Ludwig auch runter vom Bahnsteig. Der andere lief immer geradeaus, zwischen den Gleissträngen, bis er auch die Bahnsteige des Starnberger Flügelbahnhofs hinter sich hatte. Dann zog er nach links rüber, zur Arnulfstraße, obwohl die Bayerstraße eigentlich näher gewesen wäre. Vielleicht, weil auf der Seite jemand auf ihn wartete? Oder bloß, weil er in Panik falsche Entscheidungen traf?
Dem Ausländer ging offenbar die Puste aus, er wurde langsamer, Ludwig holte auf. In den Muskeln ein Stechen wie von tausend heißen Nadeln. Die Lungen brannten bei jedem Atemzug. Fünfzehn, zwanzig Meter waren es noch, dann hatte er ihn.