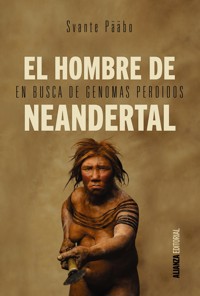17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch des Nobelpreisträgers überarbeitet und erweitert wieder lieferbar: Die aufregende Geschichte der Entschlüsselung des Neandertalergenoms und das Porträt einer faszinierenden Wissenschaft
Als Svante Pääbo und seinem Team eines Nachts 1996 die Entschlüsselung von genetischem Material aus dem jahrtausendealten Armknochen eines Neandertalers gelingt, machen sie eine unerwartete Entdeckung: Das Neandertaler-Material enthält DNA-Sequenzen, die im Vergleichsmaterial Tausender moderner Menschen noch nie gefunden wurden. Das lässt nur einen Schluss zu: Sie haben erstmals DNA eines ausgestorbenen Verwandten des Menschen gewonnen. Ein sensationeller Befund, der ein völlig neues Licht auf die Entwicklung des Menschen wirft, und ein Höhepunkt in Pääbos vielfach preisgekröntem Forscherleben, das mit der Arbeit an ägyptischen Mumien, Höhlenbären und Mammuts begann. In »Die Neandertaler und wir« schildert der 2022 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler die faszinierende Arbeit an urzeitlicher DNA in dem von ihm maßgeblich begründeten Feld der Paläogenetik. Ein spannendes Stück Forschungsgeschichte ist damit in aktualisierter Form wieder erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Als Svante Pääbo und seinem Team eines Nachts 1996 die Entschlüsselung von genetischem Material aus dem jahrtausendealten Armknochen eines Neandertalers gelingt, machen sie eine unerwartete Entdeckung: Das Neandertaler-Material enthält DNA-Sequenzen, die im Vergleichsmaterial Tausender moderner Menschen noch nie gefunden wurden. Das lässt nur einen Schluss zu: Sie haben erstmals DNA eines ausgestorbenen Verwandten des Menschen gewonnen. Ein sensationeller Befund, der ein völlig neues Licht auf die Entwicklung des Menschen wirft, und ein Höhepunkt in Pääbos vielfach preisgekröntem Forscherleben, das mit der Arbeit an ägyptischen Mumien, Höhlenbären und Mammuts begann. In Die Neandertaler und wir schildert der 2022 mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftler die faszinierende Arbeit an urzeitlicher DNA in dem von ihm maßgeblich begründeten Feld der Paläogenetik.
Autor
Svante Pääbo, geboren 1955 in Stockholm, ist Mediziner, Biologe und Begründer der Paläogenetik, der für seine bahnbrechende Forschung zum Genom der Neandertaler 2022 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Nach Stationen an der University of California in Berkeley und an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist er seit 1997 Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und seit 1999 Honorarprofessor für Genetik und Evolutionsbiologie an der Universität Leipzig.
Svante Pääbo
DieNeandertalerund wir
Meine Suchenach den Urzeit-Genen
Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2014 unter dem TitelNeanderthal Man. In Search of Lost Genomes bei Basic Books, New York. Eine erste deutschsprachige Ausgabe erschien 2014.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2014 Svante Pääbo
Copyright © der deutschsprachigen Neuausgabe 2024 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Picture Alliance / dpa / Max-Planck-Institut / Frank Vinken
Bildbearbeitung: Lorenz+Zeller GmbH, Inning a. Ammersee
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31229-9V001
www.dva.de
Für Linda, Rune und Freja
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Kapitel 1 Neandertaler ex machina
Kapitel 2 Mumien und Moleküle
Kapitel 3 Die Vergangenheit vervielfältigen
Kapitel 4 Dinosaurier im Labor
Kapitel 5 Die Frustration des Menschen
Kapitel 6 Eine Kroatien-Connection
Kapitel 7 Ein neues Zuhause
Kapitel 8 Multiregionale Meinungsverschiedenheiten
Kapitel 9 Kerntests
Kapitel 10 Auf dem Weg zum Kern
Kapitel 11 Das Genomprojekt beginnt
Kapitel 12 Harte Knochen
Kapitel 13 Der Teufel im Detail
Kapitel 14 Das Genom wird kartiert
Kapitel 15 Von Knochen zum Genom
Kapitel 16 Genfluss?
Kapitel 17 Erste Erkenntnisse
Kapitel 18 Genfluss!
Kapitel 19 Die Verdrängungshorde
Kapitel 20 Das Wesen des Menschen?
Kapitel 21 Das Genom wird veröffentlicht
Kapitel 22 Ein sehr ungewöhnlicher Finger
Kapitel 23 Ein Verwandter der Neandertaler
Nachbemerkung
Dank
Anmerkungen
Register
Vorwort zur Neuausgabe
Seit ich dieses Buch geschrieben habe, haben wir viel gelernt und gleichzeitig sehr wenig.
Wir besitzen jetzt einige zusätzliche Neandertalergenome von hoher Qualität. Aus diesen und einer größeren Anzahl von Genomen von bescheidenerer Qualität haben wir gelernt, dass Neandertaler in kleinen Gruppen lebten, dass ihre Frauen mehr als ihre Männer zwischen den Gruppen wechselten und dass die Neandertaler im Osten irgendwann vor mehr als 60000 Jahren durch Neandertaler aus dem Westen ersetzt wurden.
Wir haben immer noch nur ein Denisova-Genom von hoher Qualität aus der Denisova-Höhle, aber mindestens ein weiteres wird gerade sequenziert. Der erste direkte Beleg für Denisova-Menschen außerhalb der Denisova-Höhle wurde in Form von DNA in Höhlensedimenten an einem Ort in Tibet gefunden. Ein über 160000 Jahre alter Unterkiefer, der in derselben Höhle gefunden wurde, stammt sehr wahrscheinlich von einem Denisova-Menschen. Es ist erstaunlich, dass Denisova-Menschen wahrscheinlich über Tausende von Jahren auf einer Höhe von über 3000 Metern lebten. Einige von ihnen haben sich anscheinend an das Leben in großen Höhen angepasst und den Vorfahren der heutigen Tibeter eine genetische Variante beigesteuert, die für das Leben in Gebieten mit weniger Sauerstoff in der Atmosphäre hilfreich ist.
Wir haben einiges auch über genetische Beiträge von Neandertalern gelernt, die die Menschen heute beeinflussen. Einige erhöhen die Schmerzempfindlichkeit, andere verringern das Risiko von Fehlgeburten, und wieder andere beeinflussen die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. Zu Beginn der COVID-Pandemie war ich erstaunt, als Hugo Zeberg, ein brillanter Mediziner, der auch ein begnadeter Bioinformatiker ist, entdeckte, dass ein DNA-Segment, welches das Risiko, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus schwer zu erkranken, deutlich erhöht, von Neandertalern stammt. Dieser Beitrag der Neandertaler ist für über eine Million »zusätzliche« Todesfälle in der Pandemie verantwortlich. Wir und andere tun jetzt, was wir können, um herauszufinden, warum er das Risiko erhöht, schwer zu erkranken. Wenn wir das verstehen würden, könnte man vielleicht schweres COVID besser behandeln.
Hugo, der mittlerweile ein enger Freund der Familie geworden ist, stellte auch fest, dass diese Neandertaler-Variante paradoxerweise das Risiko einer HIV-Infektion senkt. Dies zeigt, dass die meisten genetischen Varianten nicht nur gut oder nur schlecht sind. Wie sie sich auf uns auswirken, hängt von der Umgebung ab, in diesem Fall, welchem Virus wir ausgesetzt sind. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die die Sinnlosigkeit aller fantastischen Pläne zur »Verbesserung« von Menschen durch Veränderungen in ihren Genomen verdeutlichen.
Wir wissen noch immer so gut wie nichts darüber, was den modernen Menschen von seinen archaischen Verwandten unterscheidet. Wir haben einige Veränderungen gefunden, die die Neigung zu entzündlichen Erkrankungen beim modernen Menschen verringern, und andere, die beeinflussen, wie sich Stammzellen früh in der Gehirnentwicklung teilen. Aber wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen die Funktionsweise des erwachsenen Gehirns beeinflussen.
Es wird aber zunehmend klar, da Hunderttausende Genome von heutigen Menschen verfügbar werden, dass die meisten der genetischen Veränderungen, von denen wir dachten, dass sie heute bei allen Menschen vorhanden sind, bei einigen wenigen Individuen fehlen, oft als Folge des Genflusses von Neandertalern. Manchmal haben sogar solche »archaischen« Genvarianten in einigen kleinen Populationen, wahrscheinlich zufällig, sogar erhebliche Häufigkeiten erreicht. Wir beginnen einzusehen, dass wir alle »moderne« Menschen sind, obwohl viele oder die meisten von uns einige »archaische« genetische Varianten als Erinnerung an unsere tiefen evolutionären Wurzeln tragen. Ich hoffe jedoch immer noch, dass wir zumindest einige Aspekte davon verstehen werden, wie der »Cocktail« moderner genetischer Varianten dazu geführt hat, dass moderne Menschen und nicht Neandertaler oder Denisova-Menschen auf ihre außergewöhnliche historische Reise gegangen sind, deren Ende noch nicht in Sicht ist.
Kapitel 1Neandertaler ex machina
An einem späten Abend im Jahr 1996 – ich lag im Bett und war gerade eingeschlafen – klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Matthias Krings, ein Doktorand in meinem Labor am Zoologischen Institut der Universität München. Er sagte nur: »Es ist kein Mensch.«
»Ich komme«, murmelte ich, zog mir ein paar Kleidungsstücke an und fuhr quer durch die Stadt zum Institut. Am Nachmittag hatte Matthias unsere DNA-Sequenzierautomaten in Gang gesetzt und sie mit DNA-Bruchstücken gefüttert, die er aus einem kleinen Stück eines Neandertaler-Armknochens aus dem Rheinischen Landesmuseum in Bonn gewonnen und vervielfältigt hatte. Nach jahrelangen, meist enttäuschenden Befunden hatte ich gelernt, meine Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Bei dem Material, das wir gewonnen hatten, handelte es sich höchstwahrscheinlich um bakterielle oder menschliche DNA, die irgendwann in den 140 Jahren, seit man den Knochen ausgegraben hatte, in ihn eingedrungen war. Aber Matthias hatte am Telefon aufgeregt geklungen. Hatte er möglicherweise doch genetisches Material eines Neandertalers gefunden? Darauf zu hoffen, wagte ich nicht.
Im Labor traf ich neben Matthias auch Ralf Schmitz, einen jungen Archäologen, mit dessen Hilfe wir die Genehmigung erhalten hatten, dem Neandertalerfossil aus dem Bonner Museum ein kleines Stück des Armknochens zu entnehmen. Als die beiden mir die Reihen von As, Cs, Gs und Ts zeigten, die aus dem Sequenzierapparat kamen, konnten sie ihre Begeisterung kaum verbergen. So etwas hatten weder sie noch ich schon einmal gesehen.
Was für den Uneingeweihten wie eine Zufallsfolge aus vier Buchstaben aussieht, ist in Wirklichkeit eine Kurzschreibweise für die chemische Struktur der DNA, des genetischen Materials, das in nahezu jeder Körperzelle gespeichert ist. Die beiden Stränge der berühmten DNA-Doppelhelix bestehen aus Bausteinen, in denen die Nucleotide Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin enthalten sind, abgekürzt A, T, G und C. Die Reihenfolge dieser Nucleotide bildet die genetische Information, die notwendig ist, damit unser Körper entstehen und seine Funktionen ausführen kann. Bei dem DNA-Abschnitt, den wir hier vor uns hatten, handelte es sich um einen Teil des Mitochondriengenoms – der mitochondrialen DNA oder kurz mtDNA –, das mit den Eizellen aller Mütter auf ihre Kinder weitergegeben wird. Mehrere Hundert Kopien davon liegen in den Mitochondrien, winzigen Strukturen im Inneren der Zelle, und beinhalten die Information, die diese Strukturen brauchen, um ihre Funktion – die Energieproduktion – zu erfüllen. Jeder von uns trägt in seinem Organismus nur einen Typ der mtDNA; sie macht nicht mehr als 0,0005 Prozent unseres Genoms aus. Da wir in jeder unserer Zellen viele Tausend Kopien dieses einen DNA-Typs enthalten, lässt sie sich besonders einfach untersuchen – im Gegensatz zum Rest unserer DNA, von der in jedem Zellkern nur zwei Kopien vorhanden sind, wobei eine von der Mutter und eine vom Vater stammt. Im Jahr 1996 hatte man bereits die Sequenzen der mtDNA einiger Tausend Menschen aus der ganzen Welt analysiert. Die so gewonnenen Sequenzen verglich man in der Regel mit der ersten menschlichen mtDNA-Sequenz, die man ermittelt hatte, und anhand dieser gemeinsamen Referenzsequenz konnte man in einer Liste aufführen, welche Abweichungen sich an welchen Positionen befanden. Wir waren so aufgeregt, weil die Sequenz aus dem Neandertalerknochen einige Abweichungen enthielt, die man unter Tausenden von Menschen noch nie beobachtet hatte. Ich mochte kaum glauben, dass das, was wir hier sahen, echt war.
Wie immer, wenn ich es mit einem spannenden oder unerwarteten Befund zu tun habe, quälten mich schon wenig später die Zweifel. Ich suchte nach irgendeinem Grund, warum unser Ergebnis falsch sein konnte. Vielleicht hatte jemand die Knochen irgendwann einmal mit einem Leim aus Kuhhaut behandelt, und wir sahen jetzt die mtDNA einer Kuh. Nein: Sofort überprüften wir die Rinder-mtDNA (die andere bereits sequenziert hatten) und sahen, dass sie anders war. Die neue mtDNA-Sequenz war eindeutig mit den menschlichen Sequenzen verwandt, unterschied sich aber geringfügig von ihnen allen. Allmählich glaubte ich, dass wir hier tatsächlich zum ersten Mal einen DNA-Abschnitt einer ausgestorbenen Form der Menschen gewonnen und sequenziert hatten.
Wir öffneten eine Flasche Sekt, die wir im Frühstücksraum des Labors im Kühlschrank hatten. Eines wussten wir genau: Wenn wir es hier tatsächlich mit Neandertaler-DNA zu tun hatten, eröffneten sich gewaltige Möglichkeiten. Vielleicht würde man eines Tages ganze Gene oder irgendein bestimmtes Gen der Neandertaler mit den entsprechenden Genen heute lebender Menschen vergleichen können. Als ich zu Fuß durch das nächtliche, stille München nach Hause ging (ich hatte so viel Sekt getrunken, dass ich nicht mehr fahren konnte), mochte ich immer noch kaum glauben, was geschehen war. Ich ging zu Bett, konnte aber nicht schlafen. Immer noch musste ich an die Neandertaler und an die Probe denken, deren mtDNA wir anscheinend gerade dingfest gemacht hatten.
Im Jahr 1856, drei Jahre bevor DarwinsDieEntstehung der Arten erschien, räumten Arbeiter im Neandertal, ungefähr zwölf Kilometer östlich von Düsseldorf, in einem Steinbruch eine kleine Höhle aus. Dabei entdeckten sie eine Schädeldecke und einige Knochen, von denen sie glaubten, sie stammten von einem Bären. Wenige Jahre später jedoch wurde klar, dass die Überreste zu einer ausgestorbenen Form von Menschen gehörten, die vielleicht unsere Vorfahren waren. Die Entdeckung erschütterte das Weltbild der Naturforscher, denn es war das erste Mal, dass man solche Hinterlassenschaften beschrieben hatte. Seither beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesen Knochen und vielen anderen, die ihnen ähneln und seither gefunden wurden; man will wissen, wer die Neandertaler waren, wie sie lebten, warum sie vor rund 30000 Jahren verschwanden und in welcher Beziehung unsere modernen Vorfahren, mit denen sie in Europa jahrtausendelang zusammenlebten, zu ihnen standen: Waren sie Freund oder Feind, unsere Vorfahren oder einfach längst verschwundene Vettern? (Abb. 1.1) Faszinierende Anhaltspunkte für Verhaltensweisen, die auch uns vertraut sind – Versorgung von Verletzten, rituelle Bestattungen und vielleicht auch das Musizieren –, kristallisierten sich aus den archäologischen Fundstätten heraus und machten deutlich, dass die Neandertaler uns viel stärker ähnelten als alle heutigen Menschenaffen. Aber wie ähnlich waren sie? Ob sie sprechen konnten, ob sie einen abgestorbenen Ast im Stammbaum der Homininen darstellten oder ob einige ihrer Gene sich noch heute in uns verbergen – all diese Fragen sind zu einem unverzichtbaren Teil der Paläoanthropologie geworden, jenes Fachgebiets, von dem man mit Fug und Recht behaupten kann, es habe mit der Entdeckung der Knochen im Neandertal begonnen. Und jetzt waren wir offensichtlich in der Lage, aus ihnen genetische Information zu gewinnen.
Abb. 1.1: Das rekonstruierte Skelett eines Neandertalers (links) und eines heutigen Menschen (rechts). Bildnachweis: Ken Mowbray, Blaine Maley, Ian Tattersall, Gary Sawyer, American Museum of Natural History.
So interessant diese Fragen für sich genommen schon waren, so hatte ich doch den Eindruck, dass der Neandertalerknochen eine noch größere Überraschung bereithielt. Die Neandertaler sind die engsten ausgestorbenen Verwandten der heutigen Menschen. Wenn wir ihre DNA analysieren konnten, würden wir zweifellos feststellen, dass ihre Gene den unseren sehr ähnlich waren. Einige Jahre zuvor hatte meine Arbeitsgruppe zahlreiche DNA-Fragmente aus dem Schimpansengenom sequenziert und damit nachgewiesen, dass sich in den DNA-Sequenzen, die wir mit den Schimpansen gemeinsam haben, nur etwas mehr als ein Prozent der Nucleotide unterscheiden. Die Neandertaler mussten uns natürlich noch viel näher stehen. Aber – und das war ungeheuer spannend – unter den wenigen Abweichungen, mit denen wir im Neandertalergenom rechneten, mussten genau jene sein, durch die wir uns von allen früheren Menschenvorläufern unterscheiden: nicht nur von den Neandertalern, sondern auch vom Jungen von Turkana, der vor rund 1,6 Millionen Jahren lebte, von Lucy vor 3,2 Millionen Jahren, vom Pekingmenschen vor mehr als einer halben Million Jahre. Diese wenigen Unterschiede mussten die biologische Basis für die vollkommen neue Entwicklungsrichtung bilden, die unsere Abstammungslinie mit der Entstehung der Jetztmenschen einschlug: für das Aufkommen einer Technologie, die sich schnell weiterentwickelte, für Kunst in der Form, die wir heute sofort als solche erkennen, und vielleicht auch für Sprache und Kultur, wie sie uns heute vertraut sind. Wenn wir die Neandertaler-DNA analysieren konnten, lagen alle solche Erkenntnisse in Reichweite. Versunken in derartige Träume (oder im Größenwahn), schlief ich bei Sonnenaufgang schließlich ein.
Am nächsten Tag kamen Matthias und ich erst spät ins Labor. Wir überprüften noch einmal die DNA-Sequenz vom Abend vorher, um sicherzugehen, dass wir keine Fehler gemacht hatten; dann setzten wir uns zusammen und überlegten, was als Nächstes zu tun war. Die Sequenz aus einem kleinen Stück der mtDNA zu gewinnen, die interessant aussah und aus einem Neandertalerfossil stammte, war das eine; ganz etwas anderes war die Aufgabe, uns selbst – vom Rest der Welt ganz zu schweigen – davon zu überzeugen, dass es sich um die mtDNA eines Individuums handelte, das (in diesem besonderen Fall) vor rund 40000 Jahren gelebt hatte. Wie der nächste Schritt aussehen musste, war mir aufgrund meiner Arbeiten der letzten zwölf Jahre ziemlich klar. Zuerst mussten wir das Experiment wiederholen – und zwar nicht nur den letzten Schritt, sondern alle Schritte, ausgehend von einem neuen Knochenstück; nur so konnten wir nachweisen, dass die von uns ermittelte Sequenz kein Zufallstreffer war, der auf ein übel beschädigtes und abgewandeltes modernes mtDNA-Molekül in dem Knochen zurückging. Und zweitens mussten wir die mtDNA-Sequenz erweitern, indem wir aus dem Knochenextrakt überlappende DNA-Fragmente gewannen. Dies würde uns in die Lage versetzen, eine längere mtDNA-Sequenz zu rekonstruieren, und dann konnten wir erste Schätzungen darüber anstellen, wie stark sich die mtDNA von Neandertalern und heutigen Menschen unterscheidet. Anschließend musste ein dritter Schritt folgen. Ich selbst hatte oft erklärt, dass außergewöhnliche Behauptungen über DNA-Sequenzen aus alten Knochen auch außergewöhnliche Belege erforderten – die Ergebnisse mussten in einem anderen Institut nachvollzogen werden, ein ungewöhnlicher Schritt in einem so stark von Konkurrenz geprägten Fachgebiet der Wissenschaft. Die Behauptung, wir hätten Neandertaler-DNA gewonnen, würde sicher als außergewöhnlich gelten. Um eine unbekannte Fehlerquelle in unserem Institut auszuschließen, mussten wir einen Teil des kostbaren Knochenmaterials an ein Labor weitergeben, das von unserem unabhängig war, und dann darauf hoffen, dass man dort unsere Befunde reproduzieren konnte. Über all das sprach ich mit Matthias und Ralf. Wir schmiedeten Pläne für die weitere Arbeit und schworen uns auf absolute Geheimhaltung außerhalb unserer Arbeitsgruppe ein. Wir wollten keinerlei Aufmerksamkeit erregen, bevor wir ganz sicher waren, dass wir gefunden hatten, was wir behaupteten.
Matthias machte sich sofort an die Arbeit. Nachdem er fast drei Jahre vergeblich versucht hatte, DNA aus ägyptischen Mumien zu gewinnen, war er jetzt angesichts der Erfolgsaussichten voller Energie. Ralf wirkte frustriert: Er musste zurück nach Bonn und konnte nichts anderes tun, als auf Nachrichten über unsere Befunde zu warten. Ich versuchte, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren, aber meine Gedanken von dem abzuwenden, was Matthias tat, fiel mir schwer.
Matthias’ Aufgabe war jetzt alles andere als einfach. Schließlich hatten wir es nicht mit der intakten, jungfräulichen DNA zu tun, die man aus der Blutprobe eines lebenden Menschen gewinnen kann. Das ordentliche, säuberliche doppelsträngige DNA-Helixmolekül aus den Lehrbüchern, in dem die Nucleotide A, T, G und C in Form komplementärer Paare (Adenin mit Thymin, Guanin mit Cytosin) an die beiden Zucker-Phosphat-Ketten gebunden sind, wird nicht als unveränderliche chemische Struktur in den Zellkernen und Mitochondrien unserer Zellen gespeichert. Die DNA erleidet vielmehr ständige chemische Schädigungen, die von raffinierten Mechanismen erkannt und repariert werden. Außerdem sind DNA-Moleküle sehr lang. Jedes Chromosom der 23 Paare im Zellkern besteht aus einem ungeheuer großen DNA-Molekül; die Gesamtlänge eines Satzes von 23 Chromosomen addiert sich auf ungefähr 3,2 Milliarden Nucleotidpaare. Da der Zellkern zwei Kopien des Genoms besitzt – jede davon ist in einem der beiden Sätze aus 23 Chromosomen gespeichert, von denen wir den einen von unserer Mutter, den anderen vom Vater erben –, enthält er insgesamt ungefähr 6,4 Milliarden Nucleotidpaare. Im Vergleich dazu ist die mitochondriale DNA mit etwas mehr als 16500 Nucleotidpaaren winzig klein. Da wir es jedoch mit sehr alter mtDNA zu tun hatten, war die Sequenzierung dennoch eine große Herausforderung.
Die Schädigung, die in DNA-Molekülen des Zellkerns oder der Mitochondrien am häufigsten auftritt, ist der Verlust einer chemischen Komponente – einer Aminogruppe – aus dem Cytosin-Nucleotid (C), das sich dadurch in das unnatürliche Nucleotid Uracil (abgekürzt U) verwandelt. In den Zellen gibt es Enzymsysteme, die solche Us entfernen und wieder durch das richtige Nucleotid C ersetzen. Die beseitigten U-Moleküle enden als Abfallstoffe der Zelle, und durch die Analyse geschädigter, mit dem Urin ausgeschiedener Nucleotide konnte man berechnen, dass sich in jeder Zelle an jedem Tag ungefähr 10000 Cs in Us verwandeln, die dann entfernt und ausgetauscht werden. Und das ist nur eine von mehreren Formen chemischer Angriffe, denen unser Genom ausgesetzt ist. Unter anderem gehen auch Nucleotide verloren, so dass Leerstellen entstehen, die sehr schnell zu Brüchen in den DNA-Molekülsträngen führen. Bekämpft werden sie von Enzymen, die solche fehlenden Nucleotide wieder einsetzen, bevor es zum Bruch kommt. Ist der Bruch bereits vorhanden, stellen andere Enzyme neue Verbindungen zwischen den DNA-Molekülen her. Würde das Genom in unseren Zellen nicht von solchen Reparatursystemen instand gehalten, es würde nicht einmal eine Stunde lang unversehrt bleiben.
Die Reparatursysteme brauchen natürlich Energie für ihre Tätigkeit. Wenn wir sterben, atmen wir nicht mehr; den Zellen in unserem Körper geht der Sauerstoff aus, und entsprechend geht auch ihre Energie zur Neige. Damit kommt die DNA-Reparatur zum Stillstand, und nun häufen sich schnell verschiedenartige Schäden an. Neben den spontanen chemischen Schädigungen, die auch in lebenden Zellen ständig stattfinden, kommen nach dem Tod, wenn die Zersetzung der Zellen beginnt, noch andere Schäden hinzu. Lebende Zellen haben unter anderem die entscheidende Aufgabe, in ihrem Inneren verschiedene Reaktionsräume (Kompartimente) aufrechtzuerhalten, in denen Enzyme und andere Substanzen voneinander getrennt werden. Manche derartigen Kompartimente enthalten Enzyme, die DNA-Stränge schneiden können und für bestimmte Reparaturvorgänge notwendig sind. In anderen liegen Enzyme, die DNA verschiedener Mikroorganismen abbauen können, nachdem die Zelle in Kontakt mit ihnen gekommen ist und sie in sich aufgenommen hat. Wenn ein Organismus stirbt und keine Energie mehr erzeugt, zerfallen die Membranen der Kompartimente, so dass die Enzyme austreten und die DNA unkontrolliert abbauen. Innerhalb der ersten Stunden oder Tage nach dem Tod werden die DNA-Stränge in unserem Körper in immer kleinere Stücke zerlegt, und gleichzeitig häufen sich auch andere Schäden an. Gleichzeitig können Bakterien, die in unserem Darm und in der Lunge leben, sich unkontrolliert vermehren, weil der Körper nicht mehr die Schranken aufrechterhält, durch die sie normalerweise im Zaum gehalten werden. Gemeinsam sorgen alle diese Prozesse dafür, dass die in unserer DNA gespeicherte genetische Information sich auflöst – jene Information, die dafür gesorgt hat, dass unser Körper entstehen konnte, instand gehalten wurde und funktioniert hat. Am Ende dieses Prozesses sind die letzten Spuren unserer biologischen Einzigartigkeit verschwunden. In gewisser Weise ist unser körperlicher Tod erst dann vollendet.
Andererseits enthält aber fast jede der vielen Billionen Zellen unseres Körpers unsere gesamte DNA-Ausstattung. Wenn also die DNA einiger Zellen in irgendeiner abgelegenen Ecke unseres Körpers der vollständigen Zersetzung entgeht, überlebt eine Spur unserer genetischen Information. Die enzymatischen Prozesse, die für den Abbau und die Abwandlung der DNA sorgen, funktionieren beispielsweise nur mit Wasser. Trocknen einige Teile unseres Körpers aus, bevor der DNA-Abbau abgelaufen ist, kommen die Prozesse zum Stillstand, und dann können einzelne Stücke unserer DNA auch länger erhalten bleiben. Das geschieht beispielsweise, wenn der Körper an einen trockenen Ort gelangt und zur Mumie wird. Eine solche Ganzkörper-Austrocknung kann zufällig stattfinden, weil der Körper in eine geeignete Umgebung gelangt ist, oder man kann sie auch gezielt herbeiführen. Am berühmtesten war die rituelle Mumifizierung von Toten im alten Ägypten: Dort wurden in der Zeit vor 5000 bis 1500 Jahren mehrere Hunderttausend Leichen einbalsamiert, damit ihre Seelen nach dem Tod in den Mumien noch eine Heimstatt finden konnten.
Aber auch wenn es nicht zur Mumifizierung kommt, können manche Körperteile, beispielsweise Knochen und Zähne, nach der Bestattung noch lange erhalten bleiben. Dieses harte Gewebe enthält Zellen, die beispielsweise nach einem Knochenbruch für das Wachstum neuer Knochensubstanz sorgen und in mikroskopisch kleine Löcher eingebettet sind. Sterben solche Knochenzellen ab, tritt ihre DNA unter Umständen aus und wird an die mineralischen Bestandteile des Knochens gebunden, wo sie dann vor weiteren enzymatischen Angriffen geschützt ist. Mit ein wenig Glück überlebt also eine gewisse DNA-Menge das Gemetzel von Abbau und Schädigung, das unmittelbar nach unserem Tod stattfindet.
Aber selbst wenn es so kommt, werden andere Prozesse weiterhin für den Abbau unserer genetischen Information sorgen, allerdings langsamer. Unter anderem trifft ständig Hintergrundstrahlung aus dem Weltraum auf die Erde, und die schafft reaktionsfähige Moleküle, die DNA verändern und zerstören. Und auch Prozesse, die Wasser erfordern – beispielsweise der Verlust von Aminogruppen aus dem Nucleotid C, der U-Nucleotide entstehen lässt –, setzen sich selbst dann fort, wenn die DNA unter relativ trockenen Bedingungen konserviert wird. DNA hat nämlich eine so große Affinität zu Wasser, dass Wassermoleküle selbst in einer trockenen Umgebung fast immer an die Furchen zwischen den beiden DNA-Strängen binden und damit einige spontane wasserabhängige Reaktionen möglich machen. Der schnellste derartige Prozess ist der Verlust der Aminogruppe – die Desaminierung – der C-Nucleotide, und durch ihn wird die DNA so stark destabilisiert, dass ihre Stränge am Ende brechen. Diese und andere Prozesse, von denen die meisten noch nicht aufgeklärt sind, zerstückeln unsere DNA auch dann weiter, wenn sie das Chaos, das der Tod als solcher in unseren Zellen anrichtet, überstanden hat. Die Geschwindigkeit des Abbaus hängt dabei zwar von vielen Faktoren ab, so von Temperatur, Säuregehalt und anderen, eines aber ist klar: Selbst unter günstigen Bedingungen werden irgendwann noch die letzten Informationsbruchstücke aus dem genetischen Programm, das einst einen Menschen möglich gemacht hat, zerstört. In dem von uns analysierten Neandertalerknochen hatten alle diese Prozesse ihre Zerstörungswirkung offenbar selbst nach 40000 Jahren noch nicht vollständig ausgeübt.
Matthias hatte die Sequenz eines mtDNA-Abschnitts ermittelt, der 61 Nucleotide lang war. Zu diesem Zweck musste er mit einem Verfahren namens Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction,PCR) zahlreiche Kopien des ursprünglichen DNA-Stücks herstellen. Als er daranging, unsere ersten Befunde zu bestätigen, wiederholte er zunächst das PCR-Experiment genauso, wie er es beim ersten Mal gemacht hatte. Dazu braucht man zwei Primer, kurze, synthetische DNA-Stücke, die an zwei Stellen im Abstand von 61 Nucleotidpaaren an die mtDNA binden sollten. Die Primer werden mit einer winzigen Menge der aus dem Knochen gewonnenen DNA vermischt, und nun kann ein Enzym namens DNA-Polymerase neue DNA-Stränge aufbauen, die an den Primern beginnen und enden. Die Mischung wird erwärmt, so dass die DNA-Stränge sich trennen; beim Abkühlen können die Primer dann ihre zugehörigen Sequenzen finden und durch Paarung von A mit T und G mit C an sie binden. Anschließend nutzt das Enzym die an die DNA-Stränge gebundenen Primer als Ausgangspunkte für die Synthese zweier neuer Stränge; damit sind die beiden ursprünglichen Stränge aus dem Knochen verdoppelt, und die Mischung enthält nun vier Stränge. Man wiederholt den Vermehrungsprozess, so dass acht Stränge entstehen, dann 16, dann 32 und so weiter – insgesamt läuft die Verdoppelung über 30 oder 40 Runden.
Das einfache, elegante Verfahren der PCR wurde 1983 von dem wissenschaftlichen Querdenker Kary Mullis erfunden und ist äußerst leistungsfähig. Im Prinzip kann man aus einem einzigen DNA-Fragment nach 40 Vermehrungszyklen ungefähr eine Billion Kopien herstellen. Dies machte unsere Arbeit erst möglich, und deshalb hatte Mullis mit Sicherheit den Nobelpreis für Chemie verdient, den er 1993 erhielt. Die ungeheure Empfindlichkeit der PCR machte unsere Arbeit aber auch schwieriger. Ein Extrakt aus sehr altem Knochenmaterial – entweder mit überhaupt keinem oder nur sehr wenigen noch erhaltenen alten DNA-Molekülen – kann immer durch ein DNA-Molekül oder auch mehrere von modernen Menschen verunreinigt sein. Solche Moleküle können aus den verwendeten Chemikalien stammen, aus den Kunststoffgefäßen im Labor oder aus dem Staub in der Luft. In Räumen, in denen Menschen leben oder arbeiten, handelt es sich bei einem erheblichen Teil der Staubteilchen um Hautschuppen von Menschen, und die enthalten Zellen voller DNA. Außerdem konnte menschliche DNA die Probe verunreinigt haben, als ein Mensch sie – beispielsweise in einem Museum oder bei Ausgrabungen – in der Hand hatte. Aus diesem Grund hatten wir uns entschlossen, die Sequenz des variabelsten Teils der Neandertaler-mtDNA zu analysieren. Da viele Menschen sich gerade in diesem Abschnitt voneinander unterscheiden, konnten wir dann wenigstens etwas darüber sagen, ob ein oder mehrere Menschen ihre DNA zu unserem Experiment beigetragen hatten, und dann waren wir gewarnt, dass etwas nicht stimmte. Deshalb waren wir so aufgeregt, als wir eine DNA-Sequenz fanden, deren Abweichungen man bei Menschen nie zuvor beobachtet hatte; hätte sie wie die Sequenz eines lebenden Menschen ausgesehen, wir hätten nicht wissen können, was es bedeutete: Besaßen die Neandertaler tatsächlich die gleiche mtDNA wie manche heutigen Menschen, oder hatten wir es einfach mit einem modernen mtDNA-Fragment zu tun, das aus irgendeiner heimtückischen Quelle, beispielsweise einem Staubteilchen, seinen Weg in unsere Experimente gefunden hatte?
Zu jener Zeit war mir das Problem der Verunreinigungen nur allzu vertraut. Seit mehr als zwölf Jahren hatte ich an der Gewinnung und Analyse alter DNA gearbeitet, darunter solche von ausgestorbenen Säugetieren wie Höhlenbären, Wollhaarmammuts und Riesenfaultieren. Nach einer Reihe frustrierender Ergebnisse – in fast allen Tierknochen, die ich mit der PCR analysiert hatte, hatten wir vorwiegend menschliche mtDNA nachgewiesen – war mir häufig die Frage durch den Kopf gegangen, wie man die Verunreinigungen auf ein Minimum beschränken kann. Deshalb hatte Matthias alle Gewinnungsprozesse und andere Experimente bis zum ersten Temperaturzyklus der PCR in einem kleinen Labor durchgeführt, das peinlich sauber gehalten wurde und von unseren übrigen Laborräumen völlig getrennt war. Als die alte DNA, die Primer und alle anderen erforderlichen Komponenten für die PCR sich in einem Röhrchen befanden, wurde dieses luftdicht verschlossen; die Temperaturzyklen und alle weiteren Experimente fanden dann in unserem normalen Labor statt. In dem Reinraum wurden alle Oberflächen einmal in der Woche mit Chlorbleiche abgewaschen, und jede Nacht wurde der Raum mit UV-Licht bestrahlt, das alle im Staub enthaltene DNA zerstörte. Matthias betrat das Reinlabor durch einen Vorraum, in dem er und andere, die dort arbeiten, Schutzanzüge, Gesichtsvisiere, Haarnetze und sterile Gummihandschuhe anlegten. Alle Reagenzien und Instrumente wurden unmittelbar in das Reinlabor geliefert; aus anderen Teilen des Instituts durfte nichts dorthin mitgenommen werden. Matthias und seine Kollegen mussten ihren Arbeitstag im Reinraum beginnen, weil in den anderen Laborteilen unseres Instituts große DNA-Mengen analysiert wurden. Nachdem sie ein solches Labor betreten hatten, durften sie das Reinlabor an diesem Tag nicht mehr aufsuchen. Ich litt, um es vorsichtig auszudrücken, im Hinblick auf DNA-Verunreinigungen unter Verfolgungswahn, und nach meinem eigenen Eindruck hatte ich dazu auch allen Grund.
Trotz allem hatten wir in Matthias’ ersten Experimenten einige Indizien für Verunreinigungen der Knochen mit menschlicher DNA gefunden. Er hatte ein Stück der mtDNA aus dem Knochen mit der PCR vervielfältigt und anschließend die so entstandenen, angeblich identischen DNA-Kopien in Bakterien kloniert. Damit wollte er herausfinden, ob es unter den exponierten Molekülen mehrere verschiedene mtDNA-Sequenzen gab. Jedes Bakterium nimmt nämlich nur ein Molekül von 61 Nucleotiden auf und wächst dann zu einem Klon heran, der Kopien dieses Moleküls in sich trägt; wir brauchten also nur eine gewisse Anzahl von Klonen zu sequenzieren und konnten uns so einen Überblick darüber verschaffen, was für verschiedene DNA-Sequenzen in der Molekülpopulation vorhanden waren. In Matthias’ ersten Experimenten fanden wir 17 Moleküle, die ähnlich oder genau gleich waren, sich aber von den mehr als 2000 mtDNAs moderner Menschen unterschieden, die wir zu Vergleichszwecken herangezogen hatten; außerdem sahen wir aber auch eine, die mit einer Sequenz mancher heutiger Menschen identisch war. Damit war eindeutig eine Verunreinigung nachgewiesen; sie stammte möglicherweise von Museumskuratoren oder anderen, die den Knochen in den 140 Jahren seit seiner Entdeckung in der Hand gehabt hatten.
Um unseren ursprünglichen Befund zu reproduzieren, wiederholte Matthias also als Erstes die PCR und die Klonierung. Dieses Mal fand er zehn Klone mit der einzigartigen Sequenz, die uns am Anfang so spannend erschienen war, und zwei weitere, die von beliebigen Jetztmenschen stammen konnten. Dann griff er erneut auf den Knochen zurück, stellte wiederum einen Extrakt her, ließ nochmals PCR und Klonierung laufen, und erhielt nun zehn Klone des interessanten Typs sowie vier, die nach mtDNA heutiger Menschen aussahen. Jetzt waren wir zufrieden: Unser ursprünglicher Befund hatte seine erste Prüfung bestanden: Wir konnten ihn wiederholen und fanden jedes Mal dieselbe ungewöhnliche DNA-Sequenz.
Als Nächstes »wanderte« Matthias an der mtDNA entlang; die Primer, die er dazu benutzte, waren so gestaltet, dass man mit ihnen Fragmente vervielfältigen konnte, die sich mit einem Teil des ersten Fragments überlappten, sich aber auch weiter in andere Abschnitte der mtDNA erstreckten (siehe Abb. 1.2). Auch hier stellten wir fest, dass man manche Nucleotidabweichungen in den Sequenzen dieser Fragmente bei modernen Menschen noch nie beobachtet hatte. Im Laufe der nächsten Monate vervielfältigte Matthias 13 verschiedene DNA-Fragmente unterschiedlicher Größe jeweils mindestens zweimal. Die Interpretation der Sequenzen wurde dadurch erschwert, dass jedes DNA-Molekül Mutationen tragen kann, die auf die unterschiedlichsten Ursachen zurückgehen: auf chemische Abwandlungen in früherer Zeit, auf Fehler bei der Sequenzierung oder auch auf die seltene, aber natürliche Variation, die es innerhalb der vielen Hundert mtDNA-Moleküle eines Menschen gibt. Deshalb bedienten wir uns einer Strategie, die ich zuvor für sehr alte DNA von Tieren entwickelt hatte (siehe wiederum Abb. 1.2). In jedem Experiment betrachteten wir an jeder einzelnen Position in der DNA das sogenannte Consensus-Nucleotid als typisch, jenes Nucleotid (A, T, G oder C) also, das in dieser Position in den von uns untersuchten Molekülen am häufigsten vorkam. Außerdem machten wir es zur Bedingung, dass an jeder Position in mindestens zwei unabhängigen Experimenten das gleiche Nucleotid stehen musste, denn im Extremfall könnte die PCR von einem einzigen DNA-Strang ausgegangen sein, so dass alle Klone aufgrund eines Fehlers im ersten PCR-Zyklus oder wegen einer chemischen Abwandlung in diesem besonderen DNA-Strang das gleiche Nucleotid in der gleichen Position trugen. Wenn zwei PCR-Produkte sich auch nur in einer einzigen Position unterschieden, wiederholten wir die PCR ein drittes Mal und stellten so fest, welches der beiden Nucleotide sich reproduzieren ließ. Am Ende setzte Matthias aus 123 klonierten DNA-Molekülen eine Sequenz von 379 Nucleotiden aus dem variabelsten Abschnitt der mtDNA zusammen. Nach den Kriterien, auf die wir uns geeinigt hatten, war dies die DNA-Sequenz, die der Neandertaler (oder die Neandertalerin) zu Lebzeiten getragen hatte. Als wir diese längere Sequenz einmal kannten, konnten wir uns an die spannende Arbeit machen, sie mit den Abweichungen bei heutigen Menschen zu vergleichen.
Abb. 1.2: Rekonstruktion eines Abschnitts aus der mtDNA des Neandertalers aus dem Neandertal. Oben ist eine moderne Referenzsequenz zu sehen. Jede Zeile darunter entspricht einem klonierten, vervielfältigten Molekül aus dem Typusexemplar. Wo diese Sequenzen mit der Referenzsequenz identisch sind, habe ich einen Punkt eingezeichnet; unterschiedliche Nucleotide sind mit ihren Buchstaben gekennzeichnet. Die unterste Zeile zeigt die rekonstruierte Neandertaler-Sequenz. Wir fordern an jeder Position eine Abweichung von der Referenzsequenz in der Mehrzahl der Klone und in mindestens zwei unabhängigen PCR-Experimenten (entweder die hier gezeigten oder andere). Aus Matthias Krings et al., »Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans«, Cell 90, S. 19 – 30 (1997).
Wir stellten unsere 379 Nucleotide lange Sequenz aus der Neandertaler-mtDNA den entsprechenden mtDNA-Sequenzen von 2051 heutigen Menschen aus allen Teilen der Welt gegenüber. Im Durchschnitt fanden wir an 28 Positionen Unterschiede zwischen dem Neandertaler und einem Jetztmenschen, die Sequenzen heutiger Menschen dagegen unterscheiden sich im Durchschnitt nur in sieben Positionen voneinander. Die Neandertaler-mtDNA wich also viermal stärker ab.
Dann suchten wir nach Indizien, dass die Neandertaler-mtDNA der mtDNA moderner Europäer stärker ähnelte. Damit würde man rechnen, denn die Neandertaler entwickelten sich in Europa und Westasien und lebten auch dort; manche Paläontologen glauben sogar, sie könnten die Vorfahren der heutigen Europäer sein. Also verglichen wir die Neandertaler-mtDNA mit den entsprechenden Molekülen von 510 Europäern; dabei stellte sich heraus, dass sie im Durchschnitt 28 Abweichungen trug. Als Nächstes verglichen wir sie mit der mtDNA von 478 Afrikanern und 494 Asiaten. Hier lag die durchschnittliche Zahl der Unterschiede ebenfalls bei 28. Im Durchschnitt hatte also die mtDNA der Europäer mit den entsprechenden Molekülen der Neandertaler keine größere Ähnlichkeit als die mtDNA heutiger Afrikaner und Asiaten. Vielleicht war die Neandertaler-mtDNA aber nur der mtDNA mancher Europäer näher, was man erwarten würde, wenn die Neandertaler einen gewissen Teil der mtDNA zum Bestand der heutigen Europäer beigetragen hatten. Auch dieser Frage gingen wir nach und stellten dabei fest, dass die Europäer in unserer Stichprobe, deren mtDNA der des Neandertalers am stärksten ähnelte, 23 Unterschiede aufwiesen; die Afrikaner und Asiaten, die dem Neandertaler am nächsten standen, trugen ebenfalls 22 beziehungsweise 23 Abweichungen. Die Neandertaler-mtDNA war also anscheinend der von modernen Menschen aus der ganzen Welt gleichermaßen unähnlich, und nichts wies darauf hin, dass zwischen ihr und der mtDNA einer Untergruppe der heutigen Europäer eine besondere Beziehung besteht.
Wenn man die Evolutionsvergangenheit eines DNA-Abschnitts rekonstruieren will, reicht es aber nicht aus, nur die Unterschiede zu zählen. Abweichungen zwischen DNA-Sequenzen sind das Spiegelbild von Mutationen, die sich in der Vergangenheit ereignet haben. Manche Mutationstypen kommen aber häufiger vor als andere, und manche Positionen in DNA-Sequenzen neigen stärker zu Veränderungen. An solchen Positionen könnten sich in der Vergangenheit einer DNA-Sequenz mehrere Mutationen abgespielt haben, insbesondere die Typen, die häufiger stattfinden. Um die Vergangenheit des von uns untersuchten mtDNA-Abschnitts beurteilen zu können, mussten wir also Modelle für den mutmaßlichen Ablauf seiner Mutationen und Evolution anwenden; dabei mussten wir berücksichtigen, dass bestimmte Positionen mehrmals mutiert waren, so dass frühere Mutationen verwischt wurden. Das Ergebnis einer solchen Rekonstruktion wird als Baum dargestellt: Darin lässt sich die DNA-Sequenz an der Spitze eines Zweiges bis auf eine gemeinsame Vorläufersequenz zurückführen. Diese uralten Sequenzen entsprechen den Verbindungsstellen der Äste in dem Baum (siehe Abb. 1.3). Als wir eine solche baumförmige Rekonstruktion erstellten, konnten wir beobachten, dass die mtDNA aller heute lebenden Menschen sich auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen lässt.
Abb. 1.3: Ein mtDNA-Stammbaum. Man erkennt, wie die mtDNAs heute lebender Menschen sich auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückführen lassen; diese »Eva der Mitochondrien« (grauer Kreis) lebte später als der gemeinsame Vorfahre mit den Neandertalern. Die Reihenfolge der Verzweigungen wird aus den Nucleotidunterschieden abgeleitet; Zahlen geben die statistische Unterstützung für die gezeigte Reihenfolge an. Verändert nach Matthias Krings et al., »Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans«, Cell 90, S. 19 – 30 (1997).
Dies wusste man bereits aus den Arbeiten, die Allan Wilson in den 1980er-Jahren geleistet hatte,[1] und bei der mtDNA rechnet man auch mit nichts anderem, denn jeder von uns trägt nur mtDNA-Moleküle eines einzigen Typs und kann keine Stücke mit anderen Molekülen in der Population austauschen. Da die mtDNA ausschließlich über die Mutter weitergegeben wird, stirbt die mtDNA-Abstammungslinie einer Frau aus, wenn sie keine weiblichen Nachkommen hat; deshalb verschwinden in jeder Generation einige solche Linien. Es muss also irgendwann eine Frau – die sogenannte Eva der Mitochondrien – gegeben haben, deren mtDNA-Abstammungslinie der Ausgangspunkt für die mtDNA aller heutigen Menschen war, einfach weil alle anderen Abstammungslinien seit jener Zeit ausschließlich durch Zufall verloren gegangen sind.
Die mtDNA des Neandertalers geht nach unseren Modellen jedoch nicht auf die Eva der Mitochondrien zurück, sondern ihr gemeinsamer Vorfahre mit der mtDNA der heutigen Menschen liegt viel weiter in der Vergangenheit. Das war ein ungeheuer spannender Befund. Er bewies zweifelsfrei, dass wir ein Stück Neandertaler-DNA gefunden hatten. Außerdem war damit gezeigt, dass die Neandertaler sich zumindest im Hinblick auf ihre mtDNA tiefgreifend von uns unterscheiden.
Mit unseren Modellen schätzten wir auch ab, wie lange es her ist, seit die Neandertaler-mtDNA ihren gemeinsamen Vorfahren mit der mtDNA der Jetztmenschen hatte. Die Zahl der Unterschiede ist ein Hinweis, wie lange beide unabhängig voneinander von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Mutationsrate ist bei weit voneinander entfernten biologischen Arten – beispielsweise Mäusen und Affen – unterschiedlich, unter eng verwandten Arten jedoch, so auch unter Menschen, Neandertalern und Menschenaffen, war sie immerhin so konstant, dass man anhand der beobachteten Unterschiede einen ungefähren Zeitpunkt für den gemeinsamen Vorfahren der beiden DNA-Sequenzen angeben kann. Aufgrund unserer Modelle für die Häufigkeit der unterschiedlichen Mutationstypen in der mtDNA schätzten wir, dass die gemeinsame mtDNA-Vorfahrin aller heutigen Menschen, also die Eva der Mitochondrien, vor 100000 bis 200000 Jahren lebte; dasselbe hatten auch Allan Wilson und seine Arbeitsgruppe festgestellt. Die gemeinsame Vorfahrin von Neandertaler- und Jetztmenschen-mtDNA lebte aber vor rund 500000 Jahren – das heißt, diese Frau war drei- bis viermal älter als die Eva der Mitochondrien, von der alle mtDNAs der heutigen Menschen abstammen.
Das waren faszinierende Befunde. Ich war jetzt vollständig überzeugt, dass wir tatsächlich Neandertaler-DNA gefunden hatten und dass sie sich stark vom genetischen Material moderner Menschen unterscheidet. Bevor wir aber unsere Erkenntnisse veröffentlichen konnten, mussten wir noch eine letzte Hürde überwinden: Wir mussten ein unabhängiges Labor finden, das unsere Arbeiten wiederholen konnte. Ein solches Labor würde nicht die gesamte mtDNA-Sequenz von 379 Nucleotiden analysieren müssen, aber es musste einen der Sequenzabschnitte bestätigen, durch deren Abweichungen sich die Neandertaler von uns unterscheiden. Damit wäre gezeigt, dass die von uns ermittelte DNA-Sequenz in dem Knochen tatsächlich vorhanden war und dass es sich nicht um irgendeine fremde, unbekannte Sequenz handelte, die vielleicht in unserem Labor herumschwirrte. Aber an wen konnten wir uns wenden? Das war eine heikle Frage.
An einem derart hochkarätigen Projekt hätten sich zweifellos viele Institute gern beteiligt, aber dabei bestand eine Gefahr: Wenn wir uns ein Labor aussuchten, das nicht so intensiv wie wir daran gearbeitet hatte, Verunreinigungen möglichst gering zu halten, und auch mit allen anderen Problemen im Zusammenhang mit alter DNA nicht so vertraut war, würde es dort vielleicht nicht gelingen, eine aussagekräftige Sequenz zu gewinnen und zu vervielfältigen. Wenn das geschah, würde man unsere Ergebnisse für nicht reproduzierbar halten, und dann konnten wir sie nicht veröffentlichen. Ich wusste, dass niemand anderes so viel Zeit und Mühe auf derartige Arbeiten verwendet hatte wie wir, aber schließlich einigten wir uns auf das Labor des Populationsgenetikers Mark Stoneking an der Pennsylvania State University. Mark hatte als Doktorand und später als Postdoc bei Allan Wilson in Berkeley gearbeitet, und ich kannte ihn seit Ende der 1980er-Jahre, als ich dort ebenfalls Postdoc gewesen war. Er war einer der Wissenschaftler, die hinter der Entdeckung der Mitochondrien-Eva standen, und gehörte zu den Architekten der Out-of-Africa-Hypothese über die Ursprünge der Jetztmenschen; nach dieser Vorstellung entstanden die modernen Menschen vor rund 100000 bis 200000 Jahren in Afrika, verbreiteten sich dann über die ganze Welt und verdrängten alle früheren Menschenformen, darunter auch die Neandertaler in Europa, ohne sich mit ihnen zu vermischen. Ich hatte Hochachtung vor Marks Urteilsvermögen und seiner Aufrichtigkeit, außerdem kannte ich ihn als gelassenen Zeitgenossen. Und Anne Stone, eine seiner Doktorandinnen, hatte das Studienjahr 1992/93 in unserem Institut verbracht. Anne war eine ernsthafte und ehrgeizige Wissenschaftlerin; sie hatte mit uns an der Gewinnung von mtDNA aus Skelettresten amerikanischer Ureinwohner gearbeitet und war mit unseren Methoden vertraut. Mein Eindruck: Wenn irgendjemand unsere Befunde reproduzieren konnte, dann sie.
Ich nahm Kontakt mit Mark auf. Wie erwartet, waren er und Anne ganz wild darauf, es zu probieren; also machten wir uns mit einem der letzten Knochenstücke, die Ralf uns gegeben hatte, an die Arbeit. Wir sagten Anne und Mark, welchen Teil der mtDNA sie vervielfältigen sollten, damit sie mit der größten Wahrscheinlichkeit auf eine der Stellen in der Sequenz trafen, die eine der typischen Mutationen unserer Neandertaler-Sequenz trug. Wir schickten ihnen aber weder Primer noch andere Reagenzien, sondern nur ein Stück Knochen, das seit der Ankunft aus Bonn in einem luftdicht verschlossenen Röhrchen gelegen hatte. Damit war die Chance, dass eine Verunreinigung von unserem Labor in ihres gelangte, auf ein Minimum reduziert. Wir sagten ihnen auch nicht, welche Positionen für die Neandertaler-mtDNA typisch waren – nicht weil ich ihnen nicht vertraut hätte, sondern weil ich später sagen wollte, dass wir alles Menschenmögliche getan hatten, um jede unbewusste Voreingenommenheit zu vermeiden. Kurzum, Anne musste selbst die Primer synthetisieren und auch alle anderen experimentellen Schritte unabhängig von uns vollziehen, ohne zu wissen, mit welchem Ergebnis wir im Einzelnen rechneten. Nachdem wir den Knochen mit FedEx abgeschickt hatten, mussten wir einfach abwarten.
In der Regel dauern solche Experimente länger als ursprünglich angenommen: Eine Firma liefert die Primer nicht zum versprochenen Zeitpunkt; in einem Reagenzglas, das man auf Verunreinigungen testet, findet sich menschliche DNA; eine technische Assistentin meldet sich an dem Tag, an dem sie die entscheidende Probe mit der Sequenzierapparatur laufen lassen soll, krank. Wir warteten, so schien uns, fast eine Ewigkeit darauf, dass Anne aus Pennsylvania anrief. Eines Abends war es dann so weit. An ihrer Stimme hörte ich sofort, dass sie alles andere als glücklich war. Sie hatte 15 vervielfältigte DNA-Moleküle aus der fraglichen Region kloniert, und alle sahen so aus wie von einem beliebigen heutigen Menschen – wie meine eigene mtDNA oder die von Anne. Das war eine krachende Niederlage. Was hatte es zu bedeuten? Hatten wir irgendeine seltsame mtDNA vervielfältigt? Dass es so war, mochte ich nicht glauben. Wenn sie von irgendeinem unbekannten Tier stammte, wäre sie der menschlichen mtDNA nicht so ähnlich gewesen, andererseits konnte es sich aber auch kaum um die mtDNA eines ungewöhnlichen Menschen handeln, denn die Unterschiede waren ungefähr viermal so groß wie die zwischen allen bisher analysierten mtDNAs von Jetztmenschen. Es bestand immer die Möglichkeit, dass die von uns gefundene Sequenz durch irgendeine chemische Abwandlung der alten DNA entstanden war, die sich immer wieder auf die gleichen Positionen in der Sequenz auswirkte, aber dann müsste man damit rechnen, dass eine solche abgewandelte Sequenz aussah wie die eines Menschen, in die der unbekannte chemische Prozess zusätzliche Abweichungen eingebracht hatte; in Wirklichkeit schien es sich aber um eine Sequenz zu handeln, die sich in der Vergangenheit von der Abstammungslinie der Menschen abgespalten hatte. Außerdem stellte sich die Frage: Warum fand Anne nicht die gleiche Sequenz wie wir? Es schien nur eine plausible Erklärung zu geben: Anne hatte in ihren Versuchsansätzen mehr Verunreinigungen – und zwar so viele, dass sie gegenüber den seltenen Neandertaler-Molekülen in der Überzahl waren. Was konnten wir tun? Wir konnten uns wohl kaum noch einmal an Ralf wenden und ihn um ein weiteres Stück des kostbaren Fossils bitten, nur weil die vage Chance bestand, dass das nächste Experiment besser verlaufen würde als das erste.
Aber selbst wenn Anne mit mehr Verunreinigungen zu kämpfen hatte als wir: Konnte sie dann nicht aus ihrem Knochenstück Tausende von mtDNA-Molekülen sequenzieren und so die seltenen Exemplare finden, die wie unseres aussahen? In der Zwischenzeit hatten wir mit neuen Experimenten abgeschätzt, wie viele mtDNA-Moleküle vom Neandertaler wohl in den Knochenextrakten enthalten waren, von denen wir bei unserer PCR ausgegangen waren. Wie sich herausstellte, waren es ungefähr 50. Eine Verunreinigung dagegen, beispielsweise ein Staubteilchen, kann Zehntausende oder sogar Hunderttausende von mtDNA-Molekülen enthalten. Jeder derartige Versuch, nach den richtigen Molekülen zu angeln, war also wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.
Ich führte ausführliche Gespräche über das Dilemma, und zwar nicht nur mit Matthias, sondern während unserer wöchentlichen Laborseminare auch mit der Gruppe meiner Mitarbeiter, die an alter DNA arbeitete. Ich habe während meiner Berufslaufbahn immer wieder festgestellt, dass solche eingehenden Diskussionen mit den Wissenschaftlern, die in meinem Labor arbeiten, äußerst nützlich sind; nach meiner Überzeugung haben sie zu allen unseren Erfolgen entscheidend beigetragen. In solchen Gesprächen werden häufig Ideen geboren, die den Leuten nie kämen, wenn sie sich nur auf ihre eigene Arbeit konzentrieren würden. Außerdem können Wissenschaftler, für die persönlich in einem Projekt nichts auf dem Spiel steht, häufig zu Augenöffnern werden: Sie leiden nicht unter dem Wunschdenken, das sich nur allzu häufig einstellt, wenn man an einem Projekt arbeitet, an dem einem nicht nur etwas liegt, sondern von dem unter Umständen auch die eigene wissenschaftliche Zukunft abhängt. Ich selbst habe in solchen Diskussionen häufig die Aufgabe, zu moderieren und die Ideen herauszupicken, die vielversprechend sind und weiterverfolgt werden sollten.
Auch dieses Mal trug die Besprechung Früchte, und am Ende hatten wir einen Plan. Wir würden Anne um die Herstellung von Primern bitten, die nicht genau zu der modernen DNA passten. Das letzte Nucleotid an ihrer Spitze sollte vielmehr einem Nucleotid entsprechen, das wir nur in unserer mutmaßlichen Neandertaler-Sequenz gefunden hatten. Solche Primer würden die Vervielfältigung der mtDNA heutiger Menschen nicht oder nur in geringem Umfang in Gang setzen, das heißt, die Vervielfältigung Neandertaler-ähnlicher mtDNA würde begünstigt. Über diesen Ansatz diskutierten wir hin und her; entscheidend war insbesondere die Frage, ob man Annes Arbeiten noch als unabhängige Reproduktion unserer Befunde ansehen konnte, wenn sie Informationen über unsere Sequenz zur Herstellung der Primer nutzte. Ästhetisch wäre es natürlich erfreulicher gewesen, wenn Anne zu der gleichen Sequenz gelangt wäre wie wir, ohne vorher irgendetwas darüber zu wissen. Wir konnten ihr aber sagen, sie solle auch Neandertaler-spezifische Primer erzeugen, die rechts und links von zwei anderen Positionen mit ebenfalls einzigartigen Nucleotiden standen. Außerdem würden wir ihr nicht sagen, wo diese Positionen waren oder wie viele es von ihnen gab. Wenn sie dennoch die gleichen einzigartigen Nucleotidabweichungen fand wie wir, würden alle überzeugt sein, dass solche Moleküle tatsächlich ursprünglich zu den Knochen selbst gehörten. Nach vielen Diskussionen einigten wir uns darauf, dass dies eine legitime Vorgehensweise war.
Wir übermittelten die notwendigen Informationen an Anne; sie bestellte die neuen Primer; wir warteten. Es war jetzt Mitte Dezember, und Anne hatte uns zuvor bereits gesagt, sie wolle über Weihnachten nach North Carolina fliegen und ihre Eltern besuchen. Ich konnte ihr natürlich nicht sagen, sie solle die Reise absagen, sosehr ich es mir auch wünschte. Schließlich, nach fast zwei Wochen, klingelte das Telefon. Anne hatte fünf Moleküle von ihren neuen PCR-Produkten sequenziert. Alle enthielten die beiden Abweichungen, die wir in unserer Neandertaler-Sequenz gefunden hatten – Abweichungen, die bei modernen Menschen nur sehr selten oder gar nicht vorkommen. Das war eine ungeheure Erleichterung. Nach meiner Ansicht hatten wir alle eine Weihnachtspause verdient. Wir riefen Ralf in Bonn an, um ihm die gute Nachricht zu übermitteln. Wie so oft während der Jahre, in denen ich in München wohnte, feierte ich das neue Jahr auch dieses Mal im Skiurlaub, den ich mit einigen Freilandbiologen in abgelegenen Alpentälern nicht weit von der österreichischen Grenze verbrachte. Dieses Mal konnte ich mich nicht zurückhalten und formulierte bereits den Artikel, in dem wir die erste DNA-Sequenz eines Neandertalers beschreiben würden. Was wir zu berichten hatten, war für mich noch spektakulärer als die schneebedeckte Gebirgslandschaft um mich herum.
Nach Weihnachten setzten Matthias und ich uns im Labor zusammen und schrieben unseren Artikel. Wichtig war die Frage, wohin wir ihn schicken sollten. Die britische Fachzeitschrift Nature und ihr amerikanisches Gegenstück Science genießen das höchste Ansehen und werden sowohl in der Wissenschaftlergemeinde als auch in der Publikumspresse am besten wahrgenommen; beide wären eine naheliegende Wahl gewesen. Andererseits erlegen beide ihren Manuskripten aber auch strenge Längenbeschränkungen auf, und ich wollte unsere Arbeiten in allen Einzelheiten erläutern – nicht nur um die Welt zu überzeugen, dass wir wirklich gefunden hatten, was wir behaupteten, sondern auch um Werbung für unsere peinlich genauen Methoden zur Gewinnung und Analyse uralter DNA zu machen. Außerdem hatten beide Zeitschriften mich auch enttäuscht, weil sie dazu neigten, Aufsehen erregende Befunde über alte DNA zu veröffentlichen, obwohl sie nicht den wissenschaftlichen Kriterien genügten, die unsere Gruppe für notwendig hielt. An der Veröffentlichung von Artikeln, die ihnen eine Berichterstattung in der New York Times und anderen wichtigen Presseorganen sichern würden, waren ihre Redaktionen anscheinend oftmals mehr interessiert als daran, dass die Befunde stichhaltig waren und Bestand haben würden.
Über all das sprach ich mit Tomas Lindahl, einem schwedischstämmigen Wissenschaftler des Imperial Cancer Research Fund Laboratory in London. Tomas, ein führender Experte für DNA-Schäden, ist ein zurückhaltender Mensch, der aber Kontroversen nicht ausweicht, wenn er weiß, dass er recht hat. Er war für mich seit 1985, als ich sechs Wochen lang in seinem Labor die chemische Schädigung uralter DNA untersuchte, eine Art Mentor. Tomas schlug vor, wir sollten den Artikel an Cell schicken, ein höchst angesehenes, einflussreiches Fachblatt, das auf Molekular- und Zellbiologie spezialisiert ist. Die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift wäre für die Wissenschaftlergemeinde ein Signal, dass die Sequenzierung alter DNA handfeste Molekularbiologie ist und nicht nur der Produktion aufsehenerregender, aber fragwürdiger Befunde dient; außerdem ließ Cell auch lange Artikel zu. Tomas rief Benjamin Lewin an, den höchst angesehenen Herausgeber des Blattes, und erkundigte sich nach dessen Interesse – eigentlich lag ein solches Manuskript etwas außerhalb des üblichen Zuständigkeitsbereichs von Cell. Lewin sagte, wir sollten das Manuskript einreichen, und er werde es dann nach dem üblichen Verfahren zur Begutachtung verschicken. Das war eine großartige Nachricht. Jetzt hatten wir genügend Platz, um alle unsere Experimente zu beschreiben und alle Argumente darzulegen, deretwegen wir überzeugt waren, dass wir es mit echter Neandertaler-DNA zu tun hatten.
Noch heute halte ich diesen Artikel für einen meiner besten. Er beschreibt nicht nur, wie wir peinlich genau die mtDNA-Sequenz rekonstruiert hatten und warum wir sie für echt hielten, sondern er nennt auch Belege dafür, dass unsere mtDNA-Sequenz außerhalb der Variationsbreite liegt, die wir heute beobachten, und folgert daraus, dass die Neandertaler keine mtDNA zu den Jetztmenschen beigetragen haben. Diese Schlussfolgerungen vertrugen sich mit dem Out-of-Africa-Modell für die Evolution des Menschen, das Allan Wilson, Mark Stoneking und andere formuliert hatten. In dem Aufsatz hatten wir geschrieben: »Die Neandertaler-mtDNA-Sequenz spricht also für ein Szenario, in dem die modernen Menschen erst in jüngerer Zeit als eigenständige Spezies in Afrika entstanden und dann die Neandertaler verdrängten, wobei es kaum oder gar nicht zur Vermischung kam.«
Wir bemühten uns aber auch, alle Vorbehalte anzusprechen, die uns einfielen. Insbesondere wiesen wir darauf hin, dass die mtDNA nur einen eingeschränkten Blick auf die genetische Vergangenheit einer Spezies erlaubt. Da sie ausschließlich von den Müttern an die Nachkommen weitergegeben wird, spiegelt sich in ihr nur die weibliche Seite der Geschichte wider. Wenn Neandertaler sich mit modernen Menschen gekreuzt hätten, würden wir das also nur dann bemerken, wenn Frauen zwischen beiden Gruppen hin und her gewechselt sind. So muss es aber nicht unbedingt gewesen sein. Wenn in der jüngeren Menschheitsgeschichte verschiedene Gruppen mit unterschiedlicher sozialer Stellung aufeinandertrafen und in Wechselbeziehung traten, verkehrten sie fast immer auch sexuell miteinander und hatten Nachkommen. Solche Beziehungen waren aber, was das Verhalten von Männern und Frauen anging, fast immer einseitig. Meist stammte der Mann aus der gesellschaftlich höherstehenden Gruppe, und die Nachkommen aus solchen Verbindungen blieben in der Gruppe der Mutter. Ob eine solche Verteilung auch für die Jetztmenschen typisch war, die vor rund 35000 Jahren nach Europa kamen und auf die Neandertaler trafen, wissen wir natürlich nicht. Ebenso wenig wissen wir, ob die Jetztmenschen in einer Art und Weise, die sich mit den Verhältnissen in heutigen Menschengruppen vergleichen lässt, sozial höhergestellt waren. Eines aber ist klar: Wenn man ausschließlich die weibliche Seite der Vererbung betrachtet, erfährt man nur die halbe Wahrheit.
Eine weitere, noch wichtigere Einschränkung des mtDNA-Verfahrens ergibt sich aus dem Weg ihrer Vererbung. Wie bereits erwähnt, tauscht die mtDNA eines Individuums keine Abschnitte mit der eines anderen aus. Und wenn eine Frau nur Söhne hat, stirbt ihre mtDNA aus. Da der Zufall in der Geschichte der mtDNA eine so große Rolle spielt, könnte sie selbst dann verschwunden sein, wenn eine gewisse Menge von ihr vor 35000 bis 30000 Jahren in Europa von den Neandertalern auf die frühen Jetztmenschen übergegangen wäre. Mit den Chromosomen im Zellkern verhält es sich anders: Wie bereits erwähnt, liegen sie in jedem Menschen paarweise vor, wobei jeweils ein Chromosom von der Mutter und das andere vom Vater stammt. Wenn sich in einem Menschen die Samen- oder Eizellen bilden, brechen die Chromosomen und verbinden sich neu – ein komplizierter Tanz, der dazu führt, dass Stücke zwischen ihnen ausgetauscht werden. Wenn wir also mehrere Abschnitte aus dem Genom in den Zellkernen eines Menschen untersuchen können, gewinnen wir Aufschlüsse über mehrere Versionen der genetischen Vergangenheit einer Gruppe. Selbst wenn dann in einigen Abschnitten die von den Neandertalern beigetragenen Varianten verloren gegangen sind, würde dies wahrscheinlich nicht für alle Teile gelten. Wenn man also viele Bereiche des Genoms im Zellkern studiert, kann man ein Bild unserer Vergangenheit zeichnen, das viel weniger vom Zufall beeinflusst wurde. Deshalb gelangten wir in unserem Artikel zu dem Schluss: »Unsere Ergebnisse schließen die Möglichkeit, dass die Neandertaler andere Gene zu den Jetztmenschen beigetragen haben, nicht aus.« Angesichts der vorhandenen Befunde neigten wir allerdings eindeutig zu der Out-of-Africa-Hypothese.
Unser Artikel wurde begutachtet und mit geringfügigen Veränderungen zur Veröffentlichung in Cell angenommen. Wie es für alle führenden Fachzeitschriften typisch ist, so bestand auch Cell eisern darauf, dass wir über unsere Befunde nicht sprachen, bevor sie in der Ausgabe vom 11. Juli erschienen.[2] Die Redaktion bereitete eine Pressemitteilung vor, und ich flog zu der Pressekonferenz, die sie am Tag der Veröffentlichung in London organisiert hatte. Es war meine erste Pressekonferenz, und zum ersten Mal stand ich im Mittelpunkt eines solchen Medieninteresses. Zu meiner eigenen Überraschung machte es mir Spaß, das Wesentliche an unseren Arbeiten verständlich darzustellen; ich gab mir alle Mühe, sowohl unsere Schlussfolgerungen als auch die Vorbehalte zu beschreiben. Leicht war das nicht, denn aus unseren Daten ergaben sich unmittelbare Auswirkungen für eine hitzige Kontroverse, die im Fachgebiet der Anthropologie schon seit über zehn Jahren tobte.
Ausgegangen war die Auseinandersetzung von der Out-of-Africa-Hypothese, die Wilson und seine Kollegen vorwiegend aufgrund der Verteilung von Variationen in der mtDNA heutiger Menschen formuliert hatten. Die Gemeinde der Paläontologen hatte die Idee anfangs mit Spott und Feindseligkeit aufgenommen. Zu jener Zeit vertraten fast alle Paläontologen das sogenannte multiregionale Modell für die Entstehung der modernen Menschen: Danach haben sich die Jetztmenschen auf mehreren Kontinenten mehr oder weniger unabhängig voneinander aus dem Homo erectus entwickelt. Nach dieser Vorstellung bestehen zwischen den heutigen Menschengruppen tiefe historische Gräben: Man hielt beispielsweise die Neandertaler für Vorfahren der heutigen Europäer und vielleicht auch früherer europäischer Homininen; als Vorfahren der Asiaten galten andere archaische Formen aus Asien, die auf den Pekingmenschen zurückgingen. Eine wachsende Zahl angesehener Paläontologen, an vorderster Front unter ihnen Chris Stringer vom Natural History Museum in London, vertrat allerdings mittlerweile die Ansicht, dass das Out-of-Africa-Modell am besten sowohl zu den Fossilien als auch zu den archäologischen Funden passte. Chris war zu der Cell-Pressekonferenz eingeladen und erklärte dort, unsere Analyse der Neandertaler-DNA sei für die Paläontologie das, was die Mondlandung für die Raumfahrt gewesen war. Ich freute mich natürlich über das Lob, aber überrascht war ich nicht. Noch erfreuter war ich, als Vertreter der »anderen Seite«, die Multiregionalisten, zumindest über die technischen Aspekte unserer Arbeit Gutes zu sagen hatten; insbesondere der Lautstärkste und Kampflustigste von ihnen, Milford Wolpoff von der University of Michigan, erklärte in einem Kommentar in Science: »Wenn irgendjemand dazu in der Lage war, dann Svante.«
Alles in allem war ich verblüfft darüber, welche Aufmerksamkeit unser Artikel erregte. Berichte über ihn fanden sich auf den Titelseiten vieler wichtiger Zeitungen sowie in den Fernseh- und Radionachrichten auf der ganzen Welt. In der Woche nachdem der Aufsatz erschienen war, verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit mit Journalisten am Telefon. Ich arbeitete schon seit 1984 mit alter DNA, und im Laufe der Zeit war mir klar geworden, dass es im Prinzip möglich sein müsste, die DNA von Neandertalern zu gewinnen. Neun Monate waren jetzt vergangen, seit Matthias angerufen und mich geweckt hatte, um mir zu sagen, dass aus einem unserer Sequenzierapparate eine DNA-Sequenz gekommen war, die nicht nach einem Menschen aussah. Ich hatte also Zeit gehabt, mich an den Gedanken zu gewöhnen, und war im Gegensatz zum Rest der Welt nicht allzu erschüttert über unsere Leistung. Aber nachdem der Medienrummel nachgelassen hatte, spürte ich das Bedürfnis nach einer größeren Perspektive. Ich wollte über die Jahre nachdenken, die uns bis hierhergeführt hatten, und überlegen, was als Nächstes kommen sollte.
Kapitel 2Mumien und Moleküle
Es begann nicht mit den Neandertalern, sondern mit altägyptischen Mumien. Als ich 13 war, hatte meine Mutter mich mit nach Ägypten genommen, und seitdem hatte die Frühgeschichte des Landes mich immer fasziniert. Als ich aber an der Universität Uppsala in meinem Heimatland Schweden daranging, das Thema ernsthaft zu studieren, wurde mir zunehmend klar, dass mein Interesse an Pharaonen, Pyramiden und Mumien der romantische Traum eines Heranwachsenden war. Ich machte meine Hausaufgaben; ich lernte Hieroglyphen und historische Tatsachen auswendig; in zwei aufeinanderfolgenden Jahren arbeitete ich sogar während der Sommerferien am Stockholmer Mittelmeermuseum daran mit, Keramikscherben und andere Funde zu katalogisieren. Wenn ich in Schweden zum Ägyptologen geworden wäre, hätte das Museum durchaus mein zukünftiger Arbeitsplatz sein können. Wie ich feststellte, taten dieselben Menschen im zweiten Sommer mehr oder weniger dasselbe wie im ersten. Außerdem gingen sie zur selben Zeit in dasselbe Restaurant zum Mittagessen, bestellten dieselben Gerichte, diskutierten dieselben ungelösten Fragen aus der Ägyptologie oder tauschten Akademikertratsch aus. Letztlich wurde mir klar, dass es im Fachgebiet der Ägyptologie für meinen Geschmack zu langsam voranging. Ein solches Berufsleben konnte ich mir für mich selbst nicht vorstellen. Ich wünschte mir mehr Spannung und mehr Bedeutung für die Welt um mich herum.
Diese Entzauberung stürzte mich in eine Art Krise. Deshalb und auf Anregung meines Vaters, der Arzt war und später Biochemiker wurde, entschloss ich mich zu einem Medizinstudium mit der Perspektive, Grundlagenforschung zu betreiben. Ich immatrikulierte mich an der medizinischen Fakultät der Universität Uppsala, und nach ein paar Jahren war ich selbst überrascht darüber, welchen Spaß mir der Umgang mit Patienten machte. Es schien mir einer der wenigen Berufe zu sein, in denen man nicht nur alle möglichen unterschiedlichen Menschen kennenlernt, sondern in ihrem Leben auch eine positive Rolle spielen kann. Diese Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, war eine unerwartete Begabung, und nach vierjährigem Medizinstudium kam die nächste kleine Krise: Sollte ich Arzt werden oder in die Grundlagenforschung wechseln, wie ich es ursprünglich vorgehabt hatte? Ich entschied mich für die zweite Möglichkeit, dachte aber, dass ich nach der Promotion an die Klinik zurückkehren könnte und höchstwahrscheinlich auch würde. Vorerst ging ich an das Institut von Per Pettersson