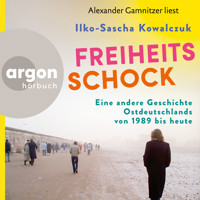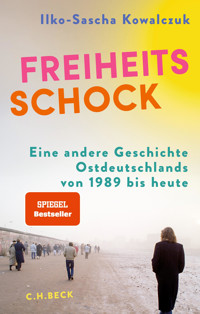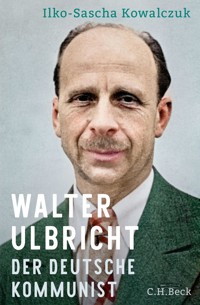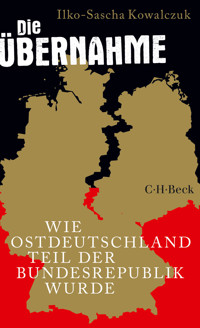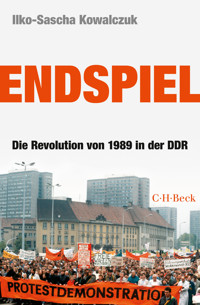20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vieles von dem, was nach 1990 im Osten schiefgelaufen ist, lässt sich aus Versäumnissen und Fehlern im Vereinigungsprozess erklären. Anderes geht auf überzogene Erwartungen und ein falsches Verständnis von Freiheit zurück. So ist eine toxische Stimmung entstanden, die immer größere Teile der Bevölkerung erfasst – nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Denn die «neue Mauer» verläuft nicht nur entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, sondern auch zwischen den Verteidigern der Demokratie und jenen, die sie – gezielt oder leichtfertig – in Gefahr bringen.
Ilko-Sascha Kowalczuk ist einer der besten Kenner der DDR-Geschichte und seit vielen Jahren ein ebenso kritischer wie kluger Beobachter des Vereinigungsprozesses. Die FAZ nannte ihn den «Punk unter den deutschen Historikern». Bodo Ramelow ist seit 1990 in Ostdeutschland politisch aktiv und war von 2014 bis 2024 Ministerpräsident in Thüringen. Die beiden haben sich zusammengesetzt, um nach den Ursachen für den flächendeckenden Wahlsieg der AfD in den neuen Bundesländern und nach den Perspektiven für unsere Demokratie zu fragen. Der Zeithistoriker und der Politiker lassen es dabei nicht an deutlichen Worten fehlen und gelangen zu einem sehr differenzierten Bild der deutsch-deutschen Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Ilko-Sascha Kowalczuk Bodo Ramelow
DIE NEUE MAUER
Ein Gespräch über den Osten
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Vorbemerkung
Woher wir kommen
Die Gesprächspartner stellen sich vor
KAPITEL 1: Versäumnisse und Fehler im Vereinigungsprozess
KAPITEL 2: Befindlichkeiten Ost – West
KAPITEL 3: Antifaschismus und Antiamerikanismus
KAPITEL 4: Der schwierige Umgang mit «den Anderen»
KAPITEL 5: Frieden und Friedenssehnsucht
KAPITEL 6: Frühes politisches Engagement
KAPITEL 7: Warum wir eine Verfassungsdebatte brauchen
KAPITEL 8: Der Traum von einer gerechten Gesellschaft
KAPITEL 9: Ostdeutschland als Frühwarnsystem?
Kurzbiografien der Gesprächspartner
Ilko-Sascha Kowalczuk
Veröffentlichungen (in Auswahl)
Bodo Ramelow
Zu diesem Buch
Zum Buch
Vita
Impressum
Vorbemerkung
Die Demokratie in Deutschland und Europa ist in großer Gefahr. Westeuropa hat sich seit 1945 neu geordnet, 1990 kam Osteuropa mit großen Hoffnungen dazu. Der Aufbruch von 1990 hat sich in Sorge, Frust und Angst gewandelt, und ständig wird gezündelt. Der Aufstieg von Extremisten und Oligarchen nun auch in der westlichen Welt verunsichert viele Menschen. Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die Vorgänge in den USA lassen erahnen, was noch kommen könnte.
Wir denken gar nicht daran, den Demokratie- und Verfassungsfeinden das Feld zu überlassen. Demokratie und Freiheit sind das Wichtigste, das wir haben. Natürlich, es gibt viel zu verändern, zu verbessern, die soziale Ungerechtigkeit hat demokratiezersetzende Ausmaße angenommen. Viele globale Probleme sind inzwischen existenzbedrohend. Für uns in Deutschland und Europa steht an erster Stelle die Bedrohung der liberalen Demokratie durch den Kreml. Putins Krieg gegen die Ukraine ist kein Stellvertreterkrieg, sondern ein Krieg, bei dem es um Freiheit versus Unfreiheit, Demokratie versus Diktatur geht – und nicht nur um Territorien und Ressourcen.
Als uns der Verlag ansprach und fragte, ob wir in einem Gespräch über einige grundlegende Probleme unserer Zeit diskutieren wollen, waren wir sofort bereit dazu. Uns war bewusst, dass wir in manchen Fragen unterschiedlicher Auffassung sind. Aber tatsächlich überwiegen die Gemeinsamkeiten, nämlich die Sorge um unsere Demokratie und die Zukunft Europas.
Das Gespräch dreht sich im Wesentlichen um den Osten, weil wir glauben, dass viele Entwicklungen in Ostdeutschland wie unter einem Brennglas zeigen, was sich anderswo ähnlich vollzog – nur später und langsamer – oder noch vollziehen könnte. Wenn wir heute, 35 Jahre nach der deutschen Einheit, in einen echten Einheitsprozess einsteigen wollen, der das Wort Einheit als neue Gemeinsamkeit begreift, dann müssen wir umdenken. Wir sollten die Unterschiede zwischen Ost und West weder einfach hinnehmen noch einebnen, vielmehr sollten wir die Unterschiedlichkeit als unsere besondere Stärke verstehen. Deutschland ist eines: vieles!
Das steht nur scheinbar im Widerspruch zum Buchtitel. Im Osten beobachten wir eine vielfache Abkehr von demokratischen Grundwerten, im Westen stehen viele den Sorgen in den neuen Bundesländern zunehmend gleichgültig gegenüber. Die Bundestagswahlergebnisse lassen auf den ersten Blick einen tiefen Riss erkennen, der quer durch das Land geht. Aber die neue Mauer verläuft nur scheinbar entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, in Wirklichkeit ist sie in den Köpfen. Mit Sorge blicken wir deshalb auf den 14. September 2025, wenn bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen rund 12,5 Millionen Wahlberechtigte – knapp zwei Millionen mehr als in den neuen Bundesländern zusammen – zur Wahl von Bürgermeistern und Landrätinnen aufgerufen sind.
Wir haben dieses Buch zusammen erarbeitet, weil wir glauben, dass Demokraten trotz aller Differenzen fest zusammenstehen müssen, um die Demokratie zu stabilisieren und um autoritäre Verhältnisse zu verhindern. Unterschiedliche Auffassungen müssen und sollen klar benannt werden, der Widerspruch und der Austausch von Argumenten gehören in der freiheitlichen Demokratie zu den grundlegenden Werten, die Meinungsfreiheit überhaupt erst begründen. In einer Zeit, in der die politische Debatte auf so vielen Ebenen der Gesellschaft empfindlich gestört zu sein scheint, sehen wir unser Gespräch als ein Zeichen der Ermutigung.
Wir danken dem Verlag C.H.Beck, namentlich dem ehemaligen Cheflektor Detlef Felken, für die Idee und das Zustandekommen dieses Bandes. Ohne die tatkräftige Arbeit von Thomas Karlauf wäre aus unseren mehrtägigen Gesprächen kein lesbares Buch geworden. Ganz herzlichen Dank dafür!
Ilko-Sascha KowalczukBodo Ramelow
Berlin und Erfurt am 6. Mai 2025, 35 Jahre nach den ersten freien und demokratischen Kommunalwahlen in der DDR
Woher wir kommen Die Gesprächspartner stellen sich vor
ILKO-SASCHA KOWALCZUK Ich bin in Ost-Berlin geboren und groß geworden. Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn man in Greifswald aufwuchs oder in Dresden. Zu meinem Alltag gehörte, dass ich wusste, was sich in meiner Heimatstadt West-Berlin in den Clubs abspielt, was in den Kinos läuft. Wir hatten ein wenig Westgeld, und meine Oma hatte ein Konto in West-Berlin. Mit einem Teil meines Wesens lebte ich immer im Westen. Und nicht nur ich, sondern fast alle Menschen, die ich kannte, das war nichts Besonderes.
Das Besondere war eher der Kontext, aus dem ich kam. Ich kam aus einem sehr politisierten, staatsnahen Elternhaus. Mein Vater, Ilko Bohdan, war ein kluger, vom Kommunismus und vom Sozialismus sehr überzeugter Mann. Mein Großvater väterlicherseits hingegen, Ilko, war ein ukrainischer Freiheitskämpfer, ein Nationalist, der für eine unabhängige Ukraine kämpfte, und dafür wurde er 1921 zum Tode verurteilt. Er konnte am Vorabend der geplanten Hinrichtung befreit werden und wurde ins Ausland, nach Böhmen, nach Leitmeritz/Litoměřice gebracht. In Böhmen gab es eine große ukrainische Diaspora mit etwa 800.000 aus der Ukraine Geflüchteten. Außerdem residierte im nahen Prag ein ukrainischer Bischof, was für meinen strenggläubigen Großvater wichtig war. Er kam 1934 wenige Monate vor der Geburt meines Vaters bei einem Eisenbahnunglück ums Leben.
Dieser Großvater war permanent Thema bei uns. Wir haben auch ukrainische Weihnachten gefeiert und am 6. Januar immer Piroggen gegessen. Als ich anfing, mich mit 15, 16 Jahren vom DDR-Staat zu emanzipieren, sagte meine Tante, die Tochter meines ukrainischen Großvaters, die in Rostock Russischlehrerin war: «Wenigstens dein Großvater wäre stolz auf dich.»
Mein anderer Opa kam aus Schlesien, aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ein Bruder von ihm ist als Leutnant oder Oberleutnant der Wehrmacht zu Weihnachten 1943 vom Essen aufgestanden mit den Worten: «Der Herrgott wird uns das nie vergeben, was wir im Osten machen», ist ins Nachbarzimmer gegangen und hat sich erschossen. Mein Opa überlebte den Weltkrieg und wurde harter Antikommunist, weil sie ihm in der DDR alles genommen haben, obwohl er nur ein einfacher Soldat war. Meine Mutter schleppte irgendwann 1961 meinen Vater an.
Mein Vater wollte ursprünglich Priester werden, auch vor dem Hintergrund seines zum Tode verurteilten Vaters. Dann trat er aus der Kirche aus und wollte bei der Stasi arbeiten. Aber die haben ihn nicht genommen: «Du sagst ja nicht mal deiner Mutter, dass du in der SED bist, so feige biste». Mein Vater war ein Überzeugungskommunist. Und weil er ein relativ bekannter Fußballspieler in Ost-Berlin war, war er der Einzige, der in den Kneipen in Friedrichshagen als Kommunist einen Platz an den Stammtischen hatte. «Wenn alle Kommunisten so wären wie Ilko, dann würde es was mit dem Kommunismus werden.» Das stimmte zwar nicht, zeigt aber, dass mein Vater trotz seiner Überzeugungen durchaus anerkannt war; er war ein guter Mensch, der immer für andere da war und der seine politischen Überzeugungen nicht versteckte. Er war aufrecht und ehrlich. Meine Mutter sagte häufiger zu ihm, er solle sich doch etwas mehr zurückhalten; wenn es mal anders käme, wäre er der Erste, der am Baum hinge. Auch das kam anders.
So wie ich von meinem Vater erzogen wurde, war klar, dass ich als kleiner Junge den Sozialismus mit allem, was ich hatte, verteidigen wollte. Mit zwölf Jahren habe ich gesagt: Ich möchte Offizier werden. Überall herrschte Personalmangel, insbesondere bei den Sicherheits- und Armeeberufen. Wer sich da frühzeitig meldete, wurde sofort erfasst. Obwohl man sich eigentlich erst mit 14 melden konnte, hat man mich gleich vorgemerkt. Mit 14 wurde ich ins FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen, das war ein feierlicher Akt.
Wenig später habe ich mit diesem «Kollektiv» an einer Fahrt nach Suhl teilgenommen. In dem Ikarus-Bus wurde an uns 14-Jährige Alkohol ausgegeben, alle im Bus durften rauchen, in Suhl durften wir dann auf Flugtauben schießen. Es waren sehr üble zwei Tage, total skurril. Ich hatte vorher schon Bauchschmerzen, aber in Suhl wurde ich dann endgültig geheilt. Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich Angst davor hatte, nein zu sagen, vor allem auch Angst, meinen Vater zu enttäuschen. Aber dann habe ich nein gesagt. Damit brach meine ganze bisherige Welt zusammen.
Aber viel schlimmer war: Ohne dass ich mich im Geringsten verändert hatte, ohne dass ich mich auch nur einen Schritt bewegte, wurde aus einem hoffnungsvollen künftigen Kader ein Staatsfeind gemacht. Die ließen nicht locker. Anderthalb Jahre lang musste ich in der Schule, vor dem Wehrkreiskommando, vor der Partei, vor der Staatssicherheit, oft in Anwesenheit meiner Mutter, immer wieder aufs Neue meinen Sinneswandel erklären. Manchmal musste ich stundenlang vor denen stehen, vor Menschen, die ich überwiegend nicht kannte. Irgendwann gab es ein letztes Gespräch. Da hat man mir in Gegenwart meiner Mutter prognostiziert, dass ich über kurz oder lang in den Verwahranstalten des sozialistischen Strafvollzugs landen werde. Warum ich so undankbar wäre, da ich doch wissen müsste, was ich den Staat bereits gekostet hätte. «Schreiben Sie mir eine Rechnung», sagte ich, wie meine Mutter mir später berichtete, «ich werde diesem Staat das auf Heller und Pfennig zurückzahlen.» Meine Mutter glaubte, wir würden nun weggesperrt werden.
Das Schlimmste an dem ganzen Vorgang: Mein Vater war so enttäuscht von mir, dass unsere Beziehung in eine Dauerkrise geriet. Er verriet mich an den Staat, dem er diente, obwohl er so intelligent war. Ich zweifelte nie an seiner Liebe mir gegenüber, aber es kam zum Bruch, weil ich nicht mehr mitmachen wollte, wie er sich das vorgestellt hatte. Auch ihn setzten Partei, Stasi und Staat nun unter Druck, aber dafür hatte ich natürlich keine Augen – ich war selbst in einer tiefen Lebenskrise mit 14, 15, 16 Jahren, obwohl mein Leben noch gar nicht richtig angefangen hatte.
Im Prinzip prägte dieser Einschnitt mein ganzes weiteres Leben. Erst als 2005 unser ältester Sohn Max zwölf wurde, ist mir die ganze Dimension bewusst geworden, die ich damals durchleben musste. Es war wie eine Retraumatisierung. Mit meinem Vater konnte ich mich ab dem Herbst 1989 ansatzweise mehrfach aussprechen, 1992 kam er bei einem Unfall ums Leben. Ihm tat alles sehr leid, was ich ihm abnahm. In einer Therapie in den 2000er Jahren konnte ich die Liebe meines Vaters spüren, und zugleich entdeckte ich dabei, wie stark mich mein ukrainischer Großvater im Griff hatte: Ich fühlte mich seiner Mission sehr stark verbunden.
Wohlgemerkt, ich war kein Widerständler. Ich versuchte zu gefallen, ich versuchte irgendwie wieder anzukommen in der DDR. Ich versuchte Kompromisse zu machen und verhielt mich opportunistisch. Das hat aber alles nicht funktioniert, weil der Staat von mir nichts mehr wissen wollte. Ich konnte zunächst kein Abitur machen. Ich bin Maurer geworden und war anschließend Pförtner. Das war eine lehrreiche Zeit mit vielen Privilegien in der Diktatur: Ich hatte Zeit, und niemand wollte etwas von mir. Aufgefangen haben mich meine vielen Freunde, die überwiegend aktiv in Kirchen unterwegs waren. Ich war entschlossen, in der DDR die DDR zu verändern, endlich sozialistisch, also freiheitlich zu machen. Viele gingen weg, ich nicht. Daher machte ich immer wieder Kompromisse, absolvierte auch den Grundwehrdienst, eine sehr schlimme Zeit. Ich hasste nicht nur die ganzen Mitmacher der Diktatur, ich hasste auch mich selbst wegen meiner Kompromisse.
1989 bin ich dann befreit worden, befreit von meinen Ängsten, befreit von meinem Opportunismus, befreit von meinem Mitmachen. Ich war aber auch Teil der Freiheitsrevolution, engagierte mich und hörte nie wieder auf, mich politisch einzubringen. Nie wieder hätte ich das Recht, politisch pessimistisch zu sein, so schwor ich mir damals. Nie wieder hätte ich das Recht, nicht für Freiheit und Demokratie zu kämpfen! In der DDR war ich zwar nicht das, was ich im Rückblick gern dort gewesen wäre. Aber dafür bin ich in der Bundesrepublik auch nicht das geworden, wovon ich träumte. Also: alles gut.
Mein Bild des Westens hatte sich im Laufe meiner ersten 22 Lebensjahre, die ich in der DDR verbrachte, grundlegend verändert. Zunächst war der Westen für mich eine glitzernde Scheinwelt, die vor allem aus Werbung bestand. Aber diese Welt war faszinierend. Bei mir im Haus wohnte jemand, der hatte eine Carrera-Autobahn, das war so ungefähr das Tollste, was ich mir vorstellen konnte. Überhaupt gab es in meinem Umfeld wahnsinnig viele Leute, die offenbar selbst ihr Frühstück aus dem Westen bekamen. Ich habe vier Kinder und nach der Wende schätzungsweise zwölf bis fünfzehn Carrera-Autobahnen gekauft. Meine Kinder sollten meinen Traum leben – aber die Autobahn war auch das Einzige, was ich ihnen diesbezüglich aufzwängte, und sie haben darunter nicht gerade gelitten.
Keine einzige Carrera-Autobahn hat zwar nur ansatzweise so funktioniert, wie es in der Werbung gezeigt wurde. Aber ich war dieser Sache völlig erlegen. Nicht weniger faszinierend als Carrera-Autobahnen fand ich Bundestagsdebatten. Ich habe ab meinem zwölften Lebensjahr die Schule geschwänzt, um sie mir im Fernsehen live anzuschauen, und ich war längst nicht der Einzige. Ich habe kein Wort verstanden, ich fand es einfach nur aufregend, dass da irgendwelche alten, dicken Männer miteinander streiten und sich anschreien. Ganz und gar herrlich!
Als junger Typ war ich viel im Ostblock unterwegs. Auf diesen Reisen war das Wichtigste für mich, dass die Leute, mit denen ich mich unterhielt, mich als gleichberechtigt betrachtet haben. Ich hatte meist ein bisschen Westgeld dabei, eingenäht im Schlafsack, damit das bei Kontrollen nicht auffiel. Mit Westgeld ließ sich was machen. Und deshalb tat es mir natürlich weh, dass der blöde Wessi aus Köln oder aus Düsseldorf, nur weil er seine Scheiß-D-Mark in der Hand hatte, in Polen, Ungarn oder in Bulgarien anders behandelt wurde als ich. Als ich dann 1990 das erste Mal offiziell mit D-Mark in den Osten reiste, war es für mich eine Offenbarung, als ich merkte, wie einfach das funktionierte: Mein Gott, du brauchst bloß ein paar D-Mark, und dann kannst du hier den Hampelmann machen!
Meine Grunderfahrung nach 22 Jahren DDR war die fehlende politische Freiheit. Das habe ich wirklich auch am eigenen Körper erlebt. Es gibt für mich nichts Wichtigeres als Freiheit. Aber den Westen habe ich nie rosarot gesehen. Ich hätte mich im November 1989 nie auf den Ku’damm gestellt und eine Aldi-Tüte in Empfang genommen. Mich hat die materielle Welt nie interessiert. Mich haben geistige Freiheiten und Freiräume interessiert. Ich habe früh ein Buch geführt. Da habe ich reingeschrieben, welche Bücher ich gerne mal lesen möchte, also solche, die in der DDR nicht zu haben oder verboten waren. Weil ich mich beschwert habe, dass ich bestimmte Bücher nicht bekam, bin ich aus der Staatsbibliothek als Leser rausgeflogen; später war ich viele Jahre privilegiert, weil ich als Pförtner einen Ausweis von der Bibliothekschefin bekam (die Frau hatte einen Ausreiseantrag gestellt), mit dem ich jedes Buch in der Stabi lesen konnte – das Institut, in dem ich Dienst tat, war kooperatives Mitglied der Staatsbibliothek.
Ich will noch zwei Erlebnisse nachtragen. Ich hatte Freunde aus K-Gruppen im Westen, die teilweise nach Ost-Berlin kommen durften, bis sie Einreiseverbot erhielten. Die haben mir erklärt, warum die DDR eigentlich viel besser ist, und ich habe denen erklärt, warum die Bundesrepublik viel besser ist. Einmal habe ich den Vorschlag gemacht: «Lasst uns doch mal die Plätze tauschen, und dann bleibt ihr mal eine Weile hier.» Aber das fanden sie keine gute Idee. Das andere war ein Erlebnis in den Sommerferien. Ich war mit Freunden nach Ungarn getrampt, und auf einem abgelegenen Zeltplatz in der Puszta trafen wir einen Vater mit seinen drei Kindern. Die kamen aus Köln und waren in der Friedensbewegung aktiv. Ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt, wie der Vater mit seinen drei Kindern umgegangen ist, wie die miteinander gesprochen haben, was das für ein Verhältnis war, ein Verhältnis auf Augenhöhe. Ich war davon so stark beeindruckt, dass ich dachte, okay, so sind also die Westler. Als die Mauer fiel, stellte ich fest, nee, die meisten Westler sind genauso scheiße wie die meisten Ostler. Der Typ war die alternative Mütze, die es natürlich auch im Osten gab. Kurz danach las ich das in der DDR verbotene Buch Summerhill von Neill – das genau war mein Ding: Käfige sind zum Ausbrechen da!
Vielleicht noch eine Anmerkung zum Titel meines letzten Buches Freiheitsschock. Wenn ich sage, meine Grunderfahrung mit der DDR war die fehlende politische Freiheit, dann weiß ich, dass ich eine Minderheitenposition im Osten einnehme. Die Mehrheit stand bei der Freiheitsrevolution abseits, hinter der Gardine, wartete ab – ganz normal für eine Revolution – und hat 1989/90 die Freiheit als Schock erlitten. Das ist die zentrale These dieses Buches, dass die meisten Ostdeutschen nach 1990 mit der Freiheit nichts anfangen konnten. Weil Freiheit bedeutet, soziale Verantwortung zu übernehmen, nicht andauernd auf den Staat zu schielen, sondern sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen.
BODO RAMELOW Ich sage immer, Ostdeutsche und Westdeutsche sprechen die gleiche Sprache, sind aber völlig anders sozialisiert, und daraus entstehen spannende Dinge. Als ich 1990 nach Thüringen kam, dachte ich, ich hätte manches von der DDR verstanden, weil ich seit Anfang der Achtzigerjahre regelmäßig in die DDR gereist war, meist privat über den kleinen Grenzverkehr. Auf diese Weise konnte man ohne Voranmeldung in die DDR reinfahren, bekam seinen Stempel in die Stempelkarte und durfte 48 Stunden bleiben. Für Leute aus Marburg, wo ich damals lebte, war Salzwedel der äußerste Punkt, den man erreichen konnte. Die Familie meines Vaters stammte von dort. Ich bin bei Verwandten untergekommen, habe Dorffeste erlebt und abends in der Konsumkneipe gesessen. Als Wessi, der alle Arbeiterlieder kannte und textsicher war, habe ich in der Konsumkneipe revolutionäre Lieder gesungen.
Die DDR war für mich damals eine fremde Welt, eine Welt, die seltsam funktionierte. Wenn zum Beispiel der Postbote kam, in diesem Dorf mit 90 Einwohnern und einer Hauptstraße, dann sagte mein Halbbruder zu mir: «Das ist Stasi-Müller!» Damit konnte ich gar nichts anfangen. Die nächste Postkarte an meinen Bruder habe ich adressiert: Platz der Revolutionäre 1. Ich wollte als Wessi einfach mal dummes Zeug machen. Es ist aber nichts passiert, die Postkarte wurde anstandslos zugestellt. Als ich 1992 Stasiunterlagen über mich anforderte und feststellen musste, dass es über mich gar nichts gab, war ich tief enttäuscht. Stasiakten sind der letzte Dreck. Meine damalige Sekretärin, die völlig unbelastet war, konnte gar nicht aushalten, was sie da alles über ihren Vater und ihre Familie zu lesen bekam. Ich musste sie erst mal in den Arm nehmen und sie trösten.
In Gotha sind 1990 Stasiakten frei auf dem Marktplatz verteilt worden, ohne dass jemand an die Folgen dachte, die das für Menschen haben konnte. Bei einer meiner Mitarbeiterinnen, die beim MfS hauptamtlich als Schreibkraft tätig gewesen war, aber nie einen Tag für die Stasi gearbeitet hat, stellte sich heraus, dass der eigene Ehemann der IM war. Der DGB hat sie wegen falscher Angaben fristlos entlassen. Ich war der zuständige Gewerkschaftssekretär und habe ihr Rechtsschutz gewährt. In diesem Zusammenhang habe ich angefangen, mich mit Stasiakten zu beschäftigen. Dabei habe ich durch Zufall einen OibE enttarnt, ohne dass ich wusste, was ein OibE ist, ein Offizier im besonderen Einsatz; ich hatte das Wort noch nie gehört. So bin ich etwas tiefer in diese Materie eingedrungen, die mich ursprünglich gar nicht interessiert hat, und habe begriffen, wie dürftig meine früheren Vorstellungen über die DDR waren. Aufgrund meiner verwandtschaftlichen Beziehungen hatte ich geglaubt, die DDR ganz gut zu verstehen. Als ich dann herkam, stellte ich fest, ich hatte gar nichts verstanden.
Im Spätsommer 1989, wenige Wochen vor dem Mauerfall, war ich mit meinen Kindern wieder einmal bei meinem Halbbruder. Seine Kinder kommen mittags aus der Schule, und mein Halbbruder fragt: «Wer hat denn heute in der Schule gefehlt?» Der ist aber fürsorglich, denke ich bei mir, fragt seine Kinder nach den Mitschülern. Erst ein Jahr später habe ich begriffen, dass er etwas ganz anderes wissen wollte, nämlich, ob Mitschüler mit ihren Eltern abgehauen waren und jetzt vielleicht in der Prager Botschaft saßen.
Mit meiner Schwägerin, die beim FDGB arbeitete, habe ich manchmal über Gewerkschaftsarbeit geredet. Ich habe nichts von dem verstanden, womit sie sich beschäftigte. Der sogenannte Freie Deutsche Gewerkschaftsbund war nur dem Namen nach eine Gewerkschaft, überhaupt nicht vergleichbar mit dem westdeutschen DGB. In der DDR war die Gewerkschaft Träger der Sozialversicherung, also der Renten- und Krankenversicherung, und Träger des FDGB-eigenen Feriendienstes der DDR. Der Kultur- und Sozialfonds in jedem Betrieb, das Bonifizierungssystem, war das, was hauptsächlich verhandelt wurde: Wie man Feiern organisiert oder in welches Theater man geht. Nach dem Selbstverständnis des FDGB waren das Tarifverhandlungen. Meine Tarifverhandlungen sahen anders aus.
Meine Tarifverhandlungen waren Kampf, und als ich 1990 nach Thüringen kam, musste ich den Menschen erst einmal sagen: Wenn wir den Kampf gewinnen wollen, müsst ihr in den Streik treten. In den Streik treten heißt Arbeitsverweigerung, heißt, eine sehr persönliche, sehr individuelle Entscheidung treffen, heißt immer auch Angst überwinden. Hinterher, wenn die Streikfront steht und der Streik erfolgreich ist, heißt es, das war das Kollektiv. Aber erst einmal geht es um Entscheidungen von Individuen, und die sind immer mit Angst verbunden. Als Streikleiter darf man nie den Respekt vor dem einzelnen Streikenden verlieren, der die Angst überwinden muss, die Angst vor dem Verlust von Einkommen, vor der Kündigung, vor einem schlechten Zeugnis. Das entsprechende Bewusstsein zur Übernahme persönlicher Verantwortung war in Ostdeutschland nicht ausgeprägt.
KOWALCZUK Ich möchte etwas ergänzen. Die Gewerkschaft FDGB saß ja in der Volkskammer. Die Volkskammer war nicht nur ein Scheinparlament für die paar Parteien, die alle unter Kuratel der SED standen, da saßen auch Massenorganisationen, über die sich die SED formell die Mehrheit in der Volkskammer sicherte. Das funktionierte so: In jedem Betrieb, jeder Universität und eben auch in der Volkskammer wurden SED-Betriebsgruppen gebildet, über die sich die SED ihre Mehrheit sicherte. In diesen SED-Betriebsgruppen oder SED-Grundorganisationen waren sämtliche SED-Mitglieder erfasst. Dort wurde bestimmt, was der staatliche Leiter zu tun und zu lassen hatte. In der Volkskammer bestand die SED-Gruppe also nicht nur aus den Mitgliedern der «SED-Fraktion», sondern auch aus den SED-Mitgliedern der FDJ, des FDGB, des Kulturbundes und so weiter, sodass in dieser SED-Betriebsgruppe die Mehrheit aller «Abgeordneten» versammelt war und dort ihre Befehle entgegennahm. Da gab es natürlich meist keine allzu großen Differenzen.
Das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften war durch diese Einbindung seit 1949/50 enorm gestärkt worden. Eigentlich lachte jeder über den FDGB, weil er nichts weiter war als ein Transmissionsriemen der SED. Er war wichtig für einige soziale Sachen wie die Urlaubsplatzvergabe und so etwas. Aber nicht für politische Sozialkämpfe. Als 1990 die neue Verfassung der DDR ausgearbeitet wurde, sollten die Gewerkschaften nun gleichsam staatliche Aufgaben zugewiesen bekommen, die DDR wäre damit fast ein Gewerkschaftsstaat geworden, einige sprachen auch von der «Gewerkschaftsdiktatur». Das hat die an der Diskussion beteiligten Bundesdeutschen, vor allem auch die Kommentatoren, extrem irritiert. Die BGL-er, die Ansprechpartner der Beschäftigten in den Betrieben, haben sich damals mächtig aufgespielt; dabei gab es gar keine Handhabe, ihre Ansprüche umzusetzen. Es war der letzte Versuch der FDGB-Heinis, ihre Pfründe in die neue Zeit zu retten.
RAMELOW Dazu passt eine Geschichte, die sich 1990 zutrug, als wir die zentralen Tarifverhandlungen für den ostdeutschen Einzelhandel auf den Weg gebracht haben. Die allererste Tarifverhandlung für den Einzelhandel fand hier in Erfurt statt, im Gasthaus Kleines Venedig, das muss im März, April 1990 gewesen sein. Daraus ist dann eine größere Bewegung entstanden, und Ende des Jahres hatten wir ganz Ostdeutschland zusammen. Die Tarifverhandlungen wurden in Berlin im Haus am Köllnischen Park geführt, übernachtet haben wir nebenan im Bildungszentrum des FDGB, genannt Tischkasten. Es gab dort ein wunderbares Restaurant für die Werktätigen. Und ein Tisch war sein Tisch – der Tisch von Harry Tisch, dem Vorsitzenden des FDGB. Wir sollten uns da mal hinsetzen, sagten unsere Gastgeber. Und dann mussten wir an die Decke gucken. Da war ein Kranz von Spiegeln angebracht, in denen man den gesamten Raum überblicken und genau sehen konnte, was an welchem Tisch vor sich ging. Solche Erlebnisse haben mich dann doch abgeschreckt.
KOWALCZUK Als die Gewerkschaften ab Dezember 1989 versuchten, sich neu aufzustellen, gab es zunächst zwei Strömungen: auf der einen Seite die alten hauptamtlichen Funktionäre, die versuchten, auch persönlich zu retten, was zu retten war, auf der anderen Seite diejenigen, die Mitbestimmung wirklich institutionalisieren wollten. Nach der BGL-Wahl im Frühjahr 1990 setzte dann eine Verschiebung in der Debatte ein. Westdeutsche Gewerkschaftsfunktionäre versuchten nämlich – Sie werden mir jetzt gleich heftig widersprechen –, Kämpfe, die sie in der alten Bundesrepublik verloren hatten, nun auf dem Ostgebiet aufs Neue zu entfachen.
RAMELOW Ich widerspreche gar nicht.
KOWALCZUK Damit stießen sie im Osten aber auf ein Problem, weil viele Leute die Schnauze voll hatten, die wollten von der Gewerkschaft nichts mehr hören. Die wollten auch von Parteien nichts mehr hören, die wollten von nichts etwas hören, was nach Staat roch. Hier müssen wir die Anfänge der schwachen Zivilgesellschaft suchen, die wir heute beobachten.
RAMELOW In der Praxis war es etwas komplizierter. Mein erster Auftrag 1990 lautete, die Gewerkschaft Handel, Nahrung und Genuss im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, Bezirke Erfurt, Suhl und Gera, zu unterstützen. Ich zog hier in Erfurt ins Gewerkschaftshaus ein. Das war kurze Zeit ziemlich strittig im DGB in Westdeutschland, ob man überhaupt in die Gewerkschaftshäuser des FDGB einziehen sollte. Die IG Metall hat eigens rote Busse angeschafft, mobile Büros, mit denen man von Betrieb zu Betrieb fuhr. Was die Frage der Mitgliedschaft anging, dachte man sich am Anfang, man übernimmt einfach die FDGB-Spartenorganisationen. Am Bogensee wurde die Gewerkschaft Handel, Nahrung und Genuss erst einmal aufgelöst. Ich hatte keine Ahnung, welche Rolle die ehemalige Hochschule der FDJ im Norden Berlins für viele Ostdeutsche spielte.
KOWALCZUK Ehemalige Villa von Goebbels, heute ein ungenutztes Areal mit Gebäuden, die verfallen. Eine Schande.
RAMELOW Es waren jedenfalls seltsame Räume. Der eine oder andere FDGB-ler, der damals dabei war, hat sich erinnert, dass er am Bogensee ein Studienjahr verbracht hatte. Also: Die Gewerkschaft Handel, Nahrung und Genuss wurde geteilt in die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten der Deutschen Demokratischen Republik, NGG, und die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen der Deutschen Demokratischen Republik, HBV. Diese Zerlegung der alten DDR-Gewerkschaft in zwei Einzelgewerkschaften war nötig, um sie mit westdeutschen Strukturen kompatibel zu machen. Auf einem Gewerkschaftstag in Köln wurde die Gewerkschaft HBV der BRD dann mit der Gewerkschaft HBV der DDR vereinigt. In der Düsseldorfer Zentrale war man der Annahme, wir wären aufgrund der Mitgliederzahl zur weltgrößten Handelsgewerkschaft geworden. Mit der Anpassung des DDR-Bankleitzahlensystems an die BRD kam dann das böse Erwachen. Vom einen auf den anderen Tag wurden die Mitgliedsbeiträge nicht mehr von den Kombinaten bezahlt, sondern mussten vom einzelnen Mitglied bezahlt werden. Da hatten wir zwar ein Riesenheer an Mitgliedern, aber wenig Beitragszahlungen.
Ich hatte die HBV in Thüringen zu organisieren. Mir stand ein riesiger Apparat zur Verfügung, der vom Westen bestens versorgt wurde, mit technischen Poststraßen, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Die Poststraßen hatten vollautomatische Kuvertier-, Sortier- und Frankiermaschinen. Wir waren ja theoretisch die weltgrößte Gewerkschaft. Das Problem war, wir konnten diese Poststraßen für nichts gebrauchen. Ich habe meinen damaligen Bundesvorsitzenden gefragt, ob sie in Düsseldorf noch alle Tassen im Schrank haben. Ich solle mich nicht so anstellen, meinte er, ich könnte sie ja in Hamburg auf dem Fischmarkt verkaufen. Ich weiß nicht, ob sie damals im Westen wirklich glaubten, dass der Nachholbedarf im Osten solche Anstrengungen nötig machte, oder ob es einfach nur westliche Ignoranz war, Unkenntnis der Verhältnisse im Osten.
Auf jeden Fall galt meine HBV in Thüringen als aufmüpfig, wir Thüringer waren auf einmal die Renegaten innerhalb der Gewerkschaftsbewegung, so etwas wie das widerständige Ostdorf Thüringen. Wir haben nicht einfach abgenickt, was uns aus Düsseldorf vorgesetzt wurde, wir haben uns nicht volllaufen lassen mit Material. Wir haben auch die Autos nicht genommen, wir haben dieses ganze Zeug nicht genommen. Ich habe einen Ehrgeiz, habe ich gesagt: Wir dürfen uns nie von den Zahlungen von den Brüdern und Schwestern im Westen abhängig machen.
Den Durchbruch unserer Selbstständigkeit brachte der Arbeitskampf in Bischofferode im Sommer 1993, der bitterste Arbeitskampf der Transformationszeit. Die Gewerkschaft der Bergleute, die westdeutsche IG Bergbau und Energie (IG BE), hatte sich schon abgewendet und die Kumpels aufgefordert, den Kampf einzustellen. In Kassel ließ die Gewerkschaft IG BE sogar gegen den Arbeitskampf der Kumpel in Thüringen demonstrieren, das war eine wirklich bittere Erfahrung. Und auf einmal saß ich mittendrin. Die Westgewerkschaftszentrale Bergbau wurde bei der Westgewerkschaftszentrale Handel vorstellig und verlangte meine Abberufung; ich hätte in Bischofferode nichts zu suchen. Es ginge nicht, dass wir die Leute aufhetzten. Damals haben Wessis und Ossis gemeinsam angefangen, sich selber zu ermächtigen, und waren plötzlich auf einem gemeinsamen Weg unterwegs. Am Ende ist es mir gelungen, den Arbeitskampf in Bischofferode zu schlichten.
Die Auseinandersetzungen in den eigenen Reihen waren nicht von Pappe. Bei einer Versammlung von Hauptamtlichen – das muss 1993 gewesen sein – meinte ich sarkastisch: Es wäre schön, wenn wir alle einheitlich gekleidet wären mit Tropenhelm und Khakihose. Dann würde man uns besser erkennen. Daraufhin haben mir zwei Westsekretäre Schläge angedroht. Sie wollten nicht wahrhaben, dass viele im Osten die Gewerkschaften als Besatzungsarmee wahrgenommen haben. Wenn Theater geschlossen oder Orchester zusammengelegt wurden, fielen Sätze wie: «Lieber zu Westgeld arbeitslos als zu Ostgeld weiterfiedeln.»
Auf diese Weise sind zahlreiche Transformationsprozesse gescheitert. Deshalb habe ich Ihnen auch nicht widersprochen, als Sie eben sagten, damals seien westdeutsche Konflikte in Ostdeutschland noch einmal ausgefochten worden. Auch der Kampf um die 35-Stunden-Woche zum Beispiel, für die ich immer eingetreten bin, wurde auf Ostdeutschland übertragen und ist in Ostdeutschland endgültig verlorengegangen. Die Ostdeutschen haben diesen Kampf nämlich gar nicht verstanden, es war zu keinem Zeitpunkt ihr Kampf. Es war der Kampf der Welt, aus der ich kam: die aufgehende Sonne mit der 35! Im Osten ging es darum, wie ich den Arbeitsplatz sichere, wie ich morgen den Betrieb am Laufen halte.
Die Umwandlung von Volkseigenen Betrieben in Aktiengesellschaften oder GmbHs auf Basis des Modrow-Gesetzes machte die Wahl von Betriebsleitern notwendig. Da kam es zu ganz erstaunlichen Allianzen mit den ehemals staatlichen Leitern, die zwischenzeitlich zu Geschäftsführern mutierten. Ich habe die Stellungnahmen der BGL mitentwickelt und dafür gesorgt, dass die Abfindungen hochgejagt wurden. An die zehntausend Klagen, Arbeitsrechtsklagen im Zusammenhang mit der Auflösung der HO, habe ich hier in Thüringen waschkorbweise an die Arbeitsgerichte tragen lassen. Wir wollten feststellen lassen, dass für die HO die Treuhand haftet und für die Treuhand die Bundesrepublik Deutschland, die sogenannte Durchgriffshaftung nach Aktienrecht. Als sich der Erfolg abzeichnete und wir die erste Instanz hier in Erfurt gewonnen haben, ging die Post richtig ab. Da wurde ich plötzlich von meinem Gewerkschaftschef einbestellt und bekam Bürokontrolle aus unserer Außenstelle in Ost-Berlin. Die haben die Akten bei mir kontrolliert …
KOWALCZUK Die wollten Sie einschüchtern.
RAMELOW So sah es jedenfalls aus. Man verlangte, dass ich den gekündigten Kollegen den Rechtsschutz entziehen solle. Ich sollte die Situation nicht eskalieren lassen. Später erfuhr ich die Hintergründe.
Der Kollege Vorsitzende und der Kollege Justiziar bei uns und der zuständige Treuhandchef hatten zusammen studiert, waren im selben Semester gesessen. Man hatte sich auf einen Deal für ganz Ostdeutschland geeinigt, den meine Gewerkschaft als Erfolg verkaufen sollte: Aus zwei Monatsgehältern Abfindung sollte auf einmal ein Viertelmonatsgehalt werden. Ich fand das schäbig. Der Erfolg, den die HBV in Thüringen erkämpft hatte, sollte irgendwie kompensiert werden.
Unsere Organisation drohte zu zerbröseln, es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Und dann sorgte das Stasiunterlagengesetz für zusätzlichen Sprengstoff. Ich habe meine Leute vergattert: «Ich erwarte, dass ihr alle Antrag auf Einsicht stellt. Und wer hier und heute was zu sagen hat, kann mit mir unter vier Augen reden.» Das hieß, wer dieses Angebot nicht annahm und später doch noch mit einer Akte angeschlichen kam, der hatte mich belogen.
Ich erinnere mich an einen peinlichen Zwischenfall in einem Betrieb mit damals rund dreitausend Beschäftigten. Der Vorstandsvorsitzende war ein ehemaliger Offizier im besonderen Einsatz, was natürlich keiner wusste. Wir hatten Aufsichtsratssitzung an einem Montagmorgen, der Betrieb war in schwerem Wasser, die Kreditlinien waren nicht gesichert, die Warenversorgung war unklar. Wir waren vorbereitet, an diesem Tag mit der Deutschen Kreditbank noch einmal längere Gespräche zu führen. Da steht der Vorstandsvorsitzende auf und liest von einem Zettel komisches Zeug ab. Er müsse jetzt mal dem Gremium erklären, dass er eigentlich einen anderen Namen habe. Ich dachte, bin ich hier im Kino, oder was ist hier los. Kneift mich oder tragt mich raus.
Was war passiert? Ihm lag ein Brief vor, der ihn enttarnte, und er ging davon aus, dass ich oder auch andere im Raum diesen anonymen Brief kannten. Er steckte tatsächlich bei mir in Erfurt im Briefkasten, aber ich war in Erfurt nicht am Briefkasten gewesen und hatte den Brief nicht gesehen. Der Betroffene enttarnte sich also unfreiwillig selber. Ich war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, begriff auf der Stelle das Problem und habe zu ihm gesagt: «Sie gehen jetzt mit mir mal raus!»
KOWALCZUK Hier muss ich einhaken. Ich habe viele Jahre in der Stasiunterlagenbehörde als Forschungsgruppenleiter gearbeitet und war in die Stasidebatten von Anfang an involviert. Jeder Fall lag anders, und man musste jeden Fall einzeln prüfen. Leider wurde das Bild der Stasi in der Öffentlichkeit im Prinzip von ein paar großen Debatten geprägt: Gysi, Stolpe, de Maizière, Schnur, Ibrahim Böhme. Dadurch kamen viele Schiefheiten in die Debatte, vor allem die Dämonisierung der Stasi. Und das hatte einen Riesenentlastungsmoment, nicht zuletzt für die PDS, die immer sagen konnte: Die waren es, nicht wir.
Aber warum ich hier einhaken muss, ist etwas anderes. Sie haben eben wunderbar nebenbei, vielleicht unabsichtlich, Kommissionen erwähnt, in denen Westdeutsche über Ostdeutsche gewissermaßen richteten: Wir können über alles reden, aber wenn du nicht die Wahrheit sagst, dann hast du mich angelogen. Damit kommt es natürlich zu einer Schieflage, denn wenn ich das jetzt mal so direkt formulieren darf, ohne dass ich Sie damit persönlich meine: Wer sind Sie, dass sich ein Ostler mit seiner Biografie vor Ihnen nackig machen muss?
RAMELOW Sie beschreiben es zutreffend, aber arbeitsrechtlich war es genau so.
KOWALCZUK Ich weiß.
RAMELOW Und deswegen musste ich die Frage stellen.
KOWALCZUK Ist mir vollkommen klar. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, woher das tiefe Misstrauen vieler Ostdeutscher kommt. Auf der anderen Seite kenne ich eine Menge Leute, die sind nach Bayern, nach Nordrhein-Westfalen, nach sonst wo gegangen und haben sich damit einer Überprüfung entzogen, die sie im Osten nie überstanden hätten, und haben dann im Westen Karriere gemacht.
RAMELOW Jetzt sind wir, ohne es zu wollen, schon wieder beim Thema Stasi gelandet. Es gab schon 1992 eine Phase, wo ich von diesem ganzen Kram genug hatte und wieder in den Westen abhauen wollte. Manche Widersprüche habe ich einfach nicht ausgehalten.
Ich wollte aber gern nochmal das Milieu schildern, aus dem ich komme. Dann versteht man meinen politischen Lebensweg besser. Also, mein Großvater mütterlicherseits war NSDAP-Mitglied und Bürgermeister bei uns im Dorf. Ursprünglich war er kaisertreu, ein absolut kaisertreuer Mensch; dann zog er in den Ersten Weltkrieg, kam heil zurück und fand die Weimarer Republik unerträglich. Deswegen ist er früh in die NSDAP eingetreten und war schon 1933 Bürgermeister. Als 1938 die Synagogen brannten, hat man ihm das Amt wieder weggenommen, weil er sich geweigert hat, in unserem Dorf die Synagoge anzuzünden. Nicht, weil er Widerständler war, das war er partout nicht. Er fand einfach, es gehöre sich nicht, Gotteshäuser anzuzünden, das war seine Meinung. In unserem Dorf war ein Drittel der Bevölkerung jüdisch, also Landjuden, und mein Großvater hatte eigentlich einen ganz guten Kontakt zu ihnen. Er starb nach dem Krieg vereinsamt in Mainz. Sein Tod hat in unserer Familie tiefe Spuren hinterlassen.
Mein Vater stammte aus Kricheldorf im Kreis Salzwedel und war vom ersten bis zum letzten Tag im Krieg. Kam mit Gelbsucht und Leberzirrhose zurück, hat weiter Alkohol getrunken, was ihn 1967 endgültig hinwegraffte. Ich habe bei ihm gesessen, als er starb. Da war ich elf.
Meine Mutter stammte aus einer protestantischen Familie und war fixiert auf Martin Niemöller, deswegen war Christsein immer Teil meines Lebens. Der bekannteste Vorfahr in dieser Familie Fresenius, der eine große Rolle bei uns zuhause spielte, war Johann Philipp Fresenius in Frankfurt am Main. Das ist der, der Goethes Eltern getraut und Goethe getauft hat, «ein sanfter Mann, von schönem gefälligen Ansehen», wie Goethe schreibt.
In der Familie meiner Mutter gab es eine Tradition: Entweder wirst du Bäcker oder du wirst Pfarrer. Der Onkel, der die Bäckerei übernehmen sollte, hatte sich aus Gründen, die wir bis heute nicht kennen, bald nach dem Krieg das Leben genommen; deswegen war der Betrieb verpachtet worden. Nach dem Tod meines Vaters zog meine Mutter mit ihren vier Kindern aus dem niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck zunächst zurück in ihre Heimat in Rheinhessen. Aber die Bäckerei dort war inzwischen ziemlich heruntergewirtschaftet. Wir zogen dann weiter in die Gegend von Gießen. So zerschlug sich der Plan, dass ich in den Familienbetrieb einsteigen sollte; außerdem stellte sich heraus, dass ich eine Mehlstauballergie hatte. Und da ich Legastheniker war, fiel auch das mit dem Theologiestudium flach.
Bald nach meiner Geburt hatte mein Vater die Verrücktheit begangen, in die DDR zu gehen und sich um Aufnahme in die neugegründete Nationale Volksarmee zu bewerben. Bei der Bundeswehr hatte man ihn abgelehnt, aber er wollte unbedingt wieder ins Militär, weil das die schönste Zeit seines Lebens war. Auch bei der NVA haben sie ihn nicht genommen. Aber sie haben ihm angeboten, ein bisschen zu spionieren: Er käme doch aus dem Westen, und da gäbe es eine Menge zu tun. Als er dann wieder bei meiner Mutter angeschlichen kam und ihr alles gebeichtet hat, hat die ihn gezwungen, zur Polizei zu gehen. So kam meine Familie das erste Mal mit dem Bundesnachrichtendienst in Kontakt. Er musste genau berichten, wer mit ihm gesprochen hatte und was man von ihm hatte wissen wollen. Deswegen ist mein Vater nie wieder in die DDR, obwohl er nach dem Krieg in Salzwedel zweimal verheiratet gewesen war und drei Kinder gezeugt hatte. Meine Mutter hat den Kindern die Alimente bezahlt in Sachleistungen – in solchen Dingen war sie sehr akkurat –, aber geredet wurde über meine Halbgeschwister nicht.
In den Achtzigerjahren nahmen meine Schwester und ich die Spurensuche auf. Wir wussten nur, dass es sich um Zwillinge handelte und eine weitere Tochter. Wir haben angefangen, die Pastoren in der Gegend von Salzwedel anzuschreiben und bekamen tatsächlich Antwort von einem Pastor aus Kalbe an der Milde: Den einen könnt ihr besuchen, der ist bei der LPG, der freut sich. Den anderen solltet ihr besser nicht besuchen, der ist bei der Volkspolizei. Unsere Halbschwester ist bis heute nicht aufgetaucht. In der Silvesternacht 1989 haben wir ein Familientreffen bei Heidelberg organisiert, und da kamen alle zum ersten Mal zusammen. Der Volkspolizist war inzwischen bei der Kriminalpolizei gelandet. Später hat er mir erzählt, wie dankbar er mir war, dass ich ihn durch meine bloße Existenz vor der Staatssicherheit bewahrt hatte. Weil Stasi-Leute keine Westverwandten haben durften – Sicherheitsrisiko –, blieb ihm diese «Karriere» erspart.
Umgekehrt war es freilich nicht anders, das wird immer gerne vergessen. Ich hatte meinem Arbeitgeber jedes Mal zu melden, wenn ich in die DDR fuhr. Als die Turbulenzen 1989 losgingen, war ich mit dem DGB bereits regelmäßig in Eisenach gewesen, es gab eine Städtepartnerschaft Marburg-Eisenach. Im Januar 1990 meinte dann einer aus meiner Gewerkschaftszentrale in Düsseldorf: «Du bist da ja dauernd in der Zone» – so hieß das damals –, «in Erfurt suchen sie jemanden, der sie beraten soll.» Dass ich den Weg nach Thüringen gefunden habe, habe ich letztendlich also der deutsch-deutschen Überwachungsparanoia zu verdanken.
Ich will meine DDR-Erfahrungen so zusammenfassen: Für mich war die DDR zeit ihres Bestehens ein enigmatisches, ein exotisches Land. Ich habe vieles über sie erst verstanden, als es sie längst nicht mehr gab. Und in der Erinnerung vieler ehemaliger DDR-Bürger wurde die DDR zu einem Land, das es so wahrscheinlich niemals gegeben hat.