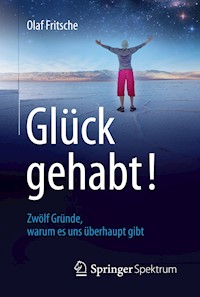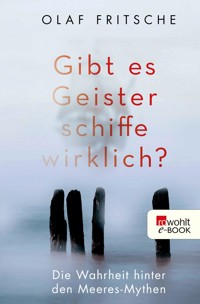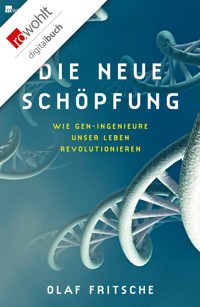
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Fast unbemerkt stehen wir am Beginn eines neuen Zeitalters. Die Synthetische Biologie macht Gentechnik so einfach wie das Spiel mit Legosteinen oder Bauklötzen und beschert uns schon in naher Zukunft künstliche Designer-Lebewesen. Statt langwierig einen Organismus zu züchten, wird er einfach am Computer geplant und mit Fertigmodulen produziert. Damit stößt die Menschheit die Tür zu einem neuen Zeitalter auf wie zuletzt mit der Erfindung des Computers. Aber dieses Mal werden die Folgen bedeutend weitreichender sein: Statt Straßenlaternen strahlen selbstleuchtende Bäume in unseren Straßen, in unseren Küchen stehen Food-Generatoren, die aus synthetischen Zellen leckere Speisen bereiten, und wir essen Fleisch, das nie Teil eines Tieres war. Künstliche Zellen filtern das CO2 aus der Luft, und Algen setzenes in billigen Treibstoff um. Bio-Implantate optimieren unsere Körperfunktionen, und Viren spüren kranke Zellen im menschlichen Körper auf. Wir tragen Kleidung, die sich selbst repariert, und umgeben uns mit Haustieren, die längst ausgestorben waren. Vielleicht klingt das noch utopisch, aber bereits heute gibt es in Laboren Fleisch aus der Retorte. Schon heute produzieren Bakterien industriell Kunststoffe, und Forscher arbeiten mit Zellen, deren Eltern Computer und Roboter sind. Und es gibt bereits Fische, die leuchten, weil man ihnen Gene einer Leuchtqualle implantiert hat. Wissenschaft und Technik erwarten eine Revolution unvorstellbaren Ausmaßes, das wahrscheinlich größte Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Dieses Buch beschreibt als erstes die anstehende wissenschaftliche und gesellschaftliche Revolution und gibt einen Ausblick auf die denkbare Entwicklung. Und es wird uns verblüffen mit den Dingen, die bereits heute möglich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Olaf Fritsche
Die neue Schöpfung
Wie Gen-Ingenieure unser Leben revolutionieren
Inhaltsverzeichnis
ES WERDE NEUES LEBEN!
Ein Rezept für die Zukunft
Wo die Zukunft gemacht wird
Forschung aus der ersten Reihe betrachtet
1 DIE ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT
DIE ZUKUNFT ALS MAMMUTAUFGABE
Kalte alte Zeiten
Angefressen, tiefgefroren und fast unerreichbar
Tiefkühltruhen der Evolution
Das Zeitalter der biologischen Inventur
Ein haariges Schnäppchen bei eBay
Ein Puzzle für Fortgeschrittene
Mammuts – Elefanten mit Abweichungen
Die Turbo-Evolution aus der Maschine
Elefant rein, Mammut raus
Pleistozän-Park statt Jurassic Park
Wo bleiben die Dinos?
Brauchen wir wirklich Mammuts?
Blick in die Zukunft
iGEM: Ein Team für «Echte Wissenschaft»
ZWERGMAMMUTS MÖGEN KEINE SÄBELZAHNKÄTZCHEN
Prestigepoker mit Fell und Federn
Vom Riesenmammut zum Kuscheltier
Keine Gnade für Schoßtiere
Bio-Hightech im Aquarium
Blick in die Zukunft
iGEM: Ein strahlendes Projekt
LÄNGST VERGESSENE VERWANDTSCHAFT
Ein Genforscher mit Forschergenen
Das Quäntchen Urzeit in uns
Neandertaler reloaded
Blick in die Zukunft
iGEM: Entscheidungen mit Krümeln
2 ES WERDE NEUES LEBEN!
IM AUSBILDUNGSCAMP FÜR BIOHACKER
Die Faszination des Chaos
Gene nach Norm
Bakterielles Blut und Arsenschnüffler
Die «Ecolicence to Kill»
Provisorien der Natur
Synthetische Patente
Schulen mit und ohne Zukunft
Der genetische Fingerabdruck des Neandertalers
iGEM fängt an der Schule an
Mein Haus, meine Garage, mein Labor!
Falsche Terroristen und wahre Betrüger
Blick in die Zukunft
iGEM: Ein Fehler ... und du kannst von vorne anfangen!
GEKÜNSTELTES STATT KÜNSTLICHES LEBEN
Wissenschaft im Rampenlicht
Kein Forscher wie jeder andere
Ein Computer wird Vater
So einfach wie möglich
Wunderhelfer von der Wunschliste
Wem gehört die Zukunft?
Blick in die Zukunft
iGEM: Gems für iGEM
DIE WAHRE NEUE SCHÖPFUNG
Rätselhafte erste Schöpfung
Wissenschaft im Untergrund
Machen, was kein anderer macht
Denn sie wissen nicht, was sie erforschen
Die Dreifaltigkeit künstlichen Lebens
Leben wandelt um
Leben speichert Wissen
Leben ist verpackt
Mehr als die Summe seiner Teile
Nur auf die Idee kommt es an
Wenn Leben nichts Besonderes mehr ist
Blick in die Zukunft
iGEM: E. Coli auf dem Prüfstand
DIE DUNKLE SEITE DER NEUEN MACHT
Ein wenig Grau im Schwarz-Weiß
Tod aus dem Online-Shop
Terror nach dem Baukastenprinzip
Darf jeder alles wissen?
Programmierte Killer
Überraschend tödlich
Erst die Kontrolle, dann die Sequenz
Genetisches Wettrüsten
Nur zur Verteidigung – natürlich
Blick in die Zukunft
iGEM: Transparenz für den Elfenbeinturm
IST «SICHER IST SICHER» SICHER GENUG?
Mutiertes Wetter über Erdbeerfeldern
Voller Stopp für die Sicherheit
Zuflucht am Meer
Sicherheitsverwahrung in vier Stufen
Schwarzmarkt der Gene
Zell-Junkies und sterile Stängel
Die Vision von einer neuen Chemie
Ein universeller Code des Lebens
Jenseits der genetischen Norm
Neue Fabriken für lebendige Experimente
Vier Buchstaben für mehr genetische Vielfalt
Ein lebendes Paralleluniversum
Fremd, fit und manchmal ein Problem
Blick in die Zukunft
iGEM: Blaue Zellen gegen rote Haut
AN DER SCHWELLE
iGEM: And The Winner Is
MEHR ERFAHREN!
ABBILDUNGSNACHWEIS
LABORBUCH
DANKSAGUNG
ES WERDE NEUES LEBEN!
«Bei dem, was in Ihrem Labor passiert –
fragen die Leute da nicht, ob Sie Gott spielen?»
«Oh, wir spielen nicht.»
Aus einem Interview des Journalisten Chris Anderson
mit dem umstrittenen Genetiker Craig Venter
Was darf es zum Frühstück sein? Rührei mit Kokosgeschmack und sanftem Wasabi-Aroma? Toast mit dick Butter und einer Scheibe Hühnchenmarmelade? Oder möchten Sie von den Frühstücksflocken ihrer Kinder naschen, die nach Pommes mit Ketchup und Mayo schmecken? Keine Sorge! Das klingt nur skurril und ungesund, ist aber cholesterinfrei und enthält jede Menge Vitamine. Denn in den 2020er Jahren kümmern sich vollautomatische Taste-Styler um das leibliche Wohl, kreieren auf Knopfdruck synthetische Zellen, die Ihnen jede beliebige Mischung aus Nährstoffen, Ballaststoffen und Mineralstoffen auf den Tisch zaubern. Optimal versorgt legen Sie den Weg zur Arbeit in einem Fahrzeug zurück, in dessen Außenhaut photosynthetische Mikroben für die Energieversorgung eingelassen sind. Lautlos gleiten Sie auf selbstleuchtenden Straßen dahin, die automatisch von implantierten Zellen repariert werden, sobald sich ein winziger Riss bildet. Nach dem genetischen Identitätscheck am Eingang plaudern Sie kurz mit dem Pförtner über die Nachricht, dass die verseuchten Kampfgebiete des letzten synbiologischen Krieges schon fast von virenfressenden Parallelmikroben gereinigt wurden. Anschließend müssen Sie in das Meeting, auf dem die Umformung der Venus-Atmosphäre besprochen wird. Beim Griff in die Jackentasche knistert es. Ich will endlich ein Zwergmammut wie alle in meiner Klasse! steht mit ungelenker Kinderschrift auf dem altmodischen Zettel aus Papier. In diesem Moment humpelt Müller II vorbei. Das rechte Knie ist bandagiert. Seine Kinder haben ein Zwergmammut. Lavendelduft breitet sich im Büro aus. Beruhigend. Das Signal für den Beginn des Meetings. Moschus gibt es nur kurz vor der Deadline der Produktivphase. Noch schnell den Zellkultivator für das Mittagessen programmieren, dann geht es los. Während Müller II referiert, dämmern Sie in einem organischen Sessel dahin, der sich Ihrer Anatomie anpasst und wohltuende Wärme abgibt. Ein synthetischer Organismus, der die vielen Reden auf das Wesentliche komprimiert – das wäre mal eine lohnenswerte Erfindung, überlegen Sie. Aber das wird wohl auch in der Zukunft noch eine Weile ein Traum von morgen bleiben.
Ein Rezept für die Zukunft
Klingt abgehoben? Spekulativ? Nach Science-Fiction? Sie haben recht! Wenn wir aus heutiger Sicht einen Blick in die nächsten 50Jahre wagen, begeben wir uns mit jedem Jahrzehnt auf immer dünner werdendes Eis. Kaum jemand wagt es, eine Prognose abzugeben. Vor allem Wissenschaftler, in deren Laboren die Zukunft entsteht, scheuen sich meistens, über ihre aktuellen Projekte hinauszuschauen. Als ob danach nichts mehr käme.
Aber es wird eine Menge kommen. Die biologische Revolution, an deren Anfang wir im Moment gerade stehen, wird nicht in den Laboren und Fabriken bleiben. Sie wird in unsere Küchen gelangen, unsere Wohnzimmer erobern, die Kinderzimmer erreichen und vielleicht… wahrscheinlich… vermutlich… sogar uns selbst erfassen. Was genau passieren wird, ist natürlich unmöglich vorherzusagen. Wer hätte vor 50Jahren, als Computer groß wie Schränke waren, an eine Welt voller Smartphones und Tablets gedacht? Wem wäre eingefallen, dass Rechner nicht nur Atombombenversuche simulieren können, sondern über Facebook und Twitter Freunde rund um den Globus stets auf den aktuellen Stand über jede erdenkliche Kleinigkeit halten? Ist irgendwer auf den Gedanken verfallen, dass pubertierende Jugendliche von ihren Kinderzimmern aus ganze Industriezweige zum Wanken bringen könnten? Dies alles wäre vor 50Jahren spekulativ gewesen. Und Science-Fiction. Heute ist es Wirklichkeit. Und Alltag. Wenn wir wissen wollen, was mit der neuen Biologie auf uns zukommt, wie wir in der Zukunft leben werden, dürfen wir also nicht nur spekulieren – wir müssen spekulieren.
Und wenn wir dabei richtig vorgehen, sind unsere futuristischen Phantasien gar nicht so weit hergeholt, wie es zunächst den Anschein hat. Das geeignete Rezept dafür hat einst Jules Verne entwickelt. Die U-Boote, Hubschrauber und Mondreisen in den Romanen des Franzosen sind keineswegs dessen blühender Vorstellungskraft entsprungen. Verne hat die Anregungen für seine Utopien vielmehr in populärwissenschaftlichen Zeitschriften gefunden oder in Gesprächen mit Wissenschaftlern von deren Projekten erfahren und die Ideen lediglich konsequent weitergesponnen. Eine simple Methode, mit der auch viele Entwicklungen der Computerrevolution vorauszusehen gewesen wären. Das erste Videospiel Tennis for Two entstand bereits 1958 am Brookhaven National Laboratory. Mit dem Arpanet als Vorläufer des Internets verbanden sich US-amerikanische Universitäten ab 1969, zwei Jahre später ging die erste E-Mail durch das Netz, und 1982 infizierte der 15-jährige Schüler Rich Skrenta Apple-Computer mit seinem selbstprogrammierten Virus. Offenbar fällt die Zukunft nicht vom Himmel, sondern sie entsteht in den Köpfen und Laboren findiger Wissenschaftler und Amateure.
Vernes Rezept funktioniert also noch immer, und wir werden es in diesem Buch benutzen, um einen Blick in die Zukunft des Lebens und des Menschen zu erhaschen. Dafür spüren wir die wichtigsten, spannendsten und meistversprechenden Trends der Biologie auf und versuchen zu erahnen, wie sie die Welt verändern werden. Vom Frühstückstisch bis zum künstlichen Leben aus der Retorte. Immer nur ein, zwei Schritte vor der aktuellen wirklichen Forschung und doch schon in einer Welt, in welcher der Mensch die Schöpfung selbst in die Hand genommen hat. Die Utopie wird dadurch zur Hochrechnung. Und die Wissenschaft rückt ein ums andere Mal erstaunlich nahe an unsere Science-Fiction-Szenarien.
Wo die Zukunft gemacht wird
An Jurassic Park beispielsweise. Im Roman erweckt ein reicher Geschäftsmann längst ausgestorbene Dinosaurier wieder zum Leben, indem er ihre DNA isoliert und die Lücken mit Amphibien-DNA auffüllt. Wenn es anstelle der schrecklichen Echsen auch eiszeitliche Mammuts sein dürfen, befinden wir uns auf dem besten Weg vorwärts in die Vergangenheit. Im ersten Teil des Buches werden wir sehen, wie der deutsche Biochemiker Stephan Schuster das Erbmaterial der zotteligen Elefanten analysiert hat. Wir lernen den Automaten seines amerikanischen Kollegen George Church kennen, der die DNA von einer Art in das Erbgut einer anderen umwandeln kann, und erfahren von den Plänen des russischen Biologen Sergei Zimow, der in Sibirien ein Naturschutzgebiet im eiszeitlichen Stil aufzieht. Pleistozän-Park statt Jurassic Park – diese Fiktion könnte schon in wenigen Jahrzehnten Wirklichkeit werden.
Ebenso wie die Visionen von Craig Venter. Die Projekte des enfant terrible der Wissenschaft begegnen uns im zweiten Teil des Buches, in dem sich alles um Zellen im Baukastensystem und neugeschaffenes Leben dreht. Der Biochemiker, Genetiker, Unternehmer und Medienstar Venter schlägt gerne Alarm, um auf sich und seine Forschung aufmerksam zu machen. Er spricht von synthetischen Zellen, die in den Medien schnell zu künstlichem Leben werden, während er in Wahrheit nur einen Computer zum Vater gemacht hat. In dem Hype um Gott oder Frankenstein? gehen die tatsächlichen Erfolge seines Instituts leicht unter. Der schillerndste Vertreter der Synthetischen Biologie schafft nämlich kein neues, sondern weitestgehend minimiertes Leben. Leben, das so weit reduziert ist, dass es gerade eben noch überleben kann. Diese Minimalzellen sollen als Chassis für designte Biomaschinen nach Wunsch dienen, die ihre Vielfalt aus dem Katalog erhalten. Wie beim Kauf eines Computers sollen Biologen, Chemiker, Pharmazeuten und Mediziner schon bald die Zellen für ihre Forschung nach Belieben mit standardisierten Komponenten ausstatten und online bestellen. So entstehen genau nach Plan Algen, die Diesel produzieren, Bakterien, die Kunststoffe herstellen, oder Pilze, die Giftstoffe abbauen. Die biologische Revolution wird also wahrscheinlich in der Industrie anfangen. Aber sie wird keineswegs dort haltmachen. Nichts spricht dagegen, dass wir uns in der Zukunft beispielsweise mit Zellkulturen aus dem Internet selbst ein kalorienarmes Schnitzel mit Schokoladengeschmack züchten. Leuchtenden Joghurt haben jedenfalls schon Studenten in ihrer Freizeit wie mit einem genetischen Legokasten zusammengebastelt.
Craig Venter mag nicht wirklich künstliches Leben erschaffen wollen – Jack Szostak schon. Wir werden erfahren, mit welchen Tricks der Nobelpreisträger in seinem Labor an einer neuen Schöpfung arbeitet, um herauszufinden, wie die erste Schöpfung auf der Erde abgelaufen sein könnte. Aus allerlei chemischen Substanzen und Verbindungen, die allesamt nicht den kleinsten Hauch von Leben in sich tragen, bildet Szostak mikroskopische Membranbläschen, die auch nicht leben. Aber fast. In vielen, vielen kleinen Schritten nähern sich seine Gebilde dem Vorbild langsam an. Wie dicht er dem Ziel bereits ist, lässt sich nur schwer abschätzen. Der Durchbruch könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen. Oder in zehn? Vielleicht in 50? Wenn er Erfolg hat, bedeutet dies nicht weniger, als dass der Mensch das Wissen und die Macht hat, tote Materie zum Leben zu erwecken. Und dass auf Szostak ein zweiter Nobelpreis warten dürfte.
Oder sollte der Mensch solche Experimente besser bleibenlassen? Muten wir uns zu viel zu? Sind unsere biosynthetischen Fähigkeiten dabei, unser moralisches Vermögen endgültig abzuhängen? Ist die Erschaffung von Leben zu groß für unseren kleinen Geist? Dürfen wir, was wir können? Aus ethischer Sicht kommen in der Zukunft schwierige Fragen auf uns zu, die wir gerne beiseiteschieben, solange es möglich ist, denen wir uns in diesem Buch aber stellen wollen. Gerade weil sie zu heftigen Kontroversen führen. Denn neben Macht und Verantwortung geht es um viel Geld. Darf man Leben patentieren? Oder muss man es vielleicht sogar, damit die Forschung bezahlbar bleibt? Die Diskussion hierzu ist noch nicht in Fahrt gekommen. Vielleicht weil immer beide Seiten Recht und Unrecht zugleich haben. Je nachdem, welchen Wertemaßstab wir anlegen. Aber wird sich der Maßstab nicht verschieben, wenn wir selber Leben gestalten und schaffen können?
Auf jeden Fall werden sich die Risiken ändern. Leben nach Maß wird sich kaum auf Säbelzahnkätzchen als Haustiere und tumorkillende Bakterien beschränken. Im Jahr 2006 orderte ein Journalist des britischen Guardian probehalber über Internet bei einer Spezialfirma für künstliche DNA ein Stück synthetisches Erbgut. Kein Gen für Bananenaroma oder ein fluoreszierendes Protein, sondern eine Kopie der verbotenen DNA des Pockenerregers. Weltweit gibt es nur noch zwei Labore, in denen das tödliche Virus aufbewahrt wird, ansonsten ist der Besitz strengstens untersagt. Trotzdem fand sich die Lieferung wenig später im Briefkasten. Wie wir feststellen werden, hatte schlicht niemand nachgeprüft, was der Guardian bestellt hatte. Gegenwärtig ist es noch eine Aufgabe für Spezialisten, aus solchen DNA-Fragmenten wieder ein tödliches Virus zu machen. Doch heute führen Studenten schon in Praktika gentechnische Experimente durch, für die vor 20Jahren ein Doktorand mehrere Jahre gebraucht hätte. Noch einmal 20Jahre, und jeder halbwegs begabte Forscher kann nach DNA-Sequenzen aus dem Internet einen tabuisierten Killer konstruieren, in 40Jahren kann er womöglich ein völlig neues Virus kreieren. An bösen Buben mit finsteren Absichten hat es noch nie gemangelt, und in Zukunft werden auch Terroristen ungeahnte Möglichkeiten haben. Denn im Vergleich zum Bau einer Atombombe sind tödliche Mikroorganismen leicht herzustellen, und ein Labor für Synthetische Biologie ist verhältnismäßig billig und klein.
Zur Not passt es auch in die Garage. Oder in die Küche. Alles, was man braucht, gibt es bei eBay zu kaufen, oder man bastelt es selbst aus Bohrmaschinen, Legosteinen und leeren Wasserflaschen. Wir schauen uns die Welle der Do-it-yourself-Biologie an, die derzeit durch die USA läuft und bereits nach Europa schwappt. Je nach Enthusiasmus und Geldbeutel machen sich Amateure daran, mit einfachsten Mitteln oder halbprofessioneller Ausstattung ihre eigene DNA zu isolieren oder Krebs zu heilen. Ganz nach dem Vorbild der Computerrevolution wollen die Biohacker die Wissenschaft vom Leben aus den Elfenbeintürmen der Universitäten befreien und zu den Menschen bringen. Viel Schaden anrichten können sie nicht, viel lernen schon. Wer jemals mit eigenen Händen überprüft hat, ob er selbst ein bestimmtes Gen in sich trägt, wird nie mehr glauben, in Biotomaten gebe es keine Gene. Vor allem könnten die Amateure aber eine Flut von Innovationen lostreten. Gerade weil sie über kein großes Budget verfügen und teilweise kaum wissen, was sie tun, sind die Hacker für manche Überraschung gut. Beispielsweise wenn sie mit einem simplen DNA-Test feststellen, dass in Sushi nicht überall Thunfisch drin ist, wo Thunfisch draufsteht. Der schnelle Gentest für die Hosentasche dürfte bald so manche Restaurants das Fürchten lehren.
Vielleicht auch die Gen-Industrie selbst? Bislang ist es ein teurer und aufwendiger Prozess, nachzuprüfen, ob sich fremde Gene aus veränderten Organismen selbständig gemacht haben. Für den weitverbreiteten Gen-Raps haben Wissenschaftler das bereits nachgewiesen. In Zukunft könnten entwichene Gene aber ohne jede Bedeutung oder gar Gefahr für das Ökosystem sein. Denn die synthetischen Organismen von morgen schreiben ihre Gene womöglich in einer anderen Sprache als ihre natürlichen Verwandten. Wir erfahren, mit welchen Tricks der Berliner Biochemiker Nediljko Budisa seine Bakterien auf einen neuen genetischen Code umprogrammiert, mit dem herkömmliche Zellen nichts anfangen können. Er errichtet damit gewissermaßen eine genetische Firewall zwischen der Eigenschöpfung und der Natur. Das ist Jason Chin aber noch zu wenig. Der Brite versetzt seine Zellen gleich in eine Art Parallelwelt, indem er ihnen einen selbstentwickelten Code aufzwingt, der einen komplexen neuen Leseapparat benötigt. Auf diese Weise wird der Baum des Lebens dicht an der Wurzel gespalten. Der Mensch zweigt sich ein Stück der Natur ab, das ganz allein seinen Regeln gehorcht.
Forschung aus der ersten Reihe betrachtet
Minimalzellen, Gen-Bausteine, erweiterte genetische Codes… Das alles klingt utopisch, abstrakt und fern von unserem alltäglichen Leben. Doch der Eindruck täuscht. Um eine Ahnung zu entwickeln, wie die Biologie unsere Arbeit, das Familienleben und unsere Freizeit verändern wird, beginnen wir deshalb jedes Kapitel in diesem Buch mit einer fiktiven Szene aus einer möglichen Zukunft. Anschließend erfahren wir, wie weit reale heutige Forscher mit ihrer Science auf dem Weg zu unserer Fiction bereits gekommen sind. Wissenschaftlich-technische Zusammenhänge sind dabei in ein «Laborbuch» ausgelagert, das uns selbst komplexe Abläufe der Synthetischen Biologie verstehen lässt. Neben der Wissenschaft vergessen wir nicht die ethische Seite der Forschung und stellen uns die Frage, ob wir wirklich tun sollten, was wir tun können. Den Abschluss bildet dann jeweils ein Blick in die Zukunft, in dem wir versuchen, mit unserem neuen Wissen abzuschätzen, was wann passieren wird.
Zwischen den Kapiteln streifen wir uns die weißen Laborkittel über. Um an einem konkreten Beispiel mitzuerleben, wie Wissenschaft wirklich funktioniert, sind wir live dabei, wenn eine Gruppe von Forschern der Zukunft an der Zukunft der Forschung arbeitet. Der international Genetically Engineered Machine Competition oder kurz iGEM genannte Wettbewerb ist eine Spielwiese für Visionen, auf der junge Nachwuchswissenschaftler jenseits der eingefahrenen Schienen des regulären Forschungsbetriebs ihre eigenen Ideen entwickeln und umsetzen dürfen. Wer wissen will, welche Richtung die Biologie der kommenden Jahrzehnte einschlägt, darf sich nicht auf die altgedienten Nobelpreisträger der Vergangenheit fixieren, sondern muss denen über die Schulter schauen, die diese Zukunft aktiv gestalten werden. Dafür begleiten wir eine Gruppe von fünf Schülern, die am Heidelberger Life-Science Lab ein eigenes Projekt entwickeln. Schritt für Schritt erleben wir mit, wie die Ideen reifen, welche Schwierigkeiten auftreten und was alles dazugehört, eine Vision in die Wirklichkeit selbstgeschaffener Zellen zu verwandeln.
Wie die Zukunft tatsächlich aussehen wird, werden wir am Ende des Buches trotz unserer Analysen und Prognosen nicht mit Sicherheit sagen können. Aber wir werden eine ungefähre Vorstellung haben und wissen, woran einige der besten Wissenschaftler der Welt angestrengt arbeiten und was wirklich hinter den Schlagzeilen vom künstlichen Leben steckt. Vor allem schaffen wir eine Grundlage für die gesellschaftliche Diskussion, die wir alle – Wissenschaftler, Politiker, Industriemanager und ganz gewöhnliche Bürger – führen müssen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Letztlich wird es nur eine Zukunft geben, in der wir alle leben müssen. Gemeinsam.
1 DIE ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT
Der erste Schritt in die Zukunft führt manchmal in die Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an Jurassic Park? Den Bestseller von Michael Crichton oder wahrscheinlich eher die Verfilmung durch Steven Spielberg? Darin lässt ein Multimilliardär für seinen neuen Vergnügungspark Dinosaurier klonen, deren DNA aus dem Verdauungstrakt von Mücken stammt, die vor Millionen Jahren in Bernstein eingeschlossen wurden. Natürlich geht dabei einiges schief, und der größte Teil der Handlung besteht darin, dass eine Gruppe Wissenschaftler, die vor Eröffnung des Parks zur Begutachtung eingeladen wurde, um ihr Leben läuft und dennoch bis auf die Hauptfiguren nacheinander als Reptiliennahrung endet. Ein typischer Thriller eben. Spannend, aber mit einer ziemlich weit hergeholten Idee. – Oder?
Jurassic Park ist nicht nur eine Abenteuer- und Horrorgeschichte, es ist auch Science-Fiction, bei der die Fiktion zu einem erstaunlich großen Teil auf soliden Ergebnissen aus der echten Forschung beruht. «DNA hatte man bereits aus ägyptischen Mumien extrahiert und aus dem Fell eines Quagga, eines zebraähnlichen afrikanischen Tieres, das in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgestorben war. Ab 1985 schien es möglich, die Quagga-DNA zu rekonstruieren und auf diese Weise ein neues Tier entstehen zu lassen», heißt es beispielsweise im Auftakt der Geschichte. Und die Realität? «Der Roman […] war von unserem Labor inspiriert», verriet der Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, Svante Pääbo, in einem Interview mit der Zeit. Er muss es wissen, denn er selbst ist der Wissenschaftler, der als Doktorand heimlich und beinahe in 007-Manier die Mumien-DNA isoliert hatte. Nach seiner Promotion ging Pääbo an die University of California in Berkeley und arbeitete mit Allan Wilson zusammen, dem die Entschlüsselung des Quagga-Erbguts gelungen war. So weit stimmen Fiktion und Wirklichkeit also überein. Wie sieht es aber mit dem nächsten Schritt im Roman aus? Hat die Wissenschaft bereits das Quagga auferstehen lassen?
Sie hat es nicht. Crichton lag erneut richtig, als er schrieb: «1982 waren die technischen Probleme natürlich gewaltig gewesen […]. Das Verfahren war nur schwierig, teuer und hatte geringe Erfolgsaussichten.» Diese Aussagen gelten am Beginn des 21.Jahrhunderts noch immer. Doch in den rund 25Jahren seit Erscheinen des Buches hat die Wissenschaft neue Methoden entwickelt, die rasend schnell immer mächtiger und zugleich billiger werden, sodass die Erfolgsaussichten für die Neuschöpfung einer ausgestorbenen Art wahrscheinlich nicht mehr lange so gering sein werden. Für die Zukunft stehen die Chancen sogar ausgesprochen gut. Deshalb werden wir uns im ersten Teil des Buches ansehen, wie weit die Forschung bereits gekommen ist auf dem Weg zum Jurassic Park und mit welchen wiedererschaffenen Arten wir in den kommenden Jahrzehnten rechnen müssen. Wir werden erfahren, auf welche Weise Neuschöpfungen in unsere privaten Haushalte einziehen werden und in welcher Hinsicht die wirkliche Zukunft den Roman übertrumpfen wird. Dabei werden wir auch überlegen, ob die Wissenschaft sich tatsächlich in diese Richtung entwickeln sollte, und abzuschätzen versuchen, ob sie es tun wird. Denn wie heißt es in Jurassic Park: «Möglich war es mit Sicherheit; es musste sich nur jemand finden, der es versuchte.»
DIE ZUKUNFT ALS MAMMUTAUFGABE
27.März 2048, Ostsibirien, Pleistozän-Park
Es hat sich gelohnt! Gut, die Anreise in der klapprigen Maschine war ein wenig abenteuerlich und dauerte gefühlte drei Ewigkeiten. Das Hotel kann man bestenfalls mit dem Prädikat «rustikal» belegen und muss selbst dabei noch beide Augen zudrücken. Das Essen schmeckt, als habe es vor seinem kurzen Aufenthalt in der Küche schon einige Jahrtausende im dauergefrosteten Boden zugebracht. Und zu allem Überfluss hat selbst das angeblich so modern eingerichtete Pressezentrum keine Verbindung zur globalen Datengalaxie. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als in traditioneller Weise ein Reisetagebuch zu führen und meine Reportage später abzuschicken, wenn wir wieder zu Hause sind.
Trotzdem hat es sich gelohnt! Wegen der Mammuts! Ich kannte die Tiere natürlich schon aus dem Eiszeit-Zoo in Frankfurt. Hatte über verschiedene Entwicklungssprünge und diverse Rückschläge berichtet, mit denen aus einer Gruppe Asiatischer Elefanten schrittweise eine kleine Herde Neo-Wollhaarmammuts wurde, wie der offizielle deutsche Name lautet. Ich war bei der feierlichen Eröffnung des Zoos dabei gewesen und hatte miterlebt, wie radikale Gegner der neuen Biologie die Mammuts vor laufenden Surround-Cams mit giftgrüner Farbe besprüht haben. Ich habe der Geburt des ersten «echten» Mammutbabys entgegengefiebert und bin einer seiner 1000Paten geworden, deren Name in eine Plakette neben dem Eingang zum Gehege eingraviert ist. Kurz: Ich dachte, ich wüsste alles über Mammuts.
Ich hatte ja keine Ahnung.
Wer wirklich und wahrhaftig Mammuts erleben will, muss in den Pleistozän-Park kommen. Das weite Gelände, die offene Graslandschaft, der eisige Wind und, ja, auch die unzähligen Mücken vermitteln von Anfang an ein ganz anderes Gefühl als selbst das durchdachteste Zoogehege. Hier stehen keine mehr oder minder deplatzierten Eiszeittiere verloren im Herzen einer modernen Großstadt. Hier ist die Eiszeit selbst wieder zum Leben erwacht.
Mit dem Beobachtungsfahrzeug geht es hinein in das Herz des Parks. Geländegängige Zehnradwagen, an deren Anwesenheit die Tiere seit ihrer Geburt in der Aufzuchtstation gewöhnt sind. In der Regel achten sie gar nicht auf die brummenden Transportdosen für neugierige Besucher. Für den Fall, dass sich doch einmal ein Mammut oder Höhlenlöwe gestört fühlen sollte, sind die Fahrzeuge gepanzert und wie ein Kugelabschnitt flach gehalten, sodass sie weder aufzubeißen noch platt zu trampeln sind. Die Ranger benutzen sie schon seit Jahren, und es hat noch keinen einzigen ernsthaften Vorfall gegeben. Dabei fahren die Wagen mit uns ganz dicht heran an Saiga-Antilopen, Moschusochsen und Wisente.
Und endlich die Mammuts.
Es war nur die kleinere der beiden Herden, die wir heute zu sehen bekamen. Acht Weibchen und ein mächtiger Bulle, dessen gedrehte Stoßzähne zur Warnung unser Fahrzeug leicht schüttelten. Goliath ist nervös, klärte uns der Ranger auf. Auch für ihn ist es das erste Mal. Wie auch nicht? Der Park hatte die Presse schließlich eingeladen, damit wir Zeugen einer Weltpremiere werden. Schon in wenigen Tagen sollte es so weit sein. Goliath verpasst uns einen letzten Schubser und dreht dann ab. An seinem zotteligen Körper vorbei erhasche ich einen Blick auf Valya. Mit einem Gewicht von etwa sechs Tonnen sind die Weibchen trotz ihrer Höhe von 2,70Meter kompakt gebaut. Man muss schon genau hinsehen, um es zu bemerken. Aber dann ist es deutlich zu erkennen: Valya ist hochträchtig. Es kann wirklich nicht mehr lange dauern, und sie wird ihr Junges gebären. Das erste Mammut seit Tausenden von Jahren, das in Freiheit geboren wird. Und mit ein wenig Glück werde ich die Geburt miterleben.
Kalte alte Zeiten
Wenn es um die Wiederbelebung der Vergangenheit geht, sind sie unsere größte Hoffnung: Mammuts besiedelten etwa vier Millionen Jahre lang die Steppen Afrikas, Eurasiens und Nordamerikas. Den größten Teil dieser Zeit mussten sie mit ständigen Umschwüngen des Klimas zurechtkommen. Während des Pleistozän genannten Erdzeitalters, das vor 2,6Millionen Jahren begann und erst vor rund 10000Jahren endete, wechselten sich Kaltzeiten, in denen mächtige Gletscher heranwuchsen und große Flächen im Norden sowie in den Gebirgen bedeckten, mit Warmzeiten ab, in denen sich das Eis zurückzog und eine baumlose Landschaft zurückließ. Viele der Tierarten, die wir heute kennen, entwickelten sich in diesem Hin und Her der Temperaturen, darunter Bisons, Moschusochsen, Elche, Rentiere und Pferde. Sie lebten neben Arten, die inzwischen längst verschwunden sind, wie Säbelzahnkatze, Riesenhirsch, Höhlenbär und Wollnashorn.
Die Mammuts des Nordens reagierten auf die eisigen Verhältnisse, indem sie ihren Körperbau an das Klima anpassten. Statt auf fünf Meter heranzuwachsen wie ihre Vorfahren, die Steppenmammuts, maßen Wollhaarmammuts lediglich drei bis vier Meter, die dem kalten Wind weniger Angriffsfläche boten. Sie waren damit ungefähr so groß wie heutige Elefanten, aber kompakter gebaut mit kleineren Ohren und einem kürzeren Rüssel. Vor allem waren die Wollhaarmammuts aber mit einem dichten Fell bedeckt. Fast einen Meter lang konnten die Deckhaare des Winterfells werden. Unter ihnen gab es eine zweite Schicht mit halb so langen und weniger borstigen Haaren, auf die schließlich eine dichte Unterwolle und eine isolierende Fettschicht folgten. Das Fell bedeckte das ganze Mammut, einschließlich Ohren, Schwanz und Rüssel. Auf der Stirn bildete es eine Ponyfrisur, ganz wie in den Animationsfilmen der Ice Age-Reihe beim Mammut Manfred zu sehen.
Wollhaarmammuts waren damit hervorragend vor allen Widrigkeiten ihrer Umwelt geschützt – außer vor dem Menschen. Im Pleistozän wagte sich der Zweibeiner mit dem großen Hirn zum ersten Mal aus dem warmen Süden in mittlere Breitengrade. Vermutlich schon als Neandertaler, spätestens als moderner Homo sapiens machte er Jagd auf alles essbare Großwild. Noch streiten sich die Wissenschaftler, ob der Mensch mit seinem Hunger manche Arten, darunter das Mammut, ausgerottet hat oder ob doch eher die Änderung des Klimas schuld ist. Fest steht, dass mit dem Auftreten des Menschen rund um den Globus viele Arten Großsäuger verschwanden. Auch das Wollhaarmammut starb am Ende der letzten Eiszeit auf dem Festland aus. Lediglich auf einigen isolierten Inseln konnten sich kleinere Gruppen halten, die dort bis in die Zeit der Pharaonen lebten.
Alles, was von den Mammuts bis in die Gegenwart überdauert hat, sind Knochen und eingefrorene Kadaver im Permafrostboden Sibiriens. In warmen Sommern taut das Eis mitunter so weit ab, dass es unvermittelt ein Mammut freigibt. Auch in Zeiten von Geländewagen und Hubschraubern ist es noch immer ein Abenteuer, solch einen Fund zu bergen und für die wissenschaftliche Untersuchung an einen sicheren Ort zu transportieren. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts waren die Strapazen jedoch ungleich größer und die Bedeutung der Skelette weitaus rätselhafter. Denn zu einer Zeit, in der die Schöpfungsgeschichte der Bibel auch in wissenschaftlicher Sicht den Maßstab setzte, hatten haarige gefrorene Elefanten eigentlich keinen Platz im kalten Norden.
Angefressen, tiefgefroren und fast unerreichbar
Die Rentiere waren am schlimmsten. Was nicht heißen soll, dass es der Expedition des russischen Botanikers und Naturforschers Michael Friedrich Adams an Widrigkeiten gemangelt hätte. Anfang Juni 1806 war er von der Provinzhauptstadt Jakutsk aufgebrochen. Rund 1500Kilometer fuhr er auf der Lena nordwärts, jener sibirischen Lebensader, die zu den längsten Flüssen der Welt gehört, aber in der Regel nur fünf Monate im Jahr eisfrei und damit schiffbar ist. Dann saß Adams fest. Die Winde in der Nähe des Polarmeeres waren für die Weiterreise zu ungünstig.
Der unfreiwillige Aufenthalt gab Adams Gelegenheit, besser mit den Männern bekannt zu werden, deren Zeugnis ihn in das kalte Nichts gelockt hatte. Vor allem mit dem Jäger und Ewenkenhäuptling Ossip Schumachow, der sieben Jahre zuvor inmitten des Eises einen unförmigen Block entdeckt hatte. Als Schumachow im darauffolgenden Sommer wieder zu der Stelle kam, war der Block teilweise aufgetaut und gab den Blick auf ein gewaltiges Mammut frei. Ausgerechnet ein Mammut. Für die Ewenken galten diese haarigen Elefanten nach einer alten Überlieferung als mächtige Boten des Todes. Überzeugt, bald sterben zu müssen, erkrankte Schumachow im Winterlager der Familie schwer. Doch seine Konstitution war schließlich stärker als der Aberglaube, und als er sich erholt hatte, holte er zum Gegenschlag aus. Wenn das Mammut schon harmlos war, sollte es ihm wenigstens ein bisschen Profit einbringen. Kurzerhand verkaufte er die Stoßzähne des Tieres an den Elfenbeinhändler Roman Baltunow. Bei dieser Gelegenheit fertigten die beiden Männer eine etwas ungelenke Zeichnung des Mammuts an, die Adams durch Zufall in Jakutsk zu sehen bekam. Einige Wochen später wartete der Forscher nun ungeduldig mit Schumachow und Baltunow auf eine Gelegenheit, endlich zu den Überresten des Mammuts aufbrechen zu können.
Der Fundort lag hinter einer Reihe schroffer Berge und strauchloser Ebenen. Rund drei Tage war man dorthin unterwegs, und es gab nur eine Möglichkeit, die weglose Strecke zurückzulegen: auf dem Rücken von Rentieren. Auf einem locker geschnürten Sattel hielten die Reiter ihr Gleichgewicht – oder eben nicht. «Ich hatte große Mühe, auf solch einem Rentier zu sitzen», gab Adams in seinem Bericht über eine Reise ins Eismeer und die Entdeckung von Überresten eines Mammuts zu. Mehrmals fiel er auf «sehr verdrießliche Weise» herab und wünschte sich sehnlichst ein Paar Steigbügel.
Am Ziel angekommen, erwartete ihn zunächst eine schwere Enttäuschung. Nach den Berichten hatte Adams damit gerechnet, einem hervorragend konservierten Mammut gegenüberzustehen. Fast wie lebendig sollte das Tier wirken. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus. «Ich fand das Mammut noch an derselben Stelle vor, aber es war übel zugerichtet», schrieb Adams. Schuld an dem schlechten Zustand des Kadavers war der vorhergegangene Sommer. Seine Wärme hatte das Mammut so weit angetaut, dass es unter seinem eigenen Gewicht auf die Seite gekippt war und auf einer Sandbank lag. Dort war es im wörtlichen Sinne ein gefundenes Fressen für Wölfe, Eisbären, Vielfraße und Füchse gewesen, und die ewenkischen Jäger hatten mit dem Fleisch ihre Hunde gefüttert. Der Rüssel fehlte vollkommen. Übrig waren nur das Skelett (mit Ausnahme eines Vorderbeins), beide Augen, ein Ohr, das eingeschrumpelte Gehirn sowie eine Menge Haut und Haare. Nicht gerade viel.
Aber Adams war nicht lange niedergeschlagen. Als er die Überreste genauer musterte, erkannte er, das vor ihm mehr Mammut lag, als die Wissenschaft des 19.Jahrhunderts jemals zuvor zu sehen bekommen hatte. Bislang hatten sich die Zoologen mit einzelnen Knochen, Stoßzähnen und vagen Beschreibungen Reisender zufriedengeben müssen. Das reichte nicht aus, um zu erklären, was ein derartiges Wesen so weit im Norden machte. Handelte es sich um eine unbekannte Tierart? Oder war es nur ein besonders großer Elefant, den die biblische Sintflut in den hohen Norden gespült hatte? Solche Fragen waren mit Adams’ Fund geklärt. Die anatomischen Besonderheiten der Knochen stellten das Mammut als eigenständige Spezies neben den Asiatischen und den Afrikanischen Elefanten. Und es war als ständiger Bewohner der sibirischen Steppe an die Kälte angepasst, wie die kleinen Ohren und das dicke Fell, mit dem das Tier überall bedeckt war, verrieten. Von frischem Eifer erfasst, suchte Adams alle Überbleibsel des Mammuts zusammen und bereitete sie für den Transport vor. Zurück in Jakutsk, bot ihm jemand ein Paar Stoßzähne an, die er für das verlorene Paar hielt. Adams kaufte das Elfenbein und verschickte alles zusammen nach Sankt Petersburg.
In der Hauptstadt des Zarenreichs wurde das Skelett des Mammuts nach dem Vorbild eines anderen Gerippes, das von einem Asiatischen Elefanten stammte, rekonstruiert. Dabei wurden die fehlenden Beinknochen aus Holz nachgebildet. Bis in unsere Zeit ist Adams Mammut eines der am besten erhaltenen Mammutskelette. Anders als die damaligen Forscher sind heutige Wissenschaftler aber weniger von den Knochen begeistert. Für sie liegt der wahre Wert des Mammuts in den viel unscheinbareren Fundstücken, von denen Adams gut 16,4Kilogramm mitbrachte: Haare, Borsten und Zotteln.
Tiefkühltruhen der Evolution
40Jahre lang hielt Adams’ Mammut den Rekord als besterhaltenes Relikt der nordischen Elefanten. Erst dann wurde ein weiteres vollständiges Skelett entdeckt. Seitdem gibt der Permafrost in unregelmäßigen Abständen immer wieder mehr oder weniger gut erhaltene Exemplare frei. Schätzungen zufolge stecken noch Tausende Mammuts im sibirischen Eis. Besondere Aufmerksamkeit erregen Funde, die nicht nur Haut und Knochen umfassen, sondern noch reichlich weiches Gewebe wie Muskelfleisch enthalten.
So entdeckte 1977 ein Bulldozerfahrer im Nordosten Russlands beim Baggern ein vollständiges Mammutkalb. Dima war zum Zeitpunkt seines Todes nur etwa ein halbes Jahr alt und rund einen Meter groß. Seine inneren Organe waren ausgesprochen gut erhalten für jemanden, dessen Ableben 39000Jahre zurücklag, und die roten Blutkörperchen schienen sogar vollständig intakt zu sein. Elf Jahre später stieß der Kapitän eines Frachters auf ein weiteres Mammutkalb, das als Mascha bekannt wurde und dem lediglich der Rüssel fehlte. Die schönste Eismumie ist jedoch Ljuba. Das Mammutmädchen war kaum einen Monat alt, als es vermutlich beim Überqueren eines Flusses im Schlamm stecken blieb. Die lehmige Erde tötete das Kalb nicht nur, sondern konservierte es zusammen mit der Kälte.
Das Mammutkalb Dima sah bei seinem Fund etwas eingefallen aus, war aber ansonsten ausgesprochen gut erhalten.
Egal, wie gut erhalten ein Mammut aber auch sein mag – das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist: gefunden zu werden. Spätestens wenn es freigelegt wird, setzt ein zerstörerischer Zerfallsprozess ein. Eiskristalle zerfetzen die empfindlichen Strukturen der Zellen, und Bakterien lassen Fleisch und Innereien verfaulen. Um die Tiere nach der Bergung möglichst schonend aufzutauen und dabei umfassend zu untersuchen, bringen Wissenschaftler heutzutage besonders vielversprechende Exemplare zusammen mit dem Eisblock, in den sie eingeschlossen sind, ins nordsibirische Dorf Chatanga. Dort dient eine künstliche Höhle, in der einst Fisch und Fleisch gelagert wurde, als Mekka für Mammutforscher aus der ganzen Welt. Bei konstanten minus 15Grad Celsius können sie ohne Zeitdruck ihre Proben nehmen. Beispielsweise vom Jarkow-Mammut, das 1997 praktisch gleich um die Ecke gefunden wurde. In penibler Kleinarbeit erarbeiten sie ein so lebendiges Bild von den Mammuts, als würden die zotteligen Riesen noch immer über die Steppe wandern.
Eine Vorstellung, die vielleicht bald Wirklichkeit werden könnte.
Das Zeitalter der biologischen Inventur
Eigentlich hatte der Wissenschaftler, dem die Mammuts ihre Chance auf eine Neuschöpfung verdanken, so wenig mit ausgestorbenen Elefanten zu tun, wie es innerhalb der Biologie nur möglich ist. Seit seiner Zeit als Doktorand am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried galt Stephan Schusters Vorliebe den kleinen Dingen des Lebens. Ihn faszinierten Bakterien und die Tricks, mit denen sie sich in einer meist feindlichen Umwelt durchsetzen. Obwohl sie nur aus einer einzigen Zelle bestehen, sind die Mikroorganismen dennoch in der Lage, chemische Stoffe in ihrer Nähe zu schmecken, die daraus gewonnenen Informationen zu verarbeiten, auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu fällen und auf eine Nährstoffquelle zu- bzw. von einem Gift wegzuschwimmen. Schuster untersuchte diesen Prozess in all seinen Phasen, während er das übliche Nomadenleben eines erfolgreichen jungen Wissenschaftlers führte. Nach seiner Promotion 1990 ging er für drei Jahre an das legendäre California Institute of Technology, das meist einfach kurz Caltech genannt wird, in vielen Hochschulrankings zu den zehn besten Universitäten der Welt gezählt wird und bislang 31Nobelpreisträger hervorgebracht hat. 1994 kam er als Gruppenleiter zurück ans MPI für Biochemie und wechselte 2000 an das MPI für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
Schuster hatte sich inzwischen auf die Erforschung des bakteriellen Erbmaterials spezialisiert. In den Zellen aller bekannten Lebensformen – vom Bakterium bis zum Mammut – sind die Informationen über den Bau und die Eigenschaften eines Organismus in Form langer Moleküle von Desoxyribonukleinsäure (DNA) gespeichert (siehe Abbildung rechts, Laborbuch: Das Buch des Lebens hat vier Buchstaben). Die DNA wird uns in den folgenden Kapiteln noch öfter begegnen, und wir werden nach und nach ihre Besonderheiten kennenlernen. Vorerst genügt es uns zu wissen, dass die DNA aus vier unterschiedlichen Bausteinen besteht, die mit den Buchstaben A, T, C und G abgekürzt werden. Entscheidend ist die Abfolge der Bausteine, die Biologen als Sequenz bezeichnen. In ihr steckt die Information für den Aufbau der Proteine, die entweder selbst Baustoff für Zellstrukturen sind oder als eine Art Werkzeug neues Zellmaterial produzieren. So bilden beispielsweise Keratine als Strukturproteine Fingernägel und Haare, wohingegen andere Proteine als Enzyme aus dem Abbau von Zucker Energie gewinnen. Den DNA-Abschnitt mit der Information für ein Protein bezeichnen wir als Gen, und die Gesamtheit aller Gene als Genom. Kennen wir das Genom eines Lebewesens, können wir daher ablesen, welche Proteine es bildet, welche Nährstoffe es verwerten kann, welche Vitamine es benötigt, in welchem Temperaturbereich es sich wohl fühlt, mit welchen anderen Arten es verwandt ist und vieles mehr. Mit der Sequenz des Genoms liegen folglich viele Geheimnisse des betreffenden Organismus wie ein offenes Buch vor uns.
So setzte am Ende des vorigen Jahrhunderts ein regelrechter Wettlauf der Genetiker ein, in dem es darum ging, das Genom möglichst vieler Arten als Erster zu sequenzieren, also die Reihenfolge der A, T, C und G in ihrer DNA herauszufinden. Darmbakterien, die Erreger von Cholera und Syphilis, Hefen, Schimmelpilze, Reis, Mais, Hausfliege, Großer Panda, Schnabeltier… praktisch alles, was Erbmaterial besitzt, wurde und wird analysiert. Inzwischen ist die Liste der erfassten Arten auf über 1000 angewachsen, und auch der Mensch steht darauf. Die Sequenzierung seines Genoms geriet zum medienträchtigen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Humangenomprojekt auf der einen Seite, das mit öffentlichen Geldern finanziert wurde und an dem weltweit renommierte Institute beteiligt waren, sowie dem privaten Unternehmen Celera des US-amerikanischen Biochemikers und Pioniers der Genforschung Craig Venter auf der anderen Seite. Der Wettstreit wurde hart und mit wenig Respekt für die Konkurrenz geführt, sodass der US-amerikanische Präsident Bill Clinton am 26.Juni 2000 ein vorzeitiges Unentschieden verkündete. Zwar hatte keiner der Kontrahenten wirklich das gesamte Humangenom entschlüsselt, aber beide konnten immerhin Sequenzen der einfacher zu analysierenden Abschnitte vorweisen. Bis auch die schwierigeren Teile fertig waren, dauerte es noch drei Jahre, die ruhiger und von den Medien weitgehend unbeachtet vergingen.
Auch Stephan Schuster hatte zu den Genomlisten beigetragen, indem er Teile des Erbguts von Bakterien aufschlüsselte. Für ihn waren die Sequenzen allerdings kein Selbstzweck, sondern nur das Datenmaterial, das er für seine eigentliche Arbeit benötigte. Er wollte aus dem Genom eines Bakteriums ablesen, über welche biochemischen Bausteine es verfügt und wie diese zusammenwirken. Seine Vision war, allein aus dem Erbgut vorhersagen zu können, wie ein Mikroorganismus aussieht und wie er sich verhält. Ein hochgestecktes Ziel, das noch viele Jahre intensiver Forschungsarbeit erfordert hätte.
Doch dann stellte das Schicksal die Weichen für Schusters Karriere gleich doppelt neu.
Ein haariges Schnäppchen bei eBay
Die erste Veränderung wäre für Schuster beinahe ohne Folgen geblieben. Ein junges Unternehmen der Biotechnologie-Branche hatte eine neue Maschine zur automatischen DNA-Sequenzierung entwickelt. Das Gerät von 454Life Sciences arbeitet mit einer verbesserten Methode, die speziell kurze Bruchstücke sehr schnell analysieren kann, indem sie viele Splitter parallel untersucht. Stephan Schuster ahnte, dass die Maschine die Genomforschung auf den Kopf stellen würde, aber um an dieser Revolution teilzunehmen, musste man eine Hürde nehmen, die für die meisten Forschungseinrichtungen schlichtweg zu hoch war: Die Sequenzer kosteten etwa 500000Dollar pro Stück, und wer an der Weltspitze mitmischen wollte, brauchte gleich mehrere Geräte. Selbst an einem Max-Planck-Institut sprengen solche Summen den Etat der meisten Arbeitsgruppen. Es sah ganz so aus, als würde der Schnellzug ohne Schuster abfahren, als das Schicksal sein zweites Ass aus dem Ärmel zog: Schuster erhielt einen Ruf an die Pennsylvania State University und siedelte 2006 in die USA über.
Der Umzug veränderte alles. «Ich musste mein Labor neu aufbauen», erinnert Schuster sich. Sein zukünftiger Arbeitgeber hatte ihm dafür großzügige Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Genug, um den 454-Sequenzer