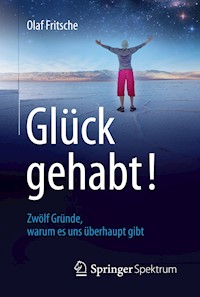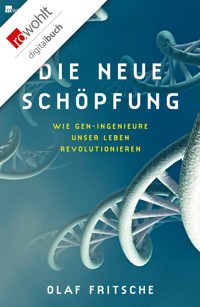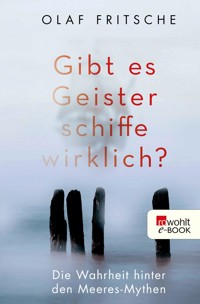
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ganz schön spannend: das geheime Leben der Meere Monsterwellen, die sich aus dem Nichts auftürmen und sogar Ölplattformen verschlingen; Frachter, die blitzschnell in die Tiefe gerissen werden; Geisterschiffe, Riesenkraken und Seeschlangen – alles nur Seemannsgarn? Nein, das gibt es wirklich! Heute, mit den Methoden moderner Wissenschaft, weiß man mehr. Sensoren, Satelliten und Tiefsee-U-Boote helfen, die – bisweilen schauerliche – Wahrheit hinter den Legenden ans Licht zu bringen. In seiner unterhaltsamen Mischung von Fakten und Anekdoten enthüllt Olaf Fritsche, was man über das geheime Innenleben der Meere inzwischen herausgefunden hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Olaf Fritsche
Gibt es Geisterschiffe wirklich?
Die Wahrheit hinter den Meeres-Mythen
Über dieses Buch
Ganz schön spannend: das geheime Leben der Meere
Monsterwellen, die sich aus dem Nichts auftürmen und sogar Ölplattformen verschlingen; Frachter, die blitzschnell in die Tiefe gerissen werden; Geisterschiffe, Riesenkraken und Seeschlangen – alles nur Seemannsgarn? Nein, das gibt es wirklich! Heute, mit den Methoden moderner Wissenschaft, weiß man mehr. Sensoren, Satelliten und Tiefsee-U-Boote helfen, die – bisweilen schauerliche – Wahrheit hinter den Legenden ans Licht zu bringen. In seiner unterhaltsamen Mischung von Fakten und Anekdoten enthüllt Olaf Fritsche, was man über das geheime Innenleben der Meere inzwischen herausgefunden hat.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung Jaroslaw Blaminsky/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-40102-0
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Geschichten von tausendundeinem Meer – Mythen und Wahrheit
Geisterschiffe, Riesenkraken, Monsterwellen, Magnetberge … Es ist ganz schön dickes Seemannsgarn, das uns die Seefahrer früherer Zeiten auftischen. So dick, dass man sich unwillkürlich fragt, wie es sein kann, dass erwachsene Männer (es waren damals fast ausschließlich Männer, da Frauen an Bord angeblich Unglück brachten – noch so ein Aberglaube) ernsthaft Seeschlangen, verlassene Schiffe und Schiffsfriedhöfe gesehen haben wollen. Selbst ansonsten respektable und nüchtern denkende Persönlichkeiten wie Christoph Kolumbus, König George V. und Heinrich der Seefahrer berichteten von Seejungfrauen, Phantomschiffen und Inseln, die es nicht gibt. Da überlegt man sich doch, wie derartige Meeres-Mythen entstehen konnten. Was Kapitäne, Entdecker und einfache Seemänner immer wieder Dinge sehen ließ, die es nicht gibt, ja, gar nicht geben kann.
Die Antwort hängt zum Teil sicherlich mit den Umständen zusammen, unter denen die Besatzungen damals auf den größeren und kleineren Segelschiffen gelebt und gearbeitet haben. Vom Komfort einer heutigen Kreuzfahrt mit ihren Luxuskabinen, reichhaltigen Buffets und detailliert ausgearbeiteten Reiseplänen war man an Bord der Karavellen, Koggen und Karacken jahrhunderteweit entfernt.
Das fing manchmal schon mit der Buchung der Reise an. Ab dem 16. Jahrhundert mussten Männer, die so aussahen, als hätten sie gerade nichts zu tun, in britischen Hafenstädten aufpassen, dass sie nicht unversehens der königlichen Marine beitraten und fortan für den Rest ihrer Tage auf einem Kriegsschiff die Ozeane befuhren. Weil sich die dabei verwendeten Argumente Alkohol, Geld und Prügel als überaus effektiv herausstellten und auch Kapitäne von Handelsschiffen ungern Planstellen in ihrer Mannschaft unbesetzt ließen, führte die zivile Schifffahrt 200 Jahre später ebenfalls das Pressen oder Schanghaien ein. Dementsprechend war nicht jeder Matrose freiwillig auf dem Schiff und dem Meer unterwegs, was bei dem ein oder anderen zu gelinden Vorurteilen gegenüber der See geführt haben mag.
Zumal die Fahrt besonders im Zeitalter der großen Entdeckungen allzu häufig ins Ungewisse führte. Ohne Funk, Satelliten und Internet reichte der Horizont des Menschen nur bis dorthin. Was dahinter verschwand, war eben weg. Wirklich weg. Meistens für Tage, manchmal für Wochen, ab und zu für Monate oder gar Jahre. Während ein Schiff auf See war, wurden zu Hause an Land Kinder geboren, Freunde begraben und Kriege geführt – und niemand an Bord bekam davon etwas mit. Umgekehrt konnten Schiffe in Stürme geraten, auf Riffe laufen oder von Ungeheuern verschlungen werden, ohne dass einer der Daheimgebliebenen auch nur die Spur einer Ahnung hatte, ob die wagemutigen Seefahrer überhaupt jemals zurückkehren würden. Häufig kamen sie nicht wieder. Dann wusste keiner, was geschehen war, und in der Unsicherheit malte man sich daheim die schrecklichsten Unglücke aus und griff jeden noch so haarsträubenden Erklärungsansatz leichtgläubig auf.
Doch selbst wenn das Schicksal gnädig gestimmt war, entsprach die Fahrt auf einem der früheren Segler nicht unbedingt unserer Vorstellung von Behaglichkeit. Da war beispielsweise die Frage der Unterbringung. Wem hier Bilder von sanft schaukelnden Hängematten vorschweben, der ist den frühen Seeleuten um ein gutes Stück voraus, denn die Hängematten wurden erst ab dem 16. Jahrhundert auf den Schiffen eingeführt, nachdem Kolumbus ihnen bei den amerikanischen Ureinwohnern begegnet war. Vorher musste jedes Besatzungsmitglied selbst zusehen, wo und wie es sich in seiner freien Zeit zur Ruhe bettete. Eine Taurolle, ein Lager hinter Kisten oder einfach eine Ecke auf dem Deck, wo man möglichst nicht so häufig von den schuftenden Kameraden getreten wurde, so sah das «Bett» der Matrosen lange Zeit aus.
Aber übermäßig viel Ruhe bekam man bei der Fahrt über das Meer sowieso nicht. Das Animationsprogramm an Bord lief praktisch rund um die Uhr. Wenn nicht gerade Segelmanöver anstanden, bei denen alle Mann anpacken mussten – ob sie nun Schicht oder eigentlich Pause hatten, war egal –, gab es immer etwas auszubessern, abzudichten oder notfalls kräftig zu schrubben oder zu scheuern. Das Schrubben des Decks diente übrigens nicht als Schikane oder Beschäftigungstherapie, sondern war nötig, um die bloßen Füße der Seeleute vor Splittern zu bewahren und damit das Holz der Planken nicht zu trocken und undicht wurde, wenn es sich zusammenzog.
Wer so viel arbeitet, sollte wenigstens gut essen. Doch selbst auf französischen und italienischen Schiffen war schon bald nach der Abfahrt nicht mehr viel übrig von der berühmten Küche ihrer Heimatländer. Die restliche Zeit bestand das Menü vorzugsweise aus hartem Schiffszwieback, salzigem Pökelfleisch und eingelegten Sardinen. Bei längeren Fahrten konkurrierten zunehmend Maden, Kakerlaken und Ratten mit den Seeleuten um das Futter. Mancher Seemann wartete deshalb mit dem Essen, bis die Sonne untergegangen war und er nicht mehr sehen konnte, was er sich gerade in den Mund schob. Runtergespült wurde alles mit fauligem Wasser oder mit Wein, dessen Alkohol konservierend wirken sollte. Auf Schiffen aus dem Norden nahm man dafür lieber Bier, das in wärmeren Gefilden allerdings schneller schlecht wurde. So oder so floss tagaus, tagein mancher Liter geistigen Getränks die Kehlen hinunter. Für einen respektablen Daueralkoholspiegel im Blut war folglich gesorgt.
Natürlich schlagen Wochen voll gammelnder Fast-Food-Ernährung unbarmherzig auf die Gesundheit. Und so litten die Seeleute auf fast allen Schiffen an Mangelerscheinungen. Vor allem Skorbut, der durch einen Mangel an Vitamin C ausgelöst wird, war berüchtigt. Er machte die Männer müde und träge, verhinderte die Wundheilung, ließ das Zahnfleisch bluten und die Zähne ausfallen. Schließlich bekamen die Matrosen hohes Fieber, Durchfall und fielen tot aus den Wanten. Der portugiesische Entdecker Vasco da Gama verlor auf einer Reise fast zwei Drittel seiner Leute durch Skorbut. Auch aus diesem Grund war eine längere Fahrt übers Meer nur allzu häufig ein Abenteuer ohne Wiederkehr.
Fassen wir einmal zusammen: Die Seeleute früherer Zeiten waren nicht immer aus Reiselust unterwegs, dafür ständig übermüdet und angetrunken, häufig krank und segelten auf einem Meer voller unbekannter Gefahren einem unbekannten Ziel entgegen. Und unter diesen Umständen soll man keine Monster und Gespenster sehen?
Hinzu kommt, dass die Daheimgebliebenen etwas hören wollten von den Wundern und Geheimnissen der großen weiten Welt. Bis vor etwa 100 Jahren sind die meisten Menschen kaum jemals aus ihrem Dorf oder ihrer Stadt herausgekommen. Wenn dann ein echter Seemann erzählte, wollte man nichts wissen von öder Bordroutine, langen Flauten oder schnödem Handel. Viel höher im Kurs standen Monster, Ungeheuer und sonstige Gefahren. Je bedrohlicher, desto besser! Und warum sollten die Seeleute ihrem Publikum den Gefallen nicht tun? Wenn man schon keine Selfies vorzeigen kann, dann vielleicht einen Schrumpfkopf, den Zahn einer Seeschlange oder eine mumifizierte Meerjungfrau.
Auch untereinander erzählten Seemänner sich gerne Geschichten, wenn gerade ruhigere Arbeiten anstanden. Beispielsweise beim Umwickeln der besonders beanspruchten Stellen von Leinen, Tauen und Wanten mit geteertem Schiemannsgarn. Aus dem «Schiemannsgarnspinnen» wurde im Laufe der Zeit das «Seemannsgarnspinnen», bei dem die eigentliche Arbeit weggefallen ist und nur die Geschichten aus dem Grenzgebiet von Wahrheit und Phantasie übrig geblieben sind.
Heute wissen wir, dass nichts dran ist am Seemannsgarn mit seinen Geisterschiffen, Monsterwesen und Riesenwellen. In Zeiten, in denen Satelliten die Ozeane aus dem Weltall beobachten, schwimmende Messbojen ständig jede noch so kleine Veränderung registrieren und Tauchboote bis zum Grund des Meeres vordringen, braucht uns niemand mehr etwas zu erzählen von den angeblichen Mythen der Meere. Längst hat die Wissenschaft aufgeräumt mit Phantomen, Todesstrudeln und Ungeheuern. Oder etwa nicht?
In diesem Buch begeben wir uns auf Spurensuche. Wir lassen uns das beste Seemannsgarn der sieben Weltmeere erzählen und forschen nach, seit wann Seefahrer an den Geschichten gesponnen haben. Anschließend stellen wir die Mythen auf den Prüfstand und finden zusammen mit professionellen Wissenschaftlern, modernen Hobbyforschern und aufgeklärten Seeleuten heraus, ob überhaupt etwas und, falls ja, wie viel wirklich dran ist an den Erzählungen.
Zunächst widmen wir uns dabei den Mythen, die von Schiffen erzählen, mit denen auf die ein oder andere Weise etwas nicht stimmt. Danach beschäftigen wir uns mit den Kreaturen der Ozeane, die so seltsam sind, dass man nicht an sie glauben mag. Im dritten Teil geht es um gefährliche Formen von Wasser, denen nachgesagt wird, dass sie ganze Schiffe verschlucken können. Und den Schluss machen Mythen, bei denen sich das Land in die Belange des Meeres einmischt und umgekehrt.
Machen Sie sich gefasst auf eine Tour über alle Meere der Erde, in die Tiefen der Ozeane und sogar in das Innere des Planeten. In die vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende wie in die Gegenwart. Mit Göttern, Monstern und Forschern.
Eines kann ich Ihnen versprechen:
Sie werden sich wundern!
Olaf Fritsche
Teil 1Verfluchte Schiffe
Wenn Sie Seefahrer sind, verstehen Sie mit Ihrem Schiff keinen Spaß. Auf hoher See gibt es nichts als Wasser. Ohne Schiff wären Sie verloren. Gar nicht einmal weil Sie ertrinken würden, wie allgemein angenommen wird. Nein, ein Seefahrer ohne Schiff stirbt bei ruhiger See für gewöhnlich an Unterkühlung. Was eine angenehmere Art zu sterben sein soll, letztendlich aber auf das Gleiche hinausläuft. Womöglich werden Sie auch gefressen, doch in der Regel knabbern einen die Fische erst an, wenn man schon tot ist und keine Energie mehr hat, auf seine strukturelle Integrität zu achten. Der Mensch ist eben nicht für das Meer gemacht, und deshalb nimmt er sich für Reisen über die Ozeane stets ein Stück selbstgebasteltes Land mit, das er Schiff nennt.
Dieses Schiff ist für einen Seemann mehr als ein Zuhause. Es rettet ihm nicht nur andauernd das Leben, es hält ihn auch die meiste Zeit trocken und warm, birgt all seine Habe und trägt seine Ladung, mit der er sich sein Geld verdient, um für die Familie, sich selbst und das Schiff zu sorgen. Für einen echten Seemann ist das Schiff sein Leben. Und deshalb würde ein echter Seemann niemals sein Schiff im Stich lassen.
Und trotzdem ziehen seit Seemannsgedenken angeblich immer wieder Geisterschiffe ohne Besatzung über die Meere. Oft sieht es an Bord so aus, als herrsche überall das pralle Leben: Die Segel sind gesetzt, der Frühstückstisch ist gedeckt, die Vorräte reichen für Monate, und selbst die Wertsachen liegen noch in den Kajüten. Lediglich die Menschen fehlen, als hätte eine fremde Macht sie inmitten ihres Tagesgeschäfts von Bord geholt. Oder haben sie sich tatsächlich in Geister verwandelt?
Während bei Geisterschiffen wenigstens die Schiffe unzweifelhaft real sind, kann man sich bei Phantomschiffen nicht einmal darauf verlassen. Wie aus dem Nichts aufgetaucht sind sie plötzlich da, halten womöglich direkt auf das eigene Schiff zu und verschwinden dann ebenso unvermittelt wieder. Manchmal fahren sie mit geblähten Segeln, manchmal als skelettierte Schatten einer einst ruhmreichen Vergangenheit. Die gruseligsten Phantomschiffe haben sich sogar von ihrem ureigenen Element befreit und fliegen zwischen den Wolken oder tauchen unter der Oberfläche. Doch sie zeigen sich nur selten dem ehrbaren Seemann, und wer ihrer angesichtig wird, dem verheißen sie häufig Tod und Verderben.
Das Gleiche droht auch dem unglücklichen Seemann, der mit seinem Schiff in einen der berüchtigten Schiffsfriedhöfe gerät. Nicht der leiseste Windhauch weht, keine Strömung schiebt das Schiff voran, und zähe Wasserpflanzen legen jede Antriebsschraube lahm. Schiffsfriedhöfe sind das ozeanische Äquivalent der straßenverkehrstechnischen Kombination aus Einbahnstraße und Sackgasse: Wer einmal in die Falle gegangen ist, kommt nie wieder heraus. Um ein Haar soll Christoph Kolumbus bei seiner Entdeckungsfahrt nach Amerika diesem Schicksal entgangen sein. Doch viele andere sollen weniger Glück gehabt haben. Zumal der berühmteste Schiffsfriedhof der Welt ausgerechnet im Bermuda-Dreieck auf seine Opfer wartet.
Oder sind dies alles nur Mythen? Sind Geisterschiffe, Phantomschiffe und Schiffsfriedhöfe vielleicht nicht mehr als besonders dickes Seemannsgarn? Gibt es womöglich ganz natürliche Erklärungen für die Schiffsmythen der Meere?
Machen Sie sich auf einige Überraschungen gefasst …
Phantomschiffe – Trugbilder mit geblähten Segeln
Es woget die See, es brauset das Meer,
hoch türmen sich Wogen auf Wogen.
Dort aus der Ferne, so graus und hehr,
kommt ein schwarzes Schiff gezogen.
Es regt sich auf Deck nicht Mann oder Maus,
es schwimmt auf dem Meere, und nirgends legt’s an.
Die Sterne des Himmels leuchten so hell
durch Tauwerk, Segel und Masten.
Es segelt bald langsam, es segelt bald schnell,
als dürft es nicht ruhen, nicht rasten.
Ein Totenkopf in den Segel steht!
Es eilen die Schiffe aus seinem Bereich;
denn sein Anblick bringt Tod und Verderben.
Der mutigste Seemann wird starr und bleich
und betet, um selig zu sterben.
So schwimmt das Schiff kreuz und quer
viel hundert Jahre auf dem Meer.
Der fliegende Holländer wird es genannt,
es ist mit dem Fluche belastet.
Als herrliches Schiff ging es einst aus dem Lande
und ist seitdem nicht mehr gelandet.
Theodor Fathschild: «Der Fliegende Holländer»
Sie kommen aus dem Nichts, sind plötzlich einfach da. Manchmal nur als undeutliche Silhouette, als schummrige Leuchterscheinung, manchmal klar und detailliert erkennbar. Und vom einen Moment auf den anderen sind sie wieder verschwunden. Spurlos. Als hätte es sie nie gegeben.
Aber … Hat es sie überhaupt gegeben? Sind die sogenannten Phantomschiffe real? Sind es optische Täuschungen? Oder einfach nur Hirngespinste aus der Werkstatt für Seemannsgarn mit Schauergarantie?
Bernard Fokke war nicht der Teufel. Manche mochten ihn aber dafür gehalten haben, denn Fokke soll groß, ungewöhnlich hässlich und jähzornig gewesen sein. Vor allem aber war er ein Kapitän, wie es keinen zweiten gab im 17. Jahrhundert. Für die Route Holland–Kapstadt–Java benötigte er 1678 gerade einmal drei Monate und vier Tage, wie ein Brief belegt, den er dem Gouverneur der damals niederländischen Republik Java im Indischen Ozean vorlegte. Drei Monate und vier Tage – im 17. Jahrhundert grenzte dies an Hexerei, zumal andere Schiffe doppelt so lange benötigten. Es war, als ob der Holländer fliegen könnte. Nur der Satan selbst oder jemand, der mit ihm im Bunde war, vermochte so schnell zu segeln!
Bernard Fokkes Route auf seiner unglaublichen Rekordfahrt
Wer einmal mit Fokke gefahren war, wusste es besser. Nicht der Teufel steckte hinter der Geschwindigkeit, mit welcher der Kapitän im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas umschiffte, sondern Wagemut und Technik. Fokke hatte auf seinem Schiff, der Libera Nos, die hölzernen Rahen, an denen die Segel aufgehängt werden, durch stabilere eiserne Stangen ersetzt. Mit ihnen konnte er auch bei starkem Sturm alle Segel stehen lassen, wenn ein normales Schiff längst Tuch reffen musste. Wo andere kaum von der Stelle kamen, fuhr Fokke also mit vollen Segeln weiter.
Bis er eines Tages wohl zu viel riskiert hatte und von einer Fahrt nicht mehr zurückkehrte. Jetzt hat der Teufel endgültig Besitz von ihm ergriffen, mutmaßten einige Seeleute. Und schon bald spannen sie Seemannsgarn, in dem sie den Fliegenden Holländer gesehen hatten, wie er verdammt für alle Ewigkeit noch immer um das Kap der Guten Hoffnung fuhr.
Ob die Legende vom Fliegenden Holländer tatsächlich auf den friesischen Kapitän Bernard Fokke zurückgeht, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Viele Forscher halten ihn für das historische Vorbild, obwohl sein Name seltsamerweise in keiner Version genannt wird. Stattdessen heißt der Kapitän im Mythos meist Van der Decken, gelegentlich auch Vanderdecken, Van Diemen, Tyn Van Straten, Van Evert oder Van Halen.
Fest steht, dass der Fliegende Holländer seit Jahrhunderten unumstritten der Superstar unter den Phantomschiffen ist. Anfangs gaben die Seefahrer die Geschichten über ihn nur mündlich weiter. Mitunter heimlich, denn nicht jeder Kapitän duldete es, wenn seine Männer an Bord über Fluch und Verdammnis redeten. Später hielten einige die Erzählungen auch schriftlich fest, und im 19. Jahrhundert wurde der Stoff so beliebt, dass selbst Dichter wie Heinrich Heine und Komponisten wie Richard Wagner ihn aufgriffen.
Wie bei Prominenten üblich verschleierten die vielen Ausschmückungen und Gerüchte zunehmend den Blick auf die wahren Hintergründe, sodass es heute anstelle einer einzelnen Legende ein ganzes Bündel an Geschichten um den Fliegenden Holländer gibt und nicht einmal zweifelsfrei feststeht, ob mit dem Namen ursprünglich das Schiff oder sein Kapitän gemeint war. Einen großen Unterschied macht das aber sowieso nicht, denn wenigstens darin besteht Einigkeit, dass Segler wie Seebär aus den Niederlanden stammen und ihrer beider Schicksale durch einen Fluch bis ans Ende aller Tage untrennbar miteinander verknüpft sind.
Den ältesten schriftlichen Überlieferungen zufolge lautete der Name des Kapitäns Van der Decken. Er soll ein überaus tüchtiger und fähiger Seemann gewesen sein, der im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie exotische Waren nach Holland brachte. Zu einer Zeit, als es den Suezkanal noch nicht gab, bedeutete dies eine Fahrt um das berüchtigte Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas. Hier ringen der Atlantik mit seinem kalten Benguelastrom und der warme Agulhasstrom des Indischen Ozeans miteinander. Begleitet von heftigen Fallböen von der Küste, wo der Tafelberg über 1000 Meter schroff aus dem Meer ragt. Schiffe, die passieren wollten, mussten früher manchmal wochenlang in den Stürmen auf eine günstige Gelegenheit warten. Taten sie das nicht, gesellten sie sich schnell zu den Hunderten von Wracks, die Taucher alleine in den Gewässern der Tafelbucht in der Nähe des Kaps gefunden haben.
An der Südspitze Afrikas wechseln Kaps und Buchten einander ab.
Van der Decken wollte aber nicht warten. Nachdem sein Schiff und ein weiterer Kauffahrer einen ganzen Tag erfolglos gegen zunehmend stärker werdende Winde angekämpft hatten, entschloss sich der Kapitän des anderen Schiffes, in der Tafelbucht vor Anker zu gehen, bis sich die Elemente beruhigt hatten. Nicht so der Holländer. Fluchend soll Van der Decken über das Deck gestiefelt sein und geschworen haben: «Möge ich auf ewig verdammt sein, wenn ich klein beigebe, und müsste ich auch bis zum Jüngsten Gericht hier kreuzen!»
Hätte er mal daran gedacht, dass man vorsichtig sein soll mit dem, was man sich wünscht – es könnte in Erfüllung gehen. So aber wandte sich sein Schwur gegen ihn, und bis in unsere Zeit hinein begegnen Seefahrer an der Südspitze Afrikas dem Fliegenden Holländer in seinem immerwährenden Kampf, den er doch nicht gewinnen kann. Wie aus dem Nichts taucht er plötzlich auf und verschwindet ebenso unvermittelt wieder. Das Schiff war zu einem Phantom geworden.
So weit der Kern der Legende, in dem sich die meisten Erzählungen einig sind. Aber eben nicht alle. Immerhin wird die Schuld für den Fluch allerorten dem Kapitän angelastet, der sich großspurig über die Gesetze des Himmels und der Seefahrt hinweggesetzt haben soll. In den schwächeren Versionen flucht er lediglich gotteslästerlich vor sich hin, was vermutlich nur aus Sicht einer frommen Landratte mit ewiger Verdammnis bestraft werden müsste. Schwerwiegender ist da schon der Vorwurf, der Kapitän hätte im Jähzorn den Steuermann erschlagen und über Bord geworfen. Und absolut unverzeihlich wäre unter Seeleuten die Weigerung, einem anderen Schiff in Seenot zu helfen, wie es mancherorts auf der Anklageschrift steht.
Gerne wird der Mythos auch mit ein bisschen Sex aufgepeppt – Sex hat schließlich schon immer für gesteigerte Aufmerksamkeit gesorgt. So soll der Kapitän mit einer Hexe im Bunde gewesen sein, die ihm extra für jeden seiner Aufenthalte im Hafen eine schöne Jungfrau fing und gefügig machte. Kurz vor seiner Abreise brachten die beiden Fieslinge das arme Geschöpf dann gemeinschaftlich um. Dieses sadistische Treiben fand ein Ende, als sich die Hexe einmal vergriff und ein Mädchen entführte, das nicht nur so schön wie ein Engel war, sondern auch so tugendhaft und fromm. Ihren Glauben konnte das satanische Duo nicht brechen, und so töteten sie die standhafte Jungfrau sofort und warfen sie ins Meer. Kaum war die Tat vollbracht, ließ der Teufel jedoch ihr Gesicht auf dem Wasser erscheinen und dem Kapitän zurufen, er könne sie haben, wenn er zu ihr käme. Noch ein gutes Stück wahnsinniger, als er sowieso schon gewesen sein muss, jagt der Fliegende Holländer seitdem der Erscheinung nach. Ohne eine wirkliche Chance, seine Wollust jemals befriedigen zu können.
Weniger brutal, dafür deutlich romantischer sind die Varianten, in denen der Kapitän durch die wahre Liebe einer Frau endlich doch erlöst werden kann. Je nachdem, wie gut der Erzähler es mit ihm meint, darf der Verfluchte alle sieben, zehn oder nur alle hundert Jahre an Land kommen, um eine Braut zu finden. Was zunächst wie ein verlockendes Hintertürchen klingt, entpuppt sich häufig als zusätzliche Schikane, denn welche Dame ist schon offen für solch eine extreme Form des Speed-Datings mit unverbrüchlichen Treueschwüren bis in den Tod? Immerhin entließ Richard Wagner in seiner Oper Der Fliegende Holländer auf diese Weise den Kapitän aus seinem Martyrium.
Der Fliegende Holländer wurde vermutlich öfter in Gedichten und Romanen behandelt als jedes andere Schiff. In der Ballade «The Rime of the Ancient Mariner» von Samuel Taylor Coleridge aus dem Jahr 1798 zieht der Kapitän den Fluch auf sich, als er einen Albatros erschießt. Sir Walter Scott macht ihn 1813 in «Rokeby» zu einem Piraten, während John Leyden im gleichen Jahr in «Scenes of Infancy» die Pest auf dem Schiff mit seiner Ladung Sklaven ausbrechen lässt. Großen Einfluss auf den Mythos hatte die Erzählung im Stil eines Augenzeugenberichts, die John Howison von der Ostindien-Kompanie 1821 unter dem Titel «Vanderdecken’s Message Home» in «Blackwood’s Edinburgh Magazine» veröffentlicht. Hier erscheint das Motiv mit den Briefen für die Familien zu Hause zum ersten Mal. Wilhelm Hauff verlegt die Handlung in seinem Märchen «Die Geschichte von dem Gespensterschiff» von 1826 in den Orient und macht die Mannschaft zu verfluchten Zombies.
Das Schauspiel «The Flying Dutchman» von Edward Fitzball aus dem Jahr 1827 hat vermutlich Heinrich Heine zu einem Abschnitt in seinen «Memoiren des Herren von Schnabelewopski» von 1834 angeregt, dem Richard Wagner die Idee für seine Oper «Der Fliegende Holländer» entnahm. In den Niederlanden sehr beliebt ist der Roman «The Phantom Ship» von Frederick Marrymat aus dem Jahr 1839. Darin wird erwähnt, dass Kapitän Vanderdecken aus dem Ort Terneuzen stammt, was das Städtchen touristisch geschickt zu nutzen weiß.
Ein häufig anzutreffendes Motiv ist außerdem die Bitte, für die verfluchten Seeleute den Briefträger zu spielen. Für die Besatzungen der alten Segler gab es in früheren Zeiten kaum eine Möglichkeit, mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Allenfalls Briefe konnte man schreiben und dann hoffen, einem Schiff zu begegnen, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr und den Stapel mitnahm. Auch die Seemänner des Fliegenden Holländers probieren mitunter, ihre Post an den Mann zu bringen. Zu diesem Zweck setzt ein Beiboot zu dem Schiff über, das dem Holländer begegnet ist. Ein einzelner Seemann klettert sodann an Bord und bittet darum, den Stapel Briefe nach Amsterdam zu bringen. In der Regel bemerken die Offiziere auf dem Schiff sofort, dass die designierten Empfänger der Briefe längst verstorben sind und es die Straßen oder gar den Wohnort schon lange nicht mehr gibt. Der Matrose besteht dennoch auf einen Transport und lässt den Packen schließlich auf das Deck fallen, bevor er zurückrudert zum Fliegenden Holländer. In diesem Fall, so mahnt die Legende, muss man umgehend die Briefe an den Mastbaum nageln, sonst widerfährt dem eigenen Schiff ein schreckliches Unglück.
Denn der Fluch des Fliegenden Holländers kann anderen Schiffen Tod und Verderben bringen. Das wissen wieder fast alle Versionen der Geschichte zu erzählen. Und das ist sogar königlich bestätigt.
Wer im 19. Jahrhundert als Prinz im britischen Königshaus geboren wurde, konnte einer militärischen Karriere nicht aus dem Wege gehen. Und so absolvierten die Prinzen Albert und George, der später als König George V. den Thron übernehmen sollte, ihre dreijährige Offiziersausbildung als Fähnriche zur See von 1879 bis 1882 auf dem kleinen Kriegsschiff HMS Bacchante. Weil das Ruder der Korvette einen Schaden hatte, stiegen sie aber vorübergehend um auf die HMS Inconstant. Zum Glück, denn hier machte der erst 16-jährige George eine Beobachtung, die er in seinem privaten Tagebuch festhielt und die 1886 höchst offiziell als Teil des Reiseberichts veröffentlicht wurde:
«11. Juli 1881. Um 4 Uhr morgens kreuzte der Fliegende Holländer unseren Bug. Ein seltsames rotes Licht wie von einem vollständig glühendem Phantomschiff, vor dem sich die Masten, Spieren und Segel einer Brigg in 200 Yard [etwa 183 m] Entfernung als deutlicher Umriss abzeichneten, während sie sich von Backbord näherte. Der Ausguck auf dem Vorderdeck meldete sie als dicht an unserem Backbordbug, wo sie auch der wachhabende Offizier auf der Brücke deutlich sah, ebenso der Fähnrich auf dem Achterdeck, der augenblicklich zum Vorderdeck geschickt wurde. Als er dort angelangte, war aber keine Spur oder irgendein Anzeichen eines wirklichen Schiffes zu sehen, weder in der Nähe noch bis zum Horizont, obwohl die Nacht klar und die See ruhig war. Insgesamt 13 Personen haben sie gesehen, ob es aber Van Diemen oder der Fliegende Holländer oder jemand anderes war, bleibt ungeklärt.»
Außer dem Prinzen und den Männern auf der Inconstant verfolgten auch die Besatzungen der Begleitschiffe HMS Cleopatra und HMS Tourmaline die Erscheinung. Als wenn das Phantomschiff alleine nicht schon rätselhaft genug gewesen wäre, forderte der Fluch auf der Inconstant kurz darauf seine Opfer, wie George unter dem gleichen Datum verzeichnet:
«Um 10.45 Uhr morgens fiel der einfache Seemann, der am Morgen den Fliegenden Holländer gemeldet hatte, von der Quersaling der Vormarsstenge auf das Vorderschiff und wurde völlig zerquetscht. […] (Im nächsten Hafen, den wir anliefen, kam auch der Admiral ums Leben.)»
Obwohl Prinz George sich nicht endgültig auf den Fliegenden Holländer festlegen mochte, hatte er doch gleich an das Phantomschiff gedacht. Damit befand er sich in guter Gesellschaft, denn vor und nach ihm wollten viele, teilweise durchaus ehrbare Seefahrer den Fliegenden Holländer gesichtet haben – und einige von ihnen wurden anschließend von seinem Fluch getroffen. So soll auf der Joseph Somers ein Feuer ausgebrochen sein, das mehrere Seeleute ihr Leben kostete, nachdem das Schiff 1857 dem Holländer begegnet war. Selbst dem deutschen Admiral Dönitz wird nachgesagt, dass er während einer Erkundungsfahrt nach Suez ein Geisterschiff gesehen hätte, das so schrecklich war, dass er es lieber mit der gesamten Flotte der Alliierten aufnehmen würde, als diesem Phantom noch einmal zu begegnen. Allzu ortstreu war der Fliegende Holländer jedoch anscheinend nicht. Manche Berichte stammen nämlich aus ganz anderen Gegenden als dem Gebiet um das Kap der Guten Hoffnung. Die General Grant soll beispielsweise 1866 nach einer Sichtung des Fliegenden Holländers vor Neuseeland Schiffbruch erlitten haben. Und die Orkney Belle wurde 1914 im Ersten Weltkrieg als eines der ersten britischen Schiffe versenkt. Drei Jahre zuvor war sie dem Holländer bei Island begegnet.
Beobachter beschreiben den Fliegenden Holländer häufig als pechschwarzes Schiff mit blutroten Segeln. Noch bemerkenswerter sind aber seine angeblichen Fähigkeiten. So soll es bei absoluter Flaute, gegen den Wind und sogar rückwärts segeln können. Bei Bedarf taucht es und setzt seine Fahrt unter Wasser fort, oder es fährt durch die Lüfte.
Seit einiger Zeit macht sich der Fliegende Holländer aber rar auf den Meeren. Als vorerst Letzte haben wohl der Kapitän und der zweite Offizier des niederländischen Frachters Straat Magelhaen ihren verfluchten Landsmann in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1959 zu Gesicht bekommen. Unter vollen Segeln hielt das Phantom auf sie zu und verschwand im letzten Augenblick, bevor es zur Kollision kam. Vielleicht drücken Phantomschiffe bei Landsleuten einfach gerne mal ein Auge zu.
Der Fliegende Holländer mag die unangefochtene Nummer eins sein, das einzige Phantomschiff ist er allerdings nicht. In vielen Teilen der Welt zeigen sich ab und zu Schiffe, die es eigentlich gar nicht gibt, manche von ihnen sogar angeblich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit.
Die Bewohner der Insel Chiloé vor der Küste Chiles kennen beispielsweise die Caleuche, einen schönen leuchtend weißen Dreimaster, auf dem lautstark gefeiert wird. Als Lebender sollte man sich dennoch besser fernhalten, denn die Mannschaft besteht aus wiedererweckten Toten und versklavten Seefahrern, die zwei Meerjungfrauen-Schwestern und deren Bruder gehorchen müssen. Als Alleinstellungsmerkmal unter den Phantomschiffen kann die Caleuche geltend machen, dass nur ihr nachgesagt wird, ein eigenes Bewusstsein zu haben.
Das Feuerschiff der Baie de Chaleurs (übersetzt die «Bucht der Hitze») im kanadischen New Brunswick setzt dagegen vor allem auf Lichteffekte. Er erscheint als brennender Dreimaster, der vorzugsweise vor einem Sturm zu sehen ist. Zum Ursprung des Mythos gibt es verschiedene Versionen. Neben den immer gern genommenen Piraten, die bei passender Gelegenheit verflucht wurden, stehen auch der ebenso beliebte Mord eines Besatzungsmitglieds auf der Liste sowie zwei portugiesische Brüder, die beim Versuch, indianische Sklaven zu fangen, das Kräfteverhältnis falsch eingeschätzt hatten. Während der eine den Irrtum mit einem grausamen Tod bezahlte, konnte der andere sich retten und schwören, die Bucht für die nächsten 1000 Jahre heimzusuchen.
Dabei muss er sich die Gegend allerdings mit einem weiteren Phantomschiff teilen, denn auch das Geisterschiff der Northumberland-Straße, die sich zwischen dem kanadischen Festland mit der Provinz New Brunswick und der Insel Prinz Edward Island erstreckt, erhebt Anspruch auf das Revier. Der Schoner fährt vor allem zwischen September und November brennend über das Wasser. Die Täuschung soll so echt sein, dass manches Mal Rettungsmannschaften aufgebrochen sind, um die Besatzung zu bergen. Doch stets war weder ein Schiff noch ein Wrack zu finden, wenn sie die Stelle erreichten, wo das Phantom gesichtet worden war.
Wenn es um Gespenster geht, darf England natürlich nicht zurückstehen. Besonders romantisch, wenngleich tragisch ist die Geschichte der Lady Lovibond, die am 13. Februar 1748, in der Nacht vor dem Valentinstag, Schiffbruch erlitten haben soll. Ausnahmsweise hatte der Kapitän nicht geflucht oder gemordet, sondern lediglich geheiratet und seine Braut zur Hochzeitsreise nach Portugal mit auf das Schiff genommen. Leider erlitt der Bootsmann John Rivers, der ebenfalls in die Dame verliebt war, vor der Küste von Kent im Südosten Englands einen so heftigen Anfall von Eifersucht, dass er kurzerhand den Steuermann erschlug und die Lady Lovibond auf die gefährlichen Untiefen von Goodwin Sands setzte, wobei die gesamte Besatzung und alle Passagiere ums Leben kamen. Seitdem erscheint das Schiff alle 50 Jahre, nur 1998 hat es sich erstaunlicherweise nicht gezeigt. Vielleicht war das Gedränge an der Sandbank zu groß, denn auch die SS Montrose und das Kriegsschiff Shrewsbury sollen hier spuken. Oder es stimmt, was die beiden Forscher George Behe und Michael Goss vermuten, dass die Geschichte eine Erfindung des «Daily Chronicle» aus dem Jahr 1924 ist, die rechtzeitig zum Valentinstag in die Zeitung kam.
Übrigens muss ein richtiges Phantomschiff nicht unbedingt groß sein und einen Mast führen. Das vermutlich kleinste Exemplar dürfte das Geister-Kanu vom Lake Rotomahana in Neuseeland gewesen sein. Es hatte seinen Auftritt 1886 wenige Tage vor dem Ausbruch des Vulkans Mount Tarawera. Damals sah eine Gruppe Touristen ein Kriegskanu, wie es in der Gegend seit langer Zeit nicht mehr gebaut wurde, über das Wasser gleiten und im Nebel verschwinden. Früher hatte man verstorbene Häuptlinge auf solchen Kanus aufrecht fixiert und zu ihren Ahnen geschickt, aber das war eigentlich schon Urzeiten her. Die Maori glauben, dass die Erscheinung des altertümlichen Kanus bevorstehende Vulkanausbrüche ankündigt. Einen Treffer kann es somit schon einmal verbuchen.
Am anderen Ende der Größenskala steht sicherlich der Fünfmaster København. Das 132 m lange und 15 m breite Schulschiff war am 28. Dezember 1928 mit 75 Mann Besatzung auf seiner letzten Fahrt von Buenos Aires nach Melbourne verschwunden. Trotz einer ausgedehnten Suche war keine Spur von dem Segler zu entdecken. Dafür meinten einige Fischer und Frachterbesatzungen, sie hätten die København während eines Sturms gesichtet – zwei Jahre nach ihrem Verschwinden. Experten vermuten, dass das Schiff mit einem Eisberg kollidierte und zu schnell sank, um die Rettungsboote zu Wasser zu lassen. Vielleicht war aber auch nur eine heftige Sturmbö schuld, die den unbeladenen Segler in einem ungünstigen Winkel getroffen und versenkt hat. Im Januar 1930 wurde die København offiziell für verschollen erklärt. Vielleicht war aber keines dieser Phantomschiffe wirklich dort, wo es gesichtet wurde.
Obwohl die obige Aufzählung unvollständig ist, können wir doch schon anhand der wenigen Beispiele drei interessante Merkmale herausstellen, die uns einer Antwort auf die Frage, ob es wirklich und wahrhaftig Phantomschiffe gibt, ein gutes Stück näher bringen. Erstens sind viele Phantomschiffe schlicht Erfindungen kreativer Geister, um ein bisschen Aufregung ins Leben zu bringen, wie das Beispiel der Lady Lovibond zeigt. Sie sind unterhaltsam, erwecken beim Zuhörer eine Gänsehaut und kurbeln den Tourismus an. Mehr als Phantasie und Psychologie steckt jedoch nicht in ihnen. Zweitens sind die Schiffe in den seriöseren Berichten oft aus der Entfernung deutlich zu sehen, lösen sich aber in nichts auf, wenn man ihnen zu nahe kommt, wie es Prinz George von seinem Treffen mit dem Fliegenden Holländer berichtet hat. Und drittens stehen Phantomschiffe gerne in Flammen, was das Geisterschiff der Northumberland-Straße sehr schön demonstriert.
Beginnen wir mit dem Auftauchen und Verschwinden. Der Effekt erinnert verblüffend an ein Phänomen, das aus einer ganz anderen unwirtlichen Gegend bekannt ist: die Fata Morgana. Inmitten von Sandwüsten scheinen sich plötzlich am Horizont Oasen mit Seen aufzutun, auf denen vielleicht sogar Fischerboote unterwegs sind. Fata Morganen sind aber nicht auf heiße Wüsten beschränkt, sondern treten unter den passenden Bedingungen überall auf der Welt auf, auch in unseren Breiten und selbst im ewigen Eis der Arktis und Antarktis.
Das Geheimnis einer Fata Morgana oder Luftspiegelung liegt in dem Weg der Lichtstrahlen, die in unser Auge fallen und dort ein Bild erzeugen. Sie haben ihren Ursprung bei einem realen Schiff – tagsüber, indem dessen Planken, Segel und Takelage das Sonnenlicht reflektieren; nachts in den Lampen und Positionslichtern oder den lodernden Flammen, sofern das Schiff tatsächlich in Flammen steht. Die Lichtstrahlen breiten sich durch die Luft aus. Das geschieht ungeheuer schnell, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Im Vakuum des Weltalls ist diese Lichtgeschwindigkeit eine der wichtigen physikalischen Konstanten und beträgt exakt 299792458 Meter pro Sekunde. Wir kennen den Wert deshalb so genau, weil die Physiker ihn so definiert, also mit ihrer wissenschaftlichen Autorität einfach entschlossen festgelegt haben. Sollte sich eines Tages bei einer erneuten Vermessung mit besseren Instrumenten herausstellen, dass das Licht im Vakuum in einer Sekunde eine winzige Strecke mehr oder weniger zurücklegt, wird nicht etwa der Wert für die Lichtgeschwindigkeit geändert, sondern einfach entsprechend an der Länge des Meters herumgeschraubt, bis alles wieder passt. Aber keine Angst: Die Änderungen wären minimal, sodass niemand seinen Ausweis umschreiben lassen muss, weil die darin angegebene Körpergröße nicht mehr stimmt.
Die Lichtgeschwindigkeit ist also konstant – allerdings nur im Vakuum! Wandert das Licht durch ein anderes Medium wie beispielsweise Luft, wird es ein bisschen abgebremst und kommt etwas langsamer voran. Der Unterschied ist nicht groß, und er ist vor allem nicht immer gleich: Kalte Luft ist für Licht eine Winzigkeit zäher als warme Luft. Im Jargon der Physiker gesprochen hat kalte Luft einen größeren Brechungsindex als warme Luft. In einer schön einheitlichen Luftsäule ist das nicht weiter von Bedeutung. Wenn aber unterschiedlich warme Luftschichten übereinanderliegen, bekommen Lichtstrahlen den Unterschied im Bereich des Übergangs zu spüren. Auf der warmen Seite kommen sie schneller voran als auf der kalten, und die Strahlen laufen nicht schnurgerade weiter, sondern werden in Richtung der kalten Luftschicht gebogen. Wir können uns das anschaulich anhand eines Autos vorstellen, das über eine Straße fährt und mit den rechten Rädern in eine Öllache gerät. Plötzlich drehen diese Räder durch und schieben die rechte Seite des Autos nicht mehr im gleichen Tempo voran, wie es die linken Räder machen. Das Auto ist folglich links schneller als rechts und fährt dadurch eine Rechtskurve.
Auf dem Meer sind verschieden temperierte Luftmassen der Normalfall. Tagsüber erwärmt sich das Wasser nicht so schnell wie die Atmosphäre und kühlt die oberflächennahe Luft ab. Normalerweise wirbeln Winde aber alles ordentlich durcheinander, sodass die Lichtstrahlen allenfalls ein bisschen im Zickzack fliegen und wir ein weit entferntes Schiff nicht ganz scharf sehen. Ist es allerdings windstill, können sich hingegen großflächige Luftschichten übereinanderlagern, ohne sich zu vermischen, und nun werden die Lichtstrahlen, die von einem Schiff ausgehen, plötzlich umgeleitet. Mit erstaunlichen Effekten.
Lichtstrahlen werden beim Wechsel von kalter zu warmer Luft verbogen.
Beispielsweise verleiht uns die Biegung der Lichtstrahlen die Fähigkeit, bis hinter den Horizont zu sehen. Die Übergänge zwischen kalter Luft unten und warmer Luft darüber lenken das Licht immer wieder nach unten, sodass die Strahlen in etwa der Erdkrümmung folgen und wir gewissermaßen «um die Ecke» schauen. Befindet sich hinter dem Horizont ein Schiff, das eigentlich außerhalb der Sichtweite ist, taucht es bei sorgsam geschichteter Luft unvermittelt doch vor uns auf. Rudern wir aber auf die Erscheinung zu, passen die Winkel nicht mehr, und das Bild verschwindet vor unseren Augen. Das Gleiche geschieht, wenn ein Windhauch die Luftschichten durcheinanderwirbelt: Das Phantomschiff löst sich in nichts auf.
Bei sauber übereinandergelagerten Luftschichten folgen Lichtstrahlen der Erdkrümmung, und wir sehen bis hinter den Horizont.
Mit dem gebogenen Strahlenverlauf sind die optischen Tricks der Phantomschiffe aber noch nicht erschöpft. Wenn die Grenze zwischen zwei Luftschichten sehr scharf und der Temperaturunterschied groß ist, werden die Lichtstrahlen, die von der kalten in die warme Schicht wollen, nicht nur gebogen, sondern reflektiert wie an einem Spiegel. Diese sogenannte Totalreflexion sorgt dafür, dass wir ein auf dem Kopf stehendes Schiff wahrnehmen, das in der Luft schwebt. Mitunter ergibt sich aus der Kombination von gebogenem und reflektiertem Licht sogar ein doppeltes Schiff, das wirkt, als hätte sein Erbauer bereits bei der Konstruktion doppelt gesehen.
Totalreflexion an scharfen Luftgrenzen beschert uns ein kopfstehendes Spiegelbild.
Ein fliegendes Schiff erhalten wir auch dann, wenn sich die Verteilung der Luftschichten einmal umkehrt. In arktischen wie auch tropischen Gewässern heizt das warme Wasser manchmal die angrenzende Luft auf, sodass sie wärmer ist als die höheren Luftschichten. Die oberflächennahe Luft kann dann wie ein Spiegel wirken, bei dem die reflektierende Seite nach oben weist. Unterhalb der normalen Aufbauten erscheinen in dem Spiegel nochmals die oberen Teile des Schiffes. Was sich aber innerhalb der warmen Luft und damit unterhalb der Spiegelebene befindet, beispielsweise der Rumpf, ist dafür aus der Ferne gar nicht zu sehen. Das Ergebnis ist ein Bild eines eigenartigen Schiffes, das in der Luft zu schweben scheint.
Ist es unten wärmer als oben, scheinen weit entfernte Schiffe zu schweben und sich teilweise gespiegelt zu verdoppeln.
All das Verbiegen und Spiegeln kann mehrfach und mit unterschiedlicher Stärke auftreten, wodurch ferne Schiffe grotesk verzerrt erscheinen und einen wahrhaft gespenstischen Anblick bieten können.
Aber nur solange es einigermaßen windstill ist, wie es etwa Prinz George für seine Begegnung mit dem Fliegenden Holländer beschrieben hat. Schon ein zarter Windhauch zerstört ansonsten die sorgsam aufgehäuften Luftschichten.
Luftspiegelungen lassen weit entfernte Schiffe ganz nah erscheinen, wie in diesem Schulbuch aus dem 19. Jahrhundert.
Ganz anders sieht es aus, wenn ein Schiff «brennen» soll wie das Feuerschiff der Baie de Chaleurs. Für diesen Auftritt kann das Wetter gar nicht zu garstig sein, denn wir brauchen möglichst kraftvolle elektrische Felder.
Wenn Stürme gewaltige Luftmassen mit sich reißen und ein Gewitter aufbauen, trennen sie dabei elektrische Ladungen, die sich mit Blitzen wieder vereinen. An den Masten großer Segler gibt es aber mitunter noch eine zweite Leuchterscheinung, die ein Schiff erstrahlen lässt, als würde es in kalten Flammen stehen: das Elmsfeuer. Dafür muss das Unwetter elektrische Felder mit Stärken von mehr als 100000 Volt pro Meter erzeugen. An spitzen Gegenständen wie den Enden der Schiffsmasten und Rahen werden die Felder nochmals konzentriert, sodass sie schließlich die Moleküle der Luft in ein Plasma verwandeln. Wie das Gas im Inneren einer Neonröhre leuchten der Sauerstoff und der Stickstoff der Luft blau bis violett auf, manchmal begleitet von einem hohen sirrenden Geräusch. Obwohl das Licht nicht besonders hell ist, kann man es in einer dunklen, stürmischen Nacht gut sehen. Ein weit entferntes Schiff, das in einer aufziehenden Gewitterfront von Elmsfeuern glüht, ist somit tatsächlich ein verlässlicher Bote für aufkommenden Sturm.
An den Spitzen der Masten und Rahen von Segelschiffen leuchten bei Unwettern manchmal Elmsfeuer.
Unter Seeleuten gelten Elmsfeuer in der Regel als ein gutes Omen, ist es doch nach dem heiligen Erasmus von Antiochia benannt, der auf Italienisch Elmo heißt und Schutzpatron der Seefahrer ist. Nur in Melvilles «Moby Dick» musste es als Zeichen für bevorstehendes Unglück herhalten, aber daran hatte vor allem die unstillbare Rachsucht von Kapitän Ahab entscheidenden Anteil. Nicht an jedem Unglück auf den Meeren sind Phantomschiffe schuld.