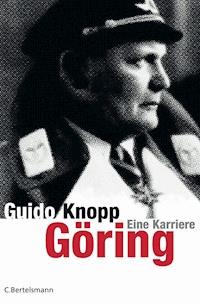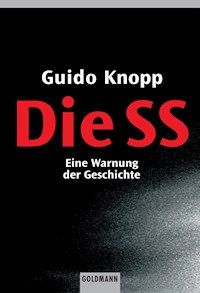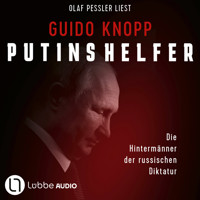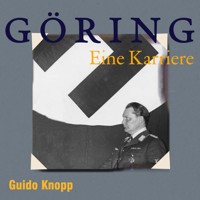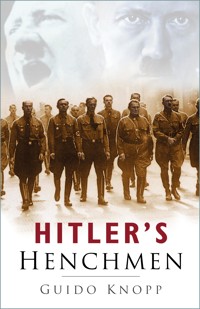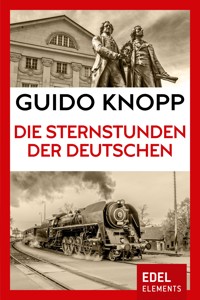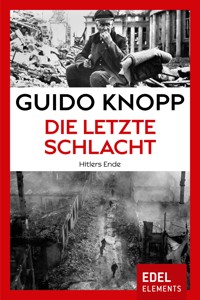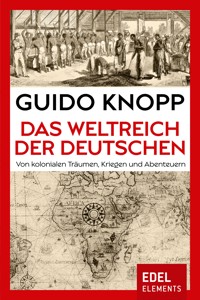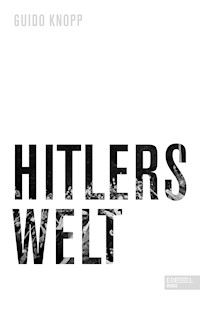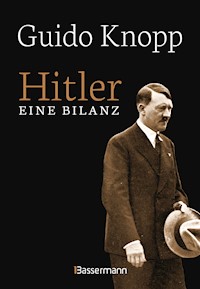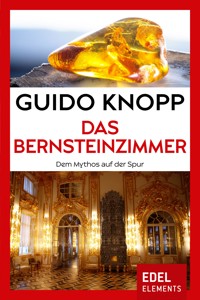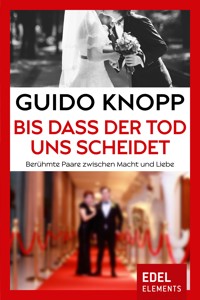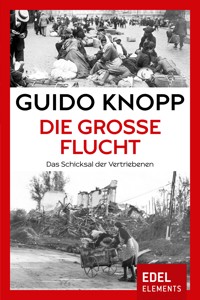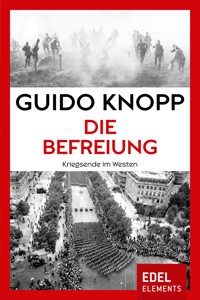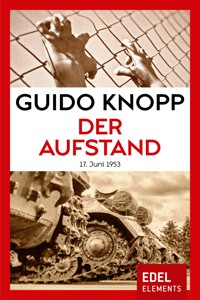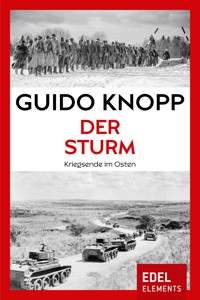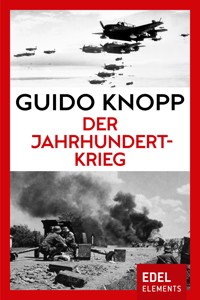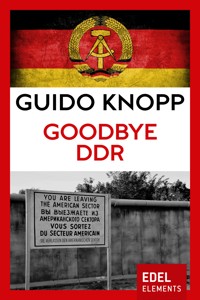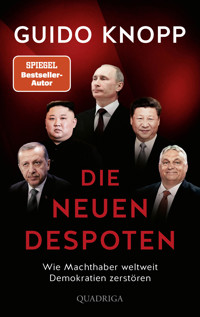
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie sind keine Erfindung unserer Zeit, aber es ist auffällig, wie sehr sie wieder in Mode sind: legitime Herrscher, die sich wie Despoten verhalten. Staatenlenker, die auf Gewalt setzen und willkürlich regieren. Sie sind zwar nicht durch Putsch oder Revolution an die Macht gekommen, sondern (weitestgehend) demokratisch in ihre Ämter gewählt worden, doch läuft ihr Regierungsstil letztlich auf Tyrannei hinaus.
In seinem neuen Buch porträtiert Guido Knopp mit Viktor Orban und Recep Erdogan zwei der wichtigsten Vertreter dieser zerfallenden Demokratien. Er hinterfragt ihre Ziele, beleuchtet Machtstrukturen und zeigt, wie sie sich mit Autokraten verbünden: Wladimir Putin, Kim Jong-un und Chinas Führer Xi. Eindrücklich führt Knopp die Gefahr dieser neuen Bündnisse vor Augen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Weitere Titel
Titel
Impressum
Vorwort
Der Rote Diktator
Der Raffinierte Autokrat
Der Enthemmte Tyrann
Der Strenge Regent
Der Absolute Herrscher
Der Schrankenlose Fürst
Danksagung
Über das Buch
Sie sind keine Erfindung unserer Zeit, aber es ist auffällig, wie sehr sie wieder in Mode sind: legitime Herrscher, die sich wie Despoten verhalten. Staatenlenker, die auf Gewalt setzen und willkürlich regieren. Sie sind zwar nicht durch Putsch oder Revolution an die Macht gekommen, sondern (weitestgehend) demokratisch in ihre Ämter gewählt worden, doch läuft ihr Regierungsstil letztlich auf Tyrannei hinaus.
In seinem neuen Buch porträtiert Guido Knopp mit Viktor Orban und Recep Erdogan zwei der wichtigsten Vertreter dieser zerfallenden Demokratien. Er hinterfragt ihre Ziele, beleuchtet Machtstrukturen und zeigt, wie sie sich mit Autokraten verbünden: Wladimir Putin, Kim Jong-un und Chinas Führer Xi. Eindrücklich führt Knopp die Gefahr dieser neuen Bündnisse vor Augen.
Über Guido Knopp
Prof. Dr. Guido Knopp war jahrzehntelang der Chefhistoriker des ZDF. Er gilt als der wohl populärste Historiker Deutschlands. Er ist erfolgreicher Publizist und Fernsehmoderator. Vor allem durch seine Einschätzungen zu zeitgeschichtlichen Themen wird er gerne als kompetenter Experte befragt.
Weiterer Titel des Autors:
Putins Helfer
Guido Knopp
Die neuenDespoten
Wie Machthaber weltweit Demokratien zerstören
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Burkard Miltenberger, Berlin
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille, Köln
Covermotiv: © mauritius images /Alamy /Alamy Stock Photos: Pictorial Press Ltd | Matic Štojs Lomovšek | ZUMA Press Inc. | American Photo Archive | Reynaldo Chaib Paganelli
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-7517-8444-3
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Vorwort
Die Neuen Despoten
Wie sie wurden, was sie sind
Das Ende der Geschichte stehe an, so pries im Rausch des Mauerfalls ein optimistischer Historiker das Zukunftsbild der Menschheit. Nur eine Macht sei nun berufen, die Ordnung in der Welt zu garantieren, der sanfte Hegemon Amerika. In dessen Schatten gebe es auf Dauer keine andere Staatsform als die demokratische. Selbst Diktaturen könnten sich am Ende nicht dagegen wehren, dass das Internet die Welt zu einem großen bunten Marktplatz macht, in dem am Ende nur noch eine große Sehnsucht alle Widerstände bricht: die Sehnsucht nach FREIHEIT.
Es wäre zu schön gewesen – doch die Illusion verflüchtigte sich schnell. Die liberale Demokratie des Westens verliert weltweit an Boden. Denn jetzt sind andere Kräfte am Zug, Neue Autokraten, ja Despoten. Es sind viele, allzu viele. Und es scheint, als sei der Traum von einer schönen neuen liberalen Welt, in der sich alle tummeln können, wie es ihnen lieb ist, vorerst passé. Die Moral muss nun beiseitetreten. Jetzt regiert die Macht.
Es sind Staaten wie Venezuela und Nicaragua, in Afrika Burkina Faso, Niger, die Zentralafrikanische Republik und der Sudan, in Asien natürlich Länder wie Iran und Myanmar. Von 193 Staaten in der Welt sind gerade einmal 33 funktionierende Demokratien, 146 aber Autokratien. Die Palette reicht bei diesen von der defizitären Demokratie à la Türkei bis zur harten Diktatur wie Nordkorea. Manche dieser Länder waren vor 20 Jahren noch echte Demokratien – Ungarn etwa. Da brauchte es nur einen machtbewussten Mann, der demokratisch ins Amt gewählt wird, um den Staat nach seinen Vorstellungen umzubauen, dass am Ende alles seinem Willen folgt. Denn echte Demokratien sind unbequem. Sie erfordern Dialog und Kompromissbereitschaft. Wie viel einfacher ist es, ohne Hindernisse und widerspruchslos durchzuregieren!
Der Übergang ist vielfach schleichend. Er beginnt mit Ausschaltung verbliebener Kontrollinstanzen, Entscheidungen in engen Machtzirkeln und Repression. Am Ende einer fortgesetzten Aushöhlung von echter Volksherrschaft steht dann oft die harte Autokratie.
Ich habe mir für dieses Buch sechs Männer – ja, es sind nur Männer! – ausgesucht, die für bestimmte Stadien einer Autokratie stehen: von Viktor Orbán, der sein EU-Land Ungarn Zug für Zug in eine »illiberale Demokratie« umwandelt, über routinierte Diktatoren wie Wladimir Putin oder Xi Jinping mit ihren Weltbeherrschungsfantasien bis hin zum mörderischen Zwangsstaat eines Kim Jong-un, der Nordkorea drangsaliert.
Beginnen wir mit Wladimir Putin: Das leninistische Denken, das er als Kind der alten Sowjetunion verinnerlicht hat, legte er nie ab – im Gegenteil: Er machte es sich für seine Zwecke dienstbar. Ein zentraler Grundsatz: Wenn du die Macht hast, gib sie niemals wieder ab. Diesen Gedanken hat er aus dem Kommunismus übernommen und in sein neues System eines imperialen Nationalismus überführt. Die Macht steht über dem Recht – ein Prinzip, das einst kommunistische Systeme prägte und das Putin in moderner Form wiederbelebt hat. Eine freiheitliche öffentliche Meinung? Unzulässig. Oppositionelle Demonstrationen? Unterdrückt. Unabhängige Medien? Ausgeschaltet. Auch das ist keine neue Entwicklung, sondern ein Rückgriff auf bewährte Kontrollmechanismen der Sowjetzeit. Die Bevölkerung wird durch Einschüchterung in Schach gehalten – mithilfe jenes Angstapparats, dem Putin selbst entstammt. Und wenn das Menschenleben kostet? Na und.
So hat er es gelernt in der Sowjetunion, so setzt er es in seinem neuen imperialen Russland um. Es ist diese Mischung aus sowjetischer Prägung und dem Glauben an eine historische Sendung Russlands und des neuen Russentums, die sein Weltbild bestimmt. In diesem Sinne ist sich Putin selbst treu geblieben. Der KGB-Mann ist heute der rote Zar.
Dann haben wir in Ungarn einen frei gewählten Mann, bei dem man sich fragen muss: Ist Viktor Orbán ein Despot? Das ist er nicht, natürlich nicht. Doch sein Ziel ist es, Ungarn in eine, wie er es nennt, »illiberale Demokratie« zu verwandeln. Und dabei ist er schon ziemlich weit gekommen. Das von ihm geschaffene Ungarn heute ist ein autokratisches System, das alle vier Jahre durch raffiniert gestaltete Wahlen abgesegnet wird. Es stützt sich auf eine reich gewordene Klientel, deren unbedingte Loyalität erkauft ist. Solange das Regime am Zug ist, kann es wohl kaum durch eine wirklich freie Wahl gestürzt werden – zumindest nicht, wenn sie von der Regierungspartei Fidesz ausgerichtet wird. Sollte dies doch irgendwann der Fall sein, dann, so befindet der Historiker Krisztián Ungváry, »wird eine beträchtliche Anzahl der Schlüsselfiguren hinter Gittern landen«. Doch bis dahin wird noch sehr viel Wasser die Donau hinunterfließen. Und Viktor Orbán hat den Ehrgeiz, einst als jener ungarische Landesherr in die Geschichte einzugehen, der sein Reich am längsten geführt hat. Das von ihm geschaffene System hat jetzt schon einen Namen: »Orbánismus«.
Und auch er ist ein gewähltes Staatsoberhaupt: Recep Tayyip Erdoğan – Staatspräsident der Türkei und seit mehr als 20 Jahren an der Spitze des Landes. Einst galt er als Reformer, wurde als Hoffnungsträger gepriesen und auch von deutschen Politikern umschmeichelt. Inzwischen ist er mächtiger, als es je ein Staatsoberhaupt in der Geschichte der Republik Türkei war. Geschickt hat er Verfassungsreformen durchgesetzt, um seine Macht zu sichern und sich seine Gegner vom Leib zu halten. Und nicht nur das: Die brutale Niederschlagung der Proteste im Istanbuler Gezi-Park hat selbst jenen, die noch Zweifel an seinen wahren Zielen hatten, gezeigt: Erdoğan ist kein Demokrat. Er regiert selbstherrlich und autoritär, spaltet das Land, indem er die einst säkulare Ordnung zugunsten einer zunehmenden Islamisierung auflöst. Persönliche Freiheiten, Meinungs- und Pressefreiheit, früher von ihm hochgepriesen und versprochen, gelten nicht mehr viel in seinem Staat. Korruptionsskandale, der Verdacht der Bereicherung – all das ficht ihn nicht an. Er lässt Ermittler versetzen, Kritiker verhaften, politische Gegner vor Gericht zerren. Ein misslungener Putsch im Jahr 2016 spielt ihm in die Karten, er nennt es »ein Geschenk Gottes«, ruft den Ausnahmezustand aus und vollzieht eine politische Säuberung: Über 100000 Menschen werden aus dem Staatsdienst entlassen, Zehntausende inhaftiert. Wer nicht auf seiner Seite steht, den erklärt Erdoğan zu seinem Feind. In seinem Prunk-Palast in Ankara mit über 1000 Zimmern residiert der Staatspräsident, der sich einmal »Mann des Volkes« nannte, weitgehend isoliert. Sicherheitsleute bewachen ihn Tag und Nacht, längst hat er die Tuchfühlung zur türkischen Bevölkerung verloren. Ein Despot, der die Richtung verloren zu haben scheint.
Autokraten scheinen einander magisch anzuziehen. Ungarns Ministerpräsident Orbán schmeichelt Putin und besucht ihn in Moskau. Zu Hause in Budapest empfängt er Chinas starken Mann Xi Jinping mit offenen Armen. Die beiden haben eine »strategische Partnerschaft« verabredet. Eine ungleiche Partnerschaft. Xi Jinping, der 2012 die Führung der kommunistischen Partei Chinas übernommen hat, gilt vielen als der mächtigste Mann der Welt. Der erfahrene Parteifunktionär hat den Führungsanspruch seiner Partei seit frühster Jugend verinnerlicht. Und das, obwohl ihm und seiner Familie unter dem Gewaltherrscher Mao Zedong böse mitgespielt wurde. Seit seinem Amtsantritt hat Xi seine Macht im Inneren ausbauen können. Dabei greift er zum großen Besteck des Diktators: Überwachungskameras, Gesichtserkennungsprogramme, Internetkontrollen, Erziehungs-Apps. Beobachter sprechen von einer »digitalen Diktatur«. Personenkult gehört auch dazu: Xi Jinping ist in China allgegenwärtig, schon die Kleinsten lernen in der Schule von ihrem großen Führer. Doch Xis Ehrgeiz geht weit darüber hinaus. Er will China als Weltmacht etablieren. Wirtschaftlich ist China längst führend, hinter den USA. Xi beansprucht aber auch politische Führung. Mit seiner Seidenstraßen-Initiative erweitert er unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Zusammenarbeit seinen Machtradius rund um den Globus. So viel Einfluss gibt man nicht gerne wieder auf. Xi Jinping hat die chinesische Verfassung ändern lassen, die nur zwei Amtsperioden vorsah. Wenn er will, kann er jetzt auf Lebenszeit regieren.
Blicken wir nun nach Nordkorea – ein geheimnisvolles Land, das sich vom Rest der Welt seit fast 80 Jahren abschottet. Das wenige, was die Weltöffentlichkeit weiß: Die Bevölkerung leidet seit Jahren unter schweren Versorgungsmängeln und einem repressiven System, das alle Bürgerinnen und Bürger von Kindesbeinen an überwacht, kontrolliert und Verstöße brutal sanktioniert.
Die Demokratische Volksrepublik Korea, so der offizielle Name, ist formell eine »Sozialistische Volksdemokratie«. An der Spitze des Staates und der einzigen Partei steht heute Kim Jong-un. Was das Terrorsystem in Pjöngjang von anderen Regimen unterscheidet: Es ist eine kommunistische Erbmonarchie. Seit der Staatsgründung 1948 herrscht die Kim-Dynastie: Großvater, Vater und Sohn. Auch in der dritten Generation hat sich nichts verändert. Das Haus Kim herrscht mit eiserner Faust über das kleine, geteilte Land auf der koreanischen Halbinsel. Meinungs- und Pressefreiheit existieren nicht, persönliche Freiheit ebenso wenig. Dafür sind Einschränkungen allgegenwärtig und noch immer sind die Straflager voller Männer, Frauen und Kinder, die der Illoyalität zum Regime verdächtig sind.
Was sich geändert hat: Der aktuelle Tyrann in Pjöngjang hat nach innen das Überwachungssystem perfektioniert und modernisiert. Und nach außen hat er sein kleines Land als Akteur auf die große internationale Bühne zurückgebracht. Denn Nordkorea verfügt mittlerweile über ein stattliches Atombomben-Arsenal und ist eine ernste Bedrohung für den Weltfrieden geworden.
Wie konnte eine Familie sich so lange an der Macht halten? Wie ist es gelungen, die Veränderungen in der kommunistischen Welt zu ignorieren? Und wie konnte Nordkorea als Paria der Weltgemeinschaft trotz internationaler Sanktionen zu einer der gefährlichsten Militärmächte der Welt werden?
Und dann ist da noch jener schrankenlose König aus dem Fernen Osten, der wie ein absoluter Autokrat sein Volk beherrscht: Vajiralongkorn, König Rama X. von Thailand. Er hat lange auf seine Krönung warten müssen. Widerspruch hat er in seinem Leben kaum erfahren, Frauen benutzt und verstößt er nach Belieben. Kaum an der Macht, sicherte er sich den Kronbesitz zur höchstpersönlichen Verfügung. Mit über 70 Milliarden Dollar ist er der reichste Monarch der Welt. Wer sich ihm widersetzt, den wirft er ins Gefängnis, Todesopfer gibt es auch.
So wie sein Vater Bhumibol sein Reich vor allem dank seiner moralischen Autorität regierte, so nutzt Vajiralongkorn ein anderes Mittel, um seine Untergebenen gefügig zu halten: Angst. Die blanke Furcht, irgendetwas falsch zu machen und den Zorn des Herrschers zu erregen. Ein kundiger Beobachter fasst Vajiralongkorns Wesen in dem Satz zusammen: »Ein gestörter, sadistischer und autoritärer Monarch, der im 21. Jahrhundert keinen Platz haben sollte.«
Putin, Orbán, Kim, Erdoğan, Xi und Rama X. – wer diese Diktatoren, Herrscher, Autokraten und Despoten heute sind, das zeigen sie uns selbst. Doch wie sie wurden, was sie sind, das wissen wir meist nicht. Hier zumindest einige Antworten.
Der Rote Diktator
Wladimir Putin
Da öffnen sich die beiden goldenen Flügeltüren, Gardeoffiziere in Parade-Uniformen stehen stramm. Und auf einem roten Teppich schreitet er hinein in den mit 2000 Getreuen gefüllten Alexandersaal des Kreml: Wladimir Wladimirowitsch Putin, Zar aller Reußen, auf dem Weg zu seiner mittlerweile fünften Präsidentschaft. So Gott will, wird er bis zu seinem Lebensende unbestrittener Herrscher eines Reiches sein, das unter ihm inzwischen eine lupenreine Diktatur geworden ist. Der Mann, der noch im Jahr 2002 im Bundestag auf Deutsch parlierend den Gastgebern die exklusive Partnerschaft anbot und von seinem Freund, dem Kanzler, als »lupenreiner Demokrat« gepriesen wurde, herrscht inzwischen über ein faschistisches System, aus dem die Gegner längst verschwunden sind – emigriert, im sibirischen Straflager oder tot, wie der unbeugsame Alexei Nawalny. Wer bleibt, weil er die Heimat nicht verlassen will, hat sich entweder in eine Art von resignativer innerer Emigration begeben oder beugt sich willig dem angesagten Patriotismus.
Wie konnte es so weit nur kommen? Wie war es möglich, dass es in der Ära Gorbatschow noch hieß, auch Russland sei imstande, dank Glasnost und Perestroika einen Weg der Freiheit zu beschreiten? Wie konnte dieses zarte Pflänzchen Hoffnung so verdorren?
Gleich neben jenem Alexandersaal, wo Putin seine Wiederwahl beging, habe ich im Jahre 1990 selbst erlebt, welche Möglichkeiten es im Miteinander von Russen und Deutschen gab. Es war das Jahr, in dem die deutsche Einheit kam, weil Gorbatschow sie uns gestattete. Es war die Zeit, als es nicht einmal 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg glückte, dieses schrecklichste Kapitel der Geschichte beider Länder in eine neue Partnerschaft zu überführen und eine große Fernsehserie zeitgleich zu senden – von Aachen bis Wladiwostok, die gleichen Bilder und der gleiche Text im Fernsehen beider Länder. Die Serie Der verdammte Krieg war nicht nur ein TV-Ereignis. Sie war auch ein Politikum. Ich habe jahrelang daran gearbeitet, diese schließlich 18-teilige Serie zu ermöglichen. Dies gelang in der Sowjetunion vor allem dank der Hilfe des Gorbatschow-Beraters Valentin Falin, zu dem ich eine ganz besondere Beziehung hatte.
Ursprünglich wollte Putins Vorvorgänger Gorbatschow die deutsche Einheit eigentlich nicht. Er wehrte sich sogar ganz vehement dagegen. Erst als klar wurde, dass nur noch Panzer den Zug zur staatlichen Vereinigung aufhalten könnten, schwenkte er im Januar des Jahres 1990 um. Nicht aus Begeisterung. Es war vor allem nüchternes Kalkül – und Einsicht in die wirtschaftlichen Zwänge. Wenn er, und als solcher wird er ja mit Recht geehrt, ein Vater der Vereinigung gewesen ist, dann war die Vaterschaft nicht immer freiwillig. Trotz alledem: Er hat die friedliche Vereinigung Europas erst ermöglicht – um den Preis der Selbstauflösung seiner Heimat, der Sowjetunion.
Das deutsch-sowjetische Verhältnis aber stand in jenen Jahren in den absoluten Flitterwochen. Eine ganz und gar romantische Phase. Alles war auf einmal möglich. Nicht nur Fernsehserien, sondern auch Debatten, die zur gleichen Zeit im Fernsehen beider Länder liefen. Unter anderem habe ich in Sichtweite des Kreml eine Diskussion mit deutschen und russischen Historikern über den Hitler-Stalin-Pakt moderiert, in dem Falin mit Einverständnis Gorbatschows die bis zu diesem Zeitpunkt verschwiegene Existenz eines geheimen Zusatzprotokolls zur Aufteilung Osteuropas eingestand. Für mich ein Höhepunkt war jene Diskussion, die ich nun schon im Kreml moderieren konnte, die ebenfalls zur gleichen Zeit im ZDF und im sowjetischen Fernsehen Gosteleradio gesendet wurde: Thema war Europa, das zusammenwächst – in Freiheit.
Die Herausforderung war, dass ich diese Diskussion im August 1990 unbedingt im Katharinensaal des Kreml aufzeichnen wollte – gleich neben jenem Alexandersaal, den Putin regelmäßig für seine Amtseinführungen nutzt. Denn 20 Jahre zuvor war hier, im Katharinensaal, der Moskauer Vertrag von Brandt und Breschnew unterzeichnet worden. Bislang hatte hier noch nie so etwas Profanes wie eine TV-Diskussion stattgefunden. Denn was im Vatikan die Sixtinische Kapelle, das war im Kreml der Katharinensaal: ein nationales Heiligtum.
Die Kreml-Verwaltung stand der verrückten Idee, dort eine bi-nationale Fernseh-Debatte abzuhalten, anfangs ausgesprochen kritisch gegenüber. Sie zierte sich. Die Verhandlungen gestalteten sich lang und zäh. Wir waren alle schon erschöpft. Dann eher aus Zufall haben wir unsere russischen Partner gefragt: »Können wir euch irgendwie behilflich sein? Braucht ihr irgendetwas?« Nun, sie schauten sich an, schauten uns an und rückten auf einmal mit der Sprache heraus: »Uns fehlen Staubsauger!«
Das war unsere Chance! Denn in Russland herrschte damals, offenkundig selbst im Kreml, eine Not an teuren westlichen Importen. Wir bildeten sofort eine Luftbrücke Frankfurt–Moskau und schickten zwanzig nagelneue Staubsauger der Marke Kärcher in den Kreml. Die Diskussion im Katharinensaal fand statt. Und jahrelang danach habe ich stolz erzählt: Gorbatschow, Jelzin, Putin – die Kremlherrscher kommen und gehen. Aber unsere Staubsauger, made in Germany, die laufen immer noch! Im Falle Putins aber ist noch nicht ausgemacht, wer länger durchhält.
Doch die Materialnot ist im Kreml mittlerweile längst behoben, und der neue Herrscher hat inzwischen selbst alle Möglichkeiten. Aber die Erinnerung an jene goldenen Jahre bleibt. Wie konnte es geschehen, dass die Träume jener Jahre so verflogen sind? Wie konnte es geschehen, dass aus der Hoffnung auf ein neues Miteinander wiederum ein neuer Kalter Krieg entstanden ist?
Um das Russland Putins zu verstehen, müssen wir zunächst versuchen, Putin zu verstehen – und das heißt: seinen Weg in der russischen Geschichte. Nach offiziellen Angaben wurde Wladimir Putin am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren – als Sohn des Arbeiters Wladimir Putin und seiner Frau Maria Putina, geborene Schelomowa. Doch es gibt auch eine andere, durchaus stichhaltige Version, die sich jahrelang hartnäckig hielt. Ihr zufolge ist der wirkliche Geburtsort unseres Helden das Dorf Teréchino bei Perm, der Vater ein gewisser Platon Priwalow, ein Alkoholiker und gleichsam Bigamist. Putin wäre demnach das Kind einer unehelichen Beziehung. Nach dieser Version wurde er bereits am 7. Oktober 1950 geboren, also exakt zwei Jahre vor dem offiziellen Geburtsdatum. Seine Mutter verließ den ungetreuen Priwalow, ging mit ihrem Söhnchen nach Georgien, heiratete einen Georgier namens Osipaschwili und gebar ihm noch ein halbes Dutzend weiterer Kinder. Und weil ebendieser Osipaschwili Wladimir Putin nicht als sein Kind anerkennen wollte, ihn sogar oft schlug, schickte Vera den Kleinen nach Leningrad und bewirkte seine Adoption durch ihren kinderlosen Vetter zweiten Grades Wladimir Spiridonowitsch Putin.
Welche Geschichte ist die wahre? Dieser Frage versuchte der prominente russische Journalist Artjom Borówik im Jahr 2000 nachzugehen. Offenkundig kam er weit, denn am 9. März 2000, mitten in Putins Wahlkampf für die zweite Präsidentschaft, stürzte ein Privatjet mit Borówik an Bord kurz nach dem Start in Moskau ab. Neun weitere Menschen starben. Der Journalist wollte drei Tage später eine größere Geschichte publizieren, für die er von Vera Putina Kindheitsfotos des kleinen Wladimir erhalten hatte. Wenig später wurde der Journalist Vacha Ibragimow tot aufgefunden. Er hatte sich mit Vera Putina getroffen und wollte ein Buch über Putins Kindheit schreiben. Und noch im Oktober 2000 starb in der georgischen Hauptstadt Tiflis der Journalist Antonio Russo. Sein Körper war übersät von Schlägen und Spuren von Folter. Er hatte zuvor italienischen Medien eine Geschichte über Putins Kindheit in Georgien angeboten. Seitdem hat es kein investigativer Journalist in Russland mehr gewagt, der Frage nach der Herkunft Putins nachzugehen.
Welche Geschichte auch immer die wahre ist – von nun an treffen sich in Putins Leben Wahrheit und Legende. Die Arbeiterfamilie Putin lebte in einer 20 Quadratmeter großen sogenannten »Gemeinschaftswohnung« in einem jener überfüllten Wohnblocks, die in Leningrad errichtet worden waren. Bad und Küche mussten sich die Putins mit den Nachbarn teilen. Einmal in der Woche besuchte die Familie ein öffentliches Bad, um sich ausgiebiger zu waschen.
Der Lebensraum des jungen Wladimir war einer jener Hinterhöfe, die mit Müll und Scherben übersät waren. Da herrschte allgemein ein rauer Umgangston. Und siehe da: Der schmächtige Junge wusste sich zu wehren. Wenn ihn jemand beleidigte, ging er Augenzeugen zufolge sofort auf den Kerl los und prügelte ihn zu Boden. Der junge Putin war, nach seinen eigenen Worten, ein »Hooligan«, ein regelrechter Schlägertyp. Zumal er schon mit elf begonnen hatte, »Sambo«, eine Variation des Judo, und Boxen zu erlernen. Mit Sambo erreichte er, nun 16-jährig, immerhin den zweiten Platz der Jugendmeisterschaft Leningrads. Das war für ihn, der nur 1,70 Meter groß ist, genau die richtige Sportart – denn im Sambo braucht man keine Kraft, man erkennt die Schwächen des Gegners – und nutzt sie aus. Eine hilfreiche Fähigkeit für einen Politiker. Putins Art zu kämpfen, so sein damaliger Trainer Anatoli Rakhlin, war so aggressiv, als ginge es hier nicht um Sport, sondern um das Überleben. »Wenn ich Sambo nicht entdeckt hätte«, schrieb Putin in seiner Autobiografie, »wäre mein Leben anders verlaufen. Es war der Sport, der mich von der Straße holte.«
In den 1960er-Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, zählten patriotische Spionagefilme zu den beliebtesten Genres im Sowjetfernsehen. Aus dem romantischen Bild des Agenten formte sich der Traumberuf des jungen Putin. Schon in der 9. Klasse fasste er sich ein Herz, begab sich zur Leningrader KGB-Zentrale und eröffnete nach eigenem Bekunden dem verdutzten diensthabenden Offizier: »Ich möchte gerne für den KGB arbeiten, am liebsten im Ausland, aber ich mache es auch im Inland!« Darauf sagte der Offizier: »Lieber junger Mann, der KGB sucht sich seine Mitarbeiter gerne selber aus – und nimmt nicht Leute, die sich hier mal so bewerben. Und im Übrigen ist die Voraussetzung ein Hochschulstudium, am besten Jura.« »Gut, das mache ich«, sagte Putin. Jura im Sowjetsystem war nicht dazu bestimmt, das Recht des Bürgers zu beschützen, sondern für die Sicherheit des Staats zu sorgen. Der Junge absolvierte seine Schullaufbahn und bewarb sich um ein Jura-Studium an der Leningrader Universität. Dass er dort aufgenommen wurde, war nicht selbstverständlich. Doch er hatte gute Noten vorzuweisen und war der einzige Sohn eines verdienten Kommunisten, der zudem ein Veteran des »Großen Vaterländischen Krieges« war. Putin absolvierte sein Studium mit Bravour – vor allem bei Professor Anatoli Sobtschak, dem späteren Bürgermeister von St. Petersburg. Dann wartete er – ein ganzes Jahr lang–, dass der KGB auf ihn zukam.
1975 klingelte das Telefon. Offenbar hatte man den Jungen, der sich nach einer Aufnahme erkundigt hatte, nicht vergessen. Wladimir Gantserow, verantwortlicher KGB-Mann für Uni-Absolventen, erzählte später, der junge Wladimir sei ein idealer Kandidat gewesen. Er trank nicht, rauchte nicht, war sportlich durchtrainiert, intelligent und besessen von seiner künftigen Aufgabe. Neben den physischen Bedingungen, so Gantserow, seien im KGB Menschen erwünscht, die nicht auffallen, weder durch Verhalten noch durch Aussehen. Am besten geeignet seien Kandidaten, die still und verschlossen seien. Offenkundig traf all dies auf Putin zu.
Er wurde angenommen und erhielt in Leningrad und Moskau eine mehrjährige Ausbildung zum, wie er hoffte, Top-Spion. Nach fast vier Jahren bekam er im Jahre 1979 die Nachricht, dass er der Abteilung Ausland zugeteilt werde. Seine Reaktion: Obwohl der Ehering bereits besorgt, der Hochzeitstermin schon angesetzt war, löste er kaltherzig die Verlobung mit der mutmaßlich jüdischen Medizinstudentin Ludmila Khmarina – aus Angst, es könne seiner künftigen Karriere schaden.
Vorgesetzte und Kollegen beschrieben ihn zu jener Zeit als kontaktarm, aber durchsetzungsfähig. Ein Womanizer war er damals nicht. Bevor er seine Frau fand, hatte er nur eine einzige Freundin – besagte Ludmila. Auch die Geschichte, wie sich Mr. und Mrs. Putin fanden, ist es wert, erzählt zu werden, weil sie doch ein Schlaglicht auf seinen Charakter wirft. Die spätere Ludmila Putina stammt aus Kaliningrad, dem früheren Königsberg, und war Stewardess. Kennenlernten sich die beiden in Leningrad, und es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Wie sie erzählt, habe Putin unscheinbar und schlecht gekleidet ausgesehen. Ihre Schilderung des Tages, als er ihr nach über drei Jahren Techtelmechtel endlich einen Heiratsantrag machte, zeugt von einem derart mittelprächtigen Kommunikationsdefizit, dass man sich fragt, wie diese beiden Menschen es überhaupt schafften, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ludmila Putina erinnert sich in ihren Memoiren:
»Eines Abends saßen wir in seiner Wohnung, und er sagte: ›Kleine Freundin, mittlerweile weißt du, wie ich bin. Ich bin eigentlich kein sehr angenehmer Mensch. Ich rede nicht viel, ich kann recht schroff sein, ich verletze die Gefühle anderer. Nicht gerade jemand, mit dem man sein Leben verbringen möchte.‹ Und er fuhr fort: ›Während der vergangenen dreieinhalb Jahre bist du sicherlich zu einem Entschluss gekommen.‹ Da dachte ich, dass er wahrscheinlich Schluss machen wollte. Also sagte ich: ›Ja, ich habe einen Entschluss gefasst.‹ Darauf er, mit Zweifel in der Stimme: ›Wirklich?‹ Da dachte ich, dass es definitiv vorbei war. Doch es kam ganz anders. Denn Putin sagte: ›Also dann erkläre ich: Ich liebe dich und schlage vor, dass wir im Sommer heiraten.‹ Das kam völlig überraschend.«
Schon in den Jahren seines Studiums hatte Putin seine Deutschkenntnisse aufgebaut und vertieft – und im Jahre 1985 kam die langersehnte Abordnung ins Ausland. Zwar nicht, wie er erhofft hatte, in das kapitalistische Westdeutschland, aber immerhin nach Ostdeutschland, in die verbündete DDR, wo er in Dresden in der dortigen Residentur zunächst in nachgeordneter Funktion agierte.
Die Zeit in Dresden war für die Familie Putin wie ein sozialistisches Schlaraffenland. Man hatte einen Dienstwagen und monatlich rund hundert Dollar extra. Zwei Töchter waren da, man lebte in einer Dreizimmerwohnung in einem Plattenbau: Radeberger Straße 101, das war ein Aufstieg nach der Leningrader Kommunalka. An den Wochenenden fuhr Familie Putin gern hinaus nach Radeberg, wo der durstige Familienvater oftmals zu viel Bier trank und nach eigenem Bekunden angeblich zwölf Kilo zunahm – was wohl etwas aufgerundet ist. Die Zeit in Dresden sei, so Putin später, die schönste seines Lebens gewesen.
Offenkundig war er damals schon im Visier westlicher Geheimdienste: Aus CIA-Protokollen geht hervor, dass eine ostdeutsche Sekretärin namens Lenchen sich nicht nur in der KGB-Residentur nützlich machte, sondern dabei auch noch für die CIA spionierte. Lenchen und Ludmila hatten sich in jenen Jahren angefreundet, und so wissen wir, dass Putin in Dresden seine Frau nicht nur betrogen, sondern auch noch geschlagen haben soll. Bezeichnend ist sein Satz: »Lobe niemals deine Frau, es bekommt ihr nicht.« So zumindest steht es in den CIA-Akten.
Im Herbst des Jahres 1989 aber kam die Krise. In der DDR erhob sich das Volk gegen das Regime – in der ersten geglückten Revolution der deutschen Geschichte. Die Mauer fiel, und im Dezember 1989 drangen auch in Dresden Demonstranten nicht nur in die örtliche Stasi-Zentrale ein, um Akten sicherzustellen, sondern wollten überdies die benachbarte KGB-Residentur in der Angelikastraße 4 stürmen. Die Russen residierten übrigens im selben Haus, in dem Hitlers Stalingrad-Feldmarschall Friedrich Paulus nach seiner Entlassung aus sowjetischer Gefangenschaft gewohnt hatte. Was dann geschah, gehört zum späteren Mythos der Putin-Geschichtsschreibung: Nach einer Darstellung soll der Oberstleutnant Putin in Zivil neben sowjetischen Soldaten mit Maschinengewehren gestanden und gerufen haben: »Ich bin Soldat bis zum Tod!« Darauf habe sich die Menge zurückgezogen. Nach einer anderen, deutlich dramatischeren Version habe Putin die Stürmung mit Müh und Not verhindert, nämlich mit einem Warnschuss in die Luft. Wenn das der Wahrheit entspräche, wäre es der einzige Schuss gewesen, der in der friedlichen Revolution gefallen ist.
Etwas weniger dramatisch liest sich aber jene Version, die ich für die wahrscheinliche halte. Als die Demonstranten die Residentur stürmen wollten, passierte Folgendes: »Putin kam auf die Gruppe zu und sprach in fließendem Deutsch, mit festen, bestimmten Worten und unmissverständlich: ›Das Gelände ist sehr gut bewacht von meinen Genossen. Sie haben Schusswaffen. Wenn Unbefugte in dieses Gelände eindringen, dann habe ich Schießbefehl erteilt.‹« Soweit die Erinnerung von Siegfried Dannath-Grabs, einem der damaligen Demonstranten. Ich halte diese Version für glaubhaft, zumal sie sich mit der Erinnerung von Putin deckt.
In jedem Falle hatten die Bewohner der Angelikastraße 4 nach diesem Vorfall das sichere Gefühl, dass ihre Zeit in der DDR zu Ende gehen würde, und sie begannen, ihre Akten zu verbrennen. Kollegen aus der Stasi, die mittlerweile schon entlassen waren, wandten sich an Putin und baten um Hilfe. Es war die Zeit, als er versuchte, einen neuen Spionagering aus ehemaligen Stasi-Mitarbeitern aufzubauen. Sein Pech war, dass die von ihm so sorgfältig ausgewählte Zentralfigur ausgerechnet zum westdeutschen Verfassungsschutz überlief und der Ring auf schmähliche Weise aufflog.
Schon im Februar 1990 wurde Putin samt Familie in die UdSSR zurückbeordert. Nach seinem eigenen Bekunden geschah das, weil er um die Rückversetzung bat, zumal er für die DDR keine Zukunft mehr gesehen habe. Tatsächlich aber musste er wohl aufgrund seiner letzten Misserfolge den aktiven Dienst verlassen und, gleichsam mit Schimpf und Schande, heimkehren. Der KGB in Leningrad hatte keinen Platz für ihn und versetzte ihn in den Reservedienst. Es war die erste berufliche Krise seines Lebens.
Er hatte Riesenglück, dass er in seiner alten Universität in Leningrad (noch nicht St. Petersburg) noch einmal einen Unterschlupf fand – als Assistent des Prorektors für Internationale Beziehungen. Dort begann er auch mit seiner Doktorarbeit, von der noch zu reden sein wird.
Doch wie Genosse Zufall es wollte – er kam in Kontakt mit seinem alten Rechts-Professor Anatoli Sobtschak, der mit seiner glänzenden Rhetorik ein Hoffnungsträger aller Leningrader Demokraten war. Sobtschak kannte Putins gute Eigenschaften, brauchte aber auch dessen schlechte. Er engagierte seinen alten Zögling als Berater und machte zusammen mit ihm Karriere. Ein Jahr später, im Juni 1991, wurde Sobtschak zum Bürgermeister gewählt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Umbenennung seiner Stadt in das historische St. Petersburg. Und der stets dienstbereite Putin hatte es nunmehr geschafft. Er wurde unter Sobtschak Chef des Komitees für Außenbeziehungen und ein Jahr später sogar Vizebürgermeister.
In dieser Phase seines Aufstiegs, inmitten einer Zeit des hemmungs- und rücksichtslosen Manchester-Kapitalismus in der Ära Jelzin, gab es erste Korruptionsvorwürfe gegen Putin. Schon 1992 ging das Petersburger Stadtparlament diesbezüglichen Vorwürfen nach.
Und obwohl es Bürgermeister Sobtschak noch gelang, die Anschuldigungen gegen seinen Schützling niederzuschlagen – die Tatsache blieb offenkundig: Zu jener Zeit wurde die Wirtschaft der Stadt zu mindestens zwei Dritteln von der organisierten Kriminalität kontrolliert. Der beflissene Putin hatte sich für Sobtschak allezeit nützlich gemacht. Es gelang ihm, durch den Zufluss von sogenanntem »Schattengeld« die Bedürfnisse des Bürgermeisteramts zu sichern. Dabei kam es zu Dienstleistungen, die damals üblich waren. Die Tricks konnte man schnell lernen. Zum Beispiel den Verkauf von Antiquitäten zu vielfach überhöhten Preisen.
De facto lief und läuft das so: Sie sind ein Antragsteller und Sie wollen einen lukrativen Auftrag von der Stadt. Ein Beamter gibt Ihnen beiläufig die Visitenkarte eines bestimmten Antiquitäten-Geschäfts. Das gehört, ganz zufällig, einem guten Freund von Putin, Ilja Traber, genannt »der Antiquar«. Sie kaufen dort einen einzigartigen Tisch aus der Zeit der Zarin Katharina für eine Million Dollar. Tatsächlich ist der Tisch ein sowjetisches Modell und gerade einmal 80 Dollar wert. Jetzt erhalten Sie vom Bürgermeisteramt der Stadt St. Petersburg einen Auftrag der öffentlichen Hand, dessen Wert den des Tisches um ein Vielfaches übersteigt.
Wohlgemerkt: All das war in der wilden Ära Jelzin absolut üblich. Ausländische Firmen, die in Russland Geschäfte tätigten, hatten sich daran gewöhnt, rund 15 Prozent ihrer Abschlüsse an die lokale Mafia zu überweisen, man nannte es die Mafia-Mehrwertsteuer. Mitte der 1990er-Jahre kassierte die Mafia auch bei temporären Russland-Reisenden ab.
Ich habe ja in dieser Zeit mit meinen Teams sehr oft in diesem Riesenland gedreht. Wer nicht zahlen wollte, wie ein Team der BBC, dem wurde schon mal die gesamte Ausrüstung im Wert von 300000 Dollar demoliert. Eines Abends erhielt ich im Moskauer Hotel Metropol einen Anruf. Eine höfliche Stimme fragte in sehr gutem Deutsch: »Sie drehen doch gerade in Moskau für eine Serie über Spionage im Kalten Krieg?« »Ja, das stimmt«, sagte ich. »Nun, dann wollen Sie ja sicher nicht, dass Ihnen dasselbe passiert wie der BBC?« »Natürlich nicht«, sagte ich. »Dann sollten wir uns einmal treffen«, meinte der Anrufer. Am nächsten Abend traf ich zwei gut gekleidete Herren in der Hotelhalle. Der eine sagte: »Wissen Sie, was den Schutz von Ausländern in unserem Land angeht, da sind unsere Behörden leider oft sehr machtlos. Wir helfen aber gerne aus. Das ist natürlich nicht umsonst!« »Wie viel?«, fragte ich. »Nun, für Ihre restliche Drehzeit von zwei Wochen (diese Information hatte er, woher auch immer) berechnen wir 35000 Schweizer Franken.« Er wollte keine Dollars, er wollte keine D-Mark, er wollte Schweizer Franken. Sowohl mein Produktionschef als auch unser Moskauer Studioleiter empfahlen dringend zu bezahlen. Das taten wir – zumal es unter dem Rubrum »Schutzgebühr« sogar eine Quittung gab. Team und Ausrüstung blieben unversehrt, denn die schützende Hand der Moskauer Mafia wachte fortan über uns.
Für Putin hätte seine Zeit als Protegé Sobtschaks in St. Petersburg gerne weitergehen können.
Doch 1996 geschah das Unerwartete: Sobtschak verlor die Bürgermeisterwahlen und Putin seinen Job. Erneut schien er am Boden – aber nur für eine kurze Weile. Denn was nun begann, das war die nahezu unglaubliche Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs. Denn binnen vier Jahren wurde aus dem Arbeitslosen von St. Petersburg der Präsident der Russischen Föderation. Wie war das möglich?
Es begann mit einem kleinen Job im Kreml. Mithilfe alter KGB-Freunde wurde Putin Stellvertreter eines gewissen Pawel Borodin, der die Liegenschaftsverwaltung Jelzins leitete. Das Zuckerstückchen dabei war die kleine Staatsdatscha in Archangelskoje, einer Prominentensiedlung westlich von Moskau, die Familie Putin fortan bewohnen durfte. Jelzin stand gerade im Wahlkampf um die zweite Präsidentschaft – ein Kampf, an dem sich Putin pro Jelzin nach Kräften beteiligte. Wir wissen heute, dass diese Wahlen gnadenlos manipuliert wurden. Denn der Sieger hieß eigentlich Gennadi Sjuganow, Chef der Kommunistischen Partei. Der aber kam zu dem nützlichen Schluss, es sei für ihn günstiger, der ewige Oppositionelle zu bleiben und dafür vom Kreml großzügig versorgt zu werden: mit einem 120 Quadratmeter großen Arbeitszimmer in der Staatsduma, einem Audi A8 nebst Polizeieskorte sowie einer luxuriösen Staatsdatscha im schönsten Waldgebiet vor Moskau. Das war damals so und ist es noch heute. Der Kreml hält sich seine eigene kommunistische Opposition.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Putin den Verlauf der Präsidentschaftswahlen 1996 als sehr lehrreich empfunden hat. Schon im März 1996 wurde unser Mann stellvertretender Kanzleileiter des russischen Präsidenten, ein Jahr später sogar Chef des FSB, des neuen russischen Geheimdienstes. Putin hatte eine vorrangige Eigenschaft: Er machte sich bei seinen Vorgesetzten unentbehrlich – und auf diesem Weg rasant Karriere.
Um diese Zeit war es, als er im Jahre 1997 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promovierte – mit einer 218 Seiten langen Dissertation über die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen. Zentrale These war, dass der Export von Öl und Erdgas vor allem die Aufgabe habe, außenpolitische Ziele durchzusetzen. Dafür müsse der Energiesektor so weit wie möglich unter staatliche Kontrolle kommen. Das war exakt die Strategie, die Putin später als Präsident betrieb. Allerdings stammte diese Doktorarbeit nicht aus seiner Feder. Amerikanische Ökonomen haben sie später genauer unter die Lupe genommen. Und siehe da: Sie bestand in wesentlichen Teilen aus Plagiaten von Arbeiten zweier US-Wissenschaftler. 16 Seiten hat Dr. Putin sogar wortwörtlich übernommen. Und wohl das Wichtigste: Es gibt belastbare Hinweise, dass die gesamte Arbeit nicht von ihm verfasst wurde, sondern von Wladimir Litwinenko, damals Rektor der Staatlichen Bergbau-Akademie St. Petersburg. Der war später Chef-Wahlkämpfer des Präsidenten Putin. Als Dank für seine Dienste, nicht zuletzt die Doktorarbeit, erhielt er Jahre später Aktien im Wert von Hunderten Millionen Dollar des russischen Phosphat-Giganten PhosAgro.
Die Sache mit der Doktorarbeit steht symbolisch für einen deutlichen Charakterzug im Wesen Putins, der im Lauf der Jahre wohl noch stärker wurde. Er ist nicht vertrauenswürdig. Für mich ist das Kriterium bei der Beurteilung eines Mannes immer eine schlichte Frage: Würde ich von ihm einen Gebrauchtwagen kaufen? Bei Putin lautet die Antwort: eher nicht. Er nimmt es mit der Wahrheit nicht genau. Das machen andere Politiker zwar auch. Von Churchill wird das Bonmot überliefert: Die Wahrheit ist ein so kostbares Gut, dass man sie mit einem Wall von Lügen schützen muss. Und der alte Adenauer kannte die höchst katholische Steigerung von Wahrheit: die volle, die reine und die lautere Wahrheit. Nur bei Letzerer, und nur bei der, darf man nicht lügen. Doch bei Putin ist die Sache chronisch. Macht Geheimdienstarbeit einen Mann zum Lügner?
Am wichtigsten von allen Jobs war einer, den er ab dem März des Jahres 1999 zusätzlich ausübte: Er wurde Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Eigentlich ein Amt ohne Machtbefugnisse, doch der Amtsträger hatte ein Büro im Kreml – in der Nähe Jelzins, und somit die Chance, dem Präsidenten mit einem Strom von Spickzetteln seine Unentbehrlichkeit zu beweisen.
Das hatte Erfolg. Die Familie Jelzin hatte sich in all den Jahren seiner Herrschaft nach Kräften bereichert. Und nun natürlich Angst, dass ein potenzieller Nachfolger sie dafür vor Gericht zerren würde. Es gab nur einen Ausweg: Der alte, müde, kranke Präsident musste vorzeitig zurücktreten, dann würde nach der russischen Verfassung der Ministerpräsident sein Nachfolger. Der musste dann ein Mann sein, der seinem Vorgänger und der Familie Straffreiheit gewährte. In seinen kurzen Monaten im Kreml hatte Putin sich das Wohlwollen der Jelzins redlich erworben. Er war lenkbar und loyal. Und so ernannte ihn der Präsident am 9. August 1999 völlig überraschend zum Ministerpräsidenten.
Ein wahres Sommergelächter erhob sich über Moskau. Putin? Wer ist Putin? So fragte die Presse. Sie sollte es bald erfahren, denn der frischgebackene Ministerpräsident zog unverzüglich in den zweiten, blutigen Tschetschenienkrieg. Tschetschenien, die islamisch geprägte, autonome Republik im Kaukasus, gehörte zwar zur Russischen Föderation, strebte aber nach Unabhängigkeit. Putin widersetzte sich und überzog das trotzige Land mit Feuer und Schwert. Binnen weniger Wochen wussten die Russen nicht nur, wer Putin ist, der wurde geradezu populär. Und als Jelzin am 31. Dezember 1999 zurücktrat, gewährte der dankbare Nachfolger als erste Amtshandlung ihm und seiner Familie absolute Straffreiheit. Sodann stürzte er sich in den Wahlkampf für die Märzwahlen 2000, den er als Law-and-Order-Mann bestritt. Er gewann mit vergleichsweise wenig Manipulation.
1. Januar 2000: Beginn der Ära Putin, die bis heute andauert – und wenn nichts Überraschendes geschieht, wohl bis zu seinem Lebensende dauern wird. Russland heute, das ist Putins Land.
Es lebt von seinen Bodenschätzen, Öl und Gas vor allem. Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Denn Russland ist somit von all den Schwankungen der Weltmarktpreise abhängig. Sind die Preise hoch, ist Putin in der Lage, seine Bürger mit diversen Wohltaten zu füttern. Ist dies nicht der Fall, dann kann es Schwierigkeiten geben.
Die Herrscher über all diese Güter waren in den ersten Jahren Russlands Oligarchen. Manche sind es immer noch. In der Ära Gorbatschow emporgestiegen, oft als kluge junge Leute aus der Kommunistischen Partei, rissen sie sich in den wilden Jelzin-Jahren, auch mithilfe von Krediten, all die schönen und nicht ganz maroden Staatsbetriebe unter ihre Nägel – und wurden gleichsam über Nacht Milliardäre. Das lief so lange gut, bis sie sich erdreisteten, auch in der Politik mitmischen zu wollen. Sie gründeten zum Beispiel eigene Fernsehsender und fühlten sich als heimliche Herrscher hinter den Kulissen. Der kranke Jelzin hatte das geduldet; Putin nicht.
Kaum an der Macht, trennte er die Oligarchen rasch in Freund und Feind. Freund, das war und ist noch immer einer wie Roman Abramowitsch, früher Besitzer des FC Chelsea. Der zeigte schon in den 1980er-Jahren, noch als sowjetischer Soldat, wie man Geschäfte machen kann. Er war der heimliche Anführer einer Gruppe von Armisten, die im hintersten Sibirien auf Befehl des Standortkommandanten einen Wald abholzen sollten. Die Axt schwangen aber nicht sie, sie beauftragten für diese schwere Arbeit die Bauern vor Ort. Abramowitsch verkaufte die Hälfte des geschlagenen Holzes für gutes Geld an ebendiese Bauern, die die ganze Arbeit gemacht hatten – und zeigte sich somit bereits als wahrer Unternehmer. Heute hat er – wenngleich zum Teil vom Westen konfisziert – Paläste, Jachten, Flugzeuge. Und immer, wenn sein Pate Putin einen Mittler braucht, ist Abramowitsch zur Stelle.
Wer als Oligarch jedoch politisch ehrgeizige Ambitionen hegt, die den Herrscher stören, lebt gefährlich. Wir kennen den Fall des Michail Chodorkowski, der über zehn Jahre einen barbarischen Leidensweg durch russische Gefängnisse und Lager gehen musste – und erst vor den Olympischen Spielen in Sotschi aus PR-Gründen freigelassen wurde. Ein anderer Oligarch, Wladimir Gussinski, leitete den Putin-kritischen Medienkonzern Media-Most, der ab 2001 mit staatlichen Gängelungen regelrecht überzogen wurde und binnen weniger Monate dahinschwand. Gussinski selber zog es vor, nach Spanien ins Exil zu gehen.
Der superreiche Boris Beresowski, zu Beginn ein Förderer von Putin, flüchtete aus Russland, als gegen ihn gerichtliche Verfahren eingeleitet wurden. Sein Fernsehsender ORT hatte es gewagt, Putin zu kritisieren. Heute ist der Sender längst verstaatlicht und beweihräuchert den Präsidenten. Beresowski selbst erhängte sich im Londoner Exil 2013 mit einem Schal. Heute sind die relevanten Medien alle längst in staatlicher, das heißt in Putins Hand.
Ein Journalist hat in Russland heute im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist Opportunist und passt sich an. Dann kann er morgens eigentlich nicht mehr in den Spiegel schauen. Er kann natürlich auch zum willfährigen Trommler des Regimes werden wie der unsägliche Propagandist Wladimir Solowjow, der Berlin lieber früher als später mit Atombomben überziehen würde.
Oder Journalisten berichten kritisch. Dann leben sie, je nach Prominentenstatus, eigentlich immer am Rande des Grabes.
Nur ein paar Beispiele: Dmitri Cholodow schrieb über Korruption in der Armee. Als er in seinem Büro einen anonym gesandten Koffer öffnete, der angeblich brisantes Material enthielt, explodierte der Koffer und Cholodow starb. Vor seinem Moskauer Büro erschossen wurde der Chefredakteur der russischen Forbes-Ausgabe, Pawel Klebnikow. Er hatte des Öfteren über Korruption in höchsten Kreisen berichtet. Die Journalistin Anna Politkowskaja hatte sich kritisch mit den Machtstrukturen in Russland beschäftigt. Sie wurde in ihrem Hausflur ermordet. Weltweit hohe Wellen schlug der berühmte Fall des Alexander Litwinenko. Er war kein Journalist, sondern früherer Geheimdienstmann. Er hatte aber ein Buch über die Machenschaften des KGB-Nachfolgers FSB veröffentlicht – just zu der Zeit, als Putin FSB-Chef war – und lebte vorsorglich im Londoner Exil. Er wurde mit Polonium vergiftet. Zwei Tage vor seinem Tod diktierte er im Krankenbett seinem Vater einen Abschiedsbrief, in dem er Putin persönlich für sein Sterben verantwortlich machte. Zitat:
»Sie, Putin, werden es vielleicht schaffen, mich zum Schweigen zu bringen. Aber dieses Schweigen hat einen Preis. Sie haben sich als so barbarisch und rücksichtslos erwiesen, wie Ihre ärgsten Feinde es behauptet haben. Sie haben gezeigt, dass Sie keine Achtung vor dem Leben, vor der Freiheit oder irgendeinem Wert der Zivilisation kennen. Sie haben gezeigt, dass Sie Ihres Amtes nicht würdig sind und das Vertrauen zivilisierter Menschen nicht verdienen. Es mag Ihnen gelingen, einen einzelnen Mann zum Schweigen zu bringen. Doch der weltweite Protest, Herr Putin, wird bis zum Ende Ihres Lebens in Ihren Ohren nachhallen. Möge Gott Ihnen vergeben, was Sie nicht nur mir angetan haben, sondern auch meinem geliebten Russland und seinem Volk.«
Wladimir Putin wies die Anschuldigung als »völlig unbegründet« zurück. Das Fazit aber bleibt:
Wer sich in Russland mit der weitverbreiteten Korruption beschäftigt, steht mit einem Fuß im Grabe.
An der Spitze der Korruptionspyramide steht Putin selbst. Er ist ein reicher Mann. Offiziell versteuerte er als »Einkommen« zwischen 2018 und 2024 insgesamt etwa 693000 Euro. Daran glaubt auch in Russland kein Mensch. Tatsächlich ist sein wahres Vermögen um etliche Milliarden höher. Die Schätzungen westlicher Medien (wie etwa dem einschlägig kompetenten Forbes-Magazin) reichen von 40 Milliarden bis 200 Milliarden Dollar. Das teilt sich auf in bare Geldbestände, die früher auf Konten in der Schweiz und Liechtenstein lagen und später wegen der Sanktionen umgeschichtet wurden – wohl nach Dubai und in die Türkei. Auf keinem dieser Konten taucht der Name Putin auf. Inhaber sind offiziell Vertraute aus alten KGB-Zeiten. Der weit größere Teil des Putinschen Vermögens aber besteht aus Immobilien wie dem notorischen Protz-Palast am Schwarzen Meer und vor allem Aktienpaketen und Beteiligungen an russischen Öl- und Gaskonzernen, die gleichermaßen über alte Seilschaften laufen. Wladimir Putin wird also nie auf irgendeiner Reichen-Liste auftauchen. Und doch ist er ein superreicher Mann. Nach der russischen Verfassung ist das alles andere als legal. Doch die russische Verfassung ist ein Stück Papier. Und Putin ist aus Fleisch und Blut. Dazu gehört auch das Bedürfnis, Rache auszuüben.