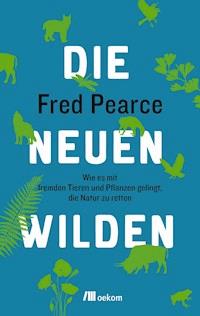Fred Pearce
Die neuen Wilden
Wie es mit fremden Tieren undPflanzen gelingt, die Natur zu retten
Übersetzt aus dem Englischen vonGabriele Gockel und Barbara Steckhan(Kollektiv Druck-Reif)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright der Originalausgabe »The New Wild. Why invasive Species will be Nature‘s Salvation«: © 2015 Fred PearceOriginal erstmals veröffentlicht bei: Icon Books Ltd., www.iconbooks.comDeutsche Erstausgabe © 2016 oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbH,Waltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenLektorat: Christoph Hirsch, oekom verlagKorrektorat: Silvia StammenInnenlayout, Satz: Ines Swoboda, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-86581-984-0
Wir danken der Stiftung »Forum für Verantwortung« für die großzügige Förderung der Publikation.
VorwortBrauchen wir eine neue Natur?Josef H. Reichholf
Dank
Vorbemerkung
EinführungNatur in einer Welt von Menschen
TEIL IDie Hoheitsgebiete der Fremden
Kapitel 1Der grüne Berg
Kapitel 2Neue Welten
Kapitel 3Alle auf See
Kapitel 4Willkommen in Amerika
Kapitel 5Großbritannien in den Fängen des Knöterichs
TEIL IIMythen und Dämonen
Kapitel 6Säuberungen in Ökosystemen
Kapitel 7Die Mythen um die Fremden
Kapitel 8Der Mythos des Ursprünglichen
Kapitel 9Nativismus im Garten Eden
TEIL IIIDie neue Wildnis
Kapitel 10Neu entstandene Ökosysteme
Kapitel 11Naturschutz auf urbanen Ödflächen
Kapitel 12Der Ruf der neuen Wildnis
Anmerkungen
Artenregister
VorwortBrauchen wir eine neue Natur?
Sie kommen »wie eine feindliche Armee« und breiten sich aus »wie ein Krebsgeschwür, infiltrierend, metastasierend«! So charakterisierte ein entsetzter Naturschützer schon in den 1990er-Jahren die fremden Arten. Inzwischen gilt: Die »Aliens«, die »Neos« sind neben dem Klimawandel die größte Bedrohung der Biodiversität, hierzulande in Mitteleuropa, wie auch global. Internationale Vereinbarungen und nationale Gesetze sollen den Kampf gegen die Fremden unterstützen, ihre weitere Ausbreitung unterbinden und sie nach Möglichkeit bis zur Wiederausrottung zurückdrängen. Um das Heimische zu schützen.
Das klingt so überzeugend fachlich, wie es emotional unter die Haut geht. Denn zumindest latent fremdeln wir (fast) alle. Was uns nicht vertraut ist, empfinden wir zunächst als Gefahr. Und wenn Pflanzen oder Tiere sich so unübersehbar breit machen, kann da etwas nicht in Ordnung sein. »Anständige«, »gute« Arten sind selten und bedroht. Zumindest sollten sie ab- und nicht zunehmen, wo doch alles schlechter wird in unserer Natur. Argwohn erscheint angebracht, Vorsicht geboten. Sonst ist es womöglich bald zu spät mit den Gegenmaßnahmen und unsere gute Natur wird von den bösen Fremdlingen überrollt. Und dies ausgerechnet jetzt, wo nach Einschätzung vieler ein neues großes Massensterben, »die sechste Auslöschung«, in Gang gekommen ist. Als Kennzeichen des Zeitalters der Menschen, des Anthropozäns. Soweit so klar, aber auch so schlecht die Lage. Denn die Aliens lassen sich offenbar kaum jemals aufhalten auf ihrem Siegeszug. Je mehr ihnen mit Feuer und Schwert, mit echtem Gift und verbaler Galle zu Leibe gerückt wird, desto stärker werden sie. Ist die Lage also hoffnungslos?
Konstant ist nur der Wandel
Fred Pearce sagt »nein!«, ganz und gar nicht! Der hoffnungslose Fall sind wir; wir Naturschützer und ihre Anhänger, die wir eine längst vergangene Welt davor bewahren wollen, dass sich das Rad der Zeit weiter dreht und dass nichts so bleiben kann, wie es einmal war. So etwas auch nur zu denken ist Gift, werden manche, vielleicht die meisten Naturschützer kontern; ätzendes Gift, das gegen ihre ehrenwerten Bemühungen gerichtet ist und nur all jene begeistern wird, die im Naturschutz ohnehin bloß einen (unnötigen) Hemmschuh für die (nötigen) Entwicklungen sehen. Die Thesen von Fred Pearce haben also Sprengkraft. Sein Buch wird als ein infames Unterlaufen der aus der Verzweiflung der Schwachen heraus agierenden Naturschützer angesehen werden, wenn er ausgerechnet den Aliens Gutes nachsagt und in ihnen die Zukunft sieht – wo sie doch eigentlich mit allen Mitteln bekämpft werden müssten! Muss man das wirklich? Folgen Sie mir an einem gar nicht so konstruierten Beispiel.
Rot flammten die Blüten auf. So blutrot, dass sie empfindsamen Seelen die Schamröte ins Gesicht trieben. Zuerst sah man sie einzeln oder in kleinen Gruppen. Doch rasch wurden es immer mehr. Ganze Felder durchsetzte das obszöne Rot. Es verdeckte das zarte Goldgelb der zur Reife ansetzenden Ähren der Gerste und ließ das bläuliche Grün der Weizenähren verschwinden. In Flammen schienen die Felder geraten und niemand wusste, ob das Korn nach der Ernte noch genießbar sein würde. Die Lebenskraft dieser fremden Roten schien unfassbar. Jeden Tag öffnete sich eine Blüte neu und verging. Ein paar Stunden reichten ihnen offenbar. Neue kamen nach, unzählige. Riss man sie von den Stängeln, quoll gelblichweißer Milchsaft heraus. Giftig? Verdächtig sicher!
Ohne Fremde keine neue Vielfalt
So ähnlich könnten einst Bauern das Erblühen von Mohn, von Klatschmohn, empfunden haben, als dieser die Äcker »eroberte«. Und er war nicht allein. Blaue Kornblumen, weiße, jedoch heilkräftige Kamille, giftige, aber schön blühende Kornrade und viele andere »Unkräuter« kamen und füllten die Felder. Auch in die Wiesen drangen fremde Pflanzenarten ein. Viele Arten, die es vorher im Waldland Mitteleuropas nicht gegeben hatte, breiteten sich aus. Sie kamen, weil ihnen die Landwirtschaft die Fluren geschaffen hatte, offene, sonnige Fluren. Und zu den als Unkraut mit Hacke und Handarbeit im Schweiße des Angesichts Bekämpften gesellten sich viele weniger auffällige Arten hinzu, wie die duftenden Veilchen am Bachufer, zarte Orchideen auf Triften und andere mehr. Ohne sie, ohne die Fremdlinge von früher, wären unsere Fluren von jeher so artenarm geblieben, wie sie es inzwischen »dank« des massiven Einsatzes von Giften und Überdüngung geworden sind. Es gäbe auch keine Feldhasen und Feldlerchen, Goldammern und Rebhühner, kaum Schmetterlinge, die am Tag fliegen, und sehr wenige Wildbienenarten. Fast die gesamte Artenvielfalt der Fluren, die mehr als der Hälfte der Landfläche Mitteleuropas ausmachen, wird von den Fremdlingen von einst gestellt. Der weitaus größte Teil davon ist nun in seinem Fortbestand bedroht. Immer rarer werden die Felder, über denen im Frühjahr Lerchen singend aufsteigen, wo vom Gebüsch am Feldrand das schlichte, so süße Lied der Goldammer erklingt, Grillen zirpen, Bläulinge und Schwalbenschwänze fliegen – und Fliegen von Schwalben gejagt werden. Auch sie, die einstigen Glücksbringer, gehör(t)en »nicht hierher«. Sie kamen im Gefolge der Landwirtschaft, so wie die Spatzen noch viel früher.
Ärmlich wäre unsere freie Natur, gäbe es die Fremden von früher nicht mehr. Längst schätzen und schützen wir sie. Mit Millionen aus dem EU-Agrarfonds versucht man seit Jahren die Unkräuter, umbenannt in Ackerwildkräuter, zu erhalten. Wer die Zeit vor der alles vernichtenden »Chemischen Keule« nicht erlebt hat, kann sich keine Vorstellung mehr davon machen, wie vielfältig – und schön (!) – unsere Kulturlandschaft früher gewesen ist. Sie verdiente diese Bezeichnung, denn die Kultivierung bot neuen Lebensraum für sehr viele Tier- und Pflanzenarten.
Von falschen Sündenböcken
Stadtmenschen, die nicht die Arbeit zu leisten hatten, mit der die alte, nicht motorisierte Form der Landwirtschaft den ausgemagerten Böden die überlebensnotwendigen Ernten abzuringen versuchte, priesen »das gute Land« und seine Lebensqualität. Dass die Bauern nach einem halben Jahrhundert beispielloser Agrarförderung längst des Guten zuviel tun und für Natur und Lebensvielfalt katastrophale Zustände auf den Fluren geschaffen haben, wollen jedoch nur wenige akzeptieren. Auch vielen Naturschützern gilt das Land immer noch als gut, weil »grün«, und sie halten die Städte für schlecht, weil »grau«, zugebaut und voller Menschen. Dabei übertreffen diese bereits das Land an Lebensvielfalt beträchtlich; so sehr, dass sie nach den gängigen Kriterien der Biodiversität eigentlich alle als Naturschutzgebiete eingestuft werden müssten.
Der gegenwärtige Kreuzzug gegen die fremden Arten richtet sich jedoch nicht gegen die Ursachen ihres Erfolgs, sondern in geradezu bizarrer Weise gegen die Symptome. Weshalb denn können sich Riesenbärenklau, Riesenknöteriche und Springkräuter so sehr, »so invasiv« ausbreiten? In ihrem Wuchern drückt sich aus, dass ihnen der Nährboden bereitet worden ist – durch Überdüngung. Die so auffällig invasiven Pflanzen sind in besonderem Maße nährstoffbedürftig. Vor allem Stickstoffverbindungen befähigen sie zu ihrem raschen Wachstum. Diese bekommen sie überreich, weil sich die Landwirtschaft auf fremde Pflanzen verlegt hat, die noch nährstoffbedürftiger sind. Aus einem Maiskorn muss in wenigen Monaten eine zweieinhalb bis drei Meter hohe Riesenpflanze heranwachsen. Das geht nur durch massive Überdüngung. Die Massen von Springkräutern und Knöterichen zeigen daher gerade so wie das Wuchern von Kanadischer Wasserpest und Algen in Seen, Flüssen und Bächen vor knapp einem halben Jahrhundert das exorbitante Übermaß an Pflanzennährstoffen an, das ihnen serviert wird. Mit modernen, sehr teuren Kläranlagen hat sich die Überdüngung der Gewässer so weit vermindern lassen, dass die Wasserpest Geschichte (und gegenwärtig eine Seltenheit) ist. Die entsprechende Eindämmung der Überdüngung des Landes steht hingegen aus. Niemand wagt sich politisch daran. Zu mächtig ist die Agrarlobby. Zu bereitwillig werden weiterhin die Agrarsubventionen ausgegeben. Die Bevölkerung wird nicht gefragt. Sie hat die immensen Kosten der Beschaffung oder Herstellung von trinkbarem Wasser ebenso zu tragen, wie die teure Reinigung ihrer Abwässer, während die Landwirtschaft mit einem Mehrfachen davon in Form von Gülle aus der Stallviehhaltung das Land überfluten darf, dass es zum Himmel stinkt. Was aber tun Naturschützer? Sie spannen sich selbst ein im Kampf gegen die invasiven Arten anstatt die Verursacher des invasiven Wucherns anzuklagen und zur Rechenschaft zu ziehen zu versuchen.
Fremde Arten akzeptieren!
Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, wird mit der Verteufelung der fremden Arten unterschwellig auch Fremdenfeindlichkeit geschürt, die allzu leicht auf Menschen und ihre Bewertung übertragen wird. Die Ideologie des Naturschutzes, die »heimisch« von »fremd« unterscheidet, stammt aus jener Zeit, die in der Katastrophe des II. Weltkriegs mündete. Wortwahl und Eifer klingen nach. Diese Herkunft gilt es zu bedenken! Sie sollte Grund genug sein, zu einer sachlichen Betrachtung zu kommen. Zu einer, die nicht vorab nach »heimisch« und »fremd« sortiert und erst danach die vielleicht feststellbaren Schäden betrachtet. Solche verursachen sehr wohl auch Arten, die »urheimisch« sind. Wie die Birken und die Spirken, wenn sie in Hochmoore hinein wachsen, diese verwalden und dabei den Moorspezialisten die Existenz nehmen. Sie werden ganz selbstverständlich über sogenannte Pflegemaßnahmen zurückgedrängt, die Aufwand und Kosten verursachen, ohne dass die Bäume, weil heimisch, angeklagt werden. Und schon das Laufenlassen der Natur verursacht nahezu zwangsläufig einen Schwund an Artenvielfalt. Würde Mitteleuropa wieder ganz von der »potenziell natürlichen Vegetation« bedeckt, hätten wir recht artenarme, einförmige Buchenwälder, regional auch Eichen- oder Kiefern- und Fichtenwälder. Aber keine Lüneburger Heide, keine Streuobstwiesen und Hecken und vor allem keine offenen, sonnig-mageren Flächen voller Lerchen, Hasen, Schmetterlinge, bunter Blumen und wilder Bienen.
Die Kulturlandschaft, auch die jetzt so eintönig gewordene und zur Produktion von »Grüner Energie« umfunktionierte, spiegelt in den Arten von Pflanzen und Tieren, die darin ohne besondere Hilfe seitens der Menschen gedeihen, zu jeder Zeit die vorhandenen Lebensbedingungen. Ihr gegenwärtiger Zustand ist von uns allen gemacht worden, ob direkt durch die Landwirtschaft, oder indirekt durch Förderung und Akzeptanz dieses Nutzungssystems. Gerade deshalb dürfen nicht die Arten angeklagt und schlecht gemacht werden, die sich den massierten Gifteinsätzen widersetzen und die aus der anhaltenden Überdüngung Nutzen ziehen. Sie sind die sichtbaren Signale für den Zustand und für die laufenden Entwicklungen, nicht die Bösen an sich. Manche Art wird vielleicht in Zukunft »gebraucht« werden; die vielfach von Naturschützern als Fremdling geschmähte Douglasie zum Beispiel, weil sie unter künftig trockeneren Bedingungen, denen unsere Wälder eventuell ausgesetzt sein werden, besser wachsen als die Tannen. Oder die Roteichen in von Massenvermehrungen der Eichenwickler betroffenen Eichenwäldern. Die rot blühende amerikanische Rosskastanie hat sich als nahezu unanfällig für die Kastanienminiermotte erwiesen und ohne die Blütenfülle des Drüsigen Springkrautes vom Himalaja hätten unsere Hummeln im Hoch- und Spätsommer weithin keine nektarreichen Blüten mehr. Wenn wir eine andere, eine vielfältigere Natur haben wollen, in der die Mehrzahl der uns vertrauten »heimischen Arten« weiterhin überlebt, müssen wir die Landnutzung ändern. Die Bekämpfung »der Fremden« ist keine Lösung! Sie ist jedoch für die eigentlichen Verursacher und für die Politiker ein höchst willkommener Nebenkriegsschauplatz, der von den wirklichen Problemen ablenkt. So frisst seit mehr als einem Vierteljahrhundert unser Stallvieh tropische Biodiversität, weil die Regenwälder vernichtet werden, um Futtermittel auf den gerodeten Flächen anzubauen; Futtermittel, die in unseren Ställen landen.
Die Spaltung von Mensch und Natur überwinden
Wenigstens ergibt sich aus der Betrachtung des internationalen Naturschutzes, die Fred Pearce vornimmt, dass nicht nur wir in Deutschland so extrem einseitig und geschichtsblind sind. Es wird überall, nicht nur bei uns, geradezu maßlos übertrieben. Dennoch ist dies letztlich wenig tröstlich. Die Übertreibungen stumpfen ab. Politisch kauft man sich mit Geld »frei«, anstatt wirkliche Änderungen vorzunehmen, die global beispielgebend wirken könnten. Der Schutz der Natur und die Erhaltung der Lebensvielfalt sind vielen Menschen ein tiefes Anliegen. Ein neuer Naturschutz wird dringend gebraucht; einer, der sich aus den alten Dogmen löst und die unselige Spaltung von Mensch und Natur überwindet. Fred Pearce weist einen Weg. Sein Buch ist ungemein wichtig. Sich darauf einzulassen, erfordert jedoch die Überwindung von eingepaukten Widerständen, die unsere Sicht- und Denkweise so sehr beschränken. Eine Wende im Naturschutz ist überfällig. Das Buch wird Sie davon überzeugen!
Prof. Dr. Josef H. Reichholf
lehrte Ökologie und Naturschutz an der Technischen Universität München und war umfangreich tätig im nationalen und internationalen Naturschutz.
Dank
Die Liste der Menschen, die zu diesem Buch beigetragen haben, ist zum Großteil im Lauf meiner 35 Jahre als Wissenschafts- und Umweltautor zustande gekommen. Viele werden im Text namentlich genannt und zitiert. Einige, die mir auf meinen Reisen geholfen haben, möchte ich jedoch besonders erwähnen. Wie Stedson Strout auf Ascension, der sich als hervorragender Mentor und Führer erwies; Paul Lister lud mich in das schottische Alladale Wilderness Reserve ein; Geoffrey Howard war in Ostafrika mein Gastgeber; Nicola Divine McClain lockte mich nach Montana; Peter Shaw zeigte mir seine Aschehalden in Essex und Peter Fraser stand mir in Liberia zur Seite. Mein innerer Widerspruchsgeist führte mich jedoch außerdem zu mehreren Treffen im kalifornischen Breakthrough Institute, wo einige der in diesem Buch wiedergegebenen Gespräche stattfanden. Dank an Michael Shellenberger und Ted Nordhaus, die mich dorthin eingeladen haben.
Viele Redakteure des New Scientist haben mir im Lauf der Jahre geholfen, indem sie sich um die Finanzierung meiner Recherchen kümmerten. Kate Douglas schickte mich an den Viktoriasee und David Concar nach Sarawak. Ich danke aber auch Jeremy Webb, Bill O’Neill, Michael Bond, Sumit Paul-Choudhury, Rowan Hooper und Graham Lawton. Andere Auftraggeber, die mit ihrer Begeisterungsfähigkeit dazu beitrugen, dass ich meine Theorien zur neuen Wildnis im Lauf der Jahre entwickeln konnte, waren unter anderem Brian Leith von Granada TV, Bruce Stutz bei der National Audubon Society (der mich ans Mittelmeer auf die Spur der »Killeralgen« schickte), Susanna Wadeson von Transworld und Roger Cohn von Yale e360.
Während meiner Arbeit an diesem Buch gaben mir viele Menschen ein Interview. Zu ihnen gehören Chris Thomas, Joseph Mascaro, Nicola Weber, Paul Robbins, Andrew Cohen, Melissa Leach, Erle Ellis, Stephen Pyne, Borgthor Magnusson, Jay Stachowicz, Ariel Lugo, Rick Shine, Peter Kareiva, Douglas Sheil, Stewart Brand, Joe DiTomaso, Sean Hathaway, Dick Shaw, Matt Shardlow, Jim Dickson, David Wilkinson, Susan Schwartz, Ken Collins, Jeffrey Sayer und William Laurance. Viele andere haben ausführlich auf meine E-Mails geantwortet. Und dann gibt es noch all jene – zum Teil zitiert, zum Teil vergessen –, die mit ähnlichen Beiträgen zu meinen früheren Werken beitrugen, deren Gedanken aber auch in dieses Buch einfließen. Ihnen allen gilt mein Dank.
Fred Pearce
Vorbemerkung
Zur Beschreibung von Spezies, die sich auf neues Terrain vorwagen, habe ich in diesem Buch viele Begriffe verwendet. Meistens nenne ich sie Fremde, was nicht abwertend gemeint ist, sondern einfach nur ihren Status beschreibt. Hauptsächlich um der Abwechslung willen bezeichne ich sie auch als Vagabunden, Eindringlinge, Abenteurer, Einwanderer, Nichtheimische, Zugewanderte und wohl noch vieles mehr. Einige Arten wurden willentlich oder unwillentlich von Menschen in die Fremde gebracht, andere gelangten auf traditionellem Weg dorthin. Das Adjektiv »eingeführt« habe ich für jene reserviert, deren Umsiedlung durch menschliches Zutun erfolgte. Bei manchen Ökologen hat der Begriff »invasiv« eine ganz besondere Bedeutung und gilt für jene Fremden, die Aufsehen erregen und Gebiete erobern. Wenn sich Spezies hingegen irgendwo niederlassen und sich dem Anschein nach heimisch fühlen, nennen manche sie »naturalisiert«. Ich verwende diese Begriffe im selben Sinne. Dennoch sollten die beschriebenen Arten nach ihrem Verhalten beurteilt werden und nicht nach dem Etikett, mit dem sie versehen wurden.
Manche Menschen bevorzugen die lateinischen Tier- und Pflanzennamen, und gelegentlich sind sie nützlich, um Verwirrungen zu vermeiden. Sie können aber auch stören. Deshalb habe ich im Haupttext die lateinischen Namen der wichtigsten Spezies und Gattungen angefügt, wenn sie zum ersten Mal zur Sprache kommen, nicht aber für Arten, die innerhalb des Buches nur am Rande auftauchen. Da ich in einigen Fällen vom Kontext her ausführlicher auf eine konkrete Spezies eingehe und da es einige Leser interessieren mag, habe ich im Anhang eine Liste mit den umgangssprachlichen Namen und ihren lateinischen Bezeichnungen angeführt.
Abkürzungen
CBD
Convention on Biological Diversity (Biodiversitäts-Konvention)
DDT
Dichlordiphenyltrichloethan (Insektizid)
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
GCHQ
Government Communication Headquarters (Nachrichten- und Sicherheitsdienst der britischen Regierung)
IMO
International Maritime Organization
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (»Weltklimarat«)
IUCN
International Union for Conservation of Nature (»Weltnaturschutzunion«)
MEA
Millennium Ecosystem Assessment (Studie der Vereinten Nationen zur Bewertung von Ökosystemen und ihrer Degradation)
NSA
National Security Agency
RSPB
Royal Society for the Protection of Birds
TNC
The Nature Conservancy
UNEP
United Nations Environment Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USGS
US Geological Survey
WRI
World Resources Institute
WWF
World Wildlife Fund
EinführungNatur in einer Welt von Menschen
Aggressive Ratten, verfressene Quallen, Würgegräser, Wildschweine, sich durchs Land windende Schlangenkopffische – fremde Arten übernehmen die Macht. Landstreicher, Rüpel und Schwindler der Natur sind auf dem Weg zu einem Ökosystem in Ihrer Nähe. Biologische Abenteurer in zunehmender Zahl reisen durch die Lande, verstecken sich in unserem Handgepäck, schleichen sich als blinde Passagiere in Frachtladungen, heften sich auf Schiffsböden und wandern aus, um mit dem Klimawandel Schritt zu halten. In unserer modernen, vom Menschen dominierten Welt des globalisierten Handels und der gestörten Ökosysteme bieten sich freien, ungebundenen Arten viele weitere Möglichkeiten, in der Welt herumzukommen und sich in fernen Ländern niederzulassen. Manchmal laufen sie dabei Amok, töten heimische Arten, zerstören ihre neuen Habitate und verbreiten Krankheiten.
Wir alle mögen einfache Geschichten über den Kampf zwischen Gut und Böse. Und Fremde eignen sich stets besonders als Feindbilder. Deshalb beobachten wir aufmerksam, ob nicht etwa fremde Arten in störungsanfällige Umwelten eindringen und dort ein ökologisches Chaos anrichten. Schon seit einem halben Jahrhundert bemühen sich Naturschützer, die Woge fremder Arten zurückzudrängen, sie sprechen von der zweitgrößten Bedrohung der Natur nach dem Habitatverlust. Ihre Sorge verdient Anerkennung, denn sie wollen heimische Arten und die von ihnen bewohnten Ökosysteme schützen. Aber könnte es nicht sein, dass unsere Angst vor den ökologischen Eindringlingen übertrieben ist? Ist sie nicht oft eher eine Art grüne Xenophobie? Die meisten von uns sind empört, wenn Fremde von vornherein als gefährlich betrachtet werden. Der orthodoxe Naturschutz aber ist angehalten, fremde Arten in eben dieser Weise zu dämonisieren. Heimisch ist gut, fremd ist schlecht. Aber ist diese einfache Formel auch haltbar? Oder werden die draufgängerischen, zupackenden Fremden von uns nicht vielmehr gebraucht? Könnte ihr Erfolg vielleicht sogar ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Natur angesichts des beträchtlichen Schadens sein, den die Menschen dem Planeten zugefügt haben?
Als Umweltjournalist werde ich in bestimmten Naturschutzkreisen wie ein Ketzer behandelt, wenn ich diese Fragen stelle. Ich stoße ebenso auf Skepsis wie auf Feindseligkeit. Dabei werfe ich Umweltschützern ganz bestimmt nicht vor, heimliche Fremdenhasser oder Misanthropen und erst recht nicht Rassisten zu sein. Allerdings bin ich bei Weitem auch nicht der Einzige, der mit Sorge das Kursieren gefährlicher Mythen über das Funktionieren der Natur beobachtet.
Ich stelle nicht die Motive infrage – die Stärkung der Natur –, sondern die Mittel. Viele Ökologen, die gegenwärtig die Natur erforschen, sagten mir, sie hätten den Eindruck, dass Naturschützer zwar die besten Absichten, aber ein falsches Verständnis von fremden Arten hätten. Und, schlimmer noch, dass ihre Bemühungen, fremde Arten am Eindringen in die Ökosysteme zu hindern, häufig kontraproduktiv seien und die Natur schwächten, statt sie zu stützen. Dann entdeckte ich, dass es in der Wissenschaft inzwischen eine Gegenbewegung gegen die einfache Formel gibt, wonach heimische Arten gut und fremde schlecht sind. Mit meinem Buch möchte ich dieses neue Denken erforschen und der Frage nachgehen, was es für den Naturschutz bedeuten könnte.
Etablierte Naturschützer haben meiner Meinung nach recht, wenn sie sagen, dass wir eine neue Verwilderung der Erde brauchen. Allerdings irren sie, wenn sie das erreichen wollen, indem sie die Zeit zurückdrehen. Wir brauchen neue Wilde in einer neuen Wildnis – daher der Titel dieses Buchs. Diese neue Wildnis wird aber eine völlig andere sein als die alte. Wir haben unseren Planeten schon zu sehr verändert, und die Natur kehrt nicht um in irgendeine Vergangenheit. In der Kraft der Fremden und in ihrer Fähigkeit, neue Gebiete zu kolonisieren, zeigt sie ihre Widerstandsfähigkeit. Oft sind sie die neuen Einheimischen. Wir hingegen können in der neuen Wildnis nur beiseite treten und den neuen Wilden applaudieren.
Natürlich gibt es Horrorgeschichten von der Machtübernahme durch fremde Arten. Die meisten spielen sich auf kleinen, abgelegenen Inseln mit nur wenigen heimischen Arten ab, wo Räuber wie Ratten, Katzen und andere von Schiffen springen und ein Chaos anrichten. Anderswo gehen Zehntausende eingeführter Arten nach ihrer Ankunft entweder rasch ein oder sie lassen sich nieder und werden zu vorbildlichen Ökobürgern, befruchten Pflanzen, verbreiten Samen, halten Raubtiere in Schach und bieten heimischen Arten Nahrung und Zuflucht. Nur selten vernichten sie die angestammten Bewohner. Sie vermindern nicht die Artenvielfalt, sondern errichten neue Welten, die in der Regel artenreicher sind als die, die zuvor existierten. Selbst von Naturschützern des Terrorismus verdächtigte Spezies wie die Zebramuschel und die Tamariske, der Japanknöterich und die Dickstielige Wasserhyazinthe haben oft eine positive Seite, von der aber kaum jemand berichtet.
Nachdem ich der Spur der fremden Arten auf sechs Kontinenten gefolgt bin, lautet mein Fazit, dass ihre Dämonisierung mehr über uns und unsere Angst vor Veränderungen aussagt als über sie und ihr Verhalten. Manch glühender Naturfreund zeigt seine dunkle Seite, wenn es um Aliens geht. Manchmal scheint es sogar so, dass die leidenschaftlichsten unter ihnen den größten Hass auf die Fremden hegen. Die verständliche Zuneigung zum Lokalen, Heimischen und Vertrauten, zu einer imaginierten ursprünglichen Welt vor dem Auftauchen des Menschen – schlägt nur allzu oft in radikale Ablehnung des Fremden und Unbekannten um.
Diese Feindschaft wird im Allgemeinen mit Theorien über die Abläufe in der Natur begründet, die überholt und nicht haltbar sind. Oft stellen wir uns vor, das Leben auf der Erde bestehe aus komplexen und dicht gewebten Ökosystemen wie Regenwäldern, Feuchtgebieten und Korallenriffen, die in sich vollkommen und stabil sind und in denen alle Arten eine einzigartige Rolle spielen. Bei dieser Sicht sind fremde Spezies bestenfalls störend und schlimmstenfalls schlicht böse. Doch woher kommen diese Vorstellungen? Sicherlich nicht von Darwin. Ihm zufolge ermöglicht es die natürliche Auswahl den Arten, sich anzupassen und zu überleben, doch er sagt an keiner Stelle, dass sich Ökosysteme entwickeln, bis sie eine Form von idealem Zustand erreicht haben. Vielmehr sah er eine bunte Mischung von Spezies, die sich in der Welt behaupten.
Heute glauben immer weniger Ökologen, dass die Natur stabil ist oder der Vervollkommnung zustrebt. Die wahre Natur, so meinen sie, ist häufig etwas zufällig Zustandegekommenes, Temporäres und wird ständig durch Dinge wie Feuer, Überschwemmung und Krankheitsbefall umgestaltet, wobei die Arten kommen und gehen, sich einfügen, sich anpassen oder den Kürzeren ziehen. Das Normale ist die Veränderung, sagen viele Wissenschaftler. Nach diesem Naturbegriff sind fremde Spezies nicht anders als der Rest. Ob von Menschen bewusst eingeführt oder in traditioneller Weise hinzugekommen, stellen sie nicht von Haus aus eine Bedrohung für ein Ökosystem dar. Sie sind Teil der natürlichen Prozesse, der ständigen Neuordnung, der Anpassung an Zufälle. Ob sie Veränderungen herbeiführen oder nicht – wenn Veränderungen die Norm sind, können sie nicht schädlich sein. Jedenfalls brechen Ökosysteme bei einer Invasion fremder Arten nicht zusammen. Oft gedeihen sie sogar besser als zuvor. Der Erfolg fremder Arten wird so zu einem Zeichen für die Dynamik der Natur und nicht für ihre Schwäche.
Dieses neue ökologische Denken muss unser Verständnis vom Schutz der Natur und unsere Überlegungen für zukünftige Maßnahmen zu ihrer Unterstützung prägen. Wenn die Natur der Vervollkomnung zustrebt und von Eindringlingen bedroht werden kann, muss man Barrikaden gegen diese Invasoren errichten und das Gleichgewicht der Natur wiederherstellen. Diese Ansicht vertreten die meisten Naturschützer, und ich selbst habe sie auch lange Zeit geteilt. Sollte die Prämisse jedoch falsch sein, hat es keinen Sinn, fremde Arten fernzuhalten. Es wäre oftmals nicht nur unmöglich, sondern womöglich sogar kontraproduktiv. Die Banditen der Natur sind ausgewiesene Kolonisten und schlagen aus dem von Menschen hinterlassenen ökologischen Chaos Profit. Damit aber sind sie zugleich die beste Möglichkeit der Natur, den Schaden zu reparieren, den Kettensägen und Pflüge, Umweltverschmutzung und Klimawandel angerichtet haben. Fremde Arten sind also keine Zerstörer, sondern beleben die Natur neu, sie sind ihre Retter. Vielleicht zeigen sie uns, dass sie nicht am Ende ist. Dass sie sich erholen kann. Dann aber ist der simple Naturschutz kurzsichtig und wahre Umweltschützer sollten die Invasoren begrüßen.
Ich möchte damit jedoch nicht sagen, dass wir fremde Arten immer und überall begrüßen sollten. Manchmal möchten wir Menschen die Spezies schützen, die wir kennen und lieben – in den Habitaten, mit denen wir vertraut sind. Dagegen ist nichts einzuwenden. Und wenn uns fremde Arten Unbehagen bereiten – ob Zebramuscheln in amerikanischen Wasserstraßen, Ratten auf Ozeaninseln oder Kaninchen in Australien –, wollen wir meist ihre Ausbreitung verhindern. Auch das ist durchaus in Ordnung. Unser Bedürfnis, solche Auswüchse einzudämmen, und der Wunsch zu schützen, was uns am meisten am Herzen liegt, sind legitim. Doch wir sollten uns dabei im Klaren sein, dass wir es für uns tun und nicht für die Natur, deren Bedürfnisse in der Regel ganz andere sind.
Und während wir zu schützen suchen, was uns in der Natur lieb und teuer ist, dürfen wir etwas anderes nicht vergessen. In der Natur gibt es nur noch sehr wenig, was wirklich natürlich ist. Wenn überhaupt, gibt es nur eine geringe Zahl ursprünglicher Ökosysteme, die es zu bewahren gilt. Durch Eingriffe des Menschen über Tausende von Jahren hinweg sind sämtliche Primärwälder verloren gegangen. Wir leben in einem neuen geologischen Zeitalter, dem Anthropozän, in dem nichts mehr unberührt ist und die meisten Ökosysteme aus einem Miteinander einheimischer und fremder Spezies bestehen und sich häufig auf unerwartete und produktive Art weiterentwickeln.
In meinem Journalistenleben habe ich zahlreiche Artikel über die Schäden geschrieben, die fremde Spezies augenscheinlich anrichten – über Killeralgen, wuchernde Wasserhyazinthen und viele mehr. Alle diese Artikel enthalten Wahres, doch der größere Zusammenhang fehlte. Dieses Buch handelt von meiner Suche nach dem Kurs, den der Naturschutz im 21. Jahrhundert einschlagen sollte. Er dürfte es nicht darauf anlegen, die Natur wie unter einer Glashaube zu konservieren, und noch viel weniger, die Vergangenheit wiederherzustellen. Beides ist unmöglich und wäre eine Beleidigung der Natur, etwa so, als würde man die ganze Welt in einen riesigen Zoo verwandeln. Im 21. Jahrhundert sollten wir nicht in einem aussichtslosen Kampf das schützen wollen, was wir uns unter der ursprünglichen Natur vorstellen, sondern mit der Dynamik und dem invasiven Instinkt ihrer ortsfremden Arten ihre Wiedergeburt unterstützen.
Es ist nicht die Aufgabe der Natur, unseren Willen zu erfüllen. Fremde Arten mögen uns gelegentlich stören, aber sie geben der realen Natur genau den Schub, den sie benötigt. Wer die Natur wie eine kostbare Blume hegen und pflegen und sie vor der Bedrohung durch fremde Arten schützen möchte, betreibt eine Art ethnischer Säuberung und macht die Kräfte zunichte, die er fördern sollte. Es ist dumm, die Natur gerade in ihrer höchsten Dynamik zu fürchten – blutrote Zähne und Klauen, Rhizome und Sporen, Wurzeln und Äste. Jeder wahrhaftige Umweltschützer sollte jubeln, wenn Pflanzen zwischen den Pflastersteinen hervorbrechen oder fremde Arten an fremden Ufern angespült werden. Wir sollten die Regenerationskraft der Natur feiern und ihr freien Lauf lassen. Wie anders sollen Arten gedeihen und auf die von uns ausgelösten Störungen wie den Klimawandel reagieren, als durch das Vordringen auf neue Territorien, wodurch sie zu Fremden werden? Echte Naturfreunde sollten das im Auge behalten.
Für den Biologen Edward O. Wilson aus Harvard, Guru der Artenvielfalt und intimer Kenner der Regenwälder, wird das 21. Jahrhundert »die Ära der Restauration in der Ökologie« sein. Ich kann es nur hoffen. Aber wir werden nicht zu einer vermeintlich ursprünglichen Welt zurückkehren. Das ist schlichtweg unmöglich. Wir müssen der Natur ihre Wildheit wiedergeben, statt zu versuchen, einen Zeitpunkt in der Vergangenheit als den ursprünglichen zu bestimmen und ihn wie ein versteinertes Relikt im Museum auszustellen. Die neue Wildnis wird anders sein als die alte, aber nicht weniger spektakulär und wunderbar. In deren Mittelpunkt werden fremde Arten und die sie beherbergenden neuen Ökosysteme stehen. Helfen wir ihnen dabei.
Das vorliegende Buch beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen von Invasionen fremder Arten, die Schlagzeilen gemacht haben. In Teil eins geht es um Inseln, auf denen sich dramatische Entwicklungen vollzogen und wo vom Menschen eingeführte Arten Ökosysteme schufen, die zuvor nicht existiert hatten, aber auch um Orte, wo eingeführte Arten ganze Kolonien von Seevögeln ausgeplündert haben. In der Regel aber sind die Vorgänge komplexer. Immer wieder stellte ich fest, dass sich angeblich bösartige Invasoren lediglich Ökosysteme zunutze machten, die bereits vom Menschen massiv gerstört waren. Sie waren Opportunisten und zugleich Erneuerer der Natur, und sie übernahmen oft Aufgaben, die die heimischen Arten nicht bewältigen konnten.
In Teil zwei werde ich untersuchen, wie sich unsere falschen Vorstellungen von fremden Arten auf die reale Welt auswirken und wie wir Naturschutz betreiben. Die Ergebnisse haben häufig groteske Züge. Nur selten sind unsere ökologischen Säuberungsversuche erfolgreich, weil der Naturschutz Mythen über fremde Arten, unberührte Ökosysteme und über die Vorgänge in der Natur kommuniziert, die jeder Grundlage entbehren.
Da inzwischen einige dieser Mythen widerlegt wurden, ist es an der Zeit, nach neuen Lösungen zu suchen.
In Teil drei versuche ich einen Neustart unseres Denkens über die Natur. Der Großteil unserer Welt besteht inzwischen aus einer Mischung aus heimischen und fremden Arten, die gut miteinander auskommen, unser Leben bereichern, Ökosysteme stabilisieren und die Akkus der Natur wieder aufladen. Das ist die neue Wildnis. Die Natur erblüht an den unwahrscheinlichsten Orten wie etwa komplett abgeholzten Wäldern und verwahrlosten Stadtteilen. Um das Beste daraus zu machen, müssen wir auch den Naturschutz neu überdenken. Wir sollten unsere Angst vor dem Fremden und Neuen ablegen. Naturschützer müssen aufhören, ihre Zeit ausschließlich dem Schutz von Verlierern zu widmen – den gefährdeten und sich zurückziehenden Arten. Sie müssen auch Gewinner unterstützen. Denn diese Gewinner werden dringend gebraucht, wenn sich die Natur im 21. Jahrhundert neu organisieren und wiedererstehen, wenn die neue Wildnis gedeihen soll.
TEIL IDie Hoheitsgebieteder Fremden
Weltweit haben sich fremde Arten aufgemacht, nicht selten mit unserer Hilfe. Doch meistens dringen sie nur in Gebiete ein, die vom Menschen übernutzt wurden. Oft helfen sie dabei, diese Schäden wieder zu reparieren.
Kapitel 1Der grüne Berg
Am Gipfel des erloschenen Vulkans auf der tropischen Insel Ascension im Südatlantik kommt man sich vor wie am Ende der Welt. Als ich sah, wie das britische Militärflugzeug, das mich hier irgendwo in der Mitte zwischen Brasilien und Afrika abgesetzt hatte, zurück nach Süden zu den Falkland-Inseln flog, fühlte ich mich ziemlich einsam. Unter mir in der glühenden Sonne erstreckte sich eine raue schwarze Mondlandschaft aus vulkanischer Brockenlava, und dahinter in alle Himmelsrichtungen gute tausend Kilometer Ozean. Hier oben in der kühleren Bergluft umgab mich allerdings üppiges Grün. Gegen Mittag bildete sich über der Kuppe eine einsame Wolke, die sich plötzlich absenkte und mich und den Gipfel in Nebel hüllte.
Die Bewohner der Insel – britische Vertragsarbeiter, amerikanisches Dienstpersonal und Familien von St. Helena, einer weiteren abgeschiedenen Insel – nennen diese Oase Green Mountain, den grünen Berg. Hier oben steht das Haus des britischen Inselverwalters, gemeinsam mit den dazugehörigen zwei alten, auf das Meer gerichteten Kanonen. Doch abgesehen von seinem Rasen, auf dem ich später am Nachmittag meinen Tee trank, wirkten der Berg und die Wolke auf mich irgendwie urzeitlich: Diese Szenerie mussten auch schon die ersten Seeleute vorgefunden haben, als sie vor fünf Jahrhunderten auf die Insel kamen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!