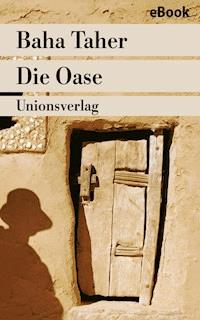
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das 19. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu, als der politisch in Ungnade gefallene Machmud Abdel Sahir von Kairo in die abgelegene und gefährliche Oase Siwa nahe der libyschen Grenze versetzt wird. Er weiß, dass zwei seiner Vorgänger ermordet wurden. Aber weiß er auch wirklich, was ihn erwartet? Siwa ist eine eigene Welt mit ureigenen Gesetzen. Auf Schritt und Tritt erwacht die Geschichte: das Orakel von Alexander dem Großen, das Bad der Kleopatra, der hartnäckige Widerstand der berberischen Einwohner gegen alle Eindringlinge. In Siwa gerät Machmud zwischen die Fronten der sich untereinander bekriegenden Einwohner. Als die Kluft zwischen Besetzer und Besetzten, Frau und Mann, Traum und Realität immer weiter wird, erreichen die Spannungen ihren Höhepunkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Das 19. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu, als der politisch in Ungnade gefallene Machmud Abdel Sahir von Kairo in die abgelegene und gefährliche Oase Siwa nahe der libyschen Grenze versetzt wird. Er weiß, dass zwei seiner Vorgänger ermordet wurden. Aber weiß er auch wirklich, was ihn erwartet? Siwa ist eine eigene Welt mit ureigenen Gesetzen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Baha Taher (1935-2022) lebte lange im Exil in der Schweiz, bevor er wieder nach Ägypten zurückkehrte. Für seinen Roman Die Oase erhielt er 2008 den International Prize for Arabic Fiction.
Zur Webseite von Baha Taher.
Regina Karachouli (*1941) ist promovierte Arabistin und Kulturwissenschaftlerin. Nach langjähriger Lehr- und Forschungstätigkeit am Orientalischen Institut in Leipzig ist sie freie Übersetzerin aus dem Arabischen.
Zur Webseite von Regina Karachouli.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Baha Taher
Die Oase
Historischer Roman
Aus dem Arabischen von Regina Karachouli
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Wahat al-ghurub bei Dar al-Schuruq in Kairo.
Das Erscheinen dieses Bandes wurde unterstützt durch Tim Guldimann, Schweizer Botschafter in Berlin, der das Preisgeld des ihm vom Berliner Senat zugesprochenen Moses-Mendelssohn-Preises 2006 für die Übersetzung eines herausragenden Werkes der arabischen Literatur zur Verfügung gestellt hat.
Originaltitel: Wahat al-Ghurub (2007)
© by Dar al-Schuruq 2007
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: © Rob Howard/CORBIS
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30226-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 07:56h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE OASE
VorbemerkungErster Teil1 — Machmud2 — Catherine3 — Machmud4 — Catherine5 — Scheich Jachja6 — Machmud7 — Catherine8 — Alexander der GroßeZweiter Teil9 — Machmud10 — Catherine11 — Machmud12 — Scheich Sabir13 — Catherine, Machmud, Scheich Jachja14 — Machmud15 — Catherine16 — Machmud17 — Catherine18 — MachmudRandbemerkungenWorterklärungenAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
»Ein Opfer kann auch Täter sein«
Über Baha Taher
»Ich war schon immer der Meinung, dass Politik und Fiktion untrennbar sind.«
Über Regina Karachouli
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
Zum Thema Wüste
Für Stefka Anastassova
Vorbemerkung
Der tatsächliche Name des Distriktkommissars der Oase Siwa in den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts war Machmud Asmi. Er wird einer Tat bezichtigt, die eine bleibende Spur in der Oase hinterließ. Der Leser wird an geeigneter Stelle in diesem Roman davon erfahren.
Abgesehen von dieser Tat sind keinerlei historische Fakten über diesen Distriktkommissar und seine Biografie überliefert.
Erster Teil
1
Machmud
Ihre Gattin ist eine mutige Frau«, hatte er zu mir gesagt. Als ob ich nicht wüsste, wie meine Frau ist! Begibt sie sich nicht freiwillig mit mir in Gefahr? Und dennoch, vielleicht kenne ich Catherine wirklich nicht. Lassen wir das jetzt beiseite! Jedenfalls hat er sie sicher nicht zufällig erwähnt, hinter jedem seiner Worte verbirgt sich eine Absicht. Aber momentan ist das Problem nicht Catherine. Außerdem werde ich kein einziges Problem lösen, wenn ich noch weiter durch die düsteren Korridore des Innenministeriums tappe, nach dieser beklemmenden Begegnung mit Mister Harvey.
Dabei war an seinen Worten überhaupt nichts Neues, abgesehen von gewissen indirekten Andeutungen, die ich zum Teil verstand, der Rest war mir ein Rätsel.
Schon bevor ich bei ihm eintrat, wusste ich, dass die Sache entschieden war. Oberst Said Bey hatte mir mitgeteilt, der Berater des Ministers habe bei Seiner Exzellenz Pascha, dem Minister für Innere Angelegenheiten, eine entsprechende Empfehlung eingereicht, und Seine Exzellenz habe bereits Order erlassen, sie weiterzuleiten und unverzüglich auszuführen. Demnach blieben mir nur wenige Tage, um mich der Karawane anzuschließen, die von Kerdasa aufbrechen werde. Als Freund rate er mir, auf die Idee zu verzichten, meine Gattin mit mir zu nehmen. Diese Reise in die Oase sei kein Spaziergang, und die Mission selbst gestalte sich äußerst schwierig, wie mir ja bekannt sein dürfte. Letzten Endes sei es meine eigene Entscheidung. Ungeachtet dessen halte er es für seine Pflicht, mich vor den Gefahren der Reise zu warnen. Selbst im günstigsten Fall und mit einem kundigen Führer werde sie mindestens zwei Wochen dauern.
Ich bin sicher, dass mir Said keine Angst machen wollte. Und bestimmt hat er alles in seinen Kräften Stehende unternommen, um mir diese Versetzung zu ersparen. Unsere Freundschaft besteht seit langer Zeit, mag sie sich auch im Laufe der Jahre gelockert haben und heute fast nur noch auf eine Beziehung zwischen Vorgesetztem und Untergebenem beschränkt sein. Trotz allem verbinden uns die Geschichten und Hintergründe einer vergangenen Epoche. Seit Jahren haben wir nicht mehr davon gesprochen, und doch weiß jeder von uns, dass der andere sich daran erinnert. Meine Kollegen haben mich ebenfalls vor der Reise gewarnt, allerdings mit verdächtigem Mitleid. Die einen sind froh, dass es mich getroffen hat und sie selbst von diesem Auftrag verschont blieben, die Übrigen gaben sich die größte Mühe, ihre Schadenfreude über mein Missgeschick zu verbergen. Sie erzählten mir von zahlreichen Karawanen, die sich in der Wüste verirrt hätten und von den Dünen verschluckt wurden. Nicht nur kleine Karawanen seien spurlos verschwunden, in alter Zeit habe die Wüste auch ein gewaltiges persisches Heer auf seinem Feldzug gegen die Oase besiegt und für immer unter den Sandmassen begraben. Glücklich die Karawane, sagten sie, die ihre Reise beendete, bevor der Wasservorrat aufgebraucht war, bevor die Sturmwinde alle Wegzeichen auslöschten und Hügel auftürmten, die es vorher dort nicht gab, und bevor sie die Brunnen verschütteten, auf die man zum Tränken der Kamele angewiesen war. Und glücklich die Karawane, die beim nächtlichen Lagern nicht von Wölfen und Hyänen überfallen wurde oder ein, zwei Reisende durch Schlangenbisse verlor.
All das und noch manches andere, was sie daherredeten, interessierte mich gar nicht. Meine Befürchtung, die Karawane könnte ihren Weg verfehlen, war nicht geringer als meine Angst, dass sie wohlbehalten ihr Ziel erreichte. Ich weiß ganz genau, dass ich mich an einen Ort begebe, wo ich vom Tod bedroht bin. Und mit mir vielleicht Catherine.
War das auch eine von Mister Harveys Andeutungen, die er in unser heutiges Gespräch eingestreut hatte?
Als ich sein Büro betrat, war ich entschlossen, ihn zu provozieren. Was hatte ich schon zu verlieren?
Es war das erste Mal, dass ich bei diesem Berater, der alle Fäden des Ministeriums in Händen hielt, vorgeladen wurde. Sein diplomatisches Geschwafel erschien mir affektiert, und ihn selbst fand ich einigermaßen aufgeblasen, wie er da mit seinem kurz geratenen Körper und dem achtlos auf den Kopf gestülpten Tarbusch, unter dem seine blonden Haare hervorschauten, hinter einem protzigen Schreibtisch thronte. Er sprach mich nicht direkt an, richtete vielmehr die meiste Zeit seine Worte an ein unsichtbares Etwas irgendwo in der rechten Ecke des Büros. Er wiederholte die gleichen Informationen, die ich bereits von Oberst Said vernommen hatte, bis er schließlich auf etwas zu sprechen kam, was er für meinen schwachen Punkt halten mochte: »Gewiss sind Sie glücklich, Captain Machmud Abdel Sahir Effendi – äh, Verzeihung, nunmehr Major Machmud –, über Ihre Ernennung zum Distriktkommissar der Oase!« Er tat, als läse er in meiner Dienstakte, die vor ihm lag, dann setzte er hinzu, unter normalen Umständen hätte ich auf diese Beförderung wohl noch lange warten müssen.
»Wobei zu bedenken ist, Eure Exzellenz«, unterbrach ich ihn mit einem möglichst höflichen Lächeln, »dass nur wenige im Ministerium diese Beförderung begrüßen dürften!«
Er ging nicht darauf ein und schaute mich auch nicht an. Stattdessen blätterte er in einem anderen Dossier, auf dem in großen englischen Buchstaben geschrieben stand: »OASIS SIWA«. Was er las, schien ihn zu amüsieren. »Interesting«, murmelte er von Zeit zu Zeit vor sich hin, »very interesting.« Schließlich hob er den Kopf und sagte, den Anflug eines Lächelns auf den Lippen: »Also, mein lieber Major Machmud, Sie werden wissen, dass Sie dort ausschließlich mit diesen Oberhäuptern der Familien in Beziehung zu treten haben, die man in der Oase ›Adschwad‹ nennt.«
»Selbstverständlich. Said Bey hat mir alle notwendigen Instruktionen gegeben.«
Als hätte ich nichts gesagt, fuhr er fort: Mit den Landarbeitern hätte ich nichts zu tun, das seien die … Er blickte wieder in das Dossier, um nach der Bezeichnung zu suchen. Ich warf ein, sie hießen »Saggala«.
Er vergewisserte sich mit einem erneuten Blick in die Mappe. »Ja, genau«, sagte er. »Saggala. Nun, solange sie mit diesem System zufrieden sind – was gehts uns an? Freilich fühlt man sich doch irgendwie an Sparta erinnert. Haben Sie von Sparta im antiken Griechenland gehört, Mister Abdel Sahir?«
»Ich habe davon gehört, Mister Harvey.«
In seinem Gesicht zeigte sich etwas wie Enttäuschung darüber, dass ich Sparta kannte. Dennoch entschloss er sich, in seinem Vortrag fortzufahren. »Jawohl, Sparta! Mit einem Unterschied natürlich. Sparta war eine Stadt, die ihre Krieger geradezu produzierte. Von klein auf erzogen sie die Kinder zu Soldaten und hielten sie getrennt von der übrigen Einwohnerschaft. So wurde schließlich ganz Sparta zu einer Armee, die in einer Stadt lebte. Die stärkste Armee in Griechenland vor Alexander! Und diese, äh … diese Saggala in der Oase sind eigentlich auch rekrutiert, nur eben zur Arbeit in der Landwirtschaft. Bis zu ihrem vierzigsten Lebensjahr müssen sie den Boden bearbeiten. Sie dürfen nicht heiraten, ja nicht einmal nach Sonnenuntergang die Tore passieren und die Stadt betreten.« Er persönlich halte diese Regelung für eine bemerkenswerte Organisation der Gesellschaft und der Arbeit. Ja, fast würde er sagen, sie verdiene Bewunderung. »Sehen Sie sich nur einmal unsere Kolonien in Afrika und Asien an, Mister Sahir! Das reine Chaos herrscht dort, weil eben die Arbeit …«
Ich unterbrach ihn noch einmal. »Aber Eure Exzellenz«, sagte ich lachend. »Wir besitzen gar keine Kolonien in Afrika oder Asien.«
Den Rest behielt ich lieber für mich: »Wir sind die Kolonisierten!«
Für einen Moment runzelte er die Stirn und stockte in seinem Redefluss. Von Neuem warf er einen Blick in das Dossier, dann hob er den Kopf. »Wiederum andere Aspekte ihres Systems«, sagte er plötzlich mit einem verschlagenen Lächeln, »etwa die Trennung der Jugendlichen von den Frauen, frequentieren uns selbstverständlich nicht. Dieses Thema ist für uns uninteressant. Mit ihren primitiven Bräuchen haben wir nichts zu schaffen.«
Ich begriff, was er mir sagen wollte, reagierte jedoch nicht auf seine Worte, sodass er sich wieder an das unsichtbare Etwas rechts in der Ecke wandte. Ohnehin hatte ich bereits von Said Bey gehört, dass die dortige Bevölkerung in zwei verfeindete Sippen gespalten war.
Meine Geduld war erschöpft. Ja, ja, ich weiß! Gewiss, die Kämpfe zwischen ihnen nehmen kein Ende.
Er kehrte mir sein Gesicht wieder zu. »Aber nicht einmal das geht uns etwas an«, erklärte er mit Nachdruck. »Diese Kämpfe sind Bestandteil ihres Lebens, und es steht ihnen frei, selbst zu bestimmen, was sie sich gegenseitig antun – außer natürlich, es böte sich die Möglichkeit, diese Feindseligkeiten durch bestimmte Allianzen mit der einen oder der anderen Sippe als Mittel zur Sicherung unserer Herrschaft zu nutzen. Es ist eine zuverlässige und bewährte Methode, vorausgesetzt, die Allianz mit einer Partei währt nicht zu lange. Das Bündnis muss einmal mit der einen Seite geschlossen werden und das nächste Mal mit ihren Gegnern. Sie verstehen?«
»Ich bemühe mich, Eure Exzellenz. Diese Politik ist mir bekannt, nur habe ich sie selber noch nie ausprobiert.«
»Sie werden es lernen, Herr Kommissar«, sagte er, und zum ersten Mal schwang etwas wie Mitgefühl in seiner Stimme. »Vergessen Sie nicht: Ihre erste Aufgabe wird die Eintreibung der Steuern sein. Eine schwierige Aufgabe, wie Sie wissen … eine überaus schwierige. Nun, der Überlebenswille wird Sie diese Politik lehren, und noch so manches andere dazu, Major …«
Er stockte plötzlich und lächelte erneut, als er sagte: »Bei alledem gibt es durchaus etwas Komisches an der Sache. Da errichten also diese Leute eine Festung auf dem Berg, und innerhalb der Festung bauen sie eine Stadt. Sie tun das, um sich vor den Überfällen der Beduinen zu schützen. Doch nachher übernehmen sie das Blutbad, das die Beduinen im Freien angerichtet hätten, eigenhändig innerhalb ihrer Mauern.« Er finde das einigermaßen kurios. Eben höchst orientalisch!
Mir stieg das Blut zu Kopfe. »Aber Mister Harvey!«, rief ich unwillkürlich. »Solche internen Kämpfe gibt es sowohl im Orient als auch im Okzident! Das ist etwas ganz anderes als eine Invasion von außen …«
Er starrte mir eine Weile ins Gesicht, dann meinte er leicht amüsiert: »Major Machmud Effendi scheint noch immer von den Ideen der Vergangenheit beeinflusst. Er wird doch nicht mehr mit den Rebellen sympathisieren?«
Es gelang mir nicht, mich zu beherrschen. »Ich habe niemals mit irgendeinem Rebellen sympathisiert!«, fuhr es aus mir heraus. »Ich habe lediglich meine Pflicht erfüllt, und ich musste dafür zu Unrecht zweimal büßen.«
Er schüttelte den Kopf. Wie auch immer, sagte er, mir sei ja wohl klar, dass meine Tätigkeit natürlich der Kontrolle und Prüfung unterliege?
Dies ist deine letzte Chance, dachte ich bei mir. Ich versuchte, einen neutralen Ton anzuschlagen, als ich erwiderte: »Hoffentlich wird meine Tätigkeit bei der Überprüfung als zufriedenstellend befunden. Aber was, wenn ich keinen Erfolg habe?«
»Dann werden Sie den Preis bezahlen«, antwortete er kurz angebunden. Und als hätte er meine Gedanken gelesen, fügte er hinzu: »Jedenfalls dürfte die Strafe nicht in Ihrer Rückversetzung nach Kairo bestehen.«
Unvermittelt wechselte er das Thema. Said Bey, dies zu meiner Kenntnis, sei übrigens dagegen gewesen, dass ich meine Gattin mitnähme. Selbstverständlich aus Sorge um sie. Er habe Seine Exzellenz allerdings unterrichtet, dass sich das Ministerium nicht in das Privatleben der Offiziere einmische. Zudem sei die Lady, wie er glaube …
Er stockte einen Moment und schien zu zögern, welche Worte er wählen sollte. »Nun ja«, fuhr er fort, »… eine mutige Frau.«
Ich entgegnete nichts. Plötzlich erhob er sich, ich stand ebenfalls auf. »Sie reisen mit der Kerdasa-Karawane«, sagte er in offiziellem Ton, »denn sie ist bereits fertig zum Aufbruch. Ich werde Ihnen aber mit der Matruh-Karawane, die in zwei Wochen startet, noch ein paar Pferde nachschicken.« Ein angedeutetes Lächeln auf den Lippen, setzte er hinzu: »Ich hoffe, dass die Pferde lebend ankommen.«
Wieder einmal von den Briten besiegt!, dachte ich, als ich sein Büro verließ. Wie ich dich hasse, Mister Harvey! Wie ich euch alle hasse, euch und euer Ministerium. Aber es gibt keinen Ausweg.
Ich musste jetzt schleunig nach Hause zurückkehren und mich für die Reise rüsten. Doch was gab es da noch groß vorzubereiten? Catherine hatte schon begonnen, alles Nötige einzupacken, als ich ihr mitgeteilt hatte, dass meine Bemühungen, die Versetzung abzuwenden, sämtlich gescheitert waren. Zudem hatte sie in den Läden vorsorglich jedes Buch gekauft, das die Oase ausführlich behandelte oder auch nur erwähnte. Sie überließ nichts dem Zufall. Gestern erzählte sie mir von ihren wirklich absonderlichen Plänen zur Behandlung von Schlangenbissen und Skorpionstichen. Ich verwies sie an einen Scheich der Rifai-Bruderschaft und überzeugte sie, dass er mehr Erfahrung im Umgang mit solchen Giften besitze. Also hatte auch sie Angst. Warum aber dann ihre Begeisterung für diese Reise? Ich hatte alles versucht, sie zum Dableiben zu bewegen – vergeblich. Sie kennt die Gefahr, die mich dort erwartet, doch das kümmert sie nicht. Wäre ich naiv genug, würde ich sagen, der Grund sei die Liebe, und sie wolle ihren Mann nicht allein sterben lassen. Ich bilde mir zwar ein, dass sie mich liebt, aber so sehr nun auch wieder nicht!
Ich verließ das Ministerium und ging über die Dawawin-Straße bis zur Abdin-Polizeistation. In dieser Station wurde mein ganzes Leben geformt, mein ganzes Leben vergeudet. Gar nicht weit davon steht das Haus, in dem ich seit meiner Geburt wohne. Und doch wäre mir in meiner Kindheit nie in den Sinn gekommen, dass ich einmal bei so einer Arbeit enden würde.
Wie auch immer, zur Reue war es jetzt zu spät. Außerdem – was sollte ich bereuen? Wovon hatte ich als Jugendlicher denn schon geträumt? Eigentlich hatte ich mir überhaupt keine Gedanken wegen der Zukunft gemacht. Ich wünschte mir nur, dass alles so weiterginge wie bisher. Eine glückliche Kindheit und eine noch glücklichere Jugend. Mein Vater mochte weder mir noch meinem jüngeren Bruder irgendetwas abschlagen. Er verbot uns kein Vergnügen, niemals zwang er uns, für die Schule zu pauken oder unsere Ausbildung in einer bestimmten Frist abzuschließen. Mein Bruder Suleiman verbrachte seine Zeit am liebsten in Vaters Geschäft im Muski-Viertel, um von ihm die Grundlagen des Handels zu erlernen. Ich hingegen erfreute mich in heiterer Unbeschwertheit meines Lebens. Die Ära des Khediven Ismail ging zu Ende, die ganze Stadt befand sich in Aufruhr, und so vertrödelte ich meine Zeit am Gymnasium, bis ich fast zwanzig war. Ich suchte Frauenbekanntschaften, verkehrte mit leichten Mädchen und verlebte meine Nächte, indem ich mit Freunden umherzog, von einem Café ins andere, von einer Bar in die nächste. In unserem großen Haus in Abdin rissen die Feste nicht ab. Kaum ein Abend verging ohne Gäste, ohne gesellige Unterhaltung und die Auftritte der berühmtesten Sängerinnen und Sänger. Die einzige Ausnahme war der Donnerstag. An diesem Abend räumten die Diener sämtliche Möbel aus dem großen Zimmer in der ersten Etage. Sie legten den Boden mit Teppichen aus, entzündeten wohlriechendes Räucherwerk und stellten mit Rosenwasser gefüllte Messingkrüge in die Ecken. Es war die Nacht der Mystik und der »Leute des Pfades«, der Lobgesänge auf den Propheten und der Anrufungen Gottes. Dafür hätte mein Vater, und ebenso ich selbst, auf jede andere Freude verzichtet. Ich psalmodierte mit den frommen Sängern und taumelte verzückt im Dhikr-Kreis der Sufis, bis mir der Schweiß ausbrach und alle Glieder erschlafften. Danach fiel ich in einen ruhigen, tiefen Schlaf, der die ganze Nacht währte. Am nächsten Morgen ging ich in aller Frühe mit meinem Vater und Suleiman zum Freitagsgebet in die Hussein-Moschee. Aber schon in der darauffolgenden Nacht verfiel ich wieder in den alten Schlendrian. Eines Abends landete ich mit meinen Freunden zufällig im Matatiacafé am Ataba-Platz. Und dort sah ich zum ersten Mal diesen Mann mit dem Turban – Scheich Al-Afghani. Er sprach Arabisch wie ein Türke oder ein Syrer. Doch niemals zuvor hatte ich solche Worte vernommen, oder vielleicht hatte ich sie gehört, ohne darauf zu achten. Seine Rede und die Begeisterung seiner Anhänger, die ihn umringten, packten mich. Ich musste ihm einfach lauschen. So kam es, dass ich fortan nicht mehr ausschließlich dem Wein und den Frauen frönte. Ja, ich wurde geradezu süchtig nach den Versammlungen des Scheichs und nach der Lektüre der Zeitungen, die seine Schüler herausgaben – »Misr«, »Al-Tidschara« und »Al-Taʼif«. Jedes Mal, wenn der Khedive eine dieser Zeitungen verbot, wechselte ich zu einer neuen, die an ihrer statt erschien und das Gleiche verkündete wie ihre konfiszierte Vorgängerin. Alle attackierten sie die Herrscher, die Ägypten in Schulden stürzten und in den Bankrott führten, und alle loderten sie vor Zorn über die Herrschaft der Europäer, die sogar Ministerämter in unserer Regierung übernahmen und als Beamte in jeder Abteilung vertreten waren. Um diese Zeit kam mir zu Ohren, der Scheich und einige seiner Schüler hätten sich zur Freimaurerei bekehrt. Es hieß, deren Anhänger gehörten unterschiedlichen Religionen an, doch sie seien geeint durch ihren Glauben an die Freiheit und die Brüderlichkeit zwischen den Menschen aller Nationen. Sofort schloss auch ich mich einer Freimaurerloge an und wartete auf den Tag, an dem die Menschheit eine einzige, weltumspannende Loge freier Brüder wäre. Dann erfuhr ich von der Gründung einer geheimen nationalen Partei. Als ich ihre verbotenen Flugschriften mit der Parole »Ägypten den Ägyptern!« las, war ich hellauf begeistert und wollte auf der Stelle der Partei beitreten. Allerdings wusste ich nicht, wie ich Kontakt zu ihr aufnehmen sollte. Und noch etwas hinderte mich daran – ein erster Schicksalsschlag, der mein Leben verändern sollte: Das Geschäft meines Vaters ging bankrott.
Bis heute ist mir unbegreiflich, wie ich ohne jedes Bedenken all diese Sachen gleichzeitig tun konnte. Eins folgte aus dem anderen, ohne dass ich mir Sorgen machte oder Gewissensbisse empfand – als wäre es ganz normal, sich zu betrinken, eine Freimaurerloge aufzusuchen, mit Frauen zu schlafen, zu einer Versammlung bei Al-Afghani zu gehen und sich mit dem Vater und den Sufis im Dhikr zu drehen. Ja, zur selben Zeit dachte ich daran, mich verstärkt meinen Studien zu widmen, um ein gutes Zeugnis zu bekommen und ans Jura-College zu gelangen, wovon die meisten Studenten träumten. Ich war sogar überzeugt, dass ich dafür besonders geeignet wäre, denn meine Lieblingsfächer am Gymnasium waren Rhetorik und Literatur. Aber nun war mein Vater plötzlich bankrott. Ein griechischer Händler hatte ihn mit der Aussicht auf dicke Profite durch den Import von Olivenöl aus seinem Land geködert, hatte ihn dann immer tiefer in Schulden verstrickt, bis er schließlich das Geschäft in Muski an sich reißen konnte. Für den Unterhalt des großen Hausstands mit Sklavenmädchen und Dienern blieb kein Einkommen mehr übrig. Mein Vater ließ nichts unversucht, bis es ihm gelang, mich im Polizeidienst unterzubringen. Mit einer gewissen Bildung und ein paar Monaten militärischer Schulung war es dazumal möglich, Offizier zu werden. So hatte mein Vater, bevor Sorgen und Krankheiten ihn gänzlich niederwarfen, wenigstens die Beruhigung, dass mein Sold ausreichen würde, um meine Mutter und meinen Bruder zu ernähren und ein gastliches Haus zu führen, wenn auch ohne große Feste, musikalische Soireen oder Dhikr-Veranstaltungen. Die Besucher wurden rar, und ebenso verschwanden die Sufis und religiösen Sänger. Erst viele Jahre später nahm ich ein einziges Mal wieder an einem Dhikr teil, als mich Oberst Said zu einer Veranstaltung der Bruderschaft einlud, der er selbst angehörte. Doch ich geriet nicht mehr in Trance. Nichts regte sich in mir, keine Ekstase riss mich hin wie früher einmal.
Nun frage ich mich: Liegt diese ferne Vergangenheit für immer hinter mir? Konnte jener vielfältig ambitionierte junge Mann eins werden mit sich, oder hat die Zeit ihn noch tiefer gespalten? Als ich Catherine nach langem Zögern heiratete, hatte ich gehofft, endlich Ruhe zu finden. Jetzt gab es eine Familie, ein Heim, eine kluge, tapfere Frau. Aber warum ist niemals Stabilität eingekehrt? Weshalb blieb sie trügerisch und unerreichbar? Meine einzige Gewissheit ist diese Uniform, die ich trage, dieser Beruf, der mir ungebeten zufiel und doch für mich der einzig vorstellbare ist – trotz aller Widrigkeiten, die er mir im Laufe der Jahre beschert hat.
Und nun noch diese Oase.
2
Catherine
Ich weiß, dass Machmud dieses große Haus vermissen wird. Im Schweigen der Wüste wird er sich zurücksehnen nach seinem Viertel, wo das Leben und Treiben niemals zur Ruhe kommt, wo unablässig die Rufe der Händler ertönen. Was ihm gewiss nicht fehlen wird, ist der benachbarte Khedivenpalast. Wir haben zwar nie einen Fuß da hineingesetzt, doch mir gefällt schon das Grün seiner prächtigen Gärten, soweit ich sie hinter den Mauern erspähen kann. Machmud vermag sich ein Leben fern von seinem Zuhause nicht vorzustellen, er kennt nur dieses eine. Ich dagegen bin dreimal umgezogen und verspüre kein Heimweh nach einem bestimmten Haus. Örtlichkeiten fallen mir eh bloß ein, wenn ich an die Menschen denke, die sie bewohnen. Aber dann erinnere ich mich sogar an vertraute Gerüche und längst vergessene Winkel. Die Kapriolen des Gedächtnisses sind doch immer wieder erstaunlich.
Machmud hat sich ein bisschen verspätet. Er ist zum Ministerium gegangen, um die letzten Formalitäten zu regeln, anschließend wollte er gleich zurückkommen und mir beim Packen helfen. Es bleibt ja nicht mehr viel zu tun, alles ist reisefertig. Außer Machmud selbst. Ich habe mich längst an seine ständigen Stimmungswechsel gewöhnt. Anfangs verblüffte es mich, wenn er etwas sagte und kurz darauf das Gegenteil behauptete oder wenn er ohne jede Ankündigung die widersprüchlichsten Dinge tat. Diesmal liegt das Problem freilich anders. Seine Traurigkeit scheint tiefer zu sitzen.
Als ich ihm zum ersten Mal begegnete, wirkte er nicht gerade glücklich, und ich war es zu dieser Zeit auch nicht. Trotzdem gelang es uns, das Glück einzufangen und es eine Zeit lang festzuhalten. Ich sehe ihn noch immer vor mir wie damals. Wir trafen uns zufällig auf einer Nilfahrt nach Assuan. Er fiel mir auf, wie er da stand, auf der Schiffsbrücke der Dahabija, hochgewachsen, in Polizeiuniform, mit Tarbusch, unter dem die grau melierten Haare hervorlugten und sein junges Gesicht umrahmten. Ich fand ihn attraktiv, aber das war nicht der eigentliche Grund, der mich zu ihm hinzog. Von Anfang an hatte ich den Eindruck, er sei anders als die Offiziere, denen ich in Kairo begegnet war. Ja, er unterschied sich tatsächlich von allen Männern, die ich hier kennengelernt hatte. Gewöhnlich behandelten sie mich ziemlich unterwürfig als Ausländerin – als Engländerin in einem von Großbritannien okkupierten Land, und dabei strömte ihnen flehend wie Bettlertränen die Begierde aus den Augen. Als ich zu ihm trat, erschien mir der Tarbusch auf seinem Kopf wie die Krone eines Pharaos. Sein strenges Gesicht mit den großen schwarzen Augen und den ebenmäßigen Zügen war das Antlitz eines wahrhaften Königs, der von einer Tempelwand aufs Deck dieser Dahabija herabgestiegen war. Ich fragte ihn, wie viel Zeit bliebe, bis wir Assuan erreichen würden. Er wandte sich mir zu, senkte aber keineswegs wie die anderen den Kopf. Im Gegenteil, in seinem flüchtigen Blick bemerkte ich Feindseligkeit. Immerhin, er schaute sich suchend um. Doch an beiden Flussufern waren weit und breit nichts als Felder und einförmige Dörfer zu sehen. Er blickte mir gerade in die Augen und sagte in seinem damals noch gebrochenen Englisch: »Ich weiß nicht. Ich bin hier nur als Wache auf der Dahabija.« Er gehörte zur Leibwache irgendeines reisenden Prinzen oder Ministers, soweit ich mich erinnere. Als ich dennoch vor ihm stehen blieb, meinte er ungerührt, ich könne ja, bitte schön, einen der Matrosen fragen. Und ich erwiderte: »Ich komme mit dir.«
Von da an blieb ich bei ihm – auf der Dahabija, in den Straßen von Assuan, in den Tempeln von Luxor, und schließlich in Kairo, wo wir heirateten. Er zögerte lange, sich mir zu öffnen, die meiste Zeit war ich es, die redete. Ich glaube, der Umschwung kam bei ihm, als er herausfand, dass ich Irin bin und die Engländer hasse, weil sie mein Land okkupiert haben, und dass ich ihre aufgezwungene Nationalität als eine Schande empfinde, die ich eines Tages abwerfen werde, wenn Irland unabhängig wird. Damit war die Barriere zwischen uns gefallen. Der Widerstand, den ich in seinen Augen genauso erkennen konnte wie seine Liebe, war gebrochen. Oder täuschte ich mich? War es denn wirklich Liebe – oder nur Verlangen? Damals kümmerte es mich wenig. Von Anfang an hatte er mich gewarnt, er habe sich geschworen, niemals zu heiraten. Aber sein Schwur hatte nicht lange Bestand.
Der Scheich, der in Kairo unsere Ehe schloss, schien unglücklich darüber zu sein, dass ein Muslim und angesehener Offizier eine Ausländerin heiratete, die nicht seiner Religion angehörte. Er stellte Fragen, und die Bestürzung in seinen Augen wurde immer größer. Er wiederholte die Antworten, als wollte er seinen Ohren nicht trauen. Sie ist keine Jungfrau? Eine Witwe? Zwei Jahre älter als er? Weder der Vater noch ein Bruder vertritt sie beim Ehekontrakt? Sie verheiratet sich selbst?
Machmud sagte mir, nichts davon verletze ihr religiöses Gesetz. Aber ich bemerkte, wie sich der Standesbeamte über seine Papiere beugte und das Gehörte eintrug, ohne den Kopf zu heben, damit wir seinen empörten Blick nicht sahen. Der Scheich war freilich ein Muster an Höflichkeit, verglichen mit der Unverschämtheit der Engländer. Als ich ins Konsulat ging, um meine Eheschließung registrieren zu lassen, fragten sie konsterniert: »Sie heiraten einen Ägypter? Noch dazu nach hiesigen Gesetzen? Und bevor Sie sich an uns wenden? Wissen Sie überhaupt, auf welche Rechte Sie damit verzichten?« Ich konterte in gleicher Weise. Das hiesige Gesetz gefalle mir eben besser als das der Engländer in Irland, sagte ich. Wenigstens sei diese Heirat meine eigene Entscheidung gewesen, und niemand habe sie mir gewaltsam aufgezwungen. Als sie das hörten, erledigten sie im Handumdrehen alle Formalitäten, damit ich nur das Konsulat rasch wieder verließ.
Machmud hatte erwartet, dass der britische Ministerialberater meine Reise in die Oase nicht genehmigen würde. Nun, ich denke mir, dass sie mit Freuden zustimmten, in der Hoffnung, ich würde dort recht bald umkommen!
In unseren ersten Tagen, unseren ersten Monaten, lernte ich mit Machmud ein Glück kennen, das ich nach meiner traurigen Erfahrung mit Michael auf dieser Welt nicht mehr für möglich gehalten hätte. Doch von Anfang an merkte ich, dass Machmud keine Liebesworte ertrug, weder mochte er sie aussprechen noch hören. Liebe bedeutete für ihn Sex, nicht mehr und nicht weniger. Und auch darin war er ein König, immer bereit zu geben, jederzeit imstande, mein Verlangen zu wecken. Ein wahrer Meister, von Jugend an erfahren durch zahlreiche Affären, die er durchaus nicht leugnete. Nur mit meinem Instinkt – der sich bei Michael verflüchtigt hatte – lernte ich, mit seiner Erfahrung Schritt zu halten. Und vielleicht habe auch ich ihm noch etwas beibringen können. Ich machte ihm begreiflich, dass es mir gar nicht gefiel, wenn er heftig und schnell zur Sache kam, was für ihn wohl ein Zeichen von Männlichkeit war. Dass ich vielmehr das zärtliche Streicheln mochte, das langsame Zueinanderfinden zweier Körper, die gleitende Steigerung von lustvoller Annäherung und Liebkosung bis zum Höhepunkt des Entzückens und der Erfüllung.
Allmählich ging er auf mich ein, und wir lebten monatelang in einem fortwährenden Rausch der Sinne. Er hielt sich nicht zurück, und ich zierte mich nicht. Nie hätte ich geglaubt, dass ich einmal fähig wäre, eine solche Auffassung von Liebe und von Leben zu akzeptieren. Mehr noch, ich wurde darin seine Gefährtin, und das ganz freiwillig, ganz und gar glücklich. Lag es an ihm, dass viele Vorurteile einfach von mir abfielen? Oder war ich schon immer dazu bereit gewesen, sodass mir Machmud nur die Maske der Prüderie abzustreifen brauchte?
Ja, ich akzeptierte bei ihm Dinge, die früher für mich unvorstellbar gewesen wären. Nach unseren ersten Monaten spürte ich, dass ich nicht die Einzige in seinem Leben war. Manchmal, wenn er neben mir im Bett lag, nahm ich den Geruch einer anderen wahr, ihren Schweiß, und ich spürte den Schatten einer Frau zwischen uns. Dann wieder sagte ich mir, das kann doch nicht sein, seine Leidenschaft ist nicht schwächer geworden, eher stärker. Trotzdem wusste ich, dass mein Körper mich nicht belog: Es gab eine Nebenbuhlerin! Unerträgliche Eifersucht quälte mich. Ich verbrachte einen ganzen Tag damit, mich zu fassen und meine Gedanken zu ordnen, um ihn zur Rede zu stellen. Als er aber von der Arbeit kam, waren alle Pläne dahin. Kaum hatte er das Wohnzimmer betreten, fuhr ich auf ihn los: »Betrügst du mich, Machmud?« Er antwortete mit einer Gegenfrage: »Du meinst, ob ich mich mit anderen Frauen abgebe?« Ich nickte, und er sagte seelenruhig: »Ja.« Ich begann am ganzen Leib zu zittern. »So also!«, brach es aus mir heraus. »Was wäre denn, wenn ich einen anderen hätte?« Er erwiderte einfach: »Ich würde dich sofort töten.« – »Aha!«, schrie ich. »Und wieso sollte ich dich jetzt nicht umbringen?« Er schwieg einen Moment, als dächte er nach. Dann zog er seinen Revolver aus dem Halfter und hielt ihn mir lächelnd, mit ausgestrecktem Arm hin. »Tatsächlich, das wäre nur gerecht«, sagte er. »Es steht dir genauso gut zu. Nimm ihn. Ich werde dich nicht hindern.« Ich stieß seinen Arm beiseite und rannte schreiend in mein Zimmer: »Ich kann nicht mit einem Verrückten leben!« Ich schloss mich ein und fing an, meine Kleider und Habseligkeiten zusammenzupacken, um für immer fortzugehen.
Vier Tage redete ich nicht mit ihm, am fünften Tag waren wir wieder zusammen im Bett. Er drückte mich fest an sich und sagte: »Lügen wäre am leichtesten gewesen, doch ich will nicht lügen. Mein Körper ist das Problem. Eine Frau genügt ihm nicht. Mich von dir zu scheiden, wäre überhaupt nicht schwierig gewesen. Auch du hättest mich jederzeit verlassen können, aber du hast es nicht getan. Wir brauchen einander, aus diesem Grund haben wir geheiratet.« – »Und wo bleibt bei alledem die Liebe?«, murmelte ich. Da beugte er sich über mich und gab mir einen Kuss.
Ich habe diese Art Liebe und diese Art Ehe akzeptiert. Ist das nun ein Leben in äußerster Wahrheit oder in äußerster Lüge? Er hat sich nicht geirrt. Jeder von uns braucht den anderen. Doch wofür? Und wie lange? Zurzeit fühle ich, dass sich sogar an dieser Beziehung, mit der wir beide einverstanden waren, etwas verändert hat. Diesmal geht es nicht um Frauen. Machmud verschließt sich auf eine Weise in sich selbst, wie ich es noch nie erlebt habe, seit ich ihn kenne. Ist es wegen dieses Auftrags, der ihm vom ersten Augenblick an verhasst war? Er hat alles Mögliche unternommen, um ihn von sich abzuwenden – ohne Erfolg. Ich kenne die Gefahr, die ihn erwartet. Aber ich weiß auch, dass Machmud kein Feigling ist. Er wird seine Pflicht dort genauso erfüllen, wie er sie sein Leben lang erfüllt hat, ganz gleich, ob er sie liebte oder hasste. Davon bin ich überzeugt. Er unterdrückt sogar den immer wiederkehrenden Schmerz in seinem Arm, wo ihm eine Kugel die Knochen zerschmettert hat. Seine Beschwerden verstärken sich im Winter, überhaupt bei Kälte. Ich merke es lediglich an seinem Gesichtsausdruck, wenn er die Hand fest auf den Arm presst. Doch weder klagt er, noch verliert er darüber ein Wort. Ich sagte ihm im Scherz, in der Oase werde er jedenfalls nie unter Kälte zu leiden haben, dort sei es das ganze Jahr über heiß. Er schüttelte den Kopf und erwiderte: »Wenn das Problem nur das Klima wäre!«
Das wirkliche Problem ist mir durchaus bekannt. Alles, was von den Historikern und Reisenden über die Oase geschrieben wurde, habe ich gelesen. Ich kenne ihre alte und ihre neuere Geschichte. Mag sein, dass ich über die alte Historie besser Bescheid weiß, aber ich habe auch die Ereignisse vom Anfang dieses Jahrhunderts studiert, als die Armee des ägyptischen Statthalters Muhammed Ali die Oase eroberte. Der Pascha gliederte sie Ägypten ein und beendete damit eine Jahrhunderte währende Unabhängigkeit, in der Siwa keinem fremden Staat und keiner äußeren Macht unterworfen war. Ich habe gelesen, wie sich die Bewohner gegen die ägyptische Herrschaft zur Wehr setzten. Unaufhörlich empörten und erhoben sie sich und kämpften gegen die Soldaten, und ebenso unaufhörlich unterdrückten die Ägypter ihre Erhebungen mit solcher Grausamkeit, dass immer neue Rebellionen und neue Aufstände die Folge waren. Und ich weiß ebenso gut wie Machmud, dass gerade der Distriktkommissar als der Herrscher über die Oase weiterhin ein lohnendes Ziel für die Anschläge bleiben wird. Anfangs hatten sie nur die einheimischen Bürgermeister umgebracht, die man in Kairo unter den Söhnen Siwas für dieses Amt auswählte. Ihre Ermordung war eine Botschaft an den Distriktkommissar gewesen, und sie bedeutete, dass auch er für sie erreichbar wäre. Bei den letzten beiden Revolten jedoch töteten sie die Kommissare selbst. Die Regierung entsandte daraufhin eine große Armee, die Ruhe herstellte und danach wieder abzog. Ob diese Ruhe aber noch Bestand hat?
Ich hoffe es. Seit Langem träume ich von dieser Reise in die Wüste. Freilich hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie auf solche Weise wahr werden würde. Ich wünschte mir nur, einmal die Oase zu sehen, über deren Sand Alexander der Große geschritten war, in der er jene faszinierende Geschichte erlebte, die ihn bis zu seinem Tod begleiten sollte. Darüber hinaus schweben mir noch mancherlei Dinge vor, die ich momentan nicht einmal auszudenken wage. Alles zu seiner Zeit. Hauptsache, wir sind da allein, Machmud und ich. Dort besteht keine Gefahr, dass ihn mir eine andere Frau streitig macht. Die übrigen Gefahren sind kein zu hoher Preis, wenn wir dafür unser früheres, unbeschwertes Leben zurückgewinnen.
Machmud ist aber wirklich spät dran.
Vielleicht ist er immer noch im Ministerium. Oder er nimmt Abschied von den Straßen seiner Stadt und denkt jetzt wie ich über alles nach. Kann sein, er zieht Bilanz über sein Leben und überlegt, wieso es ihn an diesen Punkt führte. Zum Aufbruch in ein unbekanntes Schicksal mit dieser Irin, die ihm der Zufall in den Weg gestellt hat.
Und genauso bei mir. Wie viele Zufälle mussten geschehen, um mich bis an diesen Punkt zu bringen? O nein – keine Zufälle! Für all das bin ich selbst verantwortlich, und ich bereue nichts. Mag sein, dass mein Papa mir den Anfang des Weges zeigte, doch schließlich war es mein eigener Wille, der mich hierherführte.
Wäre er noch am Leben, so würde er jetzt in allem, was mir mit Machmud passiert, eine wohlverdiente Strafe erblicken. Niemals hätte er dieser Heirat zugestimmt, dazu war er ein viel zu eifriger Katholik. Trotzdem ist er es gewesen, der mich lehrte, den Orient zu lieben und seine Altertümer zu bewundern. O ja, er weckte meine Wissbegier, vor allem, was die unerforschten Denkmäler der Griechen und Römer betraf – natürlich unter der Voraussetzung, dass ich mich von den lebenden Orientbewohnern fernhielt. Sie waren nichts weiter als die Verwahrer von Geschichte. Ich aber, und daran sollte ich immer denken, ich sei Irin und Katholikin.
Nie werde ich vergessen, wie ärgerlich er einmal wurde, als wir über die Religionen sprachen und dabei auf sein Lieblingsthema kamen – die alten Griechen. Das Gespräch drehte sich um ihre Götter, und ich erklärte, die Griechen hätten eben damals, geradeso wie die alten Ägypter, ja wie alle Menschen vor und nach ihnen, den Schöpfer ihrer Vorstellung gemäß angebetet. Gott bleibe jedoch zu allen Zeiten und an allen Orten ein und derselbe. Und ganz bestimmt nehme er das Gebet jedes Menschen an, der ihn verehre. Ich war noch sehr jung, vielleicht vierzehn oder fünfzehn, aber Papa versuchte erst gar nicht, mit mir zu diskutieren oder mich zu belehren. Sein Gesicht wurde puterrot. »Demnach setzt du einen Gläubigen, der zum wahren Gott betet, mit jemandem gleich, der eine Statue verehrt oder einen Baum oder irgendeinen Götzen? Du stellst diejenigen, die an unseren Heiland glauben, auf eine Stufe mit Heiden und Wilden, die ihre Götter anflehen, ihnen bei der Jagd oder im Krieg zu helfen?« Trotz meiner Angst vor seinem Zorn entgegnete ich: »Das habe ich doch gar nicht gemeint, Papa. Ich meine nur, dass alle Menschen nach dem Schöpfer suchen und Ihn fromm und aufrichtig anbeten, und selbst wenn sie dabei fehlgehen, wird Er gewiss ihre gute Absicht erkennen, weil Er eben alles weiß.« Aber Papa hörte mir überhaupt nicht zu. Er bestand darauf, dass ich zur Kirche ging, um dem Priester meine Sünde zu beichten und Vergebung zu erlangen. Natürlich ging ich hin, denn ich war ja auch eine gläubige Katholikin.
Wie sehr ich ihn jetzt vermisse, trotz allem! Wenn er noch am Leben wäre, würde ich ihn bitten, mir bei meiner Suche zu helfen. Er war es doch, der mir Unterricht in Griechisch und Latein gab, und er sagte, ich sei sprachbegabt und müsse mein Talent nutzen. Ich glaube, er hat sich nicht geirrt. Das Lesen der Hieroglyphen und ihrer Ableitungen brachte ich mir autodidaktisch bei, und nach meiner Heirat mit Machmud habe ich auch Arabisch gelernt. Papa wäre stolz auf mich gewesen, wenigstens in dieser Hinsicht. Immer hat er mir seine Studien und Übersetzungen aus dem Griechischen vorgelesen und mich ermutigt, ebenfalls Texte zu übersetzen. Von allem, was ich schrieb, war er begeistert. Trotzdem, von meiner Ehe mit Machmud hätte ich ihn nicht überzeugen können, da bin ich mir sicher. Ausgeschlossen.
Mama habe ich nicht mehr gesehen, seit ich nach Ägypten kam. Ich weiß nicht, wie ihre Gefühle für mich jetzt sind. Manchmal schreibt sie mir, aber nur sehr kurz, aus reinem Pflichtbewusstsein. Sie war nicht erfreut über meine erste Heirat, und diese zweite Ehe wird sie wohl noch strikter ablehnen. Meine Schwester Fiona war die Einzige, die mich sofort verstand. Und so aufrichtig, wie sie mir meine Heirat mit Michael verziehen hatte, gratulierte sie mir zur Hochzeit mit Machmud. Sie hat mir die Sache mit Michael vergeben, während ich sie mir selbst nie vergeben konnte. Kein Wunder, dass sie von Papa »Fiona die Heilige« genannt wurde. Regelmäßig schreibt sie mir ihre langen, liebevollen Briefe. Ob sie uns eines Tages in Ägypten besuchen wird, wie sie versprochen hat? Doch wenn sie wirklich kommt – wie soll sie uns erreichen, da wir nun aus der Zivilisation in die Wüste ziehen? Ich habe ihr jedenfalls geschrieben, sie möge ihre Reisepläne verschieben.
Aber um ganz ehrlich zu sein: Will ich denn, dass sie kommt, oder sollte sie trotz meiner Sehnsucht nach ihr nicht doch lieber fernbleiben? Ich möchte alles vermeiden, was mich an diese schmerzliche Geschichte erinnert. Wie viel Mühe hat es gekostet, mich davon frei zu machen. Ich bin natürlich sicher, dass Fiona nichts tun würde, was die Erinnerung daran wachruft. Vielleicht würde sie den Namen »Michael« nicht einmal erwähnen, wenn wir uns begegnen. Nicht sie ist das Problem, ich selbst bin es: Ich habe das Gefühl, ihn meiner Schwester weggenommen zu haben. Wenn Fiona wüsste, welches Glück sie hatte, ihm entkommen zu sein!
Er war unser nächster Nachbar, ein Freund von Papa, sein junger Kollege, und wie er Lehrer. Das Gesicht eines Engels, eine gedämpfte Stimme. Die beiden Männer verband das Interesse an der Sprache und Kultur der Griechen. Mein Vater begnügte sich freilich sein Leben lang damit, diese Studien als Amateur zu betreiben. Michael dagegen publizierte Artikel in einer kleinen Regionalzeitschrift, und mitunter druckte auch ein historisches Journal diese oder jene Abhandlung von ihm. Wenn er uns besuchte, ging ich wie alle anderen davon aus, dass er sich für Fiona interessierte. Meistens verweilte er lange mit ihr im Garten am Haus, wo sie sich unterhielten. Und daran war nichts Verwunderliches. Fiona war nun einmal die Schönere, die Jüngere, die Nettere. Schon von einem Blick in ihr strahlendes Antlitz wurde man glücklich. Mir war zwar bewusst, dass ich eine recht gute Figur hatte, doch mein Gesicht war ganz gewöhnlich. Trotzdem machte er mir plötzlich einen Antrag. Damals war bereits ein Jahr vergangen, seit mein Vater gestorben war, aber den Schock darüber hatte ich immer noch nicht verwunden.
Eines sonnigen Vormittags kam ich in Papas Bibliothek und fand ihn dort, über ein Buch gebeugt, als ob er darin läse. Er war niemals krank gewesen, nie hatte er über irgendwelche Beschwerden geklagt. An diesem Morgen war er sogar besonders gut gelaunt gewesen. Machmud erzählte mir, er habe auch einmal so einen ähnlichen Schock erlebt. Ich konnte es einfach nicht begreifen! Welchen Sinn hatte dieser Tod? Bis heute erkenne ich keinerlei Sinn im Tod. Aber da er nun einmal unausweichlich ist, sollten wir etwas tun, was unser Leben rechtfertigt. Wir sollten einen Fingerabdruck auf der Erde hinterlassen, bevor wir von ihr gehen.
Als Michael zu mir in den Garten trat, fragte ich ihn: »Warum ich?« Er antwortete: »Weil ich dich liebe.« – »Und Fiona?« – »Du bist es, die ich liebe«, wiederholte er. Mama war außer sich. »Da macht er uns allen vor, dass er Fiona will«, rief sie aufgebracht, »und auf einmal hält er um dich an? Man könnte ja glatt einen Skandal vermuten! Ist zwischen dir und ihm etwas vorgefallen, wovon wir nichts wissen?« Ich schwor ganz ehrlich, dass ich niemals an ihn gedacht hätte und dass er mich mit seinem Antrag völlig überrascht habe. Außerdem wolle ich ihn gar nicht. Es war Fiona selbst, die über die Sache entschied. Sie habe Michael lediglich als Freund ihres Vaters und der Familie betrachtet, sagte sie. Und hätte er um ihre Hand angehalten, so hätte sie ihn abgewiesen.
Wenn das stimmte, dann war sie nicht nur die Schönere, sondern auch die Klügere.
Zweifellos durchschaute sie ihn besser als ich. Sie erklärte, sie würde Michael auf keinen Fall nehmen, und stellte mir damit frei, ihn zu akzeptieren oder abzulehnen. Ich dachte eine Weile nach, und schließlich erklärte ich mich einverstanden. Ich sagte mir, die hübsche Fiona wird bestimmt eine bessere Partie machen.
Warum hatte ich Mamas beharrliche Einwände ignoriert: Was immer meine Schwester sagen mochte, diese Heirat war ein Verrat an ihr! Ich hätte sehen müssen, so wie sie es sah, dass er kein vertrauenswürdiger Mensch war. Doch wie hätte ich seine Kehrseite damals bemerken können? Erst nach der Hochzeit erlebte ich seine wahnsinnige Eifersucht auf andere Männer. Sie zwang uns in eine komplette Isolation. Wir besuchten niemanden, niemand besuchte uns, und kaum einmal gingen wir aus dem Haus. Seine Eifersucht bezog sich aber genauso auf die Bücher.
Er war es gewohnt, mich beim Studieren mit Papa zu sehen, und in seinem Beisein hatte er mich stets eifrig ermutigt, meine Ausbildung fortzusetzen. Nach der Heirat hasste er es, mich auch nur mit einem Buch in der Hand zu sehen. Er spottete über meine Lektüre und meine Übersetzungen. Was ich denn damit anfangen wolle, wo ich doch gar keinen Beruf hätte? Ob es nicht angemessener wäre, mich mit der Hausarbeit zu befassen? Ständig warf er mir Unwissenheit vor und rieb mir meine Lesefehler in Griechisch und Latein unter die Nase.
Die erste Zeit reagierte ich darauf, indem ich versuchte, seine Arbeit zu loben. Ich zeigte mich übertrieben begeistert von seinen Artikeln und Studien, obwohl ich wusste, dass er sie mit kleinen Veränderungen bei anderen abschrieb. Alles umsonst. Immerhin kapierte er, dass ich ihm etwas vormachte und dass meine Bewunderung gelogen war. Trotzdem gab er nichts zu, sondern beharrte darauf, dass ich wie so viele Leser nicht imstande sei, die Grundidee seines Artikels zu erfassen. Also lag es wieder an mir. Ich war selber schuld, weil mir seine Ideen zu hoch waren.
Von Anfang an bekam ich auch seinen Geiz zu spüren. Er knauserte nicht nur mit Geld. In einem armen Land, das den Menschen keinen verschwenderischen Luxus erlaubt, wäre so etwas kaum schandbar gewesen. Aber er geizte mit allem, sogar mit seinen Gefühlen.
Die wenigen Male, die er mich liebte, benahm er sich, als erweise er mir eine große Gunst, eine Dienstleistung, die er rasch hinter sich bringen wollte. Nach den gescheiterten Versuchen mit Michael habe ich meinen Körper erst wirklich mit Machmud entdeckt. Durch Machmud erfuhr ich, was für ein unerhörter Augenblick das ist, wenn zwei Leiber auf dem Höhepunkt der Liebe gemeinsam emporfliegen in eine Glückseligkeit, die jedes Mal wieder ganz neu ist. Wie ein Segen wird sie uns zuteil, einzigartig und überwältigend, als verkündete dieses letzte Seufzen eine Neugeburt oder eine Auferstehung. Jedenfalls etwas, das ich mit Michael nie erlebt hatte, etwas, das nicht zu vergleichen war mit der Empfindung von klebrigem Schweiß, von Abscheu und Anspannung des Körpers, der nach Erfüllung dürstete und sich doch wie erlöst fühlte von der Pein einer Umarmung, die nur in Ekel vor sich selber und dem Bettgefährten enden konnte.
Einmal fragte ich ihn: »Warum hast du mich überhaupt geheiratet?« Er antwortete in seiner sarkastischen Art: »Aus Masochismus.« Womöglich war er sogar aufrichtig. Kein Mann heiratet eine Frau, die er nicht liebt, außer er hätte Lust daran, sich selbst zu quälen. Aber wieso? Bis an sein Lebensende bemerkte ich in seinen Augen einen traurigen, demütigen Blick, wenn er Fiona ansah. Weshalb hatte er dann nicht sie geheiratet, weshalb wählte er mich? In meinem Leben habe ich Männer kennengelernt, die nur deshalb vor der Bindung an eine schöne Frau zurückschreckten, weil sie fürchteten, andere könnten sie abschätzig mustern und sich fragen: Verdient dieser Mann überhaupt eine solche Frau? Vielleicht war auch er so ein Feigling. Oder er hat gewusst, dass er sie nicht verdiente, also wählte er die gewöhnliche Schwester, um die ihn niemand beneiden würde – aus Masochismus, wie er sagte. Vier Jahre lang hat er sich selbst gequält und mich mit.
Wie auch immer. Nachdem meine Versuche, ihn versöhnlich zu stimmen, misslungen waren, erkannte er, dass ich anders war, als er vermutet hatte. Ich ertrug keine Beleidigung. Härte erwiderte ich mit Härte und Hass mit Hass. Als wir frisch verheiratet waren, schlug ich ihm vor, eine Reise nach Ägypten zu unternehmen, gerade das alte Ägypten hatte mich seit jeher fasziniert. Außerdem hoffte ich, wir würden uns näherkommen und besser verstehen, wenn wir weit wegfuhren. Ich sagte, wir könnten uns ja die Reisekosten teilen. Das Geld, das Papa mir hinterlassen hatte, würde für meinen Anteil ausreichen. Aber Michael betrachtete schon allein die Idee als Zeichen von Verrücktheit. Als Unvernunft und sinnlose Verschwendung. Alles Wissenswerte über Ägypten könne ich ebenso gut aus Büchern erfahren, falls mein Verstand in der Lage sei, etwas davon zu begreifen. Trotzig forderte ich ihn heraus. Ich begann, die Sprache der alten Ägypter zu studieren, und lernte als Autodidaktin Hieroglyphisch und Demotisch. Auch das passte ihm nicht. Er riss mir die Bücher aus der Hand und zerfetzte sie, weil ich meine Zeit mit nutzlosem Zeug verplemperte, statt ordentlich den Haushalt zu führen. Wenigstens solle ich versuchen, die Sprachen, die ich bereits angefangen hatte, richtig zu erlernen. Ich stand in aller Seelenruhe auf und griff mir ein Buch aus seinem Regal, um es zu zerreißen. Er stürzte sich auf mich, schlug zu, stieß mich zurück. Aber ich zog noch mehr Bücher heraus, schleuderte sie auf den Boden und zerfledderte so viele, wie ich nur konnte. Beinahe umgebracht hätten wir uns bei diesen Bücherschlachten und in anderen Kämpfen. Bestimmt hätte das alles mit einem Gewaltverbrechen oder einem Skandal geendet, denn mehr als einmal dachte ich daran, aus dem Haus zu flüchten, ja aus dem ganzen Land. Ich hätte es auch getan, wenn ich nicht Mitleid mit Mama und Fiona gehabt hätte. Und wenn er nicht vorher an seinem Geiz und seiner Starrköpfigkeit zugrunde gegangen wäre.
Er beharrte darauf, dass der Husten, der seine Brust zerstörte, nichts weiter sei als eine gewöhnliche Erkältung. Er behandelte sich selbst mit Kräutern, heißem Tee und Grog, mit Wechselbädern und allen möglichen Rezepturen, die er schon einmal ausprobiert oder von denen er irgendwann gehört hatte. Wir konnten zusehen, wie sein Körper regelrecht verdorrte, wie sein Husten zum Bellen ausartete, bis einem beim bloßen Zuhören angst und bange wurde. Sosehr ich ihn auch drängte, sooft ihn Fiona und Mama baten – er wollte partout keinen Arzt aufsuchen. Eine solche Lappalie sei nicht der Rede wert. Gerade diese Arznei, die er zuletzt probiert, die Tinktur, die er als Letzte eingenommen hatte, war für ihn das bewährteste und sicherste Mittel, um seine vorgebliche Erkältung zu heilen. Am Ende, als er bei seinen Hustenanfällen Blutklumpen ausspuckte und zum Arzt ging, war alles zu spät.
Ich war bestürzt über seinen Anblick, wie er da auf der Klinikpritsche lag, mit kalkweißem Gesicht, keuchend, nicht einmal mehr fähig zu husten. Ich verspürte eine panische Angst, aber als ich mein Innerstes nach wirklicher Traurigkeit durchforschte, fand ich nichts, nicht einmal ganz zuletzt, als er mich mit entsetzten Augen um Hilfe zu bitten schien, die ich ihm doch nicht bringen konnte. Ich war über mich selbst erschrocken, dass ich nach seinem Tod insgeheim einen unwillkürlichen Seufzer der Erleichterung ausstieß: Endlich!
Es war keine Absicht. Ich hatte ihn ja nicht umgebracht, ihm nicht einmal den Tod gewünscht. Er war von allein gestorben – wie hätte ich daran schuld sein können? Während der Trauerzeit erfüllte ich meine Pflicht und wahrte den Schein mit allen erforderlichen Verhaltensweisen. Fionas Trauer aber war echt. Was wusste ich denn? Vielleicht hatte sie ihn wirklich geliebt, obgleich sie es bestritt. Oder war es ihr gutes Herz, das mit allen Menschen mitfühlte? Sollte ich das auch noch ergründen? Als wäre mein Leben nicht schon kompliziert genug!
Vier Jahre mit Michael töteten viele Dinge in mir, zwei Jahre mit Machmud erweckten sie wieder zum Leben. Ja, es war nichts Geringeres als eine wahrhaftige Auferstehung zu einer neuen Frau. Mag sein, dass die Heilung bereits mit der Reise nach Oberägypten begann. Mit dem von Michael geerbten Geld, das er Penny für Penny zusammengespart hatte, konnte ich sie mir leisten. Als ich in den alten Bauwerken umherging und die Malereien und Statuen betrachtete, als ich die gravierten Inschriften auf den Säulen und Wänden mit eigenen Augen las und sie in mein Notizbuch übertrug, da fühlte ich eine Freude, die sogar meine schönsten Träume übertraf. Und dann begegnete ich Machmud. Wie wohltuend, dass er in allem das Gegenteil von Michael ist! Er beschenkt mich verschwenderisch, er kennt keine Grenzen – auch nicht in seiner Widersprüchlichkeit und seinen Stimmungswechseln.
Na endlich, da ist er!
Ich höre seinen vertrauten Schritt auf der Treppe.
Komm, Machmud! Lass uns zusammen hinausziehen in die Wüste. Dort werden wir gemeinsam neu geboren, und bei dieser Auferstehung lasse ich dich nicht entschlüpfen. Mir wirst du gehören, mir allein.
3
Machmud
Da ist er nun, »der Garten der Seele«, wie Said ihn nannte! Seiner Seele vielleicht, nicht meiner. Nichts erregt er in mir, dieser gelbe »Garten«. Höchstens Zorn.
Weit und breit erstreckt sich die Wüste vor meinen Augen – nur Sand und Dünen, Felsen und schimmernde Trugbilder in der Ferne. Sengende Hitze bei Tag und beißende Kälte in der Nacht. Von Zeit zu Zeit graue Bergketten wie die Überreste eines Gebirges, das ein gewaltiger Blitzschlag gespalten und zertrümmert hat.
Catherine und ich reiten auf unseren Kamelen voraus. Sie trägt ein Reitkostüm mit Hosen, die an den Schenkeln bauschig abstehen. Ihr Sattel besitzt als einziger ein Sonnendach aus dickem Stoff, es sieht aus wie eine offene Sänfte. Der Führer und die Beduinen der Karawane sind fürsorglich um uns bemüht. Nachts schlagen sie uns ein Zelt auf, während sie selbst im Freien schlafen und neben ihren knienden Kamelen Schutz vor dem Wind suchen. Die zehn Soldaten, die mich begleiten, bilden die Nachhut der Karawane, mit Ausnahme von Sergeant Ibrahim, den mir Oberst Said vor der Abreise mit seiner persönlichen Empfehlung als Ordonnanz zu meinen Diensten mitgegeben hat.
Mit jedem weiteren Tag unserer Reise lastet das Schweigen schwerer auf der Karawane. Alle Augen halten nach vorn Ausschau, doch sie starren ins Leere. Woran mögen sie denken? Ich weiß es nicht. Aber mich überfällt dieses Schweigen mit Geschrei und mit Bildern, die alles Vergangene wieder erwecken – all die Lebenden, all die Verstorbenen. Vielleicht hat das sogar schon vor der Reise angefangen. Ich muss an so viele Dinge denken, besonders an das Ende.
Ob ich mich vor dem Tod fürchte? Selbstverständlich. Wer würde das nicht? Ich frage mich, wo und wie er mich schnappen wird. Durch eine Kugel in der Oase? Oder als gewöhnliches Hinscheiden nach kurzer oder langer Krankheit? Bei irgendeinem Unfall? Durch Ersticken im Bad oder Gift im Essen? Kommt er etwa ohne jede Vorwarnung? In hunderterlei Gestalt lauert er unterwegs in der Dunkelheit, um sich womöglich mit einem Satz auf mich zu stürzen – und alles ist aus. Wie oft bemühe ich mich, nicht an meine Mutter zu denken, aber auf dieser Reise kann ich sie nicht vergessen. Ich sehe sie wieder vor mir, wie sie in jener Nacht auf mich wartete. Bei meiner Rückkehr saß sie in ihrem großen Sessel neben dem Bett, die Dienerin kauerte am Boden und schlief fest. Ich wusste, dass meine Mutter nicht einschlafen konnte, bevor ich wohlbehalten heimkam und sie mich wie üblich gefragt hatte, ob mein Bruder Suleiman aus Damaskus geschrieben habe. Meistens gab es keinen Brief, doch ich beruhigte sie: Ich hätte gehört, ihm und seinen Kindern gehe es gut. Wie gewohnt küsste ich ihre Stirn und ihre Hand und fragte, ob sie noch etwas brauche. Sie bat mich um einen Becher Wasser, sie brachte es nicht übers Herz, die Dienerin zu wecken. Bevor ich die Tür erreichte, erinnerte sie mich: »Aber aus dem braunen Krug!« Dann rief sie mir nach: »Und mit dem Messingbecher!« Ich ging ins Wohnzimmer, wo die Krüge auf einem Tablett am Nordfenster standen, und hob den braunen Krug an, dessen Wasser sie stets mit Mastix würzte und mit einem feinen, durchlässigen Tuch abdeckte. Es war tatsächlich kühler als das in den anderen Krügen. Ich füllte den mit bunten Ranken verzierten Messingbecher und kehrte zum Zimmer zurück, in der Absicht, sie ein wenig damit zu necken. Sie wollte immer nur aus diesem Becher trinken, denn mein Vater hatte ihn ihr eines Tages geschenkt. Gerade mal ein, zwei Minuten waren über diesen Verrichtungen vergangen. Als ich, den Becher in der Hand, die Tür öffnete, sah ich sie mit gesenktem Kopf dasitzen. Ich lief zu ihr und rief sie, aber sie antwortete nicht. Da wusste ich, dass sie gestorben war.
Zwei Monate war ich außerstande, etwas zu begreifen. Jedem Besucher, der mir sein Beileid aussprach, erzählte ich, was sich in der kurzen Zeit zwischen dem Verlassen des Zimmers und meiner Rückkehr zu ihr ereignet hatte. Als ob sich hinter diesen Einzelheiten ein Geheimnis oder ein Rätsel verbarg, mit denen das Geschehene zu erklären wäre. Ich stolperte umher, mir zitterten die Beine. Ich verstand das alles nicht, und eigentlich kann ich es noch immer nicht begreifen.





























