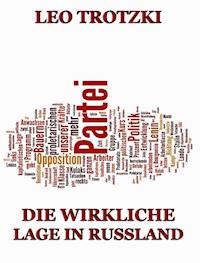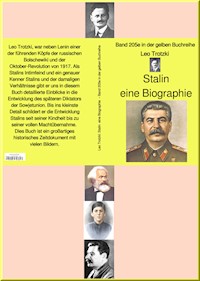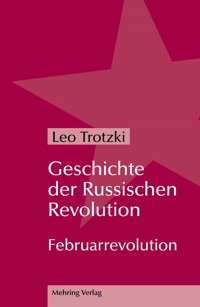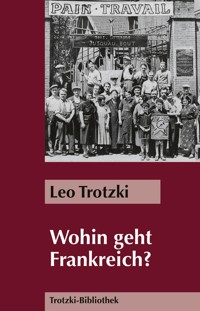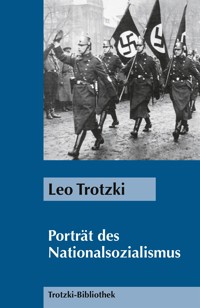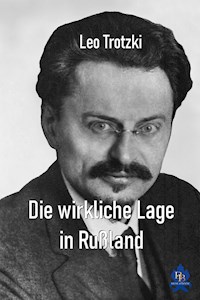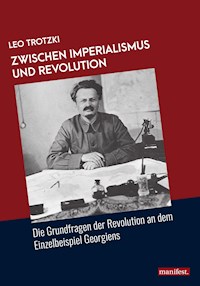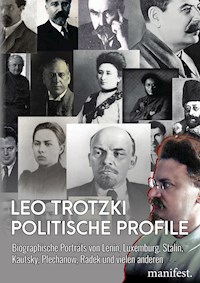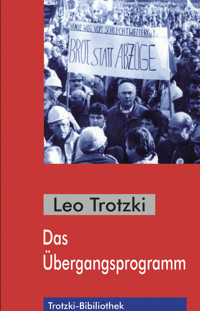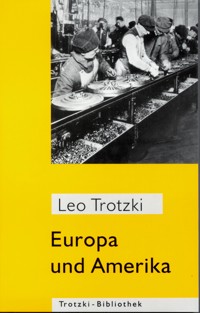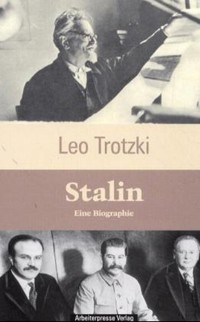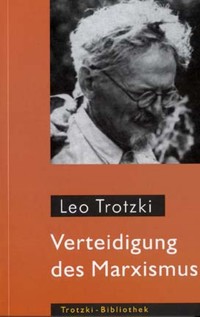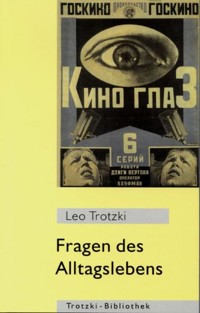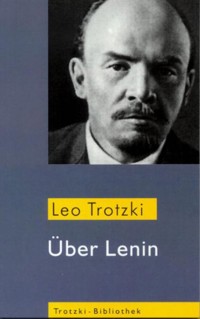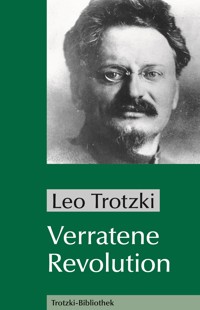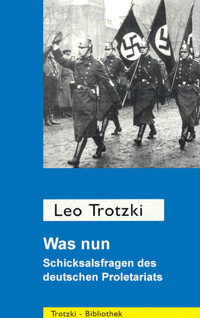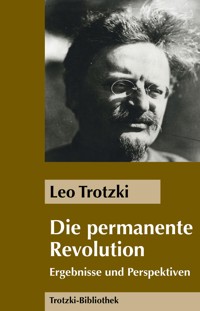
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MEHRING Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Trotzki-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
„Der Abschluss einer sozialistischen Revolution ist im nationalen Rahmen undenkbar. Sie beginnt auf nationalem Boden, entwickelt sich international und wird vollendet in der Weltarena. Folglich wird die sozialistische Revolution in einem neuen, breiteren Sinne des Wortes zu einer permanenten Revolution: Sie findet ihren Abschluss nicht vor dem endgültigen Siege der neuen Gesellschaft auf unserem ganzen Planeten.“ Die Theorie der permanenten Revolution bildete 1917 die strategische Grundlage der russischen Oktoberrevolution. Sechs Jahre später stand sie im Mittelpunkt der Angriffe auf die Linke Opposition, die sich der bürokratischen Entartung der Sowjetunion und dem Stalinismus widersetzte. Die Theorie der permanenten Revolution geht auf Marx und Engels zurück. Auf ihrer Grundlage entwickelte der junge Leo Trotzki 1906 in „Ergebnisse und Perspektiven“ die zukünftige Strategie der Oktoberrevolution. Unter dem Titel „Die permanente Revolution“ verteidigte er sie 1928 gegen die stalinistischen Angriffe und Verfälschungen. Dieses Buch ist bis heute eine der aktuellsten Schriften der sozialistischen Bewegung. Die vorliegende Ausgabe fasst beide Werke in einem Band zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gab es eine Alternative? (Gesamtausgabe)
Seit Ende der achtziger Jahre arbeitete der russische Historiker Wadim S. Rogowin an der sechsbändigen Untersuchung über die politischen Konflikte in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Internationale zwischen 1922 und 1940. Sie stützt sich auf Materialien aus sowjetischen Archiven, die in den letzten Jahren zugänglich geworden sind, und auf eine Vielzahl von neuen Memoirenquellen.
Diese sechs Bände liegen jetzt in deutscher Sprache vor und können zusammen zum vergünstigten Preis erworben werden.
Die Einzelbände:1) Trotzkismus2) Stalins Kriegskommunismus3) Vordem Großen Terror – Stalins Neo-NÖP4) 1937 – Jahr des Terrors5) Die Partei der Hingerichteten
Leo Trotzki
Die permanente Revolution(1928)
Ergebnisse und Perspektiven(1906)
Inhalt
Zu diesem Buch
ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN – Die treibenden Kräfte der Revolution
Vorwort (1919)
Ergebnisse und Perspektiven
1. Die Besonderheiten der historischen Entwicklung
2. Stadt und Kapital
3. 1789 – 1848 – 1905 …
4. Revolution und Proletariat
5. Das Proletariat an der Macht und die Bauernschaft
6. Das proletarische Regime
7. Die Voraussetzungen des Sozialismus
8. Die Arbeiterregierung in Russland und der Sozialismus
9. Europa und die Revolution
Anhang
DIE PERMANENTE REVOLUTION
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Einleitung
1. Der erzwungene Charakter dieser Arbeit und ihr Ziel
2. Die permanente Revolution ist nicht ein »Sprung« des Proletariats, sondern die Umgestaltung der Nation unter der Leitung des Proletariats
3. Drei Elemente der »demokratischen Diktatur«: Klassen, Aufgaben und politische Mechanik
4. Wie hat die Theorie der permanenten Revolution in der Praxis ausgesehen?
5. Hat sich bei uns die »demokratische Diktatur« verwirklicht? Und wann?
6. Vom Überspringen historischer Stufen
7. Was bedeutet die Parole der demokratischen Diktatur heute für den Osten?
8. Vom Marxismus zum Pazifismus
Epilog
Was ist nun die permanente Revolution? – Grundsätze
IMPRESSUM
Zu diesem Buch
Leo Trotzki schrieb »Die permanente Revolution« 1928 in Alma-Ata, dem heutigen Almaty in Kasachstan. Die stalinistische Bürokratie, die in den Jahren nach Lenins Tod in der Sowjetunion die Macht an sich riss, hatte den neben Lenin angesehensten Führer der Oktoberrevolution im Januar 1928 in die Verbannung nach Zentralasien geschickt. Tausende Mitglieder der trotzkistischen Linken Opposition erlitten ein ähnliches Schicksal. Kurz nach Vollendung des Buches, Anfang 1929, wurde Trotzki aus der Sowjetunion ausgewiesen und in die Türkei abgeschoben. Die stalinistische Herrscherclique hoffte – vergeblich –, so ihren konsequentesten marxistischen Kritiker zum Schweigen zu bringen und seinen politischen und theoretischen Einfluss zu unterbinden.
Als sich die sozialen Gegensätze in der Sowjetunion in den 1930er Jahren infolge der katastrophalen, von Trotzki kritisierten Politik Stalins weiter zuspitzten, griff die Bürokratie zum Mittel des Terrors, um sich ihrer sozialistischen Gegner zu entledigen. Zwischen 1936 und 1938 ließ sie massenhaft überzeugte Kommunisten, Wissenschaftler, Ingenieure und Künstler sowie einfache Arbeiter unter der Anschuldigung des »Trotzkismus« verschleppen, einsperren, von geheim tagenden Schnellgerichten zum Tode verurteilen und erschießen. Die Zahl der Opfer des Großen Terrors wird auf etwa eine Million geschätzt. Die öffentliche Fassade dieses politischen Völkermords bildeten die drei großen Moskauer Prozesse, in denen fast die gesamte Führung von Lenins bolschewistischer Partei auf die Anklagebank gesetzt und unter erfundenen Anklagen zum Tode verurteilt wurde.[1]
Trotzki selbst wurde am 20. August 1940 in Coyoacan/Mexiko ermordet, wo er nach Aufenthalten in der Türkei, Frankreich und Norwegen die letzten Jahre seines erzwungenen Exils verbrachte. Ramon Mercader, ein Agent der stalinistischen Geheimpolizei GPU, verschaffte sich mithilfe eines weitverzweigten Agentennetzes Zutritt zu Trotzkis bewachtem Haus und streckte ihn mit einem Eispickel nieder. Trotzki starb am folgenden Tag an den Folgen des Anschlags.
Der Grund für die mörderische Gewalt, mit der Stalin seine sozialistischen Widersacher verfolgte, waren die unüberbrückbaren sozialen und politischen Gegensätze zwischen der privilegierten Bürokratie, die den Staats- und Parteiapparat kontrollierte, und der Arbeiterklasse. Stalin, der miterlebt hatte, wie die Bolschewiki 1917 innerhalb weniger Monate Masseneinfluss gewonnen hatten, fürchtete, das marxistische Programm der Linken Opposition könnte mit der sozialen Unzufriedenheit der Arbeiterklasse zusammenkommen und zum Sturz seines Regimes führen, das die Interessen der Bürokratie verteidigte.
Das Anwachsen der Bürokratie und von konservativen Elementen innerhalb der Kommunistischen Partei, die Stalin schließlich zur Macht verhalfen, war eine Folge der verheerenden Auswirkungen von sieben Jahren Welt- und Bürgerkrieg sowie der anhaltenden Isolation der Sowjetunion aufgrund der Niederlagen der internationalen Arbeiterklasse, insbesondere in Deutschland. Seinen bewussten politischen und theoretischen Ausdruck fand der Gegensatz zwischen Bürokratie und Arbeiterklasse im Konflikt zwischen der Theorie des Sozialismus in einem Land und der Theorie der permanenten Revolution.
Vor 1923 war kein ernsthafter Marxist davon ausgegangen, dass der Sozialismus in Russland auf nationaler Grundlage aufgebaut werden könne. Die globale Krise des Kapitalismus, die in der Katastrophe des Ersten Weltkriegs gipfelte, hatte die Voraussetzungen geschaffen, unter denen die Arbeiterklasse im rückständigen Russland als Erste die Macht ergreifen und die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft in Angriff nehmen konnte. Doch die Vollendung der sozialistischen Revolution hing von deren Sieg in den fortgeschrittenen Zentren des Weltkapitalismus ab.
Erst nach dem Ende des Bürgerkriegs und dem Übergang zur marktorientierten Neuen Ökonomischen Politik wurden Stimmen laut, die für eine Abkehr von der Perspektive der Weltrevolution eintraten und behaupteten, die Sowjetunion könne den Sozialismus aus eigener Kraft aufbauen. Diese Haltung bildete die Grundlage des Programms des »Sozialismus in einem Land«, das Stalin und Bucharin 1924 formulierten. Seine rückwärtsgewandte, nationalistische Orientierung entsprach den Interessen der Bürokratie, die ihre privilegierte gesellschaftliche Stellung durch die Fortsetzung und Ausweitung der Revolution gefährdet sah.
Unmittelbar vor »Die permanente Revolution« hatte Trotzki eine andere, wichtige programmatische Schrift verfasst: die »Kritik des Programms der Komintern«, die unter dem Buchtitel »Die Dritte Internationale nach Lenin« veröffentlicht wurde.[2] Darin befasste er sich ausführlich mit dem Programm des »Sozialismus in einem Land« und seinen verheerenden Folgen für die Sowjetunion und die internationale kommunistische Bewegung. Trotzki sandte diese »Kritik« an den 6. Kongress der Kommunistischen Internationale, der im Sommer 1928 in Moskau tagte. Dort fiel sie trotz der stalinschen Zensur einigen Teilnehmern in die Hände und erreichte durch die nordamerikanischen Delegierten James P. Cannon und Maurice Spector auch das Ausland, wo sie die Grundlage für den Aufbau der internationalen Linken Opposition und später der Vierten Internationale bildete.
»Die permanente Revolution« konnte Trotzki dagegen, ergänzt durch eine Einleitung und einen Epilog, erst Anfang 1930 im Exil veröffentlichen. Er knüpfte damit an die »Kritik des Programms der Komintern« an und vertiefte die Auseinandersetzung. Es empfiehlt sich, die beiden Bücher im Zusammenhang zu lesen.
Im Mittelpunkt der Angriffe auf die Gegner der Bürokratisierung und der nationalistischen Orientierung Stalins und Bucharins stand von Anfang an die Theorie der permanenten Revolution. 1917 hatte sie die strategische Grundlage der Oktoberrevolution gebildet; nur sechs Jahre später wurde sie als ketzerische Abweichung vom Marxismus verleumdet.
Die Theorie der permanenten Revolution geht auf Marx und Engels zurück. Die Autoren des »Kommunistischen Manifests« verwendeten diesen Begriff, als sie 1850 die Lehren aus der Niederlage der europäischen Revolutionen des Jahres 1848 zogen. Die Bourgeoisie und ihre kleinbürgerlichen demokratischen Verbündeten waren der Revolution in den Rücken gefallen, weil sie die erstarkende Arbeiterklasse als Bedrohung ihres Eigentums weit mehr fürchteten als die adligen Herrscher. Marx und Engels zogen daraus den Schluss:
Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch … zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsereAufgabe, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, dass die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und dass wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind.[3]
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewann die Theorie der permanenten Revolution angesichts der sich anbahnenden revolutionären Krise in Russland neue Aktualität. In der internationalen marxistischen Bewegung löste sie eine Diskussion aus, an der sich neben Trotzki auch Franz Mehring, Rosa Luxemburg, Alexander Helphand (Parvus), Karl Kautsky und andere beteiligten.[4] Das riesige Land, in dem die reaktionäre zaristische Autokratie auf verarmte Bauernmassen und eine kleine, aber hochkonzentrierte Arbeiterklasse prallte, stand vor einer gesellschaftlichen Explosion.
Aber wer würde die Revolution führen? Was waren ihre Aufgaben? Welche Rolle würden die verschiedenen Klassen spielen? Würde sich die liberale russische Bourgeoisie anders verhalten als die deutsche 1848?
Trotzki schildert in seiner Einleitung zur »permanenten Revolution«, wie die verschiedenen politischen Strömungen diese Fragen beantworteten, so dass dies hier nicht wiederholt werden muss. Er selbst vertrat den kühnsten und weitgehendsten Standpunkt, der im Verlauf des Jahres 1917 bestätigt wurde. Trotzki war der Auffassung, dass die Revolution, auch wenn sie vorwiegend demokratische Aufgaben hatte, nur erfolgreich sein konnte, wenn die Arbeiterklasse die Führung übernahm und die armen Bauernmassen auf ihre Seite zog. Sobald sich die Arbeiterklasse an der Macht befinde, müsse sie dann allerdings den Weg sozialistischer Maßnahmen beschreiten.
Die Politik, welche die Bolschewiki 1917 nach Lenins Rückkehr aus dem Exil verfolgten, entsprach weitgehend dieser Konzeption der permanenten Revolution, die Trotzki 1906, im Alter von 27 Jahren, in der Schrift »Ergebnisse und Perspektiven« erstmals ausführlich dargelegt hatte. Sie bildet den ersten Teil dieses Buches.
Trotzki stützte seine Analyse auf die Veränderungen in der Struktur der Weltwirtschaft. Seine Herangehensweise »stellte einen wichtigen theoretischen Durchbruch dar«, wie David North im Buch »Verteidigung Leo Trotzkis« schreibt:
Sie führte zu einer Verschiebung der analytischen Perspektive, unter der revolutionäre Prozesse betrachtet wurden. Vor 1905 wurden Revolutionen als Resultat fortschreitender nationaler Ereignisse aufgefasst, deren Ergebnis von der Logik ihrer inneren sozioökonomischen Struktur und Beziehungen bestimmt wurde. Trotzki trat für eine andere Herangehensweise ein: Die Revolution sollte in der modernen Epoche als ein im Wesentlichen welthistorischer Prozess aufgefasst werden, ein Prozess des Übergangs von der Klassengesellschaft, die politisch in Nationalstaaten verwurzelt ist, zu einer klassenlosen Gesellschaft, die sich auf der Grundlage einer global integrierten Wirtschaft und der international vereinten Menschheit entwickelt.[5]
Aufgrund dieser Perspektive ist die Theorie der permanenten Revolution heute, im Zeitalter der Globalisierung, brennend aktuell. Trotzki war nicht nur ein wesentlicher Führer der Oktoberrevolution und unversöhnlicher Gegner des stalinistischen Regimes, sondern vor allem auch der herausragende Theoretiker der sozialistischen Weltrevolution. Schon 1928, als er »Die permanente Revolution« schrieb, war die Frage »längst über die eigentliche Sphäre des Kampfes gegen den ›Trotzkismus‹ hinausgewachsen«, wie er in der »Einleitung« schreibt:
Allmählich sich ausdehnend, hat sie heute buchstäblich alle Probleme der revolutionären Weltanschauung erfasst. Permanente Revolution oder Sozialismus in einem Lande – diese Alternative betrifft in gleicher Weise die inneren Probleme der Sowjetunion wie die Perspektiven der Revolution im Osten und schließlich das Schicksal der gesamten Kommunistischen Internationale.[6]
In China hatte die Zurückweisung der permanenten Revolution durch die Kommunistische Internationale bereits 1927 zu einer verheerenden Katastrophe geführt. Trotzki nimmt im Verlauf des Buches immer wieder darauf Bezug.
Die Komintern hatte im Jahr zuvor die Guomindang, eine bürgerliche, nationalistische Partei, als sympathisierende Sektion in ihre Reihen aufgenommen und die aufstrebende Kommunistische Partei Chinas gezwungen, sich in der Guomindang aufzulösen. Sie wiederholte damit im Wesentlichen die Politik der menschewistischen Gegner der Oktoberrevolution von 1917, die darauf bestanden hatten, dass die Führung der Revolution bei der Bourgeoisie bleiben müsse. Für die chinesischen Arbeiter hatte dies verheerende Folgen. Im April 1927 nutzte Chiang Kai-shek, der Führer der Guomindang, die Lähmung und Desorientierung der Kommunistischen Partei, um in Shanghai ein Massaker zu veranstalten, dem rund 25 000 kommunistische Arbeiter zum Opfer fielen. Lesern, die diese äußerst wichtigen und lehrreichen Ereignisse studieren wollen, empfehlen wir das Buch »Die Tragödie der chinesischen Revolution« von Harold Isaacs, das nun erstmals auch in deutscher Sprache erhältlich ist.[7]
Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Theorie der permanenten Revolution unzählige Male – auf negative Weise – bestätigt. Immer wieder zeigte sich, dass in Ländern mit einer verspäteten bürgerlichen Entwicklung »die volle und wirkliche Lösung ihrer demokratischen Aufgabe und des Problems ihrer nationalen Befreiung nur denkbar ist mittels der Diktatur des Proletariats«, wie Trotzki in der Zusammenfassung am Ende des Buches erklärt.[8] Nicht ein einziger bürgerlicher Nationalist – von Gamal Abdel Nasser über Fidel Castro bis hin zu Jassir Arafat und Nelson Mandela sowie in jüngerer Zeit Hugo Chavez oder Evo Morales –, der von Stalinisten oder ihren Anhängseln als Revolutionär verherrlicht wurde, erwies sich als fähig, die demokratischen Aufgaben nachhaltig zu lösen und die Abhängigkeit vom Imperialismus zu überwinden.
Heute stellen die tiefe Krise des globalen Kapitalismus, eskalierende Kriege, die wachsende soziale Polarisierung und die Rückkehr autoritärer Regime die Menschheit erneut vor die Aufgaben, die Trotzki in diesem Buch skizziert hat. Nur eine internationale sozialistische Bewegung der Arbeiterklasse kann eine weitere Katastrophe verhindern, die die Existenz der Menschheit bedroht. Die Perspektive der permanenten Revolution gewinnt wieder brennende Aktualität.
– – – –
Die Texte sind in dieser Ausgabe nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung angeordnet. Die 1906 verfassten »Ergebnisse und Perspektiven« stehen an erster Stelle und werden durch Trotzkis Vorwort zur russischen Ausgabe von 1919 eingeleitet. Es folgt der Artikel »Der Kampf um die Macht«, der 1915 in der Pariser Zeitung »Nasche Slowo« erschien. Zuletzt kommt »Die permanente Revolution« mit dem Vorwort zur deutschen Erstausgabe von 1930 und der Einleitung zur russischen Erstausgabe.
Die Texte haben wir leicht verändert aus den früheren deutschen Ausgaben übernommen. »Die permanente Revolution« wurde von der durch Trotzki autorisierten Übersetzerin Alexandra Ramm direkt aus dem Russischen übertragen. Zitatangaben beziehen sich auf die russischen Originaltexte, wenn die deutschen Quellen nicht in den Fußnoten genannt sind. Die Fußnoten in »Ergebnisse und Perspektiven« stammen, soweit sie nicht mit Trotzkis Initialen L.T. gekennzeichnet sind, vom Übersetzer.
Mehring VerlagJanuar 2016
Anmerkungen
1 Eine gute Darstellung der gesellschaftlichen Veränderungen in der Sowjetunion der Jahre 1934 bis 1936, die den Großen Terror möglich und für die herrschende Bürokratie notwendig machten, gibt Wadim S. Rogowin in »Vor dem großen Terror. Stalins Neo-NÖP«. Eine detaillierte Schilderung des Großen Terrors findet sich in den beiden folgenden Bänden von Rogowins siebenbändigem Werk »Gab es eine Alternative?«: »1937. Jahr des Terrors« und »Die Partei der Hingerichteten«. Alle Bände sind in deutscher Übersetzung beim Mehring Verlag erschienen.
2 Leo Trotzki, Die Dritte Internationale nach Lenin, Essen 1993.
3 Karl Marx/Friedrich Engels, »Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850«, in: MEW, Bd. 7, Berlin 1960, S. 247–248.
4 Einen Überblick über diese Diskussion gibt David North in der Besprechung der Dokumentation Witnesses to Permanent Revolution von Richard B. Day und Daniel Gaido in: David North, Die Russische Revolution und das unvollendete Zwanzigste Jahrhundert, Essen 2015, S. 307–342.
5 David North, »Zum Stellenwert Leo Trotzkis in der Geschichte des 20. Jahrhunderts«, in: Verteidigung Leo Trotzkis, Zweite, erweiterte Auflage, Essen 2012, S. 43.
6 S. 135 in diesem Band.
7 Harold R. Isaacs, Die Tragödie der chinesischen Revolution, Essen 2016.
8 S. 262 in diesem Band.
ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN – Die treibenden Kräfte der Revolution
Vorwort (1919)
Die Frage nach dem Charakter der russischen Revolution war die Hauptfrage, um die sich die verschiedenen ideellen Strömungen und politischen Organisationen in der russischen revolutionären Bewegung gruppierten. In der Sozialdemokratie selbst rief diese Frage, seitdem sie durch den Gang der Ereignisse begonnen hatte, konkrete Gestalt anzunehmen, die größten Meinungsverschiedenheiten hervor. Seit 1904 hatten sich diese Meinungsverschiedenheiten in zwei Grundströmungen niedergeschlagen – im Menschewismus und im Bolschewismus. Der menschewistische Standpunkt ging davon aus, dass unsere Revolution eine bürgerliche sei, d.h. dass ihre natürliche Folge die Übergabe der Macht an die Bourgeoisie sowie die Schaffung von Bedingungen eines bürgerlichen Parlamentarismus sein würde. Der Standpunkt der Bolschewiki erkannte zwar die Unvermeidlichkeit des bürgerlichen Charakters der kommenden Revolution an, sah aber ihre Aufgabe in der Schaffung einer demokratischen Republik durch die Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft.
Die soziale Analyse der Menschewiki zeichnete sich durch außerordentliche Oberflächlichkeit aus und lief im Grunde auf grobe historische Analogien hinaus – die typische Methode des »gebildeten« Kleinbürgertums. Die Hinweise darauf, dass die Entwicklungsbedingungen des russischen Kapitalismus außerordentlich große Gegensätze auf seinen beiden Polen hervorgerufen und eine bürgerliche Demokratie zur Bedeutungslosigkeit verurteilt haben, hielten die Menschewiki nicht davon ab (und auch die Erfahrungen der weiteren Ereignisse vermochten dies nicht), unermüdlich nach einer »echten«, »wahrhaften« Demokratie zu suchen, die an die Spitze der »Nation« zu treten und parlamentarische, nach Möglichkeit demokratische Bedingungen für eine kapitalistische Entwicklung einzuführen hätte. Die Menschewiki versuchten überall und immer, Anzeichen für die Entwicklung einer bürgerlichen Demokratie zu entdecken, und wenn sie keine fanden, dann dachten sie sich welche aus. Sie übertrieben die Bedeutung jeder »demokratischen« Erklärung oder Rede und unterschätzten gleichzeitig die Kraft des Proletariats und die Perspektiven seines Kampfes. Die Menschewiki waren so fanatisch darauf aus, eine führende bürgerliche Demokratie zu finden, damit der »gesetzmäßige« bürgerliche Charakter der russischen Revolution sichergestellt sei, dass sie es während der Revolution, als keine führende bürgerliche Demokratie in Erscheinung trat, selbst mehr oder minder erfolgreich übernahmen, deren Pflichten zu erfüllen. Es ist doch völlig klar, dass eine kleinbürgerliche Demokratie ohne jegliche sozialistische Ideologie, ohne ein marxistisches Studium der Klassenverhältnisse unter den Bedingungen der russischen Revolution auch gar nicht anders vorgehen konnte, als es die Menschewiki als »führende« Partei in der Februarrevolution getan haben. Das Fehlen einer ernstzunehmenden sozialen Grundlage für eine bürgerliche Demokratie erwies sich an den Menschewiki selbst, und zwar darin, dass sie sich sehr rasch überlebten und schon im achten Monat der Revolution vom Fortgang des Klassenkampfes hinweggefegt wurden.
Umgekehrt war der Bolschewismus nicht im Geringsten angesteckt vom Glauben an die Macht und die Kraft einer revolutionären bürgerlichen Demokratie in Russland. Er erkannte von Anfang an die entscheidende Bedeutung der Arbeiterklasse in der kommenden Revolution, aber sein Programm beschränkte er in der ersten Zeit auf die Interessen der Millionen bäuerlicher Massen, ohne – und gegen die – die Revolution vom Proletariat nicht zu Ende geführt werden konnte. Daher die (einstweilige) Anerkennung des bürgerlich-demokratischen Charakters der Revolution.
Nach seiner Einschätzung der inneren Kräfte der Revolution und ihrer Perspektiven gehörte der Autor in jener Periode weder zu der einen noch zu der anderen Hauptrichtung der russischen Arbeiterbewegung. Der Standpunkt, den der Autor damals einnahm, kann in schematischer Weise folgendermaßen formuliert werden: Gemäß ihren nächsten Aufgaben beginnt die Revolution als bürgerliche, bringt dann aber sehr bald mächtige Klassengegensätze zur Entfaltung und gelangt nur zum Sieg, wenn sie die Macht der einzigen Klasse überträgt, die fähig ist, an die Spitze der unterdrückten Massen zu treten – dem Proletariat. Einmal an der Macht, will und kann sich das Proletariat nicht auf den Rahmen eines bürgerlich-demokratischen Programms beschränken. Es kann die Revolution nur dann zu Ende führen, wenn die russische Revolution in eine Revolution des europäischen Proletariats übergeht. Dann wird das bürgerlich-demokratische Programm der Revolution zugleich mit seinem nationalen Rahmen überwunden werden, und die zeitweilige politische Herrschaft der russischen Arbeiterklasse wird sich zu einer dauernden sozialistischen Diktatur weiterentwickeln. Wenn sich aber Europa nicht vom Fleck rührt, dann wird die bürgerliche Konterrevolution die Regierung der werktätigen Massen in Russland nicht dulden und das Land weit zurückwerfen – weit hinter die demokratische Republik der Arbeiter und Bauern. An die Macht gekommen, darf sich das Proletariat daher nicht auf den Rahmen der bürgerlichen Demokratie beschränken, sondern muss die Taktik der permanenten Revolution entfalten, d.h. die Grenzen zwischen dem Minimal- und dem Maximalprogramm der Sozialdemokratie aufheben, zu immer tief greifenderen sozialen Reformen übergehen und einen direkten und unmittelbaren Rückhalt in der Revolution des europäischen Westens suchen. Diese Position soll die jetzt wieder herausgegebene Arbeit, die 1904–1906 geschrieben wurde, entwickeln und begründen.
Der Autor hat anderthalb Jahrzehnte den Standpunkt der permanenten Revolution verteidigt, er erlag aber bei der Einschätzung der miteinander kämpfenden Fraktionen der Sozialdemokratie einem Irrtum. Da sie damals beide von den Perspektiven einer bürgerlichen Revolution ausgingen, nahm der Autor an, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht so tief wären, als dass sie eine Spaltung rechtfertigten. Zur gleichen Zeit hoffte er darauf, dass der weitere Gang der Ereignisse einerseits die Kraftlosigkeit und Ohnmacht der russischen bürgerlichen Demokratie, andererseits die Tatsache, dass es für das Proletariat objektiv unmöglich sei, sich im Rahmen eines demokratischen Programms an der Macht zu halten, allen deutlich zeigen und so den Meinungsverschiedenheiten der Fraktionen den Boden entziehen würde.
Während der Emigration zu keiner der beiden Fraktionen gehörig, unterschätzte der Autor indessen die kardinale Tatsache, dass bei den Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bolschewiki und Menschewiki faktisch auf der einen Seite eine Gruppe unbeugsamer Revolutionäre, und auf der anderen Seite eine Gruppierung von mehr und mehr durch Opportunismus und Prinzipienlosigkeit zersetzten Elementen marschierte. Als die Revolution 1917 ausbrach, stellte die bolschewistische Partei eine starke zentralisierte Organisation dar, die die besten Elemente der fortgeschrittenen Arbeiter und revolutionären Intelligenz in sich aufgenommen hatte und in völliger Übereinstimmung mit der internationalen Lage und den Klassenverhältnissen in Russland – nach kurzem inneren Ringen – ihre Taktik auf eine sozialistische Diktatur der Arbeiterklasse hin ausrichtete. Die menschewistische Fraktion hingegen war zu dieser Zeit erst soweit herangereift, um – wie gesagt – die Aufgaben einer bürgerlichen Demokratie zu erfüllen.
Wenn der Autor jetzt seine Arbeit neu herausgibt, möchte er nicht nur jene prinzipiellen theoretischen Fundamente klarlegen, die es ihm und anderen Genossen, die eine Reihe von Jahren außerhalb der bolschewistischen Partei standen, seit Beginn 1917 erlaubt haben, das eigene Schicksal mit dem ihren zu verknüpfen (eine solche persönliche Erklärung wäre noch kein ausreichendes Motiv für die Wiederauflage des Buches), sondern auch jene sozial-historische Analyse der treibenden Kräfte der russischen Revolution in Erinnerung rufen, nach der die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse als Aufgabe der russischen Revolution angesehen werden konnte und musste – und dies lange bevor die Diktatur des Proletariats zu einer vollendeten Tatsache wurde. Der Umstand, dass wir jetzt eine Arbeit ohne Veränderungen herausgeben können, die 1906 geschrieben wurde und in ihren Grundzügen schon 1904 formuliert worden war, ist ein überzeugender Beweis dafür, dass die marxistische Theorie nicht auf der Seite der menschewistischen Platzhalter einer bürgerlichen Demokratie, sondern auf Seiten der Partei steht, die jetzt tatsächlich die Diktatur der Arbeiterklasse durchführt.
Die letzte Instanz für die Theorie bleibt die Erfahrung. Ein unwiderleglicher Beweis dafür, dass die marxistische Theorie von uns richtig angewandt wird, ist die Tatsache, dass die Ereignisse, an denen wir jetzt teilnehmen, und die Methoden dieser Teilhabe in ihren Grundzügen schon vor anderthalb Jahrzehnten vorausgesehen worden sind.
Im Anhang geben wir einen Artikel »Der Kampf um die Macht« wieder, der in der Pariser Zeitung »Nasche Slowo«[1]vom 17. Oktober 1915 erschienen ist. Der Artikel hat eine polemische Funktion: Er geht aus von der Kritik des programmatischen »Briefes« der Führer des Menschewismus »an die Genossen in Russland« und gelangt zu dem Schluss, dass in dem Jahrzehnt nach der Revolution von 1905 die Entwicklung der Klassenverhältnisse die menschewistischen Hoffnungen auf eine bürgerliche Demokratie noch weiter untergraben und damit das Schicksal der russischen Revolution offenbar noch enger mit der Frage der Diktatur der Arbeiterklasse verbunden haben. – Was muss man für ein Starrkopf sein, wenn man angesichts der ganzen jahrelangen Ideenkämpfe von dem »Abenteurertum« der Oktoberrevolution spricht.
Wenn man vom Verhältnis der Menschewiki zur Revolution spricht, so kann man nicht umhin, die menschewistische Degeneration Kautskys zu erwähnen, die nun in der »Theorie« der Martow, Dan und Zeretelli den Ausdruck seines eigenen theoretischen und politischen Niederganges findet. Nach dem Oktober 1917 hörten wir von Kautsky, dass die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse zwar auch die historische Aufgabe der sozialdemokratischen Partei sei, dass man aber – da die russische Kommunistische Partei nicht durch die Tür und nicht zu der Zeit an die Macht gekommen sei, die in Kautskys Fahrplan vorgesehen waren – die Sowjetrepublik Kerenski, Zeretelli und Tschernow zur Korrektur überlassen solle. Die pedantisch-reaktionäre Kritik Kautskys muss den Genossen umso überraschender erscheinen, die bewusst die Periode der ersten russischen Revolution miterlebt und Kautskys Artikel von 1905–1906 gelesen haben. Damals verstand und erkannte Kautsky (gewiss nicht ohne den wohltätigen Einfluss Rosa Luxemburgs) vollauf, dass die russische Revolution nicht mit einer bürgerlichen demokratischen Republik enden könne, sondern aufgrund des erreichten Niveaus des Klassenkampfes im Innern des Landes und des gesamten internationalen Zustands des Kapitalismus zur Diktatur der Arbeiterklasse führen musste. Kautsky schrieb damals direkt von einer Arbeiterregierung mit sozialdemokratischer Mehrheit. Es fiel ihm nicht ein, den realen Verlauf des Klassenkampfes von zeitlich begrenzten und oberflächlichen Kombinationen der politischen Demokratie abhängig zu machen. Kautsky verstand damals, dass eine Revolution zuerst damit beginnt, Millionenmassen von Bauern und Kleinbürgern zu wecken, und zwar nicht mit einem Mal, sondern allmählich, Schicht um Schicht, dass sich in dem Moment, in dem sich der Kampf zwischen dem Proletariat und der kapitalistischen Bourgeoisie seinem entscheidenden Moment nähert, noch breite bäuerliche Massen auf einem sehr primitiven Niveau der politischen Entwicklung befinden und ihre Stimmen den politischen Parteien der Zwischenschichten geben werden, die nur die Rückständigkeit und die Vorurteile der Bauernschaft widerspiegeln. Kautsky verstand damals, dass das Proletariat, das durch die Logik der Revolution zur Eroberung der Macht gekommen ist, diesen Akt nicht willkürlich auf unbestimmte Zeit verschieben kann – denn mit dieser Selbstverleugnung würde es nur das Feld für die Konterrevolution freimachen. Kautsky verstand damals, dass das Proletariat, wenn es die revolutionäre Macht in der Hand hält, das Schicksal der Revolution nicht von der vorübergehenden Stimmung der jeweils am wenigsten bewussten und aufgeweckten Masse abhängig machen wird, sondern umgekehrt die ganze Staatsgewalt, die sich in seinen Händen konzentriert, in einen machtvollen Apparat der Aufklärung und Organisation dieser rückständigsten, unwissendsten bäuerlichen Massen verwandeln wird. Kautsky verstand, dass die russische Revolution eine bürgerliche zu nennen und ihre Aufgaben hierauf zu beschränken, bedeutet, dass man überhaupt nichts von dem versteht, was in der Welt vorgeht. Er erkannte völlig richtig, zusammen mit den revolutionären Marxisten Russlands und Polens, dass – wenn das russische Proletariat eher die Macht erlangt als das europäische – es seine Stellung als herrschende Klasse nicht für die eilige Übergabe seiner Positionen an die Bourgeoisie, sondern für die machtvolle Unterstützung der proletarischen Revolution in Europa und der ganzen Welt zu benutzen hätte. All diese Weltperspektiven, die durchdrungen sind vom Geiste der marxistischen Lehre, wurden damals weder von Kautsky noch von uns davon abhängig gemacht, wie und für wen die Bauernschaft im November und Dezember 1917 bei den Wahlen zur sogenannten Konstituierenden Versammlung stimmen würde.
Jetzt, wo die Perspektiven, die vor 15 Jahren entworfen wurden, Wirklichkeit geworden sind, verweigert Kautsky der russischen Revolution die Anerkennungsurkunde mit der Begründung, sie sei nicht auf dem politischen Polizeirevier der bürgerlichen Demokratie ausgestellt. Welch erstaunliche Tatsache! Welch unwahrscheinliche Erniedrigung des Marxismus! Man kann mit vollem Recht sagen, dass der Niedergang der Zweiten Internationale in dieser philisterhaften Beurteilung der russischen Revolution durch einen ihrer größten Theoretiker einen noch entsetzlicheren Ausdruck gefunden hat als durch die Zustimmung zu den Kriegskrediten am 4. August.
Jahrzehntelang entwickelte und verteidigte Kautsky die Ideen der sozialen Revolution. Nun, da sie ausgebrochen ist, wendet er sich entsetzt von ihr ab. Er stemmt sich gegen die Sowjetmacht in Russland und nimmt gegen die mächtige Bewegung des kommunistischen Proletariats Deutschlands eine feindselige Haltung ein. Kautsky hat verblüffende Ähnlichkeit mit einem armseligen Schulmeister, der Jahr für Jahr in den vier Wänden seines muffigen Schulraums seinen Schülern immer wieder den Frühling beschreibt und dann, wenn er schließlich einmal am Ende seiner pädagogischen Tätigkeit im Frühling in die Natur hinauskommt, den Frühling nicht erkennt, wütend wird (soweit ein Schulmeister wütend werden kann) und zu beweisen versucht, dass der Frühling gar kein Frühling sei, sondern nur eine große Unordnung in der Natur, denn er verstoße gegen die Gesetze der Naturwissenschaft. Wie gut, dass die Arbeiter nicht diesem mit höchster Autorität ausgestatteten Pedanten vertrauen, sondern der Stimme des Frühlings!
Wir, die Schüler von Marx, bleiben gemeinsam mit den deutschen Arbeitern bei der Überzeugung, dass der Frühling der Revolution in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen der sozialen Natur und zugleich der marxschen Theorie angebrochen ist – denn der Marxismus ist nicht der Zeigestock eines Schulmeisters, der über der Geschichte thront, sondern die soziale Analyse der Wege und Methoden des historischen Prozesses, wie er sich in der Wirklichkeit vollzieht.
Ich habe die Texte der beiden unten abgedruckten Arbeiten – von 1906 und 1915 – nicht verändert. Ursprünglich wollte ich sie durch Anmerkungen ergänzen, die die Darstellung näher an den gegenwärtigen Augenblick heranführen sollten. Aber während ich den Text durchsah, habe ich diesen Plan aufgegeben. Hätte ich in Einzelheiten gehen wollen, so hätte ich mit den Anmerkungen den Umfang des Buches verdoppeln müssen, wozu mir gegenwärtig die Zeit fehlt; außerdem wäre ein solches »Zweietagenbuch« für den Leser unbequem geworden. Aber die Hauptsache ist, glaube ich, dass der Gedankengang in seinen wesentlichen Zügen den gegenwärtigen Zuständen sehr nahe kommt und der Leser, der sich der Mühe unterzieht, dieses Buch aufmerksamer zu studieren, wird die Darstellung mühelos mit den notwendigen Tatsachen aus der Erfahrung der gegenwärtigen Revolution ergänzen.
12. März 1919
L. Trotzki
Kreml
Anmerkungen
1 Unser Wort
ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN
Die treibenden Kräfte der Revolution
Die Revolution in Russland kam allen unerwartet, außer der Sozialdemokratie. Der Marxismus hat die Unvermeidlichkeit der russischen Revolution längst vorausgesagt, die als Folge des Zusammenstoßes der Kräfte der kapitalistischen Entwicklung mit den Kräften des starren Absolutismus kommen musste. Indem er sie als eine bürgerliche bezeichnete, zeigte er damit, dass die unmittelbaren objektiven Aufgaben der Revolution in der Schaffung »normaler« Bedingungen für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit bestanden.
Der Marxismus hatte recht. – Dies kann man heute nicht mehr bestreiten, noch braucht man es zu beweisen. Vor den Marxisten steht eine ganz andere Aufgabe: durch die Analyse der inneren Mechanik der sich entwickelnden Revolution ihre »Möglichkeiten« aufzudecken. Es wäre ein grober Fehler, unsere Revolution einfach mit den Ereignissen der Jahre 1789–1793 oder 1848 gleichzusetzen. Historische Analogien, mit denen sich der Liberalismus am Leben hält, können eine soziale Analyse nicht ersetzen.
Die russische Revolution besitzt einen ganz eigenartigen Charakter, der die Folge der Eigenarten unserer gesamten gesellschaftlich-historischen Entwicklung ist und der seinerseits ganz neue historische Perspektiven eröffnet.
1. Die Besonderheiten der historischen Entwicklung
Vergleichen wir die gesellschaftliche Entwicklung Russlands mit der Entwicklung der europäischen Staaten – indem wir deren gemeinsame Züge zusammenfassen und die Unterschiede zwischen ihrer Geschichte und der Geschichte Russlands herausstellen – so können wir sagen, dass das wesentliche Merkmal der russischen Gesellschaftsentwicklung ihre relative Primitivität und Langsamkeit ist.
Wir wollen hier nicht die natürlichen Ursachen dieser Primitivität behandeln, aber das Faktum selbst halten wir für unbezweifelbar: Die russische Gesellschaft entstand auf einer einfacheren und ärmeren ökonomischen Grundlage.
Der Marxismus lehrt, dass dem sozial-historischen Prozess die Entwicklung der Produktivkräfte zugrunde liegt. Die Bildung ökonomischer Zünfte, Klassen und Stände ist nur dann möglich, wenn diese Entwicklung einen bestimmten Stand erreicht hat. Für die Differenzierung in Stände und Klassen, die von der Entwicklung der Arbeitsteilung und der Herausbildung spezialisierter gesellschaftlicher Funktionen bestimmt wird, ist es notwendig, dass der Teil der Bevölkerung, der unmittelbar in der materiellen Produktion beschäftigt ist, über den eigenen Verbrauch hinaus ein Mehrprodukt, einen Überschuss produziert: Nur durch die entfremdete Aneignung dieses Überschusses können nicht-produktive Klassen entstehen und sich strukturieren. Sodann ist die Arbeitsteilung innerhalb der produktiven Klassen selbst nur bei einem bestimmten Entwicklungsstand der Landwirtschaft denkbar, durch den die Versorgung der nicht-bäuerlichen Bevölkerung mit Agrarprodukten gewährleistet werden kann. Diese grundlegenden Voraussetzungen der sozialen Entwicklung sind bereits von Adam Smith genau formuliert worden.
Daraus folgt – obgleich die Nowgoroder Periode unserer Geschichte mit dem Beginn des europäischen Mittelalters zusammenfällt –, dass die auf naturgeschichtliche Bedingungen (ungünstigere geografische Lage, geringe Bevölkerung) zurückzuführende langsame ökonomische Entwicklung den Prozess der Klassenbildung hemmen und ihm einen primitiveren Charakter geben musste.
Es ist schwer zu sagen, welchen Weg die Geschichte der russischen Gesellschaft genommen hätte, wenn sie isoliert verlaufen und allein von ihren inneren Tendenzen beeinflusst worden wäre. Es genügt, wenn wir festhalten, dass dies nicht der Fall war. Die russische Gesellschaft, die sich auf einer bestimmten inneren ökonomischen Basis ausbildete, stand immer unter dem Einfluss, ja unter dem Druck des äußeren sozial-historischen Milieus.
Im Prozess der Auseinandersetzung dieser ausgebildeten gesellschaftlich-staatlichen Organisation mit den anderen benachbarten spielten auf der einen Seite die Primitivität der ökonomischen Verhältnisse, auf der anderen Seite deren relativ hohe Entwicklungsstufe eine entscheidende Rolle.
Der russische Staat, der sich auf einer primitiven ökonomischen Basis herausgebildet hatte, trat in Beziehung und geriet in Konflikt mit staatlichen Organisationen, die sich auf einer höheren und stabileren ökonomischen Grundlage entwickelt hatten. Hier gab es zwei Möglichkeiten: Entweder musste der russische Staat im Kampf mit ihnen untergehen, wie die Goldene Horde im Kampf mit dem Moskauer Staat untergegangen war – oder der russische Staat musste in seiner Entwicklung die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse überholen und sehr viel mehr lebendige Energien verbrauchen als dies bei isolierter Entwicklung der Fall gewesen wäre. Für den ersten Ausweg war die russische Wirtschaft nicht primitiv genug. Der Staat zerfiel nicht, sondern begann unter einer schrecklichen Anspannung der volkswirtschaftlichen Kräfte zu wachsen.
Das Wesentliche ist somit nicht, dass Russland ringsum von Feinden umgeben war. Das allein genügt nicht. Im Grunde gilt dies für jeden europäischen Staat außer vielleicht für England. Aber in ihrem gegenseitigen Existenzkampf stützten sich diese Staaten auf eine annähernd gleichartige ökonomische Basis, und deshalb war die Entwicklung ihrer Staatlichkeit keinem derart starken äußeren Druck ausgesetzt.
Der Kampf gegen die Krim- und die nogaischen Tataren verlangte die äußerste Kraftanstrengung; selbstverständlich jedoch keine größere als der hundertjährige Kampf Frankreichs mit England. Es waren nicht die Tataren, die das alte Russland zwangen, Feuerwaffen einzuführen und die stehenden Strelitzenregimenter zu schaffen; es waren nicht die Tataren, die es später zwangen, die Reiterei und Soldateninfanterie zu schaffen. Es war der Druck vonseiten Litauens, Polens und Schwedens.
Als Folge dieses von Westeuropa ausgeübten Drucks verschlang der Staat einen unverhältnismäßig großen Teil des Mehrproduktes, d.h. er lebte auf Kosten der gerade formierten privilegierten Klassen und verzögerte damit deren ohnehin langsame Entwicklung. Aber das ist nicht alles. Der Staat stürzte sich auf das »notwendige Produkt« des Bauern, beraubte ihn seiner Existenzmittel, vertrieb ihn damit von dem Boden, auf dem er sich gerade angesiedelt hatte – und hemmte so das Bevölkerungswachstum, bremste die Entwicklung der Produktivkräfte. In dem Maße also, in dem der Staat einen übermäßig großen Teil des Mehrproduktes verschlang, hinderte er die ohnehin langsame Differenzierung der Stände; und in demselben Maße, in dem er noch einen bedeutenden Teil des notwendigen Produktes wegnahm, zerstörte er selbst die primitiven Produktionsgrundlagen, die seine Stütze waren.
Um aber weiterbestehen, funktionieren und sich also vor allem den hierfür notwendigen Teil des gesellschaftlichen Produkts aneignen zu können, brauchte der Staat eine ständisch-hierarchische Organisation. Daher trachtete er, während er die ökonomischen Grundlagen ihres Wachstums untergrub, zugleich danach, ihre Entwicklung durch staatliche Ordnungsmaßnahmen zu forcieren und versuchte – wie jeder andere Staat –, den Formationsprozess der Stände in seinem Sinn zu lenken. Ein russischer Kulturhistoriker, Herr Miljukow,[2] sieht darin einen direkten Gegensatz zur Geschichte des Westens. Einen Gegensatz gibt es hier jedoch nicht.
Die ständische Monarchie des Mittelalters, die sich zu einem bürokratischen Absolutismus weiterentwickelte, stellte eine Staatsform dar, in der bestimmte soziale Interessen und Beziehungen verankert waren. Diese Staatsform entwickelte aber, nachdem sie sich einmal herausgebildet und etabliert hatte, ihre eigenen Interessen (dynastische, höfische, bürokratische …), die nicht nur mit den Interessen der niederen, sondern selbst mit denen der höheren Stände in Konflikt gerieten. Die herrschenden Stände, die eine sozial unerlässliche »Trennwand« zwischen der Masse der Bevölkerung und der staatlichen Organisation bildeten, übten auf letztere Druck aus und machten die eigenen Interessen zum Inhalt ihrer staatlichen Praxis. Zugleich aber vertrat die Staatsgewalt ihren eigenen Standpunkt auch gegenüber den Interessen der höheren Stände. Als eine unabhängige Macht entwickelte sie Widerstand gegen deren Ansprüche und versuchte, sie sich unterzuordnen. Die tatsächliche Geschichte der Beziehungen zwischen Staat und Ständen verlief in der Richtung einer Resultante, die von dieser Kräftekonstellation bestimmt wurde. Ein im Wesentlichen ähnlicher Prozess vollzog sich auch im alten Russland.
Der Staat versuchte, die sich entwickelnden ökonomischen Gruppen auszunutzen und sie seinen speziellen finanziellen und militärischen Interessen unterzuordnen. Die entstehenden ökonomisch herrschenden Gruppen versuchten, den Staat dafür zu benutzen, ihre Vorrechte in Form von Standesprivilegien zu sichern. In diesem sozialen Kräftespiel kam der Macht des Staates ein weit stärkeres Gewicht zu als in der Geschichte Westeuropas.
Dieser Austausch von gegenseitigen Hilfeleistungen zwischen dem Staat und den oberen gesellschaftlichen Gruppen, der seinen Ausdruck in der Verteilung von Rechten und Pflichten, von Lasten und Privilegien findet, geschieht auf Kosten des werktätigen Volkes.
Bei uns gestaltete er sich für Adel und Klerus weniger vorteilhaft als in den mittelalterlichen ständischen Monarchien Westeuropas. Dies ist unbestreitbar. Und dennoch ist es eine schreckliche Übertreibung, eine Verletzung jeglicher Perspektive, zu sagen, dass zu der Zeit, als im Westen die Stände den Staat schufen, die Staatsgewalt bei uns aus ihrem eigenen Interesse die Stände geschaffen hätte (Miljukow).
Stände lassen sich nicht auf staatlich-juristischem Wege schaffen. Bevor sich die eine oder andere gesellschaftliche Gruppe mithilfe der Staatsgewalt zu einem privilegierten Stand entwickeln kann, muss sie sich ökonomisch mit all ihren sozialen Vorrechten herausgebildet haben. Stände können nicht nach einer vorher geschaffenen Rangordnung oder nach dem Kodex der Légion d’honneur fabriziert werden. Die Staatsgewalt kann lediglich mit all ihren Mitteln diesem elementaren ökonomischen Prozess zu Hilfe kommen, der die höheren ökonomischen Formationen hervorbringt. Wie wir gezeigt haben, verbrauchte der russische Staat verhältnismäßig viele Kräfte und hemmte dadurch den sozialen Kristallisationsprozess, dessen er doch selber bedurfte. Es ist deshalb natürlich, dass er unter dem Einfluss und dem Druck der differenzierteren westlichen Umwelt (einem Druck, der über die militärstaatliche Organisation vermittelt wurde) seinerseits die soziale Differenzierung auf einer primitiven ökonomischen Grundlage zu forcieren suchte. Weiter: Da das Bedürfnis zur Beschleunigung dieses Prozesses durch die Schwäche der sozial-ökonomischen Entwicklung hervorgerufen war, ist es natürlich, wenn der Staat in seinen fürsorglichen Anstrengungen danach strebte, sein Machtübergewicht dazu zu benutzen, eben diese Entwicklung der Oberklassen seinem eigenen Gutdünken entsprechend zu lenken. Aber als der Staat in dieser Richtung größere Erfolge erlangen wollte, stieß er in erster Linie auf seine eigene Schwäche, auf den primitiven Charakter seiner eigenen Organisation, und dieser war, wie wir schon wissen, durch die Primitivität der Sozialstruktur bestimmt.
So wurde der auf der Grundlage der russischen Wirtschaft errichtete russische Staat durch den freundlichen und mehr noch den feindlichen Druck der benachbarten Staatsorganisationen vorwärtsgetrieben, die auf einer weiterentwickelten ökonomischen Basis entstanden waren. Von einem bestimmten Zeitpunkt an – besonders seit dem Ende des 17. Jahrhunderts – trachtet der Staat danach, mit allen Kräften die natürliche ökonomische Entwicklung zu beschleunigen. Neue Zweige des Handwerks, Maschinen und Fabriken, Großproduktion und Kapital scheinen sozusagen künstliche Aufpfropfungen auf den natürlichen wirtschaftlichen Stamm zu sein. Der Kapitalismus erscheint als ein Kind des Staates.
Von diesem Standpunkt aus kann man allerdings auch sagen, die ganze russische Wissenschaft sei ein künstliches Produkt staatlicher Bemühungen, sei künstlich auf den natürlichen Stamm nationaler Unwissenheit aufgesetzt.[3]
Das russische Denken entwickelte sich wie die russische Ökonomie unter dem unmittelbaren Druck des weiter fortgeschrittenen Denkens und der weiterentwickelten Wirtschaft des Westens. Da infolge des naturalwirtschaftlichen Charakters der Ökonomie, d.h. der geringen Entwicklung des Außenhandels, die Beziehungen zu anderen Ländern vornehmlich staatlichen Charakter trugen, drückte sich der Einfluss dieser Länder, noch bevor er die Form unmittelbarer wirtschaftlicher Konkurrenz annehmen konnte, in einem verschärften Kampf um die staatliche Existenz aus. Die westliche Ökonomie beeinflusste die russische über die Vermittlung des Staates. Um inmitten feindlicher und besser bewaffneter Staaten überleben zu können, war Russland gezwungen, Fabriken, Schifffahrtsschulen, Lehrbücher über den Bau von Befestigungsanlagen usw. einzuführen. Hätte sich aber die allgemeine Bewegung der Binnenwirtschaft des riesigen Landes nicht in dieser Richtung vollzogen, hätte die Entwicklung dieser Wirtschaft nicht ein Bedürfnis nach Anwendung und Verallgemeinerung der Kenntnisse erzeugt, so wären alle Bemühungen des Staates fruchtlos geblieben: Die nationale Ökonomie, die sich in natürlicher Weise von der Naturalwirtschaft zu einer Geld-Waren-Wirtschaft entwickelte, reagierte nur auf solche Maßnahmen der Regierung, die dieser Entwicklung entsprachen, und nur in dem Maße, in dem sie mit ihr übereinstimmten. Die Geschichte der russischen Fabrik, des russischen Währungssystems und des Staatskredits ist ein schlagender Beweis für die oben dargelegte Auffassung.
»Die meisten Industriezweige (Metall, Zucker, Erdöl, Branntwein und sogar Faserstoffe)«, schreibt Professor Mendelejew, »entstanden direkt unter der Einwirkung von Regierungsmaßnahmen, zuweilen auch mithilfe hoher Regierungssubventionen, aber besonders auch deshalb, weil die Regierung anscheinend zu allen Zeiten eine bewusste protektionistische Politik verfolgte und unter der Herrschaft Zar Alexander III. diese ganz offen auf ihre Fahne schrieb … Die oberste Regierung, die sich mit vollem Bewusstsein an die Grundsätze des Protektionismus für Russland hielt, war allen unseren gebildeten Klassen zusammengenommen voraus.«[4] Der gelehrte Panegyriker des Industrieprotektionismus vergisst hinzuzufügen, dass die Regierungspolitik nicht von der Sorge um die Entwicklung der Produktivkräfte diktiert wurde, sondern von rein fiskalischen und zum Teil militärtechnischen Erwägungen. Aus diesem Grunde widersprach die Schutzzollpolitik nicht selten nicht nur den fundamentalen Interessen der industriellen Entwicklung, sondern auch den privaten Interessen einzelner Unternehmergruppen. So erklärten die Baumwollfabrikanten offen, dass »die hohen Baumwollzölle heutzutage nicht zur Förderung des Baumwollanbaus, sondern allein aus fiskalischem Interesse aufrechterhalten werden«. So wie die Regierung bei der »Schaffung« von Ständen vor allem die Abgaben an den Staat im Auge hatte, so richtete sie auch bei der »Ansiedlung« der Industrie ihre Hauptsorge auf die Erfordernisse des Staatsfiskus. Zweifellos jedoch spielte die Autokratie keine geringe Rolle bei der Verpflanzung der industriellen Produktion auf russischen Boden.
Zu der Zeit, als die sich entwickelnde bürgerliche Gesellschaft ein Bedürfnis nach den politischen Institutionen des Westens zu verspüren begann, war die Autokratie mit der ganzen materiellen Gewalt der europäischen Staaten ausgerüstet. Sie stützte sich auf einen zentralisierten bürokratischen Apparat, der für die Regelung neuer Verhältnisse völlig unbrauchbar, dafür aber in der Lage war, große Energie für systematische Repressionsmaßnahmen freizusetzen. Die ungeheuren Entfernungen des Landes waren mit dem Telegrafen überwunden worden, der den Aktionen der Verwaltung Sicherheit, relative Einheitlichkeit und Schnelligkeit (bei Unterdrückungsmaßnahmen) verlieh; die Eisenbahnen erlaubten es, Militärtruppen in kurzer Zeit vom einen Ende des Landes zum anderen zu verlegen. Die vorrevolutionären Regierungen Europas kannten Eisenbahnen und Telegrafen kaum. Die dem Absolutismus zu Gebote stehende Armee war riesig – und wenn sie sich auch in den ersten Prüfungen des russisch-japanischen Krieges als untauglich erwiesen hat, so war sie doch gut genug für die Herrschaft im Innern. Nicht nur die Regierung des alten Frankreich, sondern auch die Regierung von 1848 kannte nichts, was der gegenwärtigen russischen Armee gleichgekommen wäre.
Während die Regierung mithilfe des fiskalisch-militärischen Apparats das Land aufs Äußerste ausbeutete, erhöhte sie ihr jährliches Budget bis auf die Riesensumme von 2 Mrd. Rubel. Gestützt auf Heer und Budget, machte die autokratische Regierung die europäische Börse zu ihrem Schatzamt und den russischen Steuerzahler zum hoffnungslosen Tributpflichtigen dieser Börse.
So stellte sich die Regierung Russlands in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts der Welt als eine riesenhafte militärbürokratische Steuer- und Börsenorganisation von unerschütterlicher Macht dar.
Die finanzielle und militärische Macht des Absolutismus bedrückte und blendete nicht nur die europäische Bourgeoisie, sondern auch den russischen Liberalismus und nahm ihm jeglichen Glauben an die Möglichkeit einer offenen Auseinandersetzung mit dem Absolutismus. Die militärische und finanzielle Macht des Absolutismus schloss, so schien es, jede Möglichkeit einer russischen Revolution aus.
In Wirklichkeit traf das genaue Gegenteil ein.
Je zentralisierter ein Staat und je unabhängiger er von der Gesellschaft ist, desto eher verwandelt er sich zu einer autonomen Organisation, die über der Gesellschaft steht. Je größer die militärischen und finanziellen Kräfte einer solchen Organisation sind, desto länger und erfolgreicher kann sie um ihre Existenz kämpfen. Der zentralistische Staat mit seinem 2-Mrd.-Budget, seinen 8-Mrd.-Schulden und den bewaffneten Millionen seiner Armee konnte sich auch noch halten, als er schon längst aufgehört hatte, die elementarsten Bedürfnisse der gesellschaftlichen Entwicklung zu befriedigen – nicht allein das Bedürfnis nach einer inneren Verwaltung, sondern selbst das Bedürfnis nach militärischer Sicherheit, die zu gewähren er ursprünglich geschaffen war.
Je länger dieser Zustand anhielt, desto größer wurde der Widerspruch zwischen den Forderungen des wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts und der Regierungspolitik, die ihre eigene »milliardenfache« Trägheit entwickelt hatte. Nachdem sie die Epoche der großen Flickreformen – die diesen Widerspruch nicht nur nicht beseitigten, sondern ihn im Gegenteil erstmals deutlich enthüllten – hinter sich gebracht hatte, wurde es für die Regierung objektiv immer schwieriger und psychologisch immer weniger möglich, von selbst den Weg zum Parlamentarismus einzuschlagen. Der einzige Ausweg aus dem Widerspruch, der sich der Gesellschaft in dieser Situation anbot, bestand darin, in dem eisernen Kessel des Absolutismus genügend revolutionären Dampf anzusammeln, um ihn zu sprengen.
So schloss die administrative, militärische und finanzielle Macht des Absolutismus, die ihm die Möglichkeit gegeben hatte, sich im Widerspruch zur gesellschaftlichen Entwicklung zu behaupten, nicht nur die Möglichkeit einer Revolution nicht aus, wie der Liberalismus dachte, sondern sie machte die Revolution im Gegenteil zum einzigen Ausweg – dabei war der Revolution ein umso radikalerer Charakter sicher, je mehr die Macht des Absolutismus den Abgrund zwischen sich und der Nation vertiefte.
Der russische Marxismus kann mit Recht stolz darauf sein, dass er allein die Richtung dieser Entwicklung aufgezeigt und ihre allgemeinen Formen[5] zu einer Zeit vorhergesagt hat, da der Liberalismus sich von dem utopischen »Praktizismus« nährte und die revolutionäre Bewegung der Volkstümler von Phantasmagorien und Wunderglauben lebte.
Die gesamte zurückliegende soziale Entwicklung machte die Revolution unvermeidlich. Welches aber waren die Kräfte dieser Revolution?
Anmerkungen
2 P. Miljukow, Skizzen zur Geschichte der russischen Kultur, St. Petersburg 1896.
3 Es genügt, sich die charakteristischen Merkmale der ursprünglichen Beziehung von Staat und Schule zu vergegenwärtigen, um festzustellen, dass die Schule ein zumindest ebenso »künstliches« Produkt des Staates gewesen ist wie die Fabrik. – Die Bildungsbemühungen des Staates illustrieren diese »Künstlichkeit«. Nicht erscheinende Schüler wurden in Ketten gelegt; die ganze Schule lag in Ketten. Unterricht war Dienst. Den Schülern wurden Gehälter gezahlt usw. usw.
4 D. Mendelejew, Zum Verständnis Russlands, St. Petersburg 1906, S. 84.
5 Selbst ein so reaktionärer Bürokrat wie Prof. Mendelejew kann nicht umhin, dies zuzugeben. In seiner Schilderung der industriellen Entwicklung bemerkt er: »Die Sozialisten erkannten hier etwas und verstanden es sogar zum Teil, aber ihrem Lateinertum (!) folgend, gingen sie in die Irre, indem sie empfahlen, zur Gewalt zu greifen, den tierischen Instinkten des Pöbels freien Lauf ließen und nach Umstürzen und Macht strebten.« (Zum Verständnis Russlands, S. 120).
2. Stadt und Kapital
Die städtische Entwicklung in Russland ist ein Produkt der neuesten Geschichte, genauer – der letzten Jahrzehnte. Gegen Ende der Herrschaft Peters I., im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts, betrug die städtische Bevölkerung etwas mehr als 328000 Menschen, etwa 3 v.H. der Bevölkerung des Landes. Gegen Ende desselben Jahrhunderts betrug sie 1301000, etwa 4,1 v.H. der Gesamtbevölkerung. 1812 war die städtische Bevölkerung auf 1653000 angewachsen, das waren 4,4 v.H. Mitte des 19. Jahrhunderts zählten die Städte noch immer erst 3482000, – 7,8 v.H. Nach der letzten Volkszählung (1897) schließlich ist nun eine Bevölkerungszahl der Städte von 16289000 ermittelt worden, was ungefähr 13 v.H. der Gesamtbevölkerung ausmacht.[6]
Betrachten wir die Stadt nicht nur als eine Verwaltungseinheit, sondern als eine sozial-ökonomische Formation, so müssen wir zugeben, dass die genannten Zahlen kein wirkliches Bild der Entwicklung der Städte geben: Die russische Staatspraxis kennt massenhafte Verleihungen von Stadtrechten wie auch massenhafte Aberkennungen dieser Privilegien, ohne dass hierbei wissenschaftliche Erwägungen irgendeine Rolle gespielt haben. Trotzdem gehen aus den Zahlen sowohl die Bedeutungslosigkeit der Städte im Russland vor den Reformen hervor wie auch ihr fieberhaft schnelles Wachsen während der letzten Jahrzehnte. Nach den Berechnungen von Herrn Michailowski betrug das Wachstum der Stadtbevölkerung zwischen 1885 und 1887 33,8 v.H., d.h. es war mehr als doppelt so groß wie das allgemeine Bevölkerungswachstum Russlands (15,25 v.H.) und fast dreimal so groß wie der Zuwachs der Landbevölkerung (12,7 v.H.). Wenn wir die Dörfer und Kleinstädte mit Industrie hinzunehmen, so zeigt sich das rasche Zunehmen der städtischen (nichtlandwirtschaftlichen) Bevölkerung noch deutlicher.
Aber die modernen russischen Städte unterscheiden sich von den alten nicht nur ihrer Einwohnerzahl, sondern auch ihrem sozialen Charakter nach: Sie sind Zentren von Industrie und Handel. Die Mehrzahl unserer alten Städte spielte fast gar keine wirtschaftliche Rolle; sie waren militärisch administrative Punkte oder Festungen, ihre Bevölkerung war dienstpflichtig und wurde von der Staatskasse unterhalten. Im Allgemeinen war die Stadt das Zentrum der Verwaltung, des Militärs und der Steuererhebung.
Siedelte sich die nicht dienstpflichtige Bevölkerung im Weichbild der Stadt oder in ihrer Nähe an, um vor Feinden Schutz zu suchen, so hinderte sie das nicht im Mindesten daran, sich wie früher mit dem Ackerbau zu befassen. Selbst Moskau, die größte Stadt des alten Russland, war nach den Ausführungen Herrn Miljukows lediglich »ein Zarensitz, dessen Bewohner zu einem beachtlichen Teil auf diese oder jene Art mit dem Hof verbunden waren, entweder als Gefolge, als Garde oder als Gesinde. Von mehr als 16000 Haushalten, die nach dem Zensus von 1701 in Moskau gezählt wurden, waren nicht mehr als 7000 (44 v.H.) Händler und Handwerker, und selbst diese lebten in der Nähe des Hofes und arbeiteten für seinen Bedarf. Die übrigen 9000 Haushaltungen gehörten zum Klerus (1500) und dem herrschenden Stand.« Mithin spielte die russische Stadt, ähnlich wie die Städte der asiatischen Despotien und im Unterschied zu den Handwerks- und Handelsstädten des Mittelalters, eine reine konsumtive