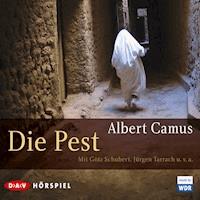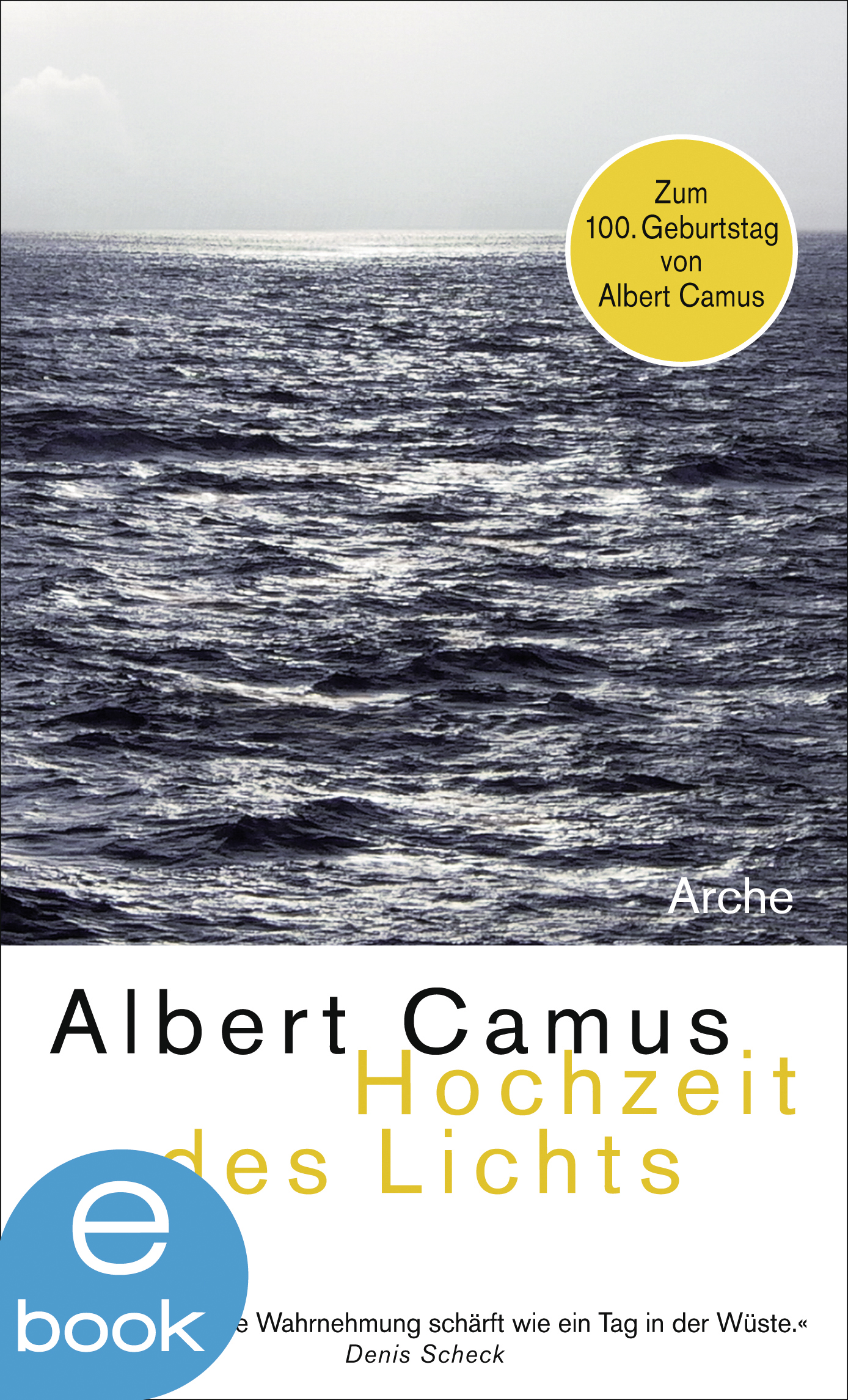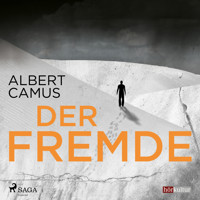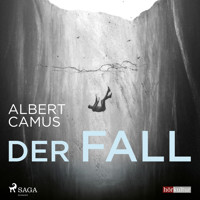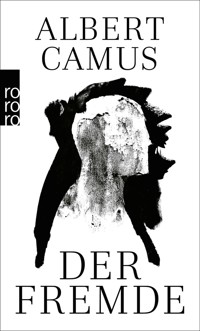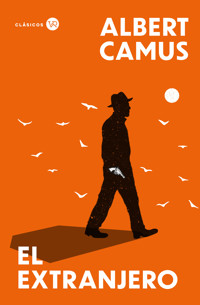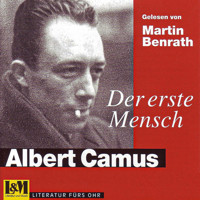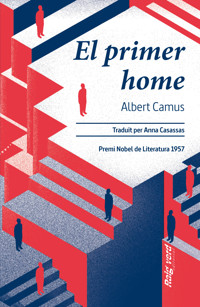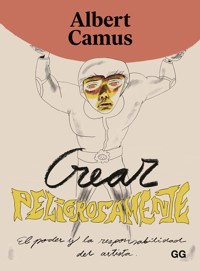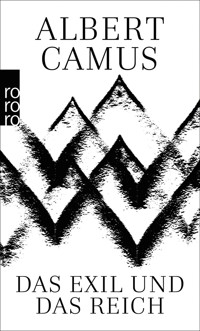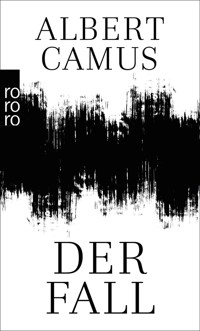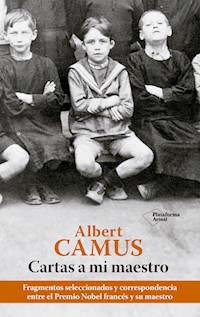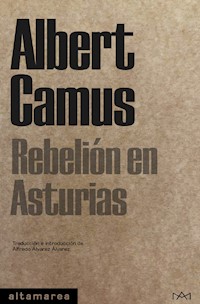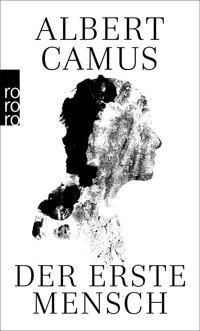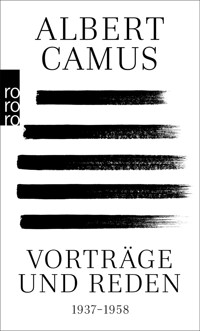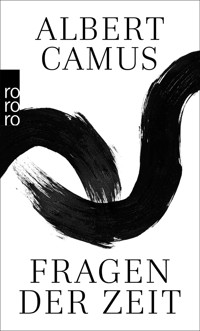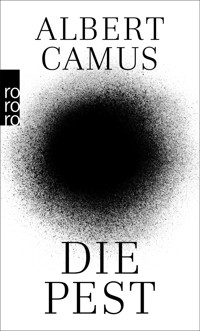
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber, und bald ist es nicht mehr zu leugnen: Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich. «Sie gingen weiter ihren Geschäften nach, bereiteten Reisen vor, bildeten sich Meinungen. Wie hätten sie einen Gedanken an die Pest verschwenden sollen, die jede Zukunft unmöglich macht, Reisen storniert, den Austausch von Meinungen zum Schweigen bringt?» Es sind Passagen wie diese, die Camus' Klassiker zu neuer Wucht verhelfen, die ihn auch für die heutige Zeit unverzichtbar machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Albert Camus
Die Pest
Roman
Über dieses Buch
Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber, und bald ist es nicht mehr zu leugnen: Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich. «Sie gingen weiter ihren Geschäften nach, bereiteten Reisen vor, bildeten sich Meinungen. Wie hätten sie einen Gedanken an die Pest verschwenden sollen, die jede Zukunft unmöglich macht, Reisen storniert, den Austausch von Meinungen zum Schweigen bringt?» Es sind Passagen wie diese, die Camus' Klassiker zu neuer Wucht verhelfen und ihn auch für die heutige Zeit unverzichtbar machen.
«Camus irrt sich nicht in seinem Roman. Das Drama sind nicht die, die durch die Hintertür zum Friedhof entwischen – und für die die Angst vor der Pest endlich vorbei war -, sondern die Lebenden, die in ihren stickigen Schlafzimmern Blut schwitzten, ohne der belagerten Stadt entfliehen zu können.» (Gabriel García Márquez)
Enthält erstmals auf Deutsch Camus' frühen Text «Anweisung an die Pestärzte».
Vita
Albert Camus wurde am 7. November 1913 in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Von 1933 bis 1936 studierte er an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama «Caligula», das 1945 uraufgeführt wurde. Camus zog 1940 nach Paris. Neben seinen Dramen begründeten der Roman «Der Fremde» und der Essay «Der Mythos von Sisyphos» sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall.
Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Der Übersetzung liegt die 1962 in der «Bibliothèque de la Pléiade» erschienene Fassung zugrunde.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021
Copyright der Neuübersetzung © 1997 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«La Peste» Copyright © 1947, 1962 by Éditions Gallimard, Paris
«Exhortation aux médecins de la peste» Copyright © «Les Cahiers de la Pléiade» 1947 Œuvres Compètes, II. Éditions Gallimard 2006
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tuomas Lehtinen/Getty Images
ISBN 978-3-644-00983-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Es ist ebenso vernünftig, eine Art Gefangenschaft durch eine andere darzustellen, wie irgendetwas, was wirklich existiert, durch etwas, was nicht existiert.
DANIEL DEFOE
I
Die seltsamen Ereignisse, die Gegenstand dieser Chronik sind, haben sich 194’ in Oran zugetragen. Nach allgemeiner Ansicht passten sie nicht dorthin, da sie etwas aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fielen. Auf den ersten Blick ist Oran nämlich eine gewöhnliche Stadt und nichts weiter als eine französische Präfektur an der algerischen Küste.
Die Stadt selbst ist, wie man zugeben muss, hässlich. Sie wirkt ruhig, und man braucht einige Zeit, um das wahrzunehmen, was sie von so vielen anderen Handelsstädten in allen Breiten unterscheidet. Wie soll man auch das Bild einer Stadt ohne Tauben, ohne Bäume und Gärten vermitteln, wo einem weder Flügelschlagen noch Blätterrauschen begegnen, mit einem Wort, einen neutralen Ort? Der Wechsel der Jahreszeiten lässt sich einzig am Himmel ablesen. Der Frühling kündet sich nur durch die Eigenart der Luft an oder durch die Blumenkörbe, die kleine Verkäufer aus den Vororten mitbringen; es ist ein Frühling, der auf den Märkten verkauft wird. Im Sommer steckt die Sonne die ausgetrockneten Häuser in Brand und bedeckt die Mauern mit grauer Asche; dann kann man nur noch im Dunkel hinter geschlossenen Läden leben. Der Herbst dagegen ist eine einzige Schlammflut. Die schönen Tage kommen erst im Winter.
Eine praktische Art, eine Stadt kennenzulernen, besteht darin, sich anzusehen, wie in ihr gearbeitet, wie in ihr geliebt und wie in ihr gestorben wird. In unserer kleinen Stadt – womöglich liegt es am Klima – macht man dies alles gleichzeitig, auf ein und dieselbe hektische und abwesende Weise. Das heißt, man langweilt sich hier und ist bemüht, Gewohnheiten anzunehmen. Unsere Mitbürger arbeiten viel, aber immer nur, um reich zu werden. Sie interessieren sich hauptsächlich für den Handel und befassen sich in erster Linie damit, was sie Geschäftemachen nennen. Natürlich haben sie auch Geschmack an den einfachen Freuden, sie lieben die Frauen, das Kino und das Baden im Meer. Aber vernünftigerweise behalten sie diese Vergnügungen dem Samstagabend und dem Sonntag vor und versuchen an den anderen Wochentagen viel Geld zu verdienen. Wenn sie am Abend aus ihren Büros und Geschäften kommen, treffen sie sich immer zur selben Zeit in den Cafés, gehen auf demselben Boulevard spazieren oder setzen sich auf ihren Balkon. Die Gelüste der Jüngeren sind heftig und kurz, während die Laster der Älteren nicht über die Zusammenkünfte besessener Boulespieler, Vereinsbankette und Clubs, in denen um hohe Einsätze Karten gespielt wird, hinausgehen.
Man wird wahrscheinlich sagen, dass das nicht nur für unsere Stadt charakteristisch ist und dass genaugenommen alle unsere Zeitgenossen so sind. Wahrscheinlich, heute ist ja nichts normaler, als Leute von morgens bis abends arbeiten zu sehen, die sich dann entscheiden, beim Kartenspiel, im Café und mit Geschwätz die Zeit zu vergeuden, die ihnen zum Leben bleibt. Aber es gibt Städte und Länder, wo die Leute hin und wieder eine Ahnung von etwas anderem haben. Im Allgemeinen ändert das ihr Leben nicht. Doch die Ahnung war da, und das ist immerhin etwas. Oran dagegen ist anscheinend eine Stadt ohne Ahnungen, das heißt eine ganz moderne Stadt. Es ist folglich unnötig zu erläutern, wie man sich bei uns liebt. Entweder verschlingen Männer und Frauen einander schnell im sogenannten Liebesakt, oder sie lassen sich auf eine lange Gewohnheit zu zweit ein. Zwischen diesen Extremen gibt es oft keinen Übergang. Auch das ist nicht originell. In Oran ist man wie anderswo aus Zeitmangel und Gedankenlosigkeit einfach gezwungen, sich zu lieben, ohne es zu merken.
Origineller an unserer Stadt ist die Schwierigkeit, der man hier beim Sterben begegnen kann. Schwierigkeit ist übrigens nicht das passende Wort, es wäre richtiger, von Ungemütlichkeit zu sprechen. Es ist nie angenehm, krank zu sein, aber es gibt Städte und Länder, die einem in der Krankheit beistehen, wo man sich in gewisser Weise gehenlassen kann. Ein Kranker braucht Sanftheit, er stützt sich gern auf etwas, das ist ganz normal. Aber die extremen klimatischen Bedingungen in Oran, die Wichtigkeit der Geschäfte, die hier betrieben werden, das Unansehnliche der Umwelt, die schnell hereinfallende Dämmerung und die besonderen Vergnügungen – all das erfordert eine gute Gesundheit. Ein Kranker ist hier sehr allein. Nun denke man erst an einen Sterbenden, hinter Hunderten von vor Hitze knisternden Mauern in die Falle geraten, während in derselben Minute eine ganze Bevölkerung am Telefon oder in den Cafés über Wechsel, Konnossemente und Skonto spricht. Man wird verstehen, wie ungemütlich hier der Tod, selbst der moderne, sein kann, wenn er in dieser Weise an einem gefühllosen Ort eintritt.
Diese paar Angaben vermitteln vielleicht eine hinlängliche Vorstellung von unserem Gemeinwesen. Im Übrigen soll man nichts übertreiben. Hervorgehoben werden musste die banale Seite der Stadt und des Lebens. Doch sobald man Gewohnheiten angenommen hat, verbringt man seine Tage mühelos. Da unsere Stadt Gewohnheiten fördert, kann man sagen, dass alles bestens ist. So gesehen ist das Leben wahrscheinlich nicht sehr aufregend. Zumindest kennt man bei uns keine Unordnung. Und unsere offenherzige, sympathische und aktive Bevölkerung hat bei Reisenden immer die gebührende Achtung hervorgerufen. Diese Stadt ohne Pittoreskes, ohne Vegetation und ohne Seele wirkt am Ende geruhsam, man schläft hier schließlich ein. Aber es ist angebracht hinzuzufügen, dass sie sich in einer unvergleichlichen Landschaft angesiedelt hat, mitten auf einer von leuchtenden Hügeln umgebenen kahlen Hochebene, an einer vollendet gezeichneten Bucht. Man kann nur bedauern, dass sie mit dem Rücken zu dieser Bucht erbaut wurde und es von daher unmöglich ist, das Meer zu sehen, das man immer suchen gehen muss.
Nach alldem wird man unschwer einräumen, dass nichts unsere Mitbürger die Vorkommnisse erwarten lassen konnte, die sich im Frühling jenes Jahres zutrugen und die, wie wir später begriffen, gleichsam die ersten Anzeichen der Serie von schlimmen Ereignissen waren, über die hier berichtet werden soll. Diese Tatsachen werden manchen ganz normal erscheinen und anderen wiederum unwahrscheinlich. Aber schließlich kann ein Berichterstatter diese Widersprüche nicht berücksichtigen. Er hat nur die Aufgabe zu sagen: «Das ist geschehen», wenn er weiß, dass dies tatsächlich geschehen ist, dass dies das Leben eines ganzen Volkes betroffen hat und es also Tausende von Zeugen gibt, die in ihrem Herzen die Wahrheit dessen, was er sagt, bewerten werden.
Außerdem hätte der Erzähler, den man noch rechtzeitig kennenlernen wird, kaum ein Recht auf ein solches Vorhaben, wenn der Zufall ihn nicht in den Stand versetzt hätte, eine gewisse Zahl von Aussagen zu sammeln, und wenn er nicht zwangsläufig in alles verwickelt gewesen wäre, wovon er zu berichten vorhat. Das berechtigt ihn dazu, sich als Geschichtsschreiber zu betätigen. Natürlich hat ein Geschichtsschreiber, selbst wenn er Amateur ist, immer Dokumente. Der Erzähler dieser Geschichte hat also die seinen: zunächst einmal sein Zeugnis, dann das der anderen, da seine Rolle dazu führte, dass er die vertraulichen Mitteilungen aller Personen in dieser Chronik sammelte, und zu guter Letzt die Texte, die ihm am Ende in die Hände fielen. Er beabsichtigt, auf sie zurückzugreifen, wenn er es für gut hält, und sie nach seinem Belieben zu benutzen. Er beabsichtigt weiter … Aber vielleicht ist es an der Zeit, mit den Kommentaren und Kautelen aufzuhören und zum Bericht selbst zu kommen. Die Schilderung der ersten Tage erfordert einige Genauigkeit.
Am Morgen des 16. April trat Doktor Bernard Rieux aus seiner Praxis und stolperte mitten auf dem Treppenabsatz über eine tote Ratte. Vorerst schob er das Tier beiseite, ohne es zu beachten, und ging die Treppe hinunter. Aber auf der Straße kam ihm der Gedanke, dass diese Ratte dort nicht hingehörte, und er machte kehrt, um den Concierge zu informieren. Angesichts der Reaktion des alten Monsieur Michel wurde ihm klarer, wie ungewöhnlich seine Entdeckung war. Das Vorhandensein dieser toten Ratte war ihm nur sonderbar vorgekommen, wohingegen es für den Concierge einen Skandal darstellte. Dessen Standpunkt war kategorisch: Es gab keine Ratten im Haus. Der Arzt mochte ihm noch so nachdrücklich versichern, dass auf dem Treppenabsatz im ersten Stock eine sei, und vermutlich eine tote, Monsieur Michels Überzeugung blieb unangetastet. Es gebe keine Ratten im Haus, diese müsse folglich von außen hereingebracht worden sein. Kurz, es handle sich um einen Streich.
Am selben Abend stand Bernard Rieux im Flur des Hauses und suchte seine Schlüssel, ehe er zu seiner Wohnung hinaufging, als er aus dem dunklen Hintergrund des Korridors eine unsicher laufende dicke Ratte mit nassem Fell auftauchen sah. Das Tier blieb stehen, schien das Gleichgewicht zu suchen, lief auf den Arzt zu, blieb wieder stehen, drehte sich mit einem kurzen Fiepen um sich selbst und fiel schließlich um, wobei sein Blut aus den halb geöffneten Lefzen spritzte. Der Arzt betrachtete es eine Weile und ging in seine Wohnung hinauf.
Er dachte nicht an die Ratte. Das verspritzte Blut brachte ihn wieder auf seine Sorgen. Seine Frau, die seit einem Jahr krank war, sollte am nächsten Tag in einen Kurort in den Bergen abreisen. Er fand sie in ihrem Zimmer im Bett liegend, wie er es von ihr erbeten hatte. So bereitete sie sich auf die Strapazen der Fahrt vor. Sie lächelte.
«Ich fühle mich sehr gut», sagte sie.
Der Arzt sah das Gesicht an, das ihm im Licht der Nachttischlampe zugewandt war. Für Rieux war dieses dreißigjährige Gesicht trotz der Spuren der Krankheit noch immer das Gesicht der Jugend, vielleicht wegen dieses Lächelns, das über alles Übrige triumphierte.
«Schlaf, wenn du kannst», sagte er. «Die Pflegerin kommt um elf, und ich bringe euch zum Mittagszug.»
Er küsste eine leicht feuchte Stirn. Das Lächeln begleitete ihn bis zur Tür.
Am nächsten Tag, dem 17. April, um acht Uhr, hielt der Concierge den vorbeikommenden Arzt an und beschuldigte geschmacklose Spaßmacher, drei tote Ratten mitten in den Flur gelegt zu haben. Sie mussten mit großen Fallen gefangen worden sein, denn sie waren voller Blut. Der Concierge war, die Ratten an den Pfötchen haltend, eine Zeitlang in der Tür stehen geblieben und hatte darauf gewartet, dass die Schuldigen sich durch irgendeine höhnische Bemerkung verrieten. Aber es war nichts gekommen.
«Ach, die werde ich schon noch erwischen!», sagte Monsieur Michel.
Beunruhigt beschloss Rieux, seine Runde in den Außenbezirken zu beginnen, wo seine ärmsten Patienten wohnten. Die Müllabfuhr fand hier viel später statt, und das durch die engen und staubigen Straßen dieses Viertels fahrende Auto streifte die am Rande des Bürgersteigs stehenden Abfalltonnen. In einer Straße, durch die er so entlangfuhr, zählte der Arzt ein Dutzend Ratten, die auf die Gemüseabfälle und die schmutzigen Lumpen geworfen worden waren.
Er fand seinen ersten Kranken im Bett vor, in einem Raum zur Straße, der als Schlaf- und Esszimmer zugleich diente. Es war ein alter Spanier mit einem strengen, zerfurchten Gesicht. Vor sich auf der Decke hatte er zwei Kochtöpfe voller Erbsen. Als der Arzt eintrat, warf sich der halb aufgerichtet in seinem Bett sitzende alte Asthmatiker gerade zurück, um wieder zu seinem rasselnden Atem zu kommen. Seine Frau brachte eine Schüssel.
«Was, Herr Doktor», sagte er während der Spritze, «sie kommen raus, haben Sie gesehen?»
«Ja», sagte die Frau, «der Nachbar hat drei aufgesammelt.»
Der Alte rieb sich die Hände.
«Sie kommen raus, man sieht in allen Mülltonnen welche, das ist der Hunger!»
Rieux konnte danach unschwer feststellen, dass das ganze Viertel von den Ratten sprach. Nachdem er seine Krankenbesuche beendet hatte, ging er wieder nach Hause.
«Oben ist ein Telegramm für Sie», sagte Monsieur Michel.
Der Arzt fragte ihn, ob er neue Ratten gesehen habe.
«O nein!», sagte der Concierge. «Ich liege auf der Lauer, wissen Sie. Und diese Schweine wagen es nicht.»
Das Telegramm kündete Rieux die Ankunft seiner Mutter für den nächsten Tag an. Sie kam, um sich während der Abwesenheit der Kranken um den Haushalt ihres Sohnes zu kümmern. Als der Arzt seine Wohnung betrat, war die Pflegerin schon da. Rieux sah, dass seine Frau im Kostüm dastand und vom Schminken etwas Farbe hatte. Er lächelte sie an:
«Gut», sagte er, «sehr gut.»
Kurz darauf, am Bahnhof, brachte er sie im Schlafwagen unter. Sie sah sich das Abteil an.
«Das ist zu teuer für uns, nicht wahr?»
«Es muss sein», sagte Rieux.
«Was ist das für eine Geschichte mit den Ratten?»
«Ich weiß nicht. Es ist sonderbar, aber es wird vorbeigehen.»
Dann sagte er sehr schnell, dass er sie um Verzeihung bitte, er hätte auf sie achtgeben müssen und habe sie sehr vernachlässigt. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie ihn zum Schweigen bringen. Aber er fügte hinzu:
«Alles wird besser, wenn du zurückkommst. Wir fangen neu an.»
«Ja», sagte sie mit glänzenden Augen, «wir fangen neu an.»
Kurz darauf wandte sie ihm den Rücken zu und schaute aus dem Fenster. Auf dem Bahnsteig drängten und stießen sich die Leute. Das Zischen der Lokomotive drang bis zu ihnen. Er nannte seine Frau bei ihrem Vornamen, und als sie sich umdrehte, sah er, dass ihr Gesicht voller Tränen war.
«Nicht», sagte er sanft.
Unter den Tränen kehrte, etwas verkrampft, das Lächeln zurück. Sie holte tief Luft:
«Geh, alles wird gut werden.»
Er drückte sie an sich, und jetzt, auf dem Bahnsteig, auf der anderen Seite des Fensters, sah er nur noch ihr Lächeln.
«Ich bitte dich», sagte er, «gib auf dich acht.»
Aber sie konnte ihn nicht hören.
Auf dem Bahnsteig, in der Nähe des Ausgangs, traf Rieux auf Monsieur Othon, den Untersuchungsrichter, der seinen kleinen Jungen an der Hand hielt. Der Arzt fragte ihn, ob er verreise. Monsieur Othon, der, groß und dunkel, halb aussah wie das, was man früher einen Mann von Welt nannte, halb wie ein Leichenträger, antwortete liebenswürdig, aber knapp:
«Ich warte auf Madame Othon, die meiner Familie ihre Aufwartung gemacht hat.»
Die Lokomotive pfiff.
«Die Ratten …», sagte der Richter.
Rieux machte eine Bewegung zum Zug hin, wandte sich aber wieder dem Ausgang zu.
«Ja», sagte er, «das ist nicht schlimm.»
Alles, was ihm von diesem Augenblick in Erinnerung blieb, war ein vorbeigehender Eisenbahnarbeiter, der eine Kiste voll toter Ratten unter dem Arm trug.
Am Nachmittag desselben Tages, zu Beginn seiner Sprechstunde, empfing Rieux einen jungen Mann, von dem man ihm sagte, er sei Journalist und sei schon am Morgen da gewesen. Er hieß Raymond Rambert. Klein, mit breiten Schultern, entschlossenem Gesicht und hellen, intelligenten Augen, trug Rambert sportlich geschnittene Kleidung und schien sich im Leben wohl zu fühlen. Er kam sofort zur Sache. Er recherchiere für eine große Pariser Zeitung über die Lebensbedingungen der Araber und wolle Informationen über ihre hygienischen Verhältnisse. Rieux sagte, sie seien nicht gut. Aber bevor er weiterredete, wollte er wissen, ob der Journalist die Wahrheit schreiben dürfe.
«Sicher», sagte der andere.
«Ich meine: Können Sie ein vernichtendes Urteil aussprechen?»
«Vernichtend nicht, das muss ich einfach sagen. Aber ich nehme an, ein solches Urteil wäre unbegründet.»
Leise sagte Rieux, ein solches Urteil sei tatsächlich unbegründet, aber mit dieser Frage wolle er nur wissen, ob Ramberts Berichterstattung rückhaltlos sein könne oder nicht.
«Ich lasse nur rückhaltlose Berichterstattung gelten. Ich werde die Ihre also nicht mit meinen Auskünften unterstützen.»
«Das ist die Sprache Saint-Justs», sagte der Journalist lächelnd.
Rieux sagte, ohne lauter zu werden, das wisse er nicht, aber es sei die Sprache eines der Welt, in der er lebte, überdrüssigen Menschen, der jedoch für seinesgleichen etwas übrig habe und entschlossen sei, was ihn anging, Ungerechtigkeit und Konzessionen abzulehnen. Rambert sah den Arzt mit hochgezogenen Schultern an.
«Ich glaube, ich verstehe Sie», sagte er schließlich im Aufstehen.
Der Arzt geleitete ihn zur Tür:
«Ich danke Ihnen, dass Sie es so aufnehmen.»
Rambert schien ungehalten zu werden:
«Ja», sagte er, «ich verstehe, verzeihen Sie die Störung.»
Der Arzt drückte ihm die Hand und sagte, es gebe eine lesenswerte Reportage über die Menge toter Ratten zu machen, die augenblicklich in der Stadt gefunden würden.
«Aha!», rief Rambert. «Das interessiert mich.»
Um siebzehn Uhr, als der Arzt wieder Krankenbesuche machen ging, begegnete er auf der Treppe einem noch jungen Mann von plumper Gestalt, mit einem schweren, zerfurchten Gesicht und dichten Augenbrauen. Er hatte ihn manchmal bei den spanischen Tänzern getroffen, die im obersten Stock seines Hauses wohnten. Jean Tarrou rauchte hingegeben eine Zigarette, während er den letzten Konvulsionen einer Ratte zusah, die auf einer Stufe zu seinen Füßen verendete. Er blickte ruhig und eindringlich mit seinen grauen Augen zu dem Arzt auf, sagte ihm guten Tag und fügte hinzu, dieses Auftauchen der Ratten sei eine merkwürdige Sache.
«Ja», sagte Rieux, «aber sie geht einem allmählich auf die Nerven.»
«In einer Hinsicht, Herr Doktor, nur in einer Hinsicht. Wir haben nie etwas Derartiges gesehen, das ist alles. Aber ich finde das interessant, ja, wirklich interessant.»
Tarrou fuhr sich mit der Hand übers Haar, um es nach hinten zu streichen, sah wieder die jetzt regungslose Ratte an und sagte lächelnd zu Rieux:
«Aber schließlich ist es vor allem die Sache des Concierge, Doktor.»
Eben den Concierge fand der Arzt vor dem Haus neben dem Eingang an die Wand gelehnt mit einem Ausdruck von Mattigkeit auf seinem sonst gut durchbluteten Gesicht.
«Ja, ich weiß», sagte der alte Michel zu Rieux, der ihm die neue Entdeckung meldete. «Jetzt werden sie zu zweien und zu dreien gefunden. Aber in den anderen Häusern ist es dasselbe.»
Er wirkte abgespannt und besorgt. Er rieb sich mechanisch den Hals. Rieux fragte ihn, wie es ihm gehe. Der Concierge konnte natürlich nicht sagen, es gehe ihm gar nicht gut. Bloß fühle er sich nicht ganz auf der Höhe. Seiner Ansicht nach sei es die Moral, die keine Ruhe ließ. Diese Ratten hätten ihm einen Schlag versetzt, und alles würde viel besser, wenn sie verschwunden sein würden.
Aber am nächsten Morgen, dem 18. April, fand der Arzt, der seine Mutter vom Bahnhof abgeholt hatte, Monsieur Michel mit noch eingefallenerem Gesicht vor: Vom Keller bis zum Dachboden waren die Treppen von einem Dutzend Ratten übersät. Die Mülltonnen der Nachbarhäuser waren voll davon. Die Mutter des Arztes nahm die Nachricht ohne Verwunderung auf.
«So etwas kommt vor.»
Sie war eine kleine Frau mit silbergrauem Haar und sanften schwarzen Augen.
«Ich bin froh, dich wiederzusehen, Bernard», sagte sie. «Daran können die Ratten nichts ändern.»
Er pflichtete ihr bei; es stimmte, dass mit ihr immer alles leicht erschien.
Rieux rief dennoch die kommunale Abteilung für Rattenbekämpfung an, deren Leiter er kannte. Ob er von diesen Ratten gehört habe, die in großer Zahl im Freien starben? Mercier, der Abteilungsleiter, hatte davon gehört, und in seiner eigenen Abteilung, die nicht weit von den Kais lag, hatte man etwa fünfzig entdeckt. Er fragte sich jedoch, ob es ernst sei. Darüber konnte Rieux nicht entscheiden, aber er meinte, die Abteilung für Rattenbekämpfung müsse einschreiten.
«Ja», sagte Mercier, «mit einer Anordnung. Wenn du glaubst, dass es wirklich der Mühe wert ist, kann ich versuchen, eine Anordnung zu bekommen.»
«Das ist immer der Mühe wert», sagte Rieux.
Seine Putzfrau hatte ihm gerade berichtet, man habe in der großen Fabrik, in der ihr Mann arbeitete, mehrere hundert tote Ratten aufgesammelt.
Etwa um diese Zeit jedenfalls fingen unsere Mitbürger an, sich zu beunruhigen. Ab dem 18. nämlich spien die Fabriken und Lagerhäuser tatsächlich Hunderte von Rattenkadavern aus. In einigen Fällen war man gezwungen, die Tiere, deren Todeskampf zu lange dauerte, totzuschlagen. Aber von den Außenbezirken bis zur Stadtmitte, überall, wo Doktor Rieux hinkam, überall, wo unsere Mitbürger zusammenkamen, warteten die Ratten zuhauf, in den Mülltonnen oder in langen Reihen im Rinnstein. Von dem Tag an griff die Abendpresse die Sache auf und fragte, ob die Stadtverwaltung vorhabe, zu handeln oder nicht und welche Notmaßnahmen sie ins Auge gefasst habe, um ihre Bürger vor dieser widerlichen Invasion zu schützen. Die Stadtverwaltung hatte nichts vor und hatte überhaupt nichts ins Auge gefasst, begann aber damit, ihren Rat zu versammeln, um zu beraten. Der Abteilung für Rattenbekämpfung wurde die Anordnung gegeben, die toten Ratten allmorgendlich in der Dämmerung einzusammeln. Nach dem Einsammeln sollten zwei Wagen der Abteilung die Tiere zur Müllverbrennungsanlage bringen, um sie zu verbrennen.
Aber an den folgenden Tagen verschlimmerte sich die Situation. Die Zahl der eingesammelten Nager nahm zu, und der Ertrag war jeden Morgen reicher. Vom vierten Tag an kamen die Ratten in Gruppen zum Sterben heraus. Aus den Verschlägen, den Untergeschossen, den Kellern, der Kanalisation kamen sie in langen taumelnden Reihen, um ans Tageslicht zu wanken, sich um sich selbst zu drehen und in der Nähe der Menschen zu sterben. Des Nachts hörte man in den Korridoren oder Gassen deutlich ihre hohen Todesschreie. Am Morgen fand man sie im Rinnstein hingestreckt, mit einem kleinen Blutflor auf der spitzen Schnauze, die einen aufgebläht und faulig, die anderen steif und mit noch gesträubten Barthaaren. In der Stadt selbst wurden sie häufchenweise auf Treppenabsätzen und in Höfen aufgefunden. Vereinzelt kamen sie auch zum Sterben in Behördenhallen, Schulhöfe und manchmal in Straßencafés. Unsere bestürzten Mitbürger entdeckten sie an den meistbesuchten Orten der Stadt. Die Place d’Armes, die Boulevards, die Promenade Front-de-Mer waren hier und da verunreinigt. Im Morgengrauen von den toten Tieren gereinigt, erlebte die Stadt, wie sie im Lauf des Tages erst vereinzelt, dann immer zahlreicher wieder auftauchten. Mehr als einem nächtlichen Spaziergänger widerfuhr es daher auf den Bürgersteigen, dass er unter seinem Fuß die nachgiebige Masse eines noch frischen Kadavers spürte. Man hätte meinen können, dass die Erde selbst, auf die unsere Häuser gestellt waren, sich von ihrer Ladung Körpersäfte entschlacke, dass sie Furunkel und Eiterwunden an die Oberfläche aufsteigen ließ, die bisher in ihrem Innern gärten. Man stelle sich nur die Bestürzung unserer bis dahin so ruhigen und in wenigen Tagen völlig verwandelten kleinen Stadt vor, wie ein gesunder Mensch, dessen dickes Blut auf einmal in Aufruhr gerät.
Die Dinge gingen so weit, dass die Agentur Ransdoc (Erkundigungen, Beweismaterial, Erkundigungen aller Art) in ihren kostenlosen Rundfunknachrichten allein am 25. sechstausendzweihunderteinunddreißig eingesammelte und verbrannte Ratten bekanntgab. Diese Zahl, die dem täglichen Schauspiel, das die Stadt vor Augen hatte, einen klaren Sinn gab, steigerte die Verwirrung noch. Bisher hatte man sich nur über eine etwas abstoßende Erscheinung beklagt. Jetzt bemerkte man, dass dieses Phänomen, dessen Auswirkung man noch nicht genau angeben und dessen Ursprung man nicht ausmachen konnte, etwas Bedrohliches hatte. Nur der asthmatische alte Spanier rieb sich weiter die Hände und wiederholte mit seniler Freude: «Sie kommen heraus, sie kommen heraus.»
Am 28. April jedoch meldete Ransdoc eine Sammlung von etwa achttausend Ratten, und die Angst war in der Stadt auf ihrem Höhepunkt. Man verlangte radikale Maßnahmen, man beschuldigte die Behörden, und manche, die Häuser am Meer hatten, sprachen schon davon, sich dorthin zurückzuziehen. Aber am nächsten Tag meldete die Agentur, das Phänomen habe abrupt aufgehört und die Abteilung für Rattenbekämpfung habe nur eine unwesentliche Menge toter Ratten eingesammelt. Die Stadt atmete auf.
Doch am selben Tag, als Doktor Rieux mittags sein Auto vor seinem Haus abstellte, sah er am Ende der Straße den Concierge, der sich mühsam, mit gesenktem Kopf, gespreizten Armen und Beinen in der Haltung eines Hampelmanns vorwärts bewegte. Der alte Mann stützte sich auf den Arm eines Priesters, den der Arzt erkannte. Es war Pater Paneloux, ein gelehrter und streitbarer Jesuit, dem er manchmal begegnet war und der in unserer Stadt sogar von jenen, die in Sachen Religion gleichgültig sind, sehr geschätzt wurde. Er wartete auf sie. Der alte Michel hatte glänzende Augen und atmete pfeifend. Er hatte sich nicht wohl gefühlt und an die frische Luft gehen wollen. Aber heftige Schmerzen am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten hatten ihn gezwungen, umzukehren und Pater Paneloux um Hilfe zu bitten.
«Das sind Schwellungen», sagte er. «Ich muss mich überanstrengt haben.»
Der Arzt streckte den Arm aus der Autotür und tastete mit dem Finger unten über den Hals, den Michel ihm entgegenstreckte; dort hatte sich eine Art holziger Knoten gebildet.
«Legen Sie sich ins Bett und messen Sie Ihre Temperatur, ich komme Sie heute Nachmittag besuchen.»
Nachdem der Concierge weg war, fragte Rieux Pater Paneloux, was er von dieser Geschichte mit den Ratten halte.
«Oh», sagte der Pater, «das muss eine Epidemie sein», und seine Augen lächelten hinter der runden Brille.
Nach dem Mittagessen las Rieux noch einmal das Telegramm der Privatklinik, die ihm die Ankunft seiner Frau meldete, als das Telefon klingelte. Es war einer seiner ehemaligen Patienten, ein Angestellter der Stadtverwaltung. Er hatte lange an einer Verengung der Aorta gelitten, und da er arm war, hatte Rieux ihn kostenlos behandelt.
«Ja», sagte er, «Sie erinnern sich an mich. Aber es geht um einen anderen. Kommen Sie schnell, bei meinem Nachbarn ist etwas passiert.»
Seine Stimme war atemlos. Rieux dachte an den Concierge und beschloss, ihn anschließend zu besuchen. Einige Minuten später betrat er ein niedriges Haus in der Rue Faidherbe, in einem Außenbezirk. Auf halber Höhe der kühlen, stinkenden Treppe begegnete er Joseph Grand, dem Angestellten, der ihm entgegenkam. Er war ein Mann um die fünfzig, mit gelbem Schnurrbart, groß und gebeugt, mit schmalen Schultern und mageren Gliedern.
«Es geht ihm besser», sagte er, als er bei Rieux ankam, «aber ich dachte, er würde draufgehen.»
Er schnäuzte sich. Im zweiten und obersten Stockwerk las Rieux auf der linken Tür mit roter Kreide geschrieben: «Herein, ich habe mich aufgehängt.»
Sie gingen hinein. Der Strick hing über einem umgekippten Stuhl und dem in eine Ecke geschobenen Tisch von der Aufhängung herab. Aber er hing ins Leere.
«Ich habe ihn noch rechtzeitig abgehängt», sagte Grand, der immer nach Worten zu suchen schien, obwohl er die einfachste Sprache sprach. «Ich wollte gerade aus dem Haus gehen und habe Lärm gehört. Als ich das Geschriebene gesehen habe, wie soll ich es Ihnen erklären, habe ich an einen Streich geglaubt. Aber er hat so komisch gestöhnt und sogar unheimlich, kann man sagen.»
Er kratzte sich am Kopf:
«Meiner Meinung nach muss das Unternehmen schmerzhaft sein. Natürlich bin ich hineingegangen.»
Sie hatten eine Tür aufgestoßen und standen auf der Schwelle eines hellen, aber ärmlich möblierten Zimmers. Ein rundlicher kleiner Mann lag auf dem Messingbett. Er atmete schwer und sah sie mit blutunterlaufenen Augen an. Der Arzt blieb stehen. Ihm war, als höre er zwischen den Atemzügen das leise Fiepen von Ratten. Aber in den Ecken bewegte sich nichts. Rieux trat an das Bett. Der Mann war weder von zu hoch oben noch zu abrupt gefallen, und die Wirbel hatten gehalten. Natürlich leichte Erstickungsanzeichen. Man würde ihn röntgen müssen. Der Arzt gab ihm eine Kampferölspritze und sagte, in ein paar Tagen werde alles wieder in Ordnung sein.
«Danke, Herr Doktor», sagte der Mann mit erstickter Stimme.
Rieux fragte Grand, ob er die Polizei benachrichtigt habe, und der Angestellte machte ein kleinlautes Gesicht:
«Nein», sagte er, «o nein! Ich dachte, das dringendste …»
«Selbstverständlich», unterbrach ihn Rieux, «das erledige ich dann.»
Aber im gleichen Augenblick wurde der Kranke unruhig, richtete sich im Bett auf und protestierte, es gehe ihm gut und das sei nicht nötig.
«Beruhigen Sie sich», sagte Rieux. «Das ist keine große Sache, glauben Sie mir, und ich muss meine Meldung machen.»
«Oh!», sagte der andere.
Und er warf sich zurück und weinte stoßweise. Grand, der schon eine Weile an seinem Schnurrbart herumzupfte, trat zu ihm.
«Na, na, Monsieur Cottard», sagte er. «Verstehen Sie das doch. Der Doktor ist sozusagen verantwortlich. Wenn Sie zum Beispiel Lust bekämen, es nochmal zu machen …»
Aber Cottard sagte unter Tränen, er mache es nicht nochmal, es sei nur ein Augenblick der Verwirrung gewesen und er wünsche sich nur, in Frieden gelassen zu werden. Rieux schrieb ein Rezept.
«Gut», sagte er. «Lassen wir das, ich komme in zwei oder drei Tagen wieder. Aber machen Sie keine Dummheiten.»
Im Treppenhaus sagte er zu Grand, er sei verpflichtet, seine Meldung zu machen, aber er werde den Polizeikommissar bitten, seine Untersuchung erst in zwei Tagen durchzuführen.
«Er muss heute Nacht überwacht werden. Hat er Familie?»
«Ich kenne sie nicht. Aber ich kann ja bei ihm wachen.»
Er schüttelte den Kopf.
«Ich kann übrigens auch nicht behaupten, dass ich ihn kenne. Aber man muss sich gegenseitig helfen.»
In den Hausgängen blickte Rieux unwillkürlich in die Winkel und fragte Grand, ob die Ratten gänzlich aus seinem Viertel verschwunden seien. Der Angestellte hatte keine Ahnung. Er habe zwar von dieser Geschichte gehört, aber er beachte die Gerüchte im Viertel nicht besonders.
«Ich habe andere Sorgen», sagte er.
Rieux drückte ihm schon die Hand. Er hatte es eilig, nach dem Concierge zu sehen, bevor er seiner Frau schrieb.
Die Verkäufer der Abendzeitungen verkündeten lauthals, die Ratteninvasion sei gestoppt. Aber Rieux traf seinen Kranken halb aus dem Bett hängend an; eine Hand auf dem Bauch und die andere um den Hals, erbrach er in großen Schwällen rosarote Galle in einen Abfallkanister. Nach langer Quälerei außer Atem, legte sich der Concierge wieder hin. Seine Temperatur betrug 39,5 Grad, die Lymphknoten am Hals und die Glieder waren geschwollen, an seiner Seite breiteten sich zwei schwärzliche Flecken aus. Er klagte jetzt über innere Schmerzen:
«Das brennt, dieses Schwein verbrennt mich.»
Wegen seines dunkel geschwollenen Mundes sprach er undeutlich, und er wandte dem Arzt hervorquellende Augen zu, die vor Kopfschmerzen tränten. Seine Frau sah Rieux angstvoll an, aber er blieb stumm.
«Herr Doktor», sagte sie, «was ist das?»
«Das kann alles Mögliche sein. Aber noch ist nichts sicher. Bis heute Abend Diät und Blutreinigungsmittel. Er soll viel trinken.»
Der Concierge kam nämlich um vor Durst.
Zu Hause rief Rieux seinen Kollegen Richard an, einen der bedeutendsten Ärzte der Stadt.
«Nein», sagte Richard, «mir ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen.»
«Kein Fieber mit lokalen Entzündungen?»
«Ach doch, zwei Fälle mit stark entzündeten Lymphknoten.»
«Unnormal?»
«Na ja, was heißt schon normal …?», sagte Richard.
Am Abend jedenfalls delirierte der Concierge und beschwerte sich bei vierzig Grad Fieber über die Ratten. Rieux versuchte es mit einem Ableitungsherd. Beim Brennen des Terpentins brüllte der Concierge: «Ah, die Schweine!»
Die Lymphknoten waren noch dicker geworden und fühlten sich hart und holzig an. Die Frau des Concierge war außer sich vor Angst.
«Wachen Sie bei ihm», sagte der Arzt, «und rufen Sie mich, wenn nötig.»
Am nächsten Tag, dem 30. April, wehte eine schon laue Brise an einem blauen, feuchten Himmel. Sie brachte Blumenduft mit sich, der aus den entferntesten Vororten stammte. Die Morgengeräusche auf der Straße schienen lebhafter, fröhlicher als sonst. Befreit von der dumpfen Furcht, in der sie eine Woche lang gelebt hatte, war dieser Tag für unsere ganze kleine Stadt ein Neubeginn. Selbst Rieux, durch einen Brief von seiner Frau beruhigt, stieg leichten Herzens zum Concierge hinunter. Und tatsächlich war das Fieber am Morgen auf achtunddreißig Grad gefallen. Geschwächt lag der Kranke im Bett und lächelte.
«Es ist besser geworden, nicht wahr, Herr Doktor?», sagte seine Frau.
«Warten wir noch ab.»
Aber mittags war das Fieber auf vierzig Grad in die Höhe geschnellt, der Kranke delirierte unentwegt, und das Erbrechen hatte wieder angefangen. Die Lymphknoten am Hals taten beim Betasten weh, und der Concierge schien seinen Kopf so weit wie möglich vom Körper entfernt halten zu wollen. Seine Frau saß am Fußende des Bettes, ihre Hände lagen auf der Decke und hielten sanft die Füße des Kranken. Sie sah Rieux an.
«Hören Sie», sagte der, «wir müssen ihn isolieren und eine Spezialbehandlung versuchen. Ich rufe das Krankenhaus an, und wir bringen ihn im Krankenwagen hin.»
Zwei Stunden später im Krankenwagen beugten sich der Arzt und die Frau über den Kranken. Aus seinem mit schwammigen Schwellungen verklebten Mund kamen Wortfetzen: «Die Ratten!», sagte er. Grünlich, mit wächsernen Lippen, bleischweren Lidern, kurzem, stoßweisem Atem, von den Lymphknoten gemartert, tief in seine Pritsche vergraben, als hätte er sie am liebsten über sich verschlossen oder als riefe ihn unablässig etwas aus der Tiefe der Erde, erstickte der Concierge unter einem unsichtbaren Gewicht. Die Frau weinte.
«Gibt es denn keine Hoffnung mehr, Herr Doktor?»
«Er ist tot», sagte Rieux.
Man kann vielleicht sagen, dass der Tod des Concierge das Ende jener Zeit voll verwirrender Zeichen und den Beginn einer anderen, vergleichsweise schwierigeren kennzeichnete, in der die anfängliche Bestürzung sich allmählich in Panik verwandelte. Wie unsere Mitbürger nun merken sollten, hatten sie nie gedacht, dass unsere kleine Stadt ein besonders geeigneter Ort sein könnte, wo die Ratten in der Sonne sterben und die Concierges an seltsamen Krankheiten zugrunde gehen. In dieser Hinsicht befanden sie sich genaugenommen im Irrtum und mussten ihre Vorstellungen revidieren. Wenn damit alles sein Bewenden gehabt hätte, wären sie sicher zu ihren Gewohnheiten zurückgekehrt. Aber andere unter unseren Mitbürgern, die nicht immer Concierges und auch nicht arm waren, mussten denselben Weg gehen, den Monsieur Michel als Erster genommen hatte. Von diesem Moment an begann die Angst und mit ihr das Nachdenken.
Doch bevor der Erzähler diese neuen Ereignisse im Einzelnen schildert, hält er es für nützlich, die Meinung eines anderen Zeugen der eben beschriebenen Zeit zu zitieren. Jean Tarrou, dem wir schon am Anfang dieses Berichts begegnet sind, hatte sich einige Wochen zuvor in Oran niedergelassen und wohnte seither in einem großen Hotel im Stadtzentrum. Er schien offenbar wohlhabend genug, um von seinen Einkünften zu leben. Aber obwohl die Stadt sich allmählich an ihn gewöhnt hatte, konnte niemand sagen, woher er kam oder warum er da war. Man begegnete ihm an allen öffentlichen Orten. Seit dem Frühlingsanfang wurde er häufig am Strand gesehen, wo er oft und mit sichtlichem Vergnügen schwamm. Gutmütig und immer lächelnd, schien er alle natürlichen Freuden zu schätzen, ohne ihnen verfallen zu sein. Tatsächlich war seine einzige bekannte Gewohnheit der rege Umgang mit den in unserer Stadt ziemlich zahlreichen spanischen Tänzern und Musikern.
Seine Aufzeichnungen jedenfalls bilden auch eine Art Chronik jener schwierigen Zeit. Aber es handelt sich um eine sehr eigentümliche Chronik, die einer Voreingenommenheit für Belangloses zu gehorchen scheint. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Tarrou sei darauf bedacht gewesen, Dinge und Menschen durch ein umgekehrtes Fernglas zu betrachten. Genaugenommen bemühte er sich in der allgemeinen Verwirrung, der Geschichtsschreiber dessen zu sein, was keine Geschichte hat. Diese Voreingenommenheit kann man zwar bedauern und darin Gefühlskälte vermuten. Aber nichtsdestoweniger können diese Aufzeichnungen als Chronik jener Zeit eine Unmenge nebensächlicher Einzelheiten liefern, die gleichwohl wichtig sind und deren Absonderlichkeit gerade verhindern wird, diese interessante Figur voreilig zu beurteilen.
Jean Tarrous erste Notizen stammen aus der Zeit seiner Ankunft in Oran. Sie offenbaren von Anfang an eine seltsame Befriedigung darüber, in einer von sich aus so hässlichen Stadt zu sein. Man findet die detaillierte Beschreibung der zwei Bronzelöwen, die das Rathaus zieren, wohlwollende Überlegungen zum Mangel an Bäumen, zu den unschönen Häusern und zur absurden Anlage der Stadt. Tarrou streut noch Dialoge ein, die er in der Straßenbahn oder auf der Straße gehört hat, ohne eigene Kommentare hinzuzufügen, außer etwas später, bei einem der Gespräche über einen gewissen Camps. Tarrou hatte die Unterhaltung zweier Straßenbahnschaffner mit angehört:
«Du hast doch Camps gekannt», sagte der eine.
«Camps? Ein Großer mit schwarzem Schnurrbart?»
«Genau. Er war im Stellwerk.»
«Ja, natürlich.
«Tja, er ist gestorben.»
«Ach, und wann?»
«Nach der Geschichte mit den Ratten.»
«Sag bloß! Was hatte er denn?»
«Ich weiß nicht, Fieber. Und außerdem war er nicht kräftig. Er hatte Geschwüre unterm Arm. Er hat es nicht überstanden.»
«Dabei sah er doch ganz normal aus.»
«Nein, er war schwach auf der Brust, und er spielte im Musikverein. Immer in ein Horn blasen, das zermürbt.»
«Tja», schloss der Zweite, «wenn man krank ist, soll man nicht in ein Horn blasen.»
Nach diesen wenigen Angaben fragte sich Tarrou, warum Camps gegen sein offensichtliches Interesse in den Musikverein eingetreten war und welche tieferen Gründe ihn dazu bewogen hatten, sein Leben für sonntägliche Umzüge aufs Spiel zu setzen.
Dann schien Tarrou von einer Szene positiv beeindruckt gewesen zu sein, die sich häufig auf dem Balkon gegenüber seinem Fenster abspielte. Sein Zimmer ging nämlich auf eine kleine Seitenstraße, wo im Schatten der Mauern Katzen schliefen. Aber jeden Tag nach dem Mittagessen, um die Zeit, wenn die ganze Stadt in der Hitze döste, erschien auf der anderen Straßenseite ein kleiner alter Mann auf einem Balkon. Mit weißem, sorgfältig gekämmtem Haar, aufrecht und streng in seiner militärisch geschnittenen Kleidung, rief er zugleich reserviert und sanft die Katzen mit einem «Miez, Miez». Die Katzen hoben ihre vom Schlaf blassen Augen, noch ohne sich stören zu lassen. Der andere zerriss über der Straße Papier in kleine Stücke, und von diesem Regen weißer Falter angezogen, gingen die Tiere zur Straßenmitte und streckten eine zögernde Pfote nach den letzten Papierschnitzeln aus. Dann spuckte der kleine Alte kräftig und präzise auf die Katzen. Wenn er mit einem Spucken sein Ziel traf, lachte er.
Schließlich schien Tarrou wahrhaftig vom kommerziellen Charakter der Stadt betört gewesen zu sein, deren Aussehen, Betrieb und sogar Vergnügungen von den Notwendigkeiten des Handels bestimmt schienen. Diese Eigentümlichkeit (so der Ausdruck im Tagebuch) fand Tarrous Zustimmung, und eine seiner lobenden Anmerkungen endete sogar mit dem Ausruf: «Endlich!» Das sind die einzigen Stellen, an denen die Aufzeichnungen des Reisenden zu jenem Zeitpunkt einen persönlichen Ton anzunehmen scheinen. Es ist nur schwierig, dessen Bedeutung und Ernsthaftigkeit einzuschätzen. So hatte Tarrou nach einer Schilderung, wie die Entdeckung einer toten Ratte den Kassierer des Hotels zu einem Fehler in seiner Rechnung gebracht hatte, in einer weniger deutlichen Schrift als sonst hinzugefügt: «Frage: Was tun, um seine Zeit nicht zu verlieren? Antwort: Sie in ihrer ganzen Länge empfinden. Mittel: Tage im Wartezimmer eines Zahnarztes auf einem unbequemen Stuhl verbringen; den Sonntagnachmittag auf seinem Balkon verleben; sich Vorträge in einer Sprache anhören, die man nicht versteht; die längsten und am wenigsten bequemen Eisenbahnverbindungen aussuchen und natürlich stehend reisen; an der Theaterkasse Schlange stehen und dann seine Karte nicht benutzen usw.» Aber gleich nach diesen sprachlichen oder gedanklichen Seitensprüngen bringt das Tagebuch eine detaillierte Beschreibung der Straßenbahnen unserer Stadt, ihrer Nachenform, ihrer unbestimmten Farbe, ihrer üblichen Unsauberkeit, und beendet diese Betrachtungen mit einem «Bemerkenswert», das nichts erklärt.
Hier nun jedenfalls Tarrous Angaben zur Geschichte mit den Ratten:
«Heute ist der kleine Alte von gegenüber ganz aus dem Häuschen. Es sind keine Katzen mehr da. Sie sind tatsächlich verschwunden, in Aufregung versetzt durch die toten Ratten, die man überall in der Stadt in großer Zahl auf der Straße entdeckt. Meiner Ansicht nach ist es ausgeschlossen, dass die Katzen die toten Ratten fressen. Ich erinnere mich, dass meine das verabscheuten. Trotzdem laufen sie wohl in den Kellern herum, und der kleine Alte ist aus der Fassung. Er ist weniger sorgfältig gekämmt, weniger energisch. Man spürt seine Unruhe. Nach einer Weile ist er wieder hineingegangen. Aber er hat einmal ins Leere gespuckt.
In der Stadt wurde heute eine Straßenbahn angehalten, weil man in ihr eine tote Ratte entdeckt hatte, die, man weiß nicht wie, da hineingeraten war. Zwei oder drei Frauen sind ausgestiegen. Die Ratte wurde hinausgeworfen. Die Trambahn ist weitergefahren.
Im Hotel hat mir der Nachtportier, ein vertrauenswürdiger Mann, gesagt, er rechne bei all diesen Ratten mit einem Unglück. ‹Die Ratten verlassen das sinkende Schiff …› Ich habe ihm erwidert, das treffe auf Schiffe zu, aber für Städte habe man es noch nie überprüft. Er blieb jedoch bei seiner Überzeugung. Ich habe ihn gefragt, mit welchem Unglück man seiner Meinung nach rechnen müsse. Er wusste es nicht, da Unglück nicht vorhersehbar sei. Aber es hätte ihn nicht gewundert, wenn es ein Erdbeben gäbe. Ich habe zugegeben, dass es möglich sei, und er hat mich gefragt, ob mich das nicht beunruhige.
‹Das Einzige, was mich interessiert, ist, inneren Frieden zu finden›, habe ich gesagt.
Er hat mich bestens verstanden.
Im Hotelrestaurant gibt es eine sehr interessante Familie. Der Vater ist ein großer, dünner Mann in schwarzer Kleidung und mit einem steifen Kragen. Oben auf dem Schädel ist er kahl und rechts und links hat er zwei graue Haarbüschel. Runde und harte kleine Augen, eine schmale Nase, ein waagerechter Mund verleihen ihm das Aussehen einer wohlerzogenen Eule. Er kommt immer als Erster an die Tür des Restaurants, tritt beiseite, lässt seine Frau vorbeigehen, die winzig klein ist wie eine schwarze Maus, und geht dann hinein, dicht gefolgt von einem kleinen Jungen und einem kleinen Mädchen, die angezogen sind wie dressierte Hunde. Am Tisch wartet er, bis seine Frau Platz genommen hat, setzt sich, und dann können die beiden Pudel endlich auf ihre Stühle klettern. Er siezt Frau und Kinder, richtet höfliche Bosheiten an die eine und endgültige Worte an die Erben:
‹Nicole, Sie führen sich höchst unsympathisch auf!›
Und das kleine Mädchen ist den Tränen nahe. Wie es sein soll.
Heute Morgen war der kleine Junge ganz aufgeregt wegen der Geschichte mit den Ratten. Er wollte bei Tisch darüber sprechen.
‹Man spricht bei Tisch nicht über Ratten, Philippe. Ich verbiete Ihnen, in Zukunft dieses Wort auszusprechen.›
‹Ihr Vater hat recht›, hat die schwarze Maus gesagt.
Die beiden Pudel ließen die Nase in ihren Teller hängen, und die Eule hat mit einem nichtssagenden Kopfnicken gedankt.
Trotz dieses schönen Vorbilds wird in der Stadt viel über diese Rattengeschichte gesprochen. Die Zeitungen haben sich eingemischt. Das Lokalblatt, das sonst sehr abwechslungsreich ist, wird jetzt vollständig von einer Kampagne gegen die Stadtverwaltung beherrscht: ‹Sind sich unsere Stadtväter der Gefahr bewusst, die die verwesten Kadaver dieser Nagetiere darstellen können?› Der Hoteldirektor kann von nichts anderem sprechen. Aber das liegt auch daran, dass er verärgert ist. Im Aufzug eines anständigen Hotels Ratten zu entdecken ist für ihn unfassbar. Um ihn zu trösten, habe ich gesagt: ‹Aber so geht es doch allen.›
‹Eben›, hat er geantwortet, ‹wir sind jetzt wie alle.›
Er hat mir von den ersten Fällen dieses sonderbaren Fiebers erzählt, über das man sich allmählich beunruhigt. Eines seiner Zimmermädchen ist davon befallen.
‹Aber es ist bestimmt nicht ansteckend›, hat er nachdrücklich klargemacht.
Ich habe gesagt, das sei mir egal. ‹
Aha, ich sehe schon! Monsieur ist wie ich, Monsieur ist Fatalist.›
Ich hatte nichts dergleichen geäußert, und außerdem bin ich kein Fatalist. Das habe ich ihm gesagt …»
Von diesem Zeitpunkt an berichten Tarrous Aufzeichnungen etwas eingehender über dieses unbekannte Fieber, das in der Öffentlichkeit schon Beunruhigung hervorrief. Nach der Notiz, dass der kleine Alte mit dem Verschwinden der Ratten endlich seine Katzen wiedergefunden habe und geduldig sein Zielen korrigiere, fügte Tarrou hinzu, man könne schon ein Dutzend Fälle dieses Fiebers zählen, von denen die meisten tödlich verlaufen seien.
Zu dokumentarischen Zwecken kann man schließlich noch Tarrous Porträt von Doktor Rieux wiedergeben. Soweit der Erzähler es beurteilen kann, ist es ziemlich treffend:
«Sieht aus wie fünfunddreißig. Mittelgroß. Breite Schultern. Beinah rechteckiges Gesicht. Dunkle, gerade Augen, aber vorspringender Kiefer. Die große Nase ist ebenmäßig. Sehr kurz geschnittenes schwarzes Haar. Der Mund ist geschwungen, die Lippen sind voll und fast immer zusammengepresst. Mit seiner verbrannten Haut, dem schwarzen Haar und der immer dunklen Kleidung, die ihm aber gut steht, sieht er ein bisschen aus wie ein sizilianischer Bauer.
Er geht schnell. Er tritt vom Bürgersteig herunter, ohne sein Tempo zu ändern, macht aber bei zwei von drei Malen einen kleinen Satz, wenn er den gegenüberliegenden Bürgersteig erreicht. Beim Autofahren ist er zerstreut und lässt oft den Winker draußen, wenn er schon abgebogen ist. Immer ohne Kopfbedeckung. Wirkt informiert.»
Tarrous Zahlen stimmten. Doktor Rieux wusste darüber Bescheid. Nachdem die Leiche des Concierge isoliert worden war, hatte er Richard angerufen, um ihn über dieses Leistendrüsenfieber auszufragen.
«Ich werde nicht klug daraus», hatte Richard gesagt. «Zwei Tote, der eine innerhalb von achtundvierzig Stunden, der andere nach drei Tagen. Den zweiten hatte ich morgens mit allen Anzeichen der Besserung verlassen.»
«Benachrichtigen Sie mich, wenn Sie weitere Fälle bekommen», sagte Rieux.
Er rief noch einige Ärzte an. Die so erfolgte Umfrage ergab etwa zwanzig ähnliche Fälle innerhalb von wenigen Tagen. Fast alle waren tödlich verlaufen. Daraufhin verlangte er von Richard, dem Vorsitzenden der Ärzteschaft, die Isolierung der Neuerkrankten.
«Aber das ist nicht meine Sache», sagte Richard. «Dazu wären Maßnahmen des Präfekten nötig. Außerdem, woher wissen Sie denn, dass Ansteckungsgefahr besteht?»
«Ich weiß es ja gar nicht, aber die Symptome sind beunruhigend.»
Richard meinte jedoch, «er sei nicht befugt». Was er tun könne, sei, mit dem Präfekten darüber zu sprechen.
Aber während noch geredet wurde, verschlechterte sich das Wetter. Am Tag nach dem Tod des Concierge bedeckten dichte Dunstwolken den Himmel. Kurze, sintflutartige Regenfälle gingen auf die Stadt nieder; diesem heftigen Platzregen folgte gewittrige Schwüle. Selbst das Meer hatte sein dunkles Blau eingebüßt und nahm unter dem verhangenen Himmel einen für die Augen schmerzhaften Glanz wie von Silber oder Stahl an. Die feuchte Hitze dieses Frühlings erweckte Sehnsucht nach der Glut des Sommers. In der spiralförmig auf ihrem Plateau angelegten Stadt, die sich kaum zum Meer hin öffnete, herrschte dumpfe Apathie. Zwischen ihren langen verputzten Mauern, in den Straßen mit den staubigen Schaufenstern, in den schmutzig gelben Trambahnen fühlte man sich ein wenig als Gefangener des Himmels. Nur Rieux’ alter Patient überwand sein Asthma und freute sich über dieses Wetter.
«Es brennt», sagte er, «das ist gut für die Bronchien.»
Es brannte tatsächlich, aber nicht mehr und nicht weniger als Fieber. Die ganze Stadt hatte Fieber, das war zumindest das Gefühl, das Doktor Rieux an dem Morgen verfolgte, als er unterwegs war in die Rue Faidherbe, um bei der Untersuchung von Cottards Selbstmordversuch dabei zu sein. Aber dieses Gefühl kam ihm töricht vor. Er schrieb es der Nervosität und den Sorgen zu, die ihn bedrängten, und gestand sich ein, dass es dringend nötig sei, etwas Ordnung in seine Gedanken zu bringen.
Als er eintraf, war der Kommissar noch nicht da. Grand wartete auf dem Treppenabsatz, und sie beschlossen, zuerst einmal zu ihm zu gehen und die Tür offen zu lassen. Der Angestellte der Stadtverwaltung bewohnte zwei karg eingerichtete Zimmer. Auffallend waren nur ein Bord aus Fichtenholz mit zwei oder drei Wörterbüchern und eine Wandtafel, auf der man noch, halb ausgewischt, die Wörter «blühende Alleen» lesen konnte. Grand zufolge hatte Cottard eine ruhige Nacht gehabt. Aber morgens war er mit Kopfschmerzen und zu keiner Reaktion fähig aufgewacht. Grand wirkte müde und nervös, ging hin und her und klappte auf dem Tisch einen dicken Ordner voll handbeschriebener Blätter auf und zu.
Währenddessen erzählte er dem Arzt, dass er Cottard nicht gut kenne, jedoch vermute, dass er über ein kleines Guthaben verfüge. Cottard sei ein sonderbarer Mensch. Ihre Beziehung habe sich lange auf gelegentliches Grüßen im Treppenhaus beschränkt.