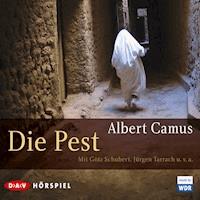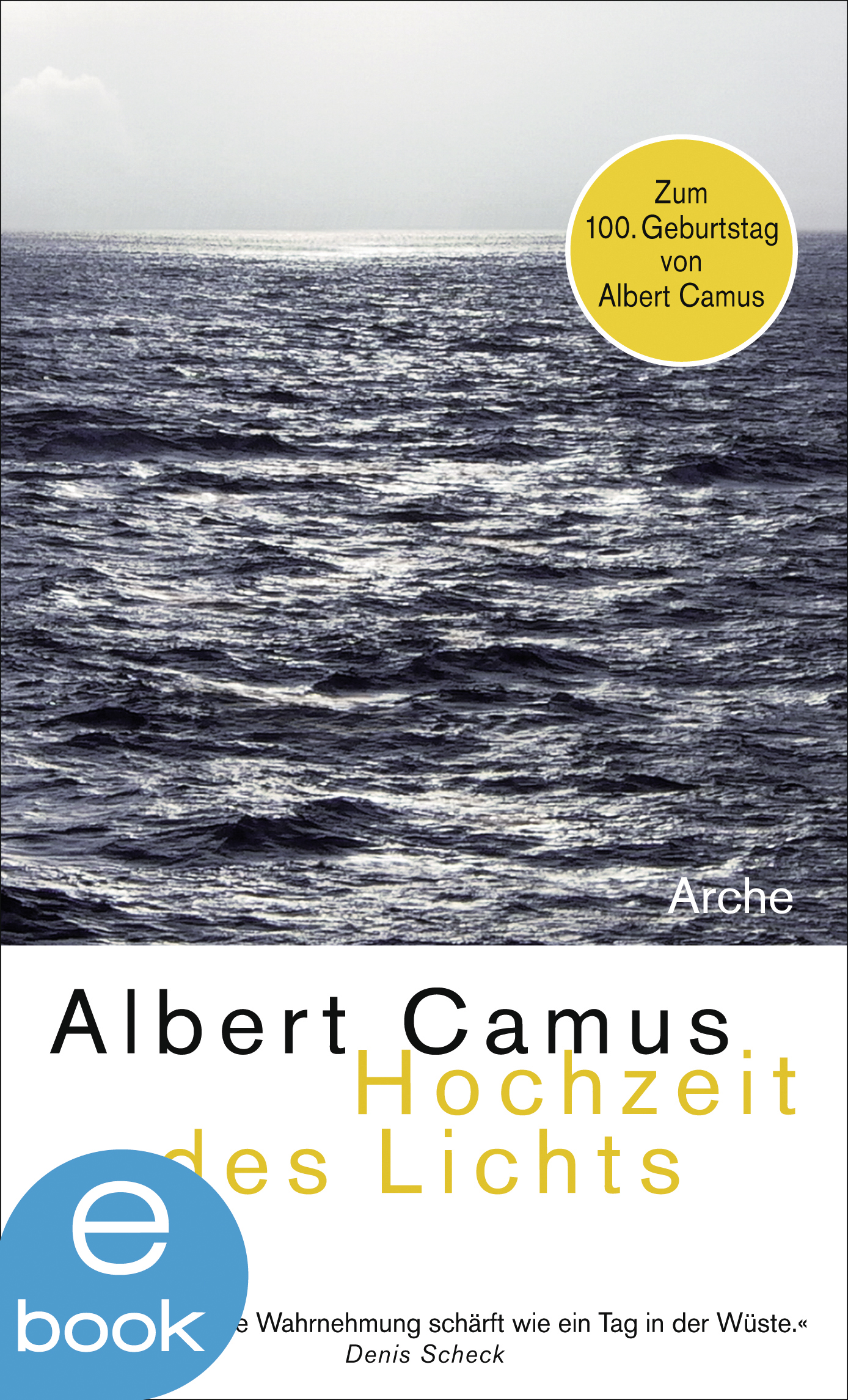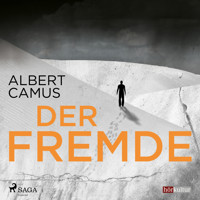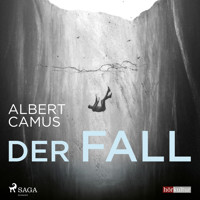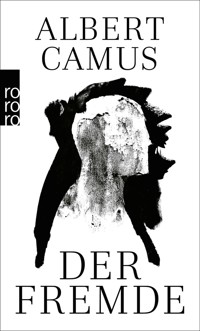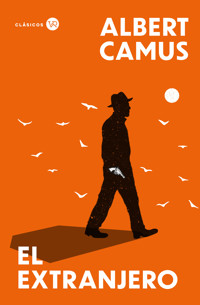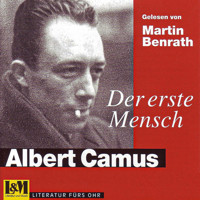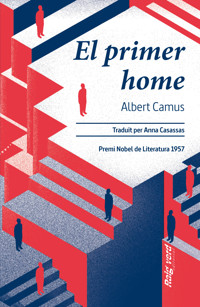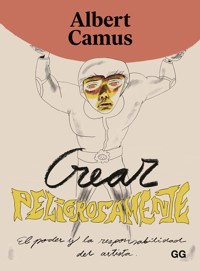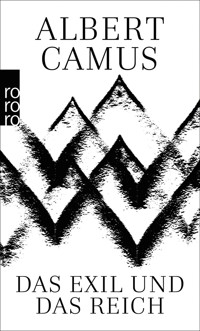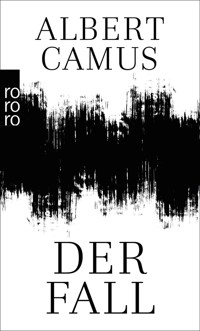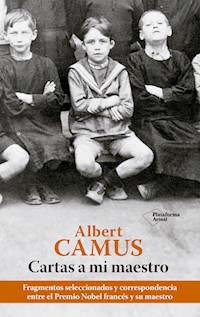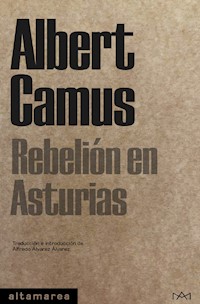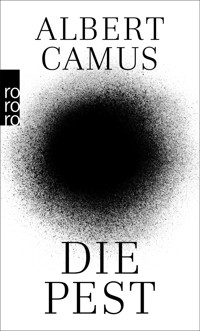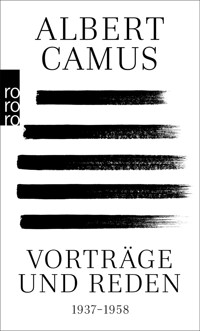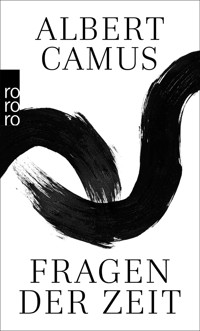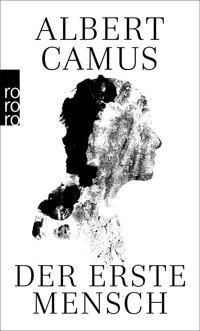
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ergreifendes Selbstzeugnis über Camus' Kindheit in Armut und die Suche nach Identität. In Der erste Mensch erzählt Albert Camus, gespiegelt in der Figur Jacques Cormery, von seiner Kindheit im Armenviertel Algiers. Aufgewachsen mit seiner fast tauben, analphabetischen Mutter und einer dominanten Großmutter, beginnt er, über die eigene Herkunft zu reflektieren und nach einer Vaterfigur zu suchen. Dieses posthum veröffentlichte, unvollendete Werk gewährt einen intimen Einblick in das Leben des Literaturnobelpreisträgers und Philosophen. [Das handgeschriebene Manuskript wurde bei dem tödlichen Autounfall Camus' in seiner Mappe gefunden. Es erscheint hier, ohne dass an dem unkorrigierten Fragment Änderungen vorgenommen wurden.] «Inszeniert wie ein Roman, enthält ‹Der erste Mensch› eine bewegende Autobiographie der algerischen Kindheit Albert Camus': das intimste Selbstzeugnis, das der diskrete und scheue Autor hinterlassen hat.» (Der Spiegel)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Albert Camus
Der erste Mensch
Über dieses Buch
Gespiegelt in der Figur Jacques Comery erzählt Camus von seiner Kindheit, die er mit seiner fast tauben, analphabetischen Mutter und einer dominanten Großmutter im Armenviertel Algiers verbringt. Auf der Suche nach einer Vaterfigur beginnt er, über die eigene Herkunft zu reflektieren.
[Das handgeschriebene Manuskript wurde bei dem tödlichen Autounfall Camus’ in seiner Mappe gefunden. Es erscheint hier, ohne dass an dem unkorrigierten Fragment Änderungen vorgenommen wurden.]
«Inszeniert wie ein Roman, enthält ‹Der erste Mensch› eine bewegende Autobiographie der algerischen Kindheit Albert Camus´: das intimste Selbstzeugnis, dass der diskrete und scheue Autor hinterlassen hat.» (Der Spiegel)
Vita
Albert Camus wurde am 7. November 1913 in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Von 1933 bis 1936 studierte er an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama «Caligula», das 1945 uraufgeführt wurde. Camus zog 1940 nach Paris. Neben seinen Dramen begründeten der Roman «Der Fremde» und der Essay «Der Mythos von Sisyphos» sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall.
Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Uli Aumüller übersetzt u.a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021
Copyright © 1995 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Le premier homme» Copyright © 1994 by Éditions Gallimard, Paris
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel «Le premier homme» im Verlag Galimard, Paris, als Band VII der Cahiers Albert Camus.
Brief von Louis Germains (S. 283) Copyright © 1994 by Bibliothèque Nationale, Paris
Covergestaltung Anzinger & Rasp, München
Coverabbildung Sloop Communications/iStock
ISBN 978-3-644-00453-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Editorische Notiz
Erster Teil Suche nach dem Vater
Saint-Brieuc
3. Saint-Brieuc und Malan (J.G.)
4. Die Spiele des Kindes
5. Der Vater. Sein Tod. Der Krieg. Der Anschlag
6. Die Familie
Étienne
6a Die Schule
7. ondovi: Die Kolonisierung und der Vater
Zweiter Teil Der Sohn oder Der erste Mensch
1. Lycée
Der Hühnerstall und das Abschlachten des Huhns
Donnerstage und Ferien
2. Sich selbst unklar
Anhang
Blatt I
Blatt II
Blatt III
Blatt IV
Blatt V
Der erste Mensch
Zwei Briefe
Editorische Notiz
Der erste Mensch ist das Werk, an dem Albert Camus bis zu seinem Tod arbeitete. Das Manuskript wurde bei dem tödlichen Autounfall am 4. Januar 1960 in seiner Mappe gefunden. Es besteht aus 144 mit der Hand in einer eiligen, schwer entzifferbaren Schrift heruntergeschriebenen Seiten, manche ohne Punkt und Komma, die nie überarbeitet wurden.
Der hier erstmals veröffentlichte Text wurde nach dem Manuskript und einer ersten Maschinenabschrift von Francine Camus, der Witwe des Autors, erstellt. Zum besseren Verständnis wurde die Zeichensetzung ergänzt. Die nicht eindeutig lesbaren Wörter stehen in eckigen Klammern, die Wörter oder Satzteile, die nicht entziffert werden konnten, als Leerzeichen in eckigen Klammern. Vom Verfasser über die Wörter geschriebene Varianten sind mit einem Sternchen, Zusätze am Rand mit einem Kleinbuchstaben, Anmerkungen der Herausgeberin mit einer Zahl [Anmerkungen der Übersetzerin mit Großbuchstaben] markiert und werden unten auf der Seite aufgeführt.
Im Anhang finden sich die (hier von I bis V nummerierten) Blätter, die teils in das Manuskript eingelegt waren (Blatt 1 vor das 4. Kapitel, Blatt II vor das Kapitel 6 a), teils an das Manuskriptende angefügt waren (Blatt III, IV und V).
Es folgt das Heft mit dem Titel Der erste Mensch (Notizen und Pläne), ein kleines Spiralheft mit kariertem Papier, aus dem der Leser ersehen kann, wie der Autor sein Werk weiterzuentwickeln gedachte.
Nach der Lektüre von Der erste Mensch wird man verstehen, weshalb wir auch den Brief Albert Camus’, den er nach der Verleihung des Literaturnobelpreises an seinen Volksschullehrer Louis Germain schickte, und dessen letzten Brief an ihn im Anhang abdrucken.
Mein Dank gilt Odette Diagne Créach, Roger Grenier und Robert Gallimard für ihre großzügige, beständige Freundschaft und Hilfe.
Catherine Camus
Erster TeilSuche nach dem Vater
Fürsprecher: Wwe. Camus
Dir, die Du dieses Buch nie wirst lesen können[*]
Über dem Karren, der auf einer steinigen Straße entlangfuhr, zogen große, dichte Wolken in der Abenddämmerung gen Osten. Drei Tage zuvor hatten sie sich über dem Atlantik aufgebläht, hatten auf den Westwind gewartet, hatten sich dann in Bewegung gesetzt, zuerst langsam und immer schneller, waren über das herbstlich phosphoreszierende Wasser geradewegs auf den Kontinent zugeflogen und an den marokkanischen Gebirgskämmen zerfleddert[*], hatten sich über den Hochebenen Algeriens wieder zusammengeschart und versuchten jetzt, im Anflug auf die tunesische Grenze, das Tyrrhenische Meer zu erreichen, um sich dort aufzulösen. Nach einer Strecke von Tausenden von Kilometern über dieser vom bewegten Meer im Norden und von den erstarrten Sandwogen im Süden geschützten Art unermesslicher Insel, die sie über diesem namenlosen Land kaum schneller zurücklegten, als es jahrtausendelang die Reiche und Völker getan hatten, erlahmte ihr Schwung, und manche verflüssigten sich schon zu einzelnen dicken Regentropfen, die auf das Stoffdach über den vier Reisenden zu klopfen begannen.
Der Karren knirschte über die recht klar sich abzeichnende, aber kaum befestigte Straße. Hin und wieder schoss ein Funke unter der Eisenfelge oder unter dem Huf eines Pferdes hervor, und ein Feuerstein schlug gegen das Holz des Karrens oder bohrte sich im Gegenteil mit einem dumpfen Geräusch in die weiche Erde des Straßengrabens. Die beiden kleinen Pferde liefen indessen gleichmäßig, kaum einmal stolpernd, mit vorgewölbter Brust, um den schweren, mit Möbeln vollgeladenen Karren zu ziehen, und ließen mit ihrem unterschiedlichen Traben rastlos die Straße hinter sich. Das eine schnaubte mitunter laut und geriet aus dem Trab. Der Araber, der lenkte, ließ dann die abgewetzten[*] Zügel flach auf seinen Rücken klatschen, und das Tier fiel brav in seinen Rhythmus zurück.
Der Mann, der auf der vorderen Bank neben dem Lenker saß, ein Franzose über dreißig, sah mit verschlossenem Gesicht auf die beiden Kruppen, die sich unter ihm auf und ab bewegten. Mittelgroß, stämmig, mit länglichem Gesicht und hoher, breiter Stirn, einem energischen Kiefer und hellen Augen, trug er trotz der vorgerückten Jahreszeit eine Drillichjacke mit drei Knöpfen, die nach der Mode der damaligen Zeit am Kragen zugeknöpft war, und auf dem kurzgeschnittenen Haar eine leichte Schirmmütze[*][*]. Sobald der Regen auf das Verdeck über ihnen zu trommeln begann, drehte er sich ins Wageninnere um: «Geht’s dir gut?», rief er. Auf einer zwischen die erste Bank und einen Haufen alter Koffer und Möbel eingezwängten zweiten Bank lächelte eine unzureichend gekleidete, aber in einen großen Schal aus grober Wolle gehüllte Frau ihn schwach an. «Ja, ja», sagte sie mit einer leichten, entschuldigenden Geste. Ein vierjähriger kleiner Junge schlief an sie gelehnt. Sie hatte ein sanftes, ebenmäßiges Gesicht, das schön gewellte schwarze Haar der Spanierin, eine gerade kleine Nase, schöne, warmherzige braune Augen. Aber etwas in diesem Gesicht fiel auf. Es war nicht nur das Maskenhafte, das die Müdigkeit oder Ähnliches vorübergehend ihren Zügen aufprägte, nein, eher ein Ausdruck von Abwesenheit und lieblicher Zerstreutheit, wie manche Naive ihn ständig zeigen, der sich hier aber flüchtig über die Schönheit der Gesichtszüge legte. In die so auffällige Güte des Blicks mischte sich bisweilen auch ein Funke unsinniger Furcht, der sogleich wieder erlosch. Mit der flachen, schon von der Arbeit ruinierten und an den Gelenken knotigen Hand klopfte sie leicht auf den Rücken ihres Mannes: «Es geht, es geht», sagte sie. Und sofort hörte sie auf zu lächeln, um unter dem Verdeck auf die Straße zu blicken, wo schon Pfützen zu schimmern begannen.
Der Mann drehte sich wieder zu dem Araber um, der still unter seinem Turban mit gelben Schnürchen saß, wie aufgeplustert von derben, über den Waden zusammengebundenen Hosen mit breitem Hosenboden. «Ist es noch weit?» Der Araber lächelte unter seinem gewaltigen weißen Schnurrbart. «Acht Kilometer, und du bist da.» Der Mann drehte sich um, sah seine Frau ohne Lächeln, aber aufmerksam an. Sie hatte den Blick nicht von der Straße gewandt. «Gib mir die Zügel», sagte der Mann. – «Meinetwegen», sagte der Araber. Er reichte ihm die Zügel, der Mann stieg über den alten Araber hinweg, während der unter ihm auf den Platz rutschte, den er eben verlassen hatte. Mit zwei Schlägen der flachen Zügel übernahm der Mann die Pferde, die ihren Trab verschärften und plötzlich gerader zogen. «Du kennst Pferde», sagte der Araber. Die Antwort kam knapp und ohne dass der Mann lächelte: «Ja», sagte er.
Die Helligkeit hatte abgenommen, und auf einmal wurde es Nacht. Der Araber holte die links von ihm hängende Laterne aus ihrer Schließklappe und verbrauchte, dem Wageninnern zugedreht, mehrere dicke Streichhölzer, um ihre Kerze anzuzünden. Dann hängte er die Laterne wieder auf. Der Regen fiel jetzt sanft und stetig. Er glänzte im schwachen Licht der Lampe und erfüllte die vollständige Finsternis ringsum mit einem leisen Rauschen. Hin und wieder rollte der Karren an Dornbüschen, an sekundenlang schwach beleuchteten niedrigen Bäumen vorbei. Die übrige Zeit aber fuhr er in einem durch die Dunkelheit noch ausgedehnter wirkenden leeren Raum. Nur Gerüche von verbranntem Gras oder, plötzlich, ein starker Geruch nach Dünger erinnerten daran, dass man mitunter an bebauten Feldern entlangfuhr. Die Frau sagte etwas hinter dem Lenkenden, der seine Pferde ein wenig zügelte und sich nach hinten beugte. «Da ist niemand», wiederholte die Frau. – «Hast du Angst?» – «Wie?» Der Mann wiederholte seinen Satz, diesmal aber schreiend. «Nein, nein, nicht, wenn du da bist.» Aber sie wirkte unruhig. «Du hast Schmerzen», sagte der Mann. – «Ein bisschen.» Er trieb seine Pferde an, und wieder hallte nur der laute Lärm der Räder, die die Furchen durchquerten, und der acht Hufeisen, die auf die Straße schlugen, durch die Nacht.
Es war eine Nacht im Herbst 1913. Die Reisenden waren zwei Stunden zuvor vom Bahnhof von Bône abgefahren, wo sie nach einer Nacht und einem Tag Fahrt auf den harten Bänken der dritten Klasse von Algier angekommen waren. Sie hatten am Bahnhof den Wagen und den Araber vorgefunden, der sie erwartete, um sie zu dem Gut in der Nähe eines kleinen Dorfes etwa zwanzig Kilometer landeinwärts zu bringen, dessen Verwaltung der Mann übernehmen sollte. Es hatte gedauert, die Koffer und ein paar Sachen aufzuladen, und dann hatte die schlechte Straße sie noch weiter aufgehalten. Als bemerke er die Unruhe seines Mitreisenden, sagte der Araber: «Keine Angst. Hier gibt es keine Banditen.» – «Die gibt es überall», sagte der Mann. «Aber ich habe das Nötige dabei.» Und er klopfte auf seine schmale Tasche. «Du hast recht», sagte der Araber. « ’s gibt immer Verrückte.» In dem Augenblick rief die Frau ihren Mann. «Henri», sagte sie, «es tut weh.» Der Mann fluchte und spornte seine Pferde noch etwas mehr an.[*] «Wir sind gleich da», sagte er. Nach einer Weile sah er wieder nach seiner Frau. «Tut es noch weh?» Sie lächelte ihn mit einer seltsamen Zerstreutheit an, jedoch ohne dass sie zu leiden schien. «Ja, sehr.» Er sah sie mit dem gleichen Ernst an. Und sie entschuldigte sich wieder. «Es ist nicht schlimm. Das kommt vielleicht von der Zugfahrt.» – «Sieh mal», sagte der Araber, «das Dorf.» Tatsächlich konnte man links von der Straße, etwas weiter weg die im Regen verschwommenen Lichter von Solférino sehen. «Aber du nimmst die Straße rechts», sagte der Araber. Der Mann zögerte, drehte sich zu seiner Frau um. «Fahren wir zum Haus oder ins Dorf?», fragte er. – «Oh, zum Haus, das ist besser.» Ein Stück weiter schwenkte der Wagen nach rechts in Richtung des unbekannten Hauses, das sie erwartete. «Noch einen Kilometer», sagte der Araber. «Wir sind gleich da», sagte der Mann zu seiner Frau hin. Sie saß zusammengekrümmt, das Gesicht in den Armen. «Lucie», sagte der Mann. Sie regte sich nicht. Der Mann berührte sie mit der Hand. Sie weinte lautlos: Er schrie, wobei er die Silben einzeln aussprach und seine Worte mit Gebärden begleitete: «Du legst dich gleich hin. Ich hole den Doktor.» – «Ja. Hol den Doktor. Ich glaube, es ist soweit.» Der Araber sah sie erstaunt an. «Sie bekommt was Kleines», sagte der Mann. «Gibt es im Dorf einen Doktor?» – «Ja. Ich hole ihn, wenn du willst.» – «Nein, du bleibst im Haus. Du passt auf. Ich bin schneller. Hat er einen Wagen oder ein Pferd?» – «Einen Wagen.» Dann sagte der Araber zu der Frau: «Es wird ein Junge. Möge er schön sein.» Die Frau lächelte ihn an, ohne dass sie zu verstehen schien. «Sie hört nicht», sagte der Mann. «Im Haus schreist du laut und machst die entsprechenden Gesten.»
Der Wagen fuhr plötzlich fast geräuschlos. Die schmaler gewordene Straße hatte eine Tuffdecke. Sie führte an ziegelgedeckten kleinen Schuppen vorbei, hinter denen man die ersten Reihen der Weinfelder sah. Ein starker Geruch nach Traubenmost schlug ihnen entgegen. Sie ließen große Gebäude mit aufgestockten Dächern hinter sich, und die Räder knirschten auf dem Schlackebelag einer Art von baumlosem Hof. Der Araber nahm wortlos die Zügel und zog sie an. Die Pferde blieben stehen, und das eine schüttelte sich.[*] Der Araber zeigte auf ein weißgekalktes Häuschen. Ein kletternder Weinstock rankte sich um eine niedrige kleine Tür, deren Umkreis vom Sulfatspritzen blau verfärbt war. Der Mann sprang hinunter und lief durch den Regen zum Haus. Er öffnete die Tür, die in einen dunklen, nach leerer Feuerstelle riechenden Raum führte. Der nachfolgende Araber ging geradewegs in der Dunkelheit auf den Kamin zu, riss ein Streichholz an und zündete eine Petroleumlampe an, die in der Mitte des Raums über einem runden Tisch hing. Der Mann nahm sich kaum die Zeit, eine gekalkte Küche mit einem rotgekachelten Ausguss, einer alten Anrichte und einem aufgeweichten Kalender an der Wand wahrzunehmen. Eine ebenfalls rotgeflieste Treppe führte nach oben. «Mach Feuer», sagte er und ging wieder zum Wagen. (Er nahm den kleinen Jungen?) Die Frau wartete, ohne etwas zu sagen. Er nahm sie in die Arme, um sie herunterzuheben, hielt sie einen Augenblick an sich gedrückt und beugte ihren Kopf zurück. «Kannst du gehen?» – «Ja», sagte sie und streichelte ihm mit ihrer knotigen Hand den Arm. Er schleppte sie zum Haus. «Warte», sagte er. Der Araber hatte bereits das Feuer angemacht und legte mit genauen und geschickten Bewegungen Rebholz nach. Sie stand neben dem Tisch, die Hände auf dem Bauch, und ihr schönes, dem Licht der Lampe zugekehrtes Gesicht wurde jetzt von kurzen Schmerzwellen durchzogen. Sie schien weder die Feuchtigkeit noch den Geruch von Verwahrlosung und Elend zu bemerken. Der Mann machte sich oben in den Zimmern zu schaffen. Dann erschien er oben auf der Treppe. «Gibt es im Schlafzimmer keinen Kamin?» – «Nein», sagte der Araber. «In dem anderen auch nicht.» – «Komm»,sagte der Mann. Der Araber ging zu ihm hinauf. Dann sah man ihn mit dem Rücken voran auftauchen, eine Matratze tragend, die der Mann am anderen Ende hielt. Sie legten sie neben den Kamin. Der Mann schob den Tisch in eine Ecke, während der Araber wieder nach oben ging und bald wieder mit einem Kopfpolster und Decken herunterkam. «Leg dich da hin», sagte der Mann zu seiner Frau und führte sie zu der Matratze. Sie zögerte. Man roch jetzt den Geruch von feuchtem Rosshaar, der aus der Matratze stieg. «Ich kann mich nicht ausziehen», sagte sie und blickte sich furchtsam um, als entdecke sie erst jetzt diese Räumlichkeiten … «Zieh aus, was du drunter hast», sagte der Mann. Und er wiederholte: «Zieh deine Unterwäsche aus.» Dann zu dem Araber: «Danke. Spann ein Pferd aus. Ich reite ins Dorf.» Der Araber ging hinaus. Mit dem Rücken zu ihrem Mann, der sich auch umdrehte, nestelte die Frau an sich herum. Dann legte sie sich hin, und sobald sie lag und die Decke über sich zog, schrie sie ein einziges Mal, lange, aus vollem Hals, als habe sie sich mit einem Schlag von allen Schreien befreien wollen, die der Schmerz in ihr angestaut hatte. Der Mann, der neben der Matratze stand, ließ sie schreien, dann, als sie verstummte, nahm er seine Mütze ab, kniete sich auf ein Bein nieder und küsste die schöne Stirn über den geschlossenen Augen. Er setzte seine Mütze wieder auf und ging dann hinaus in den Regen. Das ausgespannte Pferd drehte sich schon um sich selbst, die Vorderbeine in die Schlacke gestemmt. «Ich hole einen Sattel», sagte der Araber. – «Nein, lass die Zügel dran. Ich reite es so. Bring die Koffer und die Sachen in die Küche. Hast du eine Frau?» – «Sie ist tot. Sie war alt.» – «Hast du eine Tochter?» – «Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe die Frau meines Sohnes.» – «Sag ihr, sie soll kommen.» – «Mach ich. Geh in Frieden.» Der Mann sah den unbeweglich im feinen Regen stehenden alten Araber an, der ihn unter seinem nassen Schnurrbart hervor anlächelte. Er lächelte immer noch nicht, aber er sah ihn mit seinen hellen, aufmerksamen Augen an. Dann reichte er ihm die Hand, die der andere nach arabischer Sitte mit den Fingerspitzen nahm und dann an den Mund führte. Der Mann drehte sich mit einem Knirschen auf der Schlacke um, ging auf das Pferd zu, schwang sich auf dessen bloßen Rücken und entfernte sich in schwerfälligem Trab.
Nach dem Verlassen des Gutes schlug der Mann die Richtung zu der Kreuzung ein, von wo aus sie zum ersten Mal die Lichter des Dorfes erblickt hatten. Sie leuchteten jetzt heller, der Regen hatte aufgehört, und die Straße, die rechts auf sie zuführte, lief schnurstracks durch Weinfelder, deren Stützdrähte stellenweise glänzten. Etwa auf halbem Weg wurde das Pferd von sich aus langsamer und fiel in Schritttempo. Sie näherten sich einer Art rechteckiger Hütte, deren einer Teil, der einen Raum bildete, gemauert war, und der andere, der größere, war aus Brettern gebaut, mit einem großen Vordach, das über einer Art vorspringendem Ladentisch herabhing. Eine Tür war in den gemauerten Teil eingesetzt, über der man lesen konnte: «Landwirtschaftliche Kantine Mme Jacques». Unter der Tür drang Licht hervor. Der Mann hielt sein Pferd dicht neben der Tür an und klopfte, ohne abzusteigen. Sofort fragte eine schallende, entschiedene Stimme von innen: «Was ist?» – «Ich bin der neue Gutsverwalter von Saint-Apôtre. Meine Frau kommt nieder. Ich brauche Hilfe.» Niemand antwortete. Nach einer Weile wurden Riegel aufgeschoben, Querbalken angehoben und dann weggezogen, und die Tür ging einen Spaltbreit auf. Man konnte den schwarzen, kraushaarigen Kopf einer Europäerin mit vollen Wangen und einer etwas platten Nase über dicken Lippen sehen. «Ich heiße Henri Cormery. Können Sie zu meiner Frau gehen? Ich hole den Doktor.» Sie sah ihn fest mit einem Blick an, der es gewohnt war, Menschen und Widrigkeiten einzuschätzen. Er hielt ihrem Blick stand, aber ohne ein Wort der Erklärung hinzuzufügen. «Ich gehe zu ihr», sagte sie. «Machen Sie schnell.» Er bedankte sich und spornte das Pferd mit den Fersen an. Einige Augenblicke später erreichte er, zwischen so etwas wie Wällen aus trockener Erde hindurchreitend, das Dorf. Vor ihm erstreckte sich die offenbar einzige Straße, gesäumt von einstöckigen kleinen Häusern, alle gleich, an denen er bis zu einem kleinen Platz mit Tuffbelag entlangritt, auf dem überraschenderweise ein Musikpavillon mit schmiedeeiserner Verkleidung stand. Der Platz war wie die Straße ausgestorben. Cormery ritt schon auf eines der Häuser zu, als das Pferd einen Satz zur Seite machte. Ein Araber in einem dunklen, abgerissenen Burnus tauchte aus der Dunkelheit auf und kam auf ihn zu. «Das Haus des Doktors», fragte Cormery sofort. Der andere sah den Reiter prüfend an. «Komm», sagte er, nachdem er ihn geprüft hatte. Sie gingen die Straße in umgekehrter Richtung zurück. An einem der Häuser, das über dem Erdgeschoss um eine Etage aufgestockt war, die man über eine gekalkte Treppe erreichte, konnte man lesen: «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.» Daneben befand sich ein von verputzten Mauern umgebener kleiner Garten, in dem ein Haus stand, auf das der Araber zeigte: «Das ist es», sagte er. Cormery sprang vom Pferd und durchquerte mit Schritten, die keinerlei Müdigkeit verrieten, den Garten, von dem er nur, genau in der Mitte, eine Zwergpalme mit vertrockneten Zweigen und einem verfaulten Stamm sah. Er klopfte an die Tür. Niemand antwortete.[*] Er drehte sich um. Der Araber wartete schweigend. Der Mann klopfte noch einmal. Auf der anderen Seite waren Schritte zu hören und verhielten hinter der Tür. Aber sie öffnete sich nicht. Cormery klopfte wieder und sagte: «Ich suche den Doktor.» Sofort wurden Riegel zurückgeschoben, und die Tür ging auf. Ein Mann mit jungem, pausbäckigem Gesicht, aber fast weißem Haar, groß und stattlich, wurde sichtbar, dessen Beine in Gamaschen steckten und der gerade eine Art Jagdrock überzog. «Nanu, wo kommen Sie denn her?», sagte er lächelnd. «Ich habe Sie noch nie gesehen.» Der Mann gab Auskunft. «Ach ja, der Bürgermeister hat mich informiert. Aber sagen Sie mal, das ist eine komische Gegend, um hier niederzukommen.» Der andere sagte, er habe das Ereignis später erwartet und sich wohl getäuscht. «Gut, das passiert jedem. Reiten Sie los, ich sattle Matador und komme nach.»
Auf der Hälfte des Rückwegs, im wieder einsetzenden Regen, holte der auf einem Apfelschimmel reitende Arzt Cormery ein, der völlig durchnässt war, aber noch immer gerade auf seinem schweren Ackergaul saß. «Eine komische Art anzukommen», rief der Doktor. «Aber Sie werden sehen, der Landstrich hat seine guten Seiten, abgesehen von den Moskitos und den Banditen der Gegend.» Er ritt auf gleicher Höhe mit seinem Begleiter. «Wohlgemerkt, mit den Moskitos haben Sie bis zum Frühling Ihre Ruhe. Mit den Banditen … » Er lachte, aber der andere setzte seinen Weg wortlos fort. Der Doktor sah ihn neugierig an: «Fürchten Sie nichts», sagte er, «alles wird gutgehen.» Cormery wandte dem Doktor seine hellen Augen zu, sah ihn ruhig an und sagte mit einem Anflug von Herzlichkeit: «Ich habe keine Angst. Ich bin harte Schläge gewohnt.» – «Ist es Ihr Erstes?» – «Nein, ich habe einen vierjährigen Jungen bei meiner Schwiegermutter in Algier gelassen.» [*] Sie kamen an die Kreuzung und schlugen die Straße zum Gut ein. Bald flog die Schlacke unter den Füßen der Pferde. Als die Pferde anhielten und es wieder still wurde, hörte man aus dem Haus einen lauten Schrei. Die beiden Männer stiegen ab.
Ein Schatten erwartete sie im Schutz des tropfenden Weinstocks. Im Näherkommen erkannten sie den alten Araber, der einen Sack über dem Kopf trug. «Guten Tag, Kaddour», sagte der Doktor. «Wie steht’s?» – «Ich weiß nicht, ich gehe ja nicht zu den Frauen rein.» – «Ein guter Grundsatz», sagte der Doktor. «Besonders wenn die Frauen schreien.» Aber von innen kam kein Schrei mehr. Der Doktor öffnete die Tür und ging hinein, Cormery hinter ihm her.
Ein großes Feuer aus Rebholz loderte ihnen gegenüber im Kamin und beleuchtete den Raum noch heller als die Petroleumlampe mit Kupfer- und Perlenfassung, die in der Deckenmitte hing. Rechts von ihnen hatte sich der Ausguss mit Metallkannen und Handtüchern gefüllt. Links, vor eine wacklige Anrichte aus Fichtenholz, war der Tisch aus der Mitte geschoben worden. Eine alte Reisetasche, eine Hutschachtel und kleine Bündel lagen nun darauf. In allen Ecken des Zimmers stapelten sich überall alte Gepäckstücke und ließen nur in der Mitte, nicht weit vom Feuer, freien Raum. An dieser Stelle, auf der quer zum Kamin ausgebreiteten Matratze, lag die Frau mit etwas nach hinten auf ein Kissen ohne Bezug geneigtem Kopf und nun offenem Haar. Die Decke war jetzt nur noch über die Hälfte der Matratze gebreitet. Links von der Matratze verbarg die kniende Kantinenwirtin den aufgedeckten Teil der Matratze. Sie wrang über einer Schüssel ein Handtuch aus, von dem gerötetes Wasser herabtropfte. Rechts saß im Schneidersitz eine Araberin ohne Schleier und hielt in einer darbietenden Haltung eine Zweite, etwas abgestoßene Emailschüssel, in der heißes Wasser dampfte. Die beiden Frauen waren an den zwei Enden eines zusammengefalteten Betttuchs, das unter der Kranken lag. Die Schatten und die Flammen des Kamins stiegen und fielen auf den Kalkwänden, den Gepäckstücken, mit denen das Zimmer vollgestellt war, und glühten, noch näher daran, auf den Gesichtern der beiden Helferinnen und dem Körper der bis zum Hals zugedeckten Kranken auf.
Als die beiden Männer eintraten, sah die Araberin sie mit einem kurzen Lachen an, während ihre dünnen braunen Arme noch immer die Schüssel darboten. Die Kantinenwirtin sah sie an und rief fröhlich: «Wir brauchen Sie nicht mehr, Doktor. Es ist von ganz allein gekommen.» Sie stand auf, und die beiden Männer sahen neben der Kranken etwas Formloses und Blutiges, das von einer Art regloser Bewegung belebt wurde und aus dem jetzt ein anhaltendes Geräusch kam, einem fast unmerklichen unterirdischen Knirschen ähnlich.[*] «Das sagt man so», sagte der Doktor. «Ich hoffe, Sie haben die Nabelschnur nicht angerührt.» – «Nein», sagte die andere lachend. «Wir mussten Ihnen schließlich etwas übrig lassen.» Sie stand auf und überließ dem Doktor ihren Platz, der das Neugeborene wieder Cormerys Blick entzog, der an der Tür stehen geblieben war und seine Mütze abgenommen hatte. Der Doktor ging in die Hocke, öffnete seine Arzttasche und nahm dann die Schüssel aus der Hand der Araberin, die sich sofort aus dem beleuchteten Bereich entfernte und sich in die dunkle Ecke des Kamins verzog. Noch immer mit dem Rücken zur Tür, wusch sich der Doktor die Hände, dann goss er Alkohol darüber, der ein wenig nach Marc roch und dessen Geruch sofort das ganze Zimmer erfüllte. Im gleichen Augenblick hob die Kranke den Kopf und sah ihren Mann. Ein wunderbares Lächeln verklärte das schöne, erschöpfte Gesicht. Cormery ging zu der Matratze hinüber. «Er ist da», sagte sie in einem Atemzug und streckte die Hand nach dem Kind aus. «Ja», sagte der Doktor. «Aber liegen Sie still.» Die Frau sah ihn fragend an. Cormery, der am Fuß der Matratze stand, machte ihr ein beruhigendes Zeichen. «Leg dich hin.» Sie ließ sich zurücksinken. In dem Augenblick wurde der Regen auf dem alten Ziegeldach stärker. Der Doktor hantierte unter der Decke. Dann richtete er sich auf und schien vor sich etwas zu schütteln. Ein leiser Schrei wurde hörbar. «Es ist ein Junge», sagte der Doktor. «Und ein Prachtstück.» – «Der fängt ja gut an», sagte die Kantinenwirtin. «Mit einem Umzug.» Die Araberin in der Ecke lachte und klatschte zweimal in die Hände. Cormery sah sie an, und sie wandte sich verwirrt ab. «Gut», sagte der Doktor. «Lassen Sie uns jetzt einen Moment allein.» Cormery sah seine Frau an. Aber ihr Gesicht war noch immer nach hinten geneigt. Nur die entspannt auf der groben Decke liegenden Hände erinnerten noch an das Lächeln, das eben den armseligen Raum erfüllt und verschönt hatte. Er setzte seine Mütze auf und ging zur Tür. «Wie wollen Sie ihn nennen?», rief die Kantinenwirtin. – «Ich weiß nicht, wir haben nicht darüber nachgedacht.» Er sah ihn an. «Wir nennen ihn Jacques, weil Sie dabei waren.» Die andere lachte laut, und Cormery ging hinaus. Unter dem Weinstock wartete der Araber, immer noch mit seinem Sack auf dem Kopf. Er sah Cormery an, der nichts sagte. «Da», sagte der Araber und hielt ihm ein Stück seines Sacks hin. Cormery stellte sich darunter. Er fühlte die Schulter des alten Arabers und roch den Tabakrauch, den dessen Kleidung verströmte, und spürte den Regen, der auf den Sack über ihren beiden Köpfen fiel. «Es ist ein Junge», sagte er, ohne seinen Gefährten anzusehen. – «Gelobt sei Gott», antwortete der Araber. «Du bist ein Chef.» Das Tausende Kilometer weit hergekommene Wasser fiel ohne Unterlass auf die von zahlreichen Pfützen ausgehöhlte Schlacke, auf die Weinfelder weiter hinten, und die Stützdrähte glänzten noch immer unter den Tropfen. Es würde das Meer im Osten nicht erreichen und würde nun das ganze Land überschwemmen, das Sumpfgebiet am Fluss und die umliegenden Berge, das fast menschenleere, unermessliche Land, dessen starker Geruch zu den beiden unter demselben Sack dicht nebeneinander stehenden Männern drang, während hinter ihnen dann und wann noch ein schwacher Schrei erklang.
Spätnachts betrachtete Cormery, der in langer Unterhose und im Unterhemd auf einer zweiten Matratze neben seiner Frau lag, die an der Decke tanzenden Flammen. Das Zimmer war jetzt fast eingerichtet. An der anderen Seite seiner Frau, in einem Wäschekorb, schlummerte das Kind ohne einen Laut, außer manchmal leisem Gegluckse. Auch seine Frau schlief mit ihm zugewandtem Gesicht und leicht geöffnetem Mund. Der Regen hatte aufgehört. Am nächsten Tag würde er sich an die Arbeit machen müssen. Neben ihm erinnerte ihn die schon verbrauchte, fast holzartige Hand seiner Frau ebenfalls an diese Arbeit. Er streckte seine Hand aus, legte sie sanft auf die der Kranken, ließ sich zurücksinken und schloss die Augen.
Saint-Brieuc
[*]Vierzig Jahre später betrachtete ein Mann im Gang des Zuges nach Saint-Brieuc missbilligend das unter der blassen Sonne eines Frühlingsnachmittags vorbeiziehende, mit Dörfern und hässlichen Häusern übersäte herbe, flache Land, das sich von Paris bis zum Ärmelkanal erstreckt. Wiesen und Felder eines seit Jahrhunderten bis zum letzten Quadratmeter kultivierten Bodens folgten vor seinem Blick aufeinander. Ohne Kopfbedeckung, mit kurz geschnittenem Haar, länglichem Gesicht und feinen Zügen, mittelgroß, mit blauen, gerade blickenden Augen, wirkte der Mann trotz seiner vierzig noch schlank in seinem Regenmantel. Mit fest auf die Querstange gestützten Händen, das Körpergewicht auf eine Hüfte verlagert, den Oberkörper gereckt, machte er einen ungezwungenen, energischen Eindruck. Der Zug wurde jetzt langsamer und hielt schließlich in einem schäbigen kleinen Bahnhof. Nach einer Weile ging eine recht elegante junge Frau unter der Waggontür vorbei, an der der Mann stand. Sie blieb stehen, um ihren Koffer von der einen Hand in die andere zu nehmen, und erblickte dabei den Reisenden. Der sah sie lächelnd an, und sie konnte nicht anders als zurücklächeln. Der Mann ließ das Fenster herunter, aber schon fuhr der Zug weiter. «Schade», sagte er. Die junge Frau lächelte ihm immer noch zu.
Der Reisende ging in das Abteil dritter Klasse, wo er sich auf seinem Platz am Fenster niederließ. Ihm gegenüber saß zusammengesunken, mit geschlossenen Augen ein Mann mit schütterem angeklebtem Haar, der weniger alt war, als sein aufgedunsenes, rotgeädertes Gesicht vermuten ließ, und atmete heftig; er wurde offensichtlich von einer mühsamen Verdauung gequält und warf seinem Gegenüber hin und wieder schnelle[*] Blicke zu. Auf derselben Bank am Gang schnäuzte eine herausgeputzte Bäuerin, die einen erstaunlichen, mit einer Weintraube aus Wachs geschmückten Hut aufhatte, ein rothaariges Kind mit erloschenem, reizlosem Gesicht. Das Lächeln des Reisenden verschwand. Er zog eine Zeitschrift aus der Tasche und las zerstreut einen Artikel, der ihn zum Gähnen brachte.
Etwas später hielt der Zug an, und langsam kam ein kleines Schild, auf dem «Saint-Brieuc» stand, durch die Waggontür in Sicht. Der Reisende stand sofort auf, nahm ohne Anstrengung einen Koffer mit Ziehharmonikaboden aus der Gepäckablage über sich, und nachdem er seine Mitreisenden gegrüßt hatte, die seinen Gruß überrascht erwiderten, sprang er die drei Stufen seines Waggons hinunter. Auf dem Bahnsteig betrachtete er seine linke Hand, die noch schmutzig war vom Ruß auf dem kupfernen Geländer, das er gerade losgelassen hatte, zog ein Taschentuch hervor und wischte sie sorgfältig ab. Dann ging er auf den Ausgang zu, und auf dem Wege dahin schloss sich ihm eine Gruppe von dunkel gekleideten Reisenden mit unsauberem Teint an. Unter dem auf kleinen Säulen ruhenden Vordach wartete er geduldig darauf, seine Fahrkarte vorzuzeigen, wartete wieder, dass der schweigsame Beamte ihm seine Fahrkarte zurückgab, durchquerte einen Wartesaal mit schmutzigen nackten Wänden, die nur mit alten Plakaten geschmückt waren, auf denen selbst die Côte d’Azur etwas Rußiges angenommen hatte, und ging im schrägen Nachmittagslicht schnellen Schritts die vom Bahnhof in die Stadt führende Straße hinunter.
Im Hotel verlangte er das vorbestellte Zimmer, lehnte die Dienste des kartoffelgesichtigen Zimmermädchens ab, das sein Gepäck tragen wollte, und gab ihm trotzdem, nachdem es ihn zu seinem Zimmer gebracht hatte, ein Trinkgeld, das es überraschte und Sympathie auf seinem Gesicht hervorrief. Dann wusch er sich noch einmal die Hände und ging, ohne hinter sich abzuschließen, genauso schnell wieder hinunter. In der Halle begegnete er dem Zimmermädchen, fragte es, wo der Friedhof sei, bekam von ihm übertrieben ausführliche Erklärungen, hörte sie sich liebenswürdig an und schlug dann die angegebene Richtung ein. Er ging jetzt durch die von nichtssagenden Häusern mit hässlichen roten Ziegeln gesäumten tristen, schmalen Straßen. Manchmal zeigten alte Häuser mit sichtbaren Balken ihre krummen Schiefer. Die seltenen Passanten machten nicht einmal vor den Schaufenstern halt, die jene Glaswaren, jene Meisterwerke aus Plastik und Nylon und jene schauderhafte Keramik darboten, die man in allen Städten des modernen Abendlandes findet. Nur die Lebensmittelgeschäfte stellten Überfluss zur Schau. Der Friedhof war von abweisenden hohen Mauern umgeben. Am Tor Auslagen mit armseligen Blumen und Grabsteingeschäfte. Vor einem blieb der Reisende stehen, um ein Kind mit aufgewecktem Gesicht zu betrachten, das in einer Ecke auf einer noch unbeschrifteten Grabplatte seine Schulaufgaben machte. Dann trat er ein und ging zum Wärterhaus. Der Wärter war nicht da. Der Reisende wartete in dem ärmlich möblierten kleinen Büro, dann bemerkte er einen Plan, den er gerade entzifferte, als der Wärter hereinkam. Es war ein knorriger großer Mann mit kräftiger Nase, der unter seiner hochgeschlossenen dicken Jacke nach Schweiß roch. Der Reisende fragte nach dem Karree der Toten des Krieges von 1914. «Ja», sagte der andere. «Das heißt das Karree des Souvenir français. Welchen Namen suchen Sie?» – «Henri Cormery», antwortete der Reisende.
Der Wärter klappte ein in Packpapier eingeschlagenes großes Buch auf und fuhr mit seinem erdigen Finger eine Namenliste entlang. Sein Finger hielt inne. «Cormery, Henri», sagte er, «lebensgefährlich verwundet in der Marneschlacht, gestorben in Saint-Brieuc am 11. Oktober 1914.» – «Das ist er», sagte der Reisende. Der Wärter schlug das Buch zu. «Kommen Sie», sagte er. Und er ging vor ihm her zu den ersten Reihen von Gräbern, die einen bescheiden, die anderen eitel und hässlich, alle mit diesem Schnickschnack aus Marmor und Perlen bedeckt, der jeden beliebigen Ort der Welt verschandeln würde. «Ein Verwandter?», fragte der Wärter zerstreut. «Mein Vater.» – «Das ist hart», sagte der andere. – «Ach nein, ich war noch kein Jahr alt, als er gestorben ist. Sie verstehen also.» – «Ja», sagte der Wärter, «trotzdem. Es hat zu viele Tote gegeben.» Jacques Cormery erwiderte nichts. Gewiss hatte es zu viele Tote gegeben, aber was seinen Vater betraf, so konnte er sich keine Pietät aus den Fingern saugen, die er nicht empfand. Seit vielen Jahren, seitdem er in Frankreich lebte, nahm er sich vor zu tun, worum seine in Algerien gebliebene Mutter, worum sie[*] ihn schon so lange bat: sich das Grab seines Vaters anzusehen, das sie selbst nie gesehen hatte. Er fand, dass dieser Besuch überhaupt keinen Sinn hatte, einmal für ihn nicht, der seinen Vater nie gekannt hatte, fast nichts von ihm wusste und der konventionelle Gesten und Handlungen verabscheute, und andererseits für seine Mutter nicht, die nie von dem Verstorbenen sprach und sich von dem, was er sehen würde, nichts vorstellen konnte. Doch da sein alter Lehrer sich nach Saint-Brieuc zurückgezogen hatte und er auf diese Weise Gelegenheit fand, ihn wiederzusehen, hatte er sich entschlossen, diesem unbekannten Toten einen Besuch abzustatten und war sogar darauf aus gewesen, es zu tun, ehe er seinen alten Freund wieder sah, um sich dann ganz und gar frei zu fühlen. «Hier ist es», sagte der Wärter. Sie waren vor einem Karree angekommen, das umgeben war von kleinen, durch eine dicke, schwarzlackierte Kette miteinander verbundenen grauen Steinpflöcken. Die zahlreichen Steine waren alle gleich – schlichte Rechtecke mit Gravur, im gleichen Abstand in fortlaufenden Reihen aufgestellt. Alle waren mit einem frischen kleinen Blumenstrauß geschmückt. «Das Souvenir français hat seit vierzig Jahren die Pflege übernommen. Sehen Sie, da ist er.» Er zeigte auf einen Stein in der ersten Reihe. Jacques Cormery blieb in einiger Entfernung von dem Stein stehen. «Ich lasse Sie jetzt allein», sagte der Wärter. Cormery trat näher an den Stein und sah ihn zerstreut an. Ja, das war wirklich sein Name. Er blickte nach oben. An dem blasseren Himmel zogen langsam weiße und graue Wölkchen, und vom Himmel fiel abwechselnd zartes, dann dunkleres Licht. Um ihn herum auf dem weitläufigen Totenacker herrschte Stille. Nur von der Stadt her drang ein dumpfes Tosen über die hohen Mauern. Manchmal ging eine schwarze Gestalt zwischen den fernen Gräbern entlang. Den Blick auf das langsame Dahinsegeln der Wolken am Himmel gerichtet, versuchte Jacques Cormery unter dem Geruch der feuchten Blumen das Salzaroma zu wittern, das gerade vom fernen, unbewegten Meer her kam, als ihn das Klirren eines Eimers gegen den Marmor eines Grabes aus seiner Versunkenheit riss. In dem Augenblick las er auf dem Grab das Geburtsjahr seines Vaters, und er merkte, dass er es nicht kannte. Dann las er beide Jahreszahlen, «1885–1914», und rechnete mechanisch: neunundzwanzig Jahre. Plötzlich überfiel ihn ein Gedanke, der ihn bis ins Mark erschütterte. Er war vierzig Jahre alt. Der unter dieser Steinplatte begrabene Mann, der sein Vater gewesen war, war jünger als er.[*]
Und die Welle von Zärtlichkeit und Mitleid, die auf einmal sein Herz überflutete, war nicht die Gemütsregung, die den Sohn bei der Erinnerung an den verstorbenen Vater überkommt, sondern das verstörte Mitgefühl, das ein erwachsener Mann für das ungerecht hingemordete Kind empfindet – etwas entsprach hier nicht der natürlichen Ordnung, und eigentlich herrschte hier, wo der Sohn älter war als der Vater, nicht Ordnung, sondern nur Irrsinn und Chaos. Die Abfolge der Zeit selbst zerbrach ringsum ihn, den bewegungslos zwischen den Gräbern Stehenden, die er nicht mehr wahrnahm, und die Jahre hörten auf, sich jenem großen Strom folgend anzuordnen, der seinem Ende entgegenfließt. Sie waren nur mehr tosendes Hin- und Herbranden, in dem Jacques Cormery jetzt von Angst und Mitleid gepackt zappelte.[*] Er sah sich die anderen Steinplatten des Karrees an und erkannte an den Lebensdaten, dass dieser Boden angefüllt war mit Kindern, die die Väter von ergrauenden Männern gewesen waren, welche in diesem Augenblick zu leben vermeinten. Denn er selbst vermeinte zu leben, er hatte sich allein aufgebaut, er kannte seine Kraft, seine Energie, er bot die Stirn und hatte sich in der Hand. Doch in dem seltsamen Taumel, in dem er sich augenblicklich befand, wurde jenes Standbild, das jeder Mensch errichtet und im Feuer der Jahre härtet, um sich ihm anzuverwandeln und in ihm das letzte Zerbröckeln abzuwarten, schnell rissig, brach schon jetzt zusammen. Er war nur mehr dieses lebensgierige, gegen die tödliche Ordnung der Welt aufbegehrende verängstigte Herz, das ihn vierzig Jahre lang begleitet hatte und noch immer mit derselben Kraft gegen die Mauer schlug, die es vom Geheimnis allen Lebens trennte, die es überwinden, über die es hinausgehen und wissen wollte, wissen, bevor es starb, endlich wissen, um zu sein, ein einziges Mal, eine einzige Sekunde, aber für immer.
Er sah wieder sein verrücktes, mutiges, feiges, hartnäckiges, immer auf jenes Ziel, von dem er nichts wusste, gerichtete Leben vor sich, und in Wirklichkeit war es die ganze Zeit über verlaufen, ohne dass er versucht hätte, sich vorzustellen, was für ein Mensch es gewesen sein mochte, der ihm eben dieses Leben geschenkt hatte, um alsbald fortzugehen, um auf einem unbekannten Boden jenseits der Meere zu sterben. War er selbst mit neunundzwanzig Jahren nicht labil, krank, angespannt, eigenwillig, sinnlich, verträumt, zynisch und mutig. Ja, er war all das und vieles mehr, er war lebendig gewesen, ein Mensch eben, und doch hatte er an den Menschen, der hier ruhte, nie wie an ein lebendiges Wesen gedacht, sondern wie an einen Unbekannten, der früher einmal auf dem Boden gewandelt war, auf dem er geboren worden war, von dem seine Mutter ihm sagte, dass er ihm ähnlich sehe, und der auf dem Feld der Ehre gestorben war. Dabei kam es ihm jetzt so vor, als sei das Geheimnis, das er begierig aus Büchern und von Menschen zu erfahren getrachtet hatte, innig mit diesem Toten, diesem jüngeren Vater verbunden, mit dem, was er gewesen und dem, was aus ihm geworden war, und als habe er selbst das in weiter Ferne gesucht, was ihm zeitlich und blutsmäßig nahe war. Offen gestanden, hatte man ihm nicht geholfen. Bei einer Familie, in der wenig gesprochen, in der weder gelesen noch geschrieben wurde, bei einer unglücklichen, geistesabwesenden Mutter, wer hätte ihn über diesen jungen, bemitleidenswerten Vater informieren sollen? Niemand hatte ihn gekannt, außer seiner Mutter, die ihn vergessen hatte. Wahrscheinlich hätte er sich selbst informieren, fragen müssen. Aber einer, der wie er nichts hat und die ganze Welt will, hat bei all seiner Energie nicht genug davon, um sich aufzubauen und um die Welt zu erobern oder zu verstehen. Schließlich war es noch nicht zu spät, er konnte noch suchen, erfahren, wer dieser Mann war, der ihm jetzt näher schien als irgendein Mensch auf der Welt. Er konnte …
Der Nachmittag ging jetzt zu Ende. Das Rascheln eines Rocks in seiner Nähe, ein schwarzer Schatten, brachte ihn in seine Umgebung von Gräbern und Himmel zurück. Er musste gehen, er hatte hier nichts mehr zu tun. Doch er konnte sich von diesem Namen, von diesen Jahreszahlen nicht lösen. Unter dieser Steinplatte war nur Asche und Staub. Für ihn aber war sein Vater wieder lebendig, von einer seltsamen stummen Lebendigkeit, und es kam ihm so vor, als würde er ihn noch einmal verlassen, ihn in dieser Nacht wieder der endlosen Einsamkeit überlassen, in die man ihn geworfen und dann im Stich gelassen hatte. Der leere Himmel hallte von einem plötzlichen lauten Knall. Ein unsichtbares Flugzeug hatte die Schallmauer durchbrochen. Jacques Cormery kehrte dem Grab den Rücken und verließ seinen Vater.
3.Saint-Brieuc und Malan (J.G.)[*]
Abends beim Essen beobachtete J.C., wie sein alter Freund sich mit einer Art rastloser Gier über sein zweites Stück Keule hermachte; der Wind, der sich erhoben hatte, toste leise um das niedrige kleine Haus in einem Vorort nahe der Straße zum Strand. Als J.C. ankam, hatte er in der trockenen Gosse entlang dem Bürgersteig kleine Stücke vertrockneter Algen bemerkt, die mit dem Salzgeruch als Einziges die Nähe des Meeres heraufbeschworen. Victor Malan, der sein ganzes Berufsleben bei der Zollverwaltung gearbeitet hatte, war in dieser Kleinstadt, die er sich nicht ausgesucht hatte, in Pension gegangen, deren Wahl er aber nachträglich damit rechtfertigte, dass ihn hier nichts von der einsamen Meditation ablenke, weder übermäßige Schönheit noch übermäßige Hässlichkeit, noch die Einsamkeit als solche. Die Verwaltung von Sachen und die Führung von Menschen hatten ihn viel gelehrt, in erster Linie aber offenbar, dass man wenig weiß. Dabei war seine Bildung unermesslich, und J.C. bewunderte ihn rückhaltlos, weil Malan in einer Zeit, da die Männer in höheren Positionen so banal sind, der einzige Mensch war, der unabhängig dachte, sofern dies möglich ist, und jedenfalls unter einer aufgesetzten äußerlichen Verbindlichkeit eine solche Freiheit des Urteilens hatte, dass sie der unbeugsamsten Originalität gleichkam.
«Recht so, mein Sohn», sagte Malan. «Da Sie Ihre Mutter besuchen werden, versuchen Sie etwas über Ihren Vater zu erfahren. Und kommen Sie schleunigst wieder und erzählen Sie mir die Fortsetzung. Anlässe zum Lachen sind selten.»
«Ja, es ist lächerlich. Aber da mich diese Neugier gepackt hat, kann ich zumindest versuchen, ein paar zusätzliche Informationen zu sammeln. Dass ich mich nie darum gekümmert habe, ist ein bisschen pathologisch.»
«Ach wo, in diesem Fall ist es weise. Ich war dreißig Jahre mit Marthe verheiratet, die Sie ja gekannt haben. Eine perfekte Frau, die ich noch heute vermisse. Ich habe immer gedacht, sie liebe ihr Haus.» [*]
«Wahrscheinlich haben Sie recht», sagte Malan, den Blick abwendend, und Cormery wartete auf den Einwand, der, wie er wusste, unweigerlich auf die Zustimmung folgen würde.
«Ich würde mich, und ich hätte sicher unrecht, trotzdem hüten, mehr herauszufinden, als das Leben mir beigebracht hat», fuhr Malan fort. «Aber ich bin in dieser Hinsicht ein schlechtes Vorbild, nicht wahr? Bestimmt würde ich ja wegen meiner Fehler keinerlei Initiative ergreifen. Sie dagegen» (und in seinen Augen blitzte so etwas wie Bosheit auf), «Sie sind ein Mann der Tat.»
Mit seinem Mondgesicht, seiner etwas platten Nase, den fehlenden oder fast fehlenden Augenbrauen, der kappenartigen Frisur und einem dichten Schnurrbart, der den vollen, sinnlichen Mund nicht bedecken konnte, sah Malan aus wie ein Chinese. Selbst der Körper, mollig und rund, die fetten Hände mit den etwas wurstartigen Fingern erinnerten an einen Mandarin, der das Zufußgehen verabscheut. Wenn er mit halbgeschlossenen Augen voller Appetit aß, stellte man ihn sich unweigerlich in einer Seidenrobe und mit Stäbchen in der Hand vor. Doch der Blick änderte alles. Die dunkelbraunen Augen, fiebrig, unruhig oder plötzlich starr, als bearbeite die Intelligenz lebhaft einen bestimmten Punkt, waren die eines hochsensiblen und hochgebildeten Okzidentalen.
Das alte Hausmädchen brachte den Käse, zu dem Malan verstohlen hinschielte. «Ich habe einen Mann gekannt», sagte er, «der, nachdem er dreißig Jahre mit seiner Frau zusammengelebt hatte … » Cormery merkte auf. Jedes Mal, wenn Malan so anfing: «Ich habe einen Mann gekannt, der … oder einen Freund oder einen Engländer, der mit mir reiste … », konnte man sicher sein, dass es sich um ihn selbst handelte … «… der keinen Kuchen mochte, und auch seine Frau aß nie welchen. Jedenfalls, nach zwanzigjährigem Zusammenleben ertappte er seine Frau beim Konditor, und während er sie beobachtete, wurde ihm klar, dass sie mehrmals in der Woche hinging und sich mit Mokkaeclairs vollstopfte. Ja, er glaubte, dass sie keine Süßigkeiten mochte, und in Wirklichkeit war sie versessen auf Mokkaeclairs.»
«Folglich kennt man niemanden», sagte Cormery.
«Wenn Sie so wollen. Aber mir scheint, es wäre vielleicht richtiger, jedenfalls möchte ich, glaube ich, lieber sagen, aber machen Sie dafür meine Unfähigkeit, irgendetwas zu behaupten, verantwortlich, ja, es genügt zu sagen, wenn zwanzig Jahre des Zusammenlebens nicht ausreichen, um einen Menschen zu kennen, besteht bei einer zwangsläufig oberflächlichen Untersuchung vierzig Jahre nach dem Tod eines Menschen die Gefahr, dass sie einem nur begrenzte Informationen, ja, man kann sagen, begrenzte Informationen über diesen Menschen erbringt. Obwohl, in anderer Hinsicht … »
Er hob eine mit einem Messer bewaffnete fatalistische Hand, die sich auf den Ziegenkäse herabsenkte.
«Entschuldigen Sie. Wollen Sie keinen Käse? Nein? Immer noch so enthaltsam! Ein hartes Geschäft, gefallen zu wollen!»
Wieder leuchtete ein boshafter Funke zwischen seinen halbgeschlossenen Lidern auf. Cormery kannte seinen alten Freund jetzt seit zwanzig Jahren (hier einfügen, warum und wie) und nahm dessen ironische Bemerkungen gutgelaunt auf.
«Ich tue es nicht, weil ich gefallen will. Zu viel Essen macht mich schwer. Ich gehe unter.»
«Ja, Sie schweben nicht mehr über den anderen.»
Cormery sah sich die schönen Bauernmöbel an, die das niedrige Esszimmer mit den weißgekalkten Balken füllten.
«Lieber Freund», sagte er, «Sie haben immer geglaubt, ich sei stolz. Ich bin es. Aber nicht immer und auch nicht Ihnen gegenüber. Ihnen gegenüber, zum Beispiel, bin ich zu Stolz unfähig.»
Malan wandte den Blick ab, was bei ihm ein Zeichen von Rührung war.
«Ich weiß», sagte er, «aber warum?»
«Weil ich Sie liebe», sagte Cormery ruhig.
Malan zog die Schüssel mit Obstsalat zu sich heran und erwiderte nichts.
«Weil Sie sich», fuhr Cormery fort, «als ich sehr jung, sehr dumm und sehr allein war (erinnern Sie sich, in Algier?), mir zugewandt haben und mir unmerklich die Türen zu allem, was ich auf dieser Welt liebe, geöffnet haben.»
«Oh! Sie sind begabt.»
«Sicher. Aber auch die Begabtesten brauchen einen Wegweiser. Der, den das Leben einem eines Tages in den Weg stellt, der muss für immer geliebt und geachtet werden, auch wenn er nicht verantwortlich ist. Das ist meine Überzeugung!»
«Ja, ja», sagte Malan heuchlerisch.
«Sie zweifeln, ich weiß. Wissen Sie, Sie dürfen nicht glauben, meine Zuneigung für Sie sei blind. Sie haben große, sehr große Fehler. Zumindest in meinen Augen.»
Malan leckte seine dicken Lippen und wirkte plötzlich interessiert.
«Welche?»