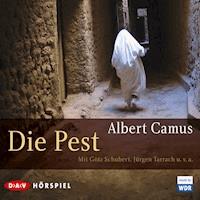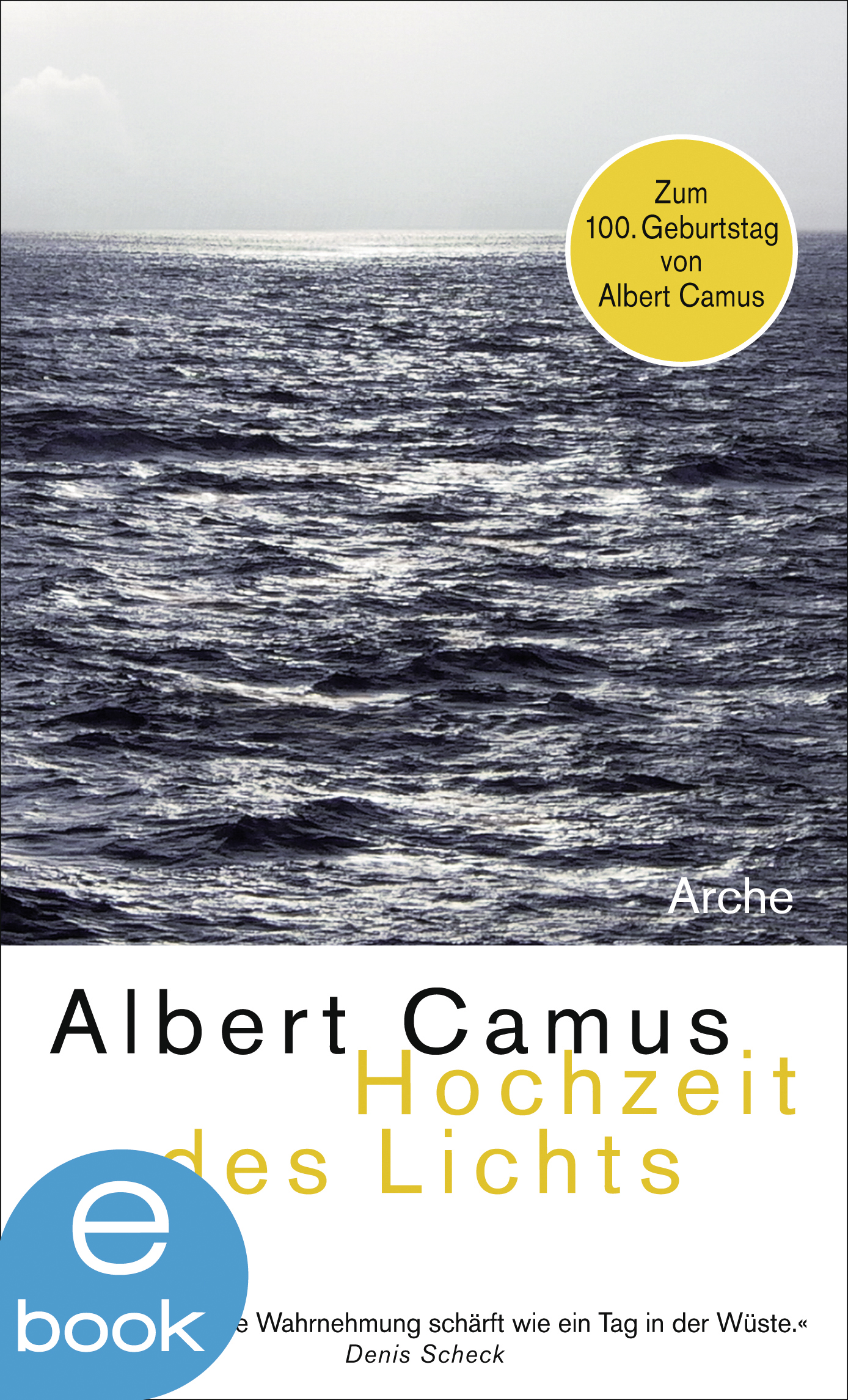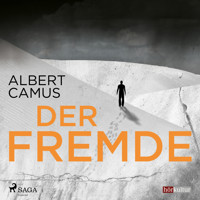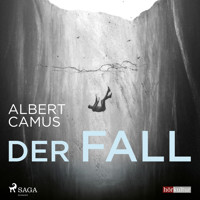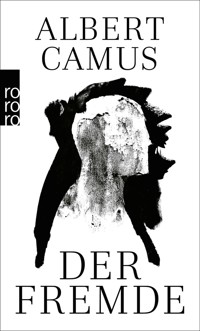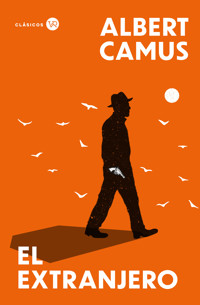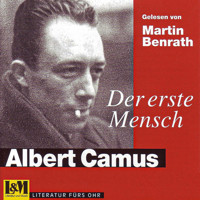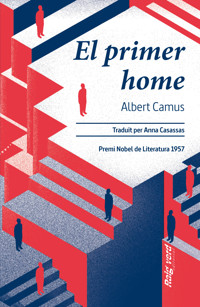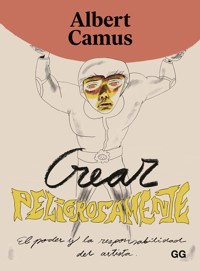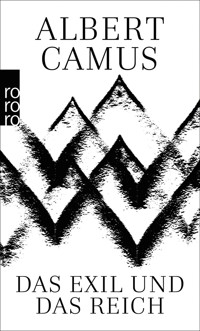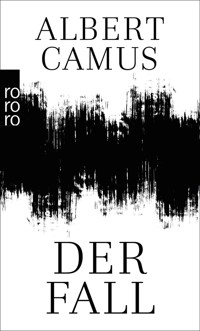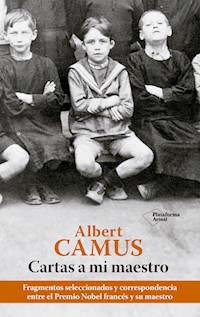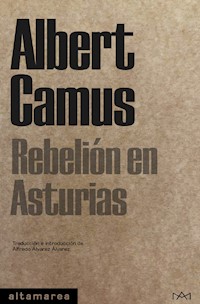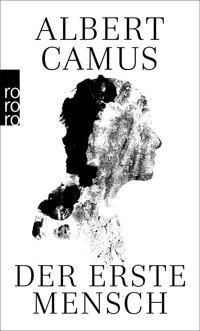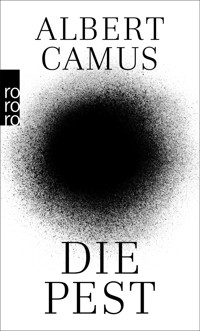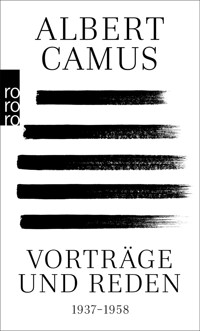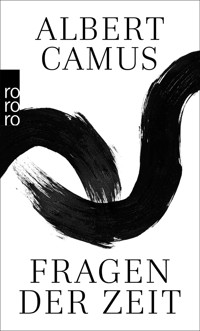
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Sammlung von Albert Camus' eindringlichsten Essays, Briefen, Reden und Aufzeichnungen über die Suche nach Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt. "Nichts wird den Menschen geschenkt, und das wenige, das sie erobern können, muss mit ungerechtem Sterben bezahlt werden. Aber nicht darin liegt die Größe des Menschen. Sondern in seinem Willen, stärker zu sein als die Conditio humana. Und wenn die Conditio humana ungerecht ist, hat er nur eine Möglichkeit, sie zu überwinden: indem er selber gerecht ist." Diese berühmt gewordenen Essays, Briefe, Reden und Aufzeichnungen des Literaturnobelpreisträgers Albert Camus gehören zu den klassischen Texten der politischen Literatur. Sie zeigen einen Schriftsteller und Philosophen, der stets inmitten der Kämpfe und Kontroversen seiner Epoche stand. Camus' scharfsinnige Betrachtungen zur menschlichen Existenz und seinem Streben nach Gerechtigkeit in einer oftmals ungerechten Welt machen Fragen der Zeit zu einem zeitlosen literarischen Werk. Ein Muss für alle Liebhaber anspruchsvoller Essays und philosophischer Literatur sowie Fans des existenzialistischen Denkens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Albert Camus
Fragen der Zeit
Über dieses Buch
«Nichts wird den Menschen geschenkt, und das wenige, das sie erobern können, muss mit ungerechtem Sterben bezahlt werden. Aber nicht darin liegt die Größe des Menschen. Sondern in seinem Willen, stärker zu sein als die Conditio humana. Und wenn die Conditio humana ungerecht ist, hat er nur eine Möglichkeit, sie zu überwinden: indem er selber gerecht ist.»
Diese berühmt gewordenen Essays, Briefe, Reden und Aufzeichnungen gehören zu dehn klassischen Texten der politischen Literatur. Sie zeigen einen Schriftsteller, der stets inmitten der Kämpfe und Kontroversen seiner Epoche stand.
Vita
Albert Camus wurde am 7. November 1913 in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Von 1933 bis 1936 studierte er an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama «Caligula», das 1945 uraufgeführt wurde. Camus zog 1940 nach Paris. Neben seinen Dramen begründeten der Roman «Der Fremde» und der Essay «Der Mythos von Sisyphos» sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall.
Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.
Impressum
Die Beiträge dieser Ausgabe wurden von Albert Camus ausgewählt und zusammengestellt.
Sie sind entnommen den bei der Librairie Gallimard, Paris, erschienenen Bänden Lettres à un ami allemand, Actuelles I, II und III und Discours de Suède sowie dem bei Calmann-Lévy, Paris, erschienenen Band Réflexions sur la peine capitale.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021
Copyright © 1960 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © Éditions Gallimard, 1948,1950, 1953, 1958
Copyright © by Calmann-Lévy éditeur, 1957
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung jayk7/Getty Images
ISBN 978-3-644-00452-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
BRIEFE AN EINEN DEUTSCHEN FREUND
Vorwort zur italienischen Ausgabe
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
DIE BEFREIUNG VON PARIS
Das Blut der Freiheit
Die Nacht der Wahrheit
RENÉ LEYNAUD
René Leynaud
Vorwort zu den Gedichten von René Leynaud
PESSIMISMUS UND TYRANNEI
Pessimismus und Mut
Den Geist hochhalten
DER UNGLÄUBIGE UND DIE CHRISTEN
Der Ungläubige und die Christen
WARUM SPANIEN?
Antwort an Gabriel Marcel
VERTEIDIGUNG DER FREIHEIT
Brot und Freiheit
Ehrung eines Verbannten
DIE GUILLOTINE
Betrachtungen zur Todesstrafe
ALGERIEN
Vorwort zur Algerischen Chronik
Brief an einen algerischen Aktivisten
Aufruf für einen Burgfrieden in Algerien
Algerien 1958
Das neue Algerien
UNGARN
Kadar hat seinen Tag der Angst erlebt
Der Sozialismus der Galgen
DER KÜNSTLER UND SEINE ZEIT
Die Wette unserer Generation
Rede anläßlich der Entgegennahme des Nobelpreises Am 10. Dezember 1957 in Stockholm
Der Künstler und seine Zeit
I
II
III
Quellenverzeichnis
BRIEFE AN EINEN DEUTSCHEN FREUND
Für René Leynaud
Seine Größe zeigt man nicht, indem man sich zu einem Extrem bekennt, sondern indem man beide in sich vereinigt.
Pascal
Vorwort zur italienischen Ausgabe
Die Briefe an einen deutschen Freund wurden nach der Befreiung Frankreichs in wenigen Exemplaren veröffentlicht und sind nie neu aufgelegt worden. Ich habe mich aus Gründen, auf die ich im folgenden näher eingehen werde, ihrer Verbreitung im Ausland stets widersetzt.
Zum erstenmal nun erscheinen sie außerhalb Frankreichs, und einzig der Wunsch, mit meinen schwachen Kräften dazu beizutragen, daß die sinnlose Grenze zwischen unseren beiden Ländern eines Tages fallen möge, hat mich dazu bewegen können.
Aber ich kann diese Briefe nicht erscheinen lassen, ohne zu erklären, wie sie verstanden werden müssen. Sie sind zur Zeit der Widerstandsbewegung geschrieben und veröffentlicht worden. Sie setzten sich zum Ziel, den blinden Kampf, in dem wir standen, etwas zu erhellen und dadurch wirksamer zu gestalten. Es sind durch die Umstände bedingte Texte, die darum ungerecht erscheinen mögen. Denn wenn man über das besiegte Deutschland schreiben müßte, wäre in der Tat ein etwas anderer Ton am Platz. Doch liegt mir daran, einem Mißverständnis vorzubeugen. Wenn der Verfasser dieser Briefe ‹ihr› sagt, meint er nicht ‹ihr Deutschen›, sondern ‹ihr Nazis›. Wenn er ‹wir› sagt, heißt das nicht immer ‹wir Franzosen›, sondern ‹wir freien Europäer›. Ich stelle zwei Haltungen einander gegenüber, nicht zwei Völker, selbst wenn in einem bestimmten Augenblick der Geschichte diese beiden Völker zwei feindliche Haltungen verkörpert haben. Wenn ich mich eines Ausspruchs bedienen darf, der nicht von mir stammt, möchte ich sagen: ich liebe mein Land zu sehr, um Nationalist zu sein.
Und ich weiß, daß weder Frankreich noch Italien etwas dabei verlieren würden, wenn sie sich einer umfassenderen Gemeinschaft anschlössen – im Gegenteil. Aber davon sind wir noch weit entfernt, und Europa ist immer noch zerrissen. Darum würde ich mich schämen, heute den Glauben zu erwecken, ein französischer Schriftsteller könne der Feind einer einzelnen Nation sein. Ich verabscheue nur die Henker. Jeder Leser, der die Briefe an einen deutschen Freund in diesem Sinne liest, das heißt als ein Zeugnis des Kampfes gegen die Gewalt, wird mir zubilligen, daß ich auch heute noch zu jedem Wort stehen darf.
Erster Brief
Sie sagten: «Die Größe meines Landes kann nicht zu teuer bezahlt werden. Alles, was ihrer Verwirklichung dient, ist gut. Und ihr müssen in einer Welt, in der nichts mehr Sinn hat, die Menschen, die wie wir jungen Deutschen das Glück haben, im Schicksal ihres Volkes einen Sinn zu finden, alles zum Opfer bringen.» Ich war Ihnen damals zugetan, aber hier schon konnte ich nicht mehr mit Ihnen einiggehen. «Nein», entgegnete ich, «ich kann nicht glauben, daß man alles einem bestimmten Ziel unterordnen darf. Es gibt Mittel, die nichts heiligt. Und ich möchte mein Land lieben können, ohne aufzuhören, die Gerech tigkeit zu lieben. Ich kann nicht zu jeder Größe ja sagen, selbst zu einer, die in Blut und Lüge gründet. Indem ich die Gerechtigkeit am Leben erhalte, möchte ich mein Land am Leben erhalten.» Und Sie haben geantwortet: «Ach was, Sie lieben Ihr Land nicht!»
Das war vor fünf Jahren. Seit jener Zeit haben sich unsere Wege getrennt, aber ich darf sagen, daß in diesen langen (für Sie so blitzartig flammend verflogenen) Jahren kein Tag verstrich, ohne daß ich mich an Ihren Ausspruch erinnert hätte. «Sie lieben Ihr Land nicht!» Wenn ich heute an diese Worte denke, würgt mich etwas in der Kehle. Nein, ich liebte es nicht, wenn Liebe darin besteht, nicht zu tadeln, was am geliebten Wesen ungerecht ist, wenn Liebe darin besteht, nicht zu fordern, daß das geliebte Wesen dem schönen Bild entspreche, das wir von ihm hegen. Das war vor fünf Jahren, und viele Menschen in Frankreich dachten wie ich. Und doch haben einige unter ihnen seither in die zwölf kleinen schwarzen Augen des deutschen Schicksals geblickt. Diese Menschen, die Ihrer Auffassung nach ihr Land nicht liebten, haben mehr für es getan, als Sie je für das Ihre tun werden, selbst wenn es Ihnen möglich wäre, Ihr Leben hundertmal für es hinzugeben. Denn sie mußten zuerst sich selbst überwinden, und darin besteht ihr Heldentum. Aber ich spreche hier von zwei verschiedenen Arten von Größe und von einem Widerspruch, über den Sie aufzuklären ich Ihnen schuldig bin.
Wir werden uns bald wiedersehen, wenn dies möglich ist. Aber unsere Freundschaft wird nicht mehr vorhanden sein. Sie werden erfüllt sein von Ihrer Niederlage und sich Ihres früheren Sieges nicht schämen, ihm im Gegenteil mit all Ihren zerschmetterten Kräften nachtrauern. Heute bin ich Ihnen im Geist noch nahe – allerdings Ihr Feind, doch immer noch ein wenig Ihr Freund, sonst würde ich Ihnen nicht mein ganzes Denken offenbaren. Morgen ist das vorbei. Was Ihr Sieg nicht anzutasten vermochte, wird Ihre Niederlage vollbringen. Aber ehe wir uns gleichmütig gegenüberstehen, will ich versuchen, Ihnen gewisse Schicksalszüge meines Landes klarzumachen, die Sie weder im Frieden noch im Krieg erkannt haben.
Gleich zu Beginn will ich Ihnen sagen, welche Art Größe unsere Triebkraft ist. Das heißt aber, Ihnen erklären, welche Art Mut wir anerkennen, denn es ist nicht der Ihre. Ins Feuer rennen hat nicht viel zu bedeuten, wenn man sich seit jeher darauf vorbereitet hat und wenn einem Rennen selbstverständlicher ist als Denken. Es bedeutet im Gegenteil viel, der Folter und dem Tod entgegenzugehen, wenn man zutiefst und unverrückbar weiß, daß der Haß und die Gewalt an sich sinnlos sind. Es bedeutet viel, sich zu schlagen, wenn man den Krieg verachtet, hinzunehmen, daß man alles verliert, wenn man das Verlangen nach Glück bewahrt, zu zerstören, wenn man an eine höhere Kultur glaubt. Darum vollbringen wir mehr als ihr, denn wir müssen uns selber überwinden. Ihr hattet in euren Herzen, in eurem Geist nichts zu besiegen. Wir hatten zwei Feinde, und der Sieg der Waffen genügte uns nicht, im Gegensatz zu euch, die ihr nichts in euch zu unterdrücken fandet.
Wir hatten viel zu unterdrücken und vielleicht in erster Linie die ständige Versuchung, euch zu gleichen. Denn es steckt immer etwas in uns, das sich dem Instinkt überläßt, der Verachtung des Geistes, der Anbetung der Tüchtigkeit. Wir werden schließlich unserer großen Tugenden müde. Wir schämen uns des Geistes und träumen zuweilen von einem glückseligen Barbarentum, das uns eine mühelose Wahrheit schenkte. Aber in dieser Beziehung sind wir schnell geheilt: ihr seid da, ihr zeigt uns, wie es mit diesem Traum bestellt ist, und wir kommen zur Besinnung. Wenn ich an eine geschichtliche Vorherbestimmung glaubte, würde ich annehmen, daß ihr uns als Heloten des Geistes zu unserer Besserung zur Seite steht. Dann finden wir zum Geist zurück, und er bereitet uns kein Unbehagen mehr.
Aber auch den Verruf, in dem das Heldentum bei uns stand, mußten wir überwinden. Ich weiß: ihr glaubt, Heldentum sei uns fremd. Ihr täuscht euch. Nur daß wir uns gleichzeitig dazu bekennen und ihm mißtrauen. Wir bekennen uns dazu, weil zehn Jahrhunderte der Geschichte uns das Wissen um alles Edle geschenkt haben. Wir mißtrauen ihm, weil zehn Jahrhunderte der Erkenntnis uns die Kunst und die Vorzüge der Natürlichkeit gelehrt haben. Um euch gegenüberzutreten, mußten wir einen weiten Weg zurücklegen. Und darum sind wir ganz Europa gegenüber im Rückstand, denn es stürzte sich im rechten Augenblick in die Lüge, während wir es uns einfallen ließen, nach der Wahrheit zu suchen. Darum erfuhren wir zuerst einmal eine Niederlage: ihr seid über uns hergefallen, während wir damit beschäftigt waren, in unseren Herzen zu prüfen, ob wir das Recht auf unserer Seite hätten.
Wir mußten unsere Freude am Menschen, das Bild, das wir uns von einem friedlichen Schicksal machten, die tief in uns wurzelnde Überzeugung überwinden, wonach kein Sieg sich lohnt, während jede Verstümmelung des Menschen nicht wiedergutzumachen ist. Wir mußten gleichzeitig auf unser Wissen und auf unsere Hoffnung verzichten, auf die Gründe zum Lieben und auf den Haß, den wir jedem Krieg entgegenbrachten. Um es mit einem Wort auszudrücken, das Sie wahrscheinlich verstehen werden, da es von mir kommt, dessen Hand Sie zu drücken liebten: wir mußten unser leidenschaftliches Verlangen nach Freundschaft zum Schweigen bringen.
Jetzt ist das geschehen. Wir hatten einen langen Umweg nötig, wir haben uns sehr verspätet. Es ist der Umweg, den der Skrupel der Wahrheit dem Geist, der Skrupel der Freundschaft dem Herzen auferlegt. Es ist der Umweg, der die Gerechtigkeit bewahrte und die Wahrheit denen schenkte, die sich Gedanken machten. Und zweifellos haben wir ihn sehr teuer bezahlt. Wir haben ihn mit Demütigungen und Schweigen bezahlt, mit Bitterkeit, Gefängnis, Hinrichtungen im Morgengrauen, Verlassenheit, Trennung, täglichem Hunger, ausgemergelten Kindern und vor allem mit erzwungenen Bußübungen. Aber das mußte sein. Wir brauchten diese ganze Zeit, um herauszufinden, ob wir das Recht hatten, Menschen zu töten, ob es uns erlaubt war, zu dem entsetzlichen Elend der Welt beizutragen. Und diese verlorene und wiedergefundene Zeit, diese hingenommene und überwundene Niederlage, diese mit Blut bezahlten Skrupel verleihen uns Franzosen heute das Recht, zu denken, daß wir mit reinen Händen in diesen Krieg getreten sind – mit der Reinheit der Opfer und der Überzeugten – und daß wir mit reinen Händen aus ihm heraustreten werden – aber diesmal mit der Reinheit eines großen Sieges, den wir über die Ungerechtigkeit und über uns selber davongetragen haben.
Denn wir werden siegen, daran besteht kein Zweifel. Aber wir werden dank dieser Niederlage siegen, dank diesem langen Weg, der uns unsere Gründe hat erkennen lassen, dank diesem Leiden, dessen Ungerechtigkeit wir gespürt und aus dem wir eine Lehre gezogen haben. Wir haben dabei das Geheimnis eines jeden Sieges erfahren, und wenn wir es nicht eines Tages wieder verlieren, werden wir den endgültigen Sieg erringen. Wir haben dabei erfahren, daß entgegen unserem bisherigen Glauben der Geist nichts gegen das Schwert vermag, daß aber der mit dem Schwert vereinte Geist stets Sieger bleibt über das um seiner selbst willen gezogene Schwert. Darum haben wir jetzt das Schwert angenommen, nachdem wir uns versichert hatten, daß der Geist mit uns war. Dafür mußten wir zusehen, wie gestorben wurde, und Gefahr laufen, selber zu sterben, dafür brauchte es den morgendlichen Gang eines französischen Arbeiters, der auf dem Weg zur Guillotine durch die Korridore seines Gefängnisses schritt und von Tür zu Tür seine Kameraden ermahnte, sich mutig zu zeigen. Und schließlich brauchte es die Folterung unseres Fleisches, damit wir uns des Geistes bemächtigen konnten. Nur das besitzt man wirklich, was man bezahlt hat. Wir haben teuer bezahlt und werden weiterhin zahlen. Aber wir besitzen unsere Gewißheiten, unsere Gründe, unsere Gerechtigkeit: eure Niederlage ist unvermeidlich.
Ich habe nie an die Macht der Wahrheit an sich geglaubt. Aber es ist schon viel, wenn man weiß, daß bei gleichen Kräfteverhältnissen die Wahrheit stärker ist als die Lüge. Dieses mühsame Gleichgewicht haben wir erreicht. Und diese Nuance gibt unserem Kampf heute seinen Sinn. Ich bin versucht, Ihnen zu sagen, daß wir eben gerade für Nuancen kämpfen, aber Nuancen, die so wichtig sind wie der Mensch selber. Wir kämpfen für die Nuance, die das Opfer von der Mystik, die Energie von der Gewalt, die Kraft von der Grausamkeit unterscheidet, für jene noch feinere Nuance, die das Falsche vom Wahren und den von uns erhofften Menschen von den von euch verehrten feigen Göttern unterscheidet.
Das wollte ich Ihnen sagen, nicht obenhin als Außenstehender, sondern als zutiefst Beteiligter. Das wollte ich jenem «Sie lieben Ihr Land nicht», das mir heute noch in den Ohren klingt, zur Antwort geben. Aber ich möchte, daß zwischen uns alles klar sei. Ich glaube, daß Frankreich seine Macht und seine Herrschaft für lange Zeit verloren hat und daß es lange Zeit verzweifelte Geduld und eine immer wache Auflehnung nötig haben wird, um das zur Entfaltung jeder Kultur unerläßliche Prestige wiederzugewinnen. Doch glaube ich, daß es das alles aus reinen Gründen verloren hat. Und darum verläßt mich die Hoffnung nicht. Darin liegt der ganze Sinn meines Briefes. Der Mensch, den Sie vor fünf Jahren bedauert haben, weil er seinem Land so zurückhaltend gegenüberstand, ist der gleiche, der Ihnen und allen Menschen unseres Alters in Europa und der ganzen Welt sagen will: «Ich gehöre einer bewundernswürdigen und ausdauernden Nation an, die trotz all ihrer Irrtümer und Schwächen nicht hat verlorengehen lassen, was ihre Größe ausmacht, jenen Begriff, den immer klarer zu formulieren die führende Schicht bisweilen und das Volk jederzeit unablässig bemüht ist. Ich gehöre einem Volk an, das seit vier Jahren den Lauf seiner ganzen Geschichte neu begonnen hat und das sich inmitten der Trümmer ruhig und sicher darauf vorbereitet, eine neue Geschichte anzufangen und in einem Spiel, in dem es ohne Trümpfe dasteht, sein Glück zu versuchen. Dieses Land ist es wert, daß ich es liebe, mit jener wählerischen und anspruchsvollen Liebe, die mir eigen ist. Ich glaube, daß es sich jetzt wohl lohnt, für dieses Land zu kämpfen, da es einer höheren Liebe würdig ist. Und ich sage, daß Ihre Nation im Gegensatz dazu von ihren Söhnen nur die Liebe empfangen hat, die sie verdiente, und diese Liebe war blind. Man wird nicht durch jede Liebe gerechtfertigt, das ist euer Verderben. Und was soll aus euch, die ihr schon in euren größten Siegen besiegt wart, in der bevorstehenden Niederlage werden?»
Juli 1943
Zweiter Brief
Ich habe Ihnen schon einmal geschrieben, und zwar im Ton der Gewißheit. Über fünf Jahre der Trennung hinweg habe ich Ihnen gesagt, warum wir die Stärkeren sind, nämlich dank dem Umweg, auf dem wir unsere Gründe gesucht haben, dank der Verspätung, die uns die Besorgtheit um unser Recht eingetragen hat, dank der Torheit, die uns hieß, alles, was wir liebten, versöhnen zu wollen. Das ist so wichtig, daß ich darauf zurückkommen muß. Ich habe es Ihnen schon gesagt, wir haben diesen Umweg teuer bezahlt. Wir haben lieber die Unordnung in Kauf genommen als die Ungerechtigkeit. Aber gleichzeitig macht dieser Umweg heute unsere Stärke aus, und ihm verdanken wir den bevorstehenden Sieg.
Ja, das alles habe ich Ihnen im Ton der Gewißheit geschrieben, in einem Zug und ohne nach Worten zu suchen. Ich hatte allerdings auch reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Die Nacht ist dem Nachdenken günstig. Seit drei Jahren herrscht eine Nacht, die ihr über unsere Städte und Herzen gesenkt habt. Seit drei Jahren verfolgen wir in der Dunkelheit den Gedankengang, der heute in Waffen vor euch tritt. Jetzt kann ich Ihnen vom Geist sprechen. Denn die Gewißheit, die uns heute erfüllt, ist so beschaffen, daß alles seinen Ausgleich und seine Klarheit findet, daß der Geist sich mit dem Mut vermählt. Und ich nehme an, daß Sie, der Sie so leichthin vom Geist sprachen, ihn nun mit großer Überraschung aus so weiter Ferne zurückkehren und plötzlich beschließen sehen, seinen Platz in der Geschichte wieder einzunehmen. An diesem Punkt will ich mich Ihnen wieder zukehren.
Ich werde später noch darauf zurückkommen, daß Gewißheit des Herzens nicht gleichbedeutend ist mit Fröhlichkeit des Herzens. Das verleiht allem, was ich Ihnen schreibe, bereits seinen Sinn. Aber zuvor will ich meine Stellung Ihnen, Ihrem Andenken und unserer Freundschaft gegenüber ins reine bringen. Solange ich es noch vermag, will ich unserer Freundschaft zuliebe das einzige tun, was für eine zu Ende gehende Freundschaft getan werden kann: ich will ihr Klarheit verleihen. Auf das «Sie lieben Ihr Land nicht», das Sie mir manchmal zuwarfen und das mir nicht aus dem Gedächtnis will, habe ich Ihnen schon geantwortet. Heute möchte ich nur auf das ungeduldige Lächeln antworten, mit dem Sie das Wort Geist quittierten. «In all seinen Geistesgrößen», sagten Sie, «verleugnet Frankreich sich selber. Ihre Intellektuellen ziehen ihrer Heimat je nachdem die Verzweiflung oder die Jagd nach einer unwahrscheinlichen Wahrheit vor. Wir hingegen stellen Deutschland diesseits der Wahrheit, jenseits der Verzweiflung.» Das stimmte offenbar. Aber ich habe es Ihnen schon gesagt: wenn wir zuweilen die Gerechtigkeit über unser Land zu stellen schienen, so lag der Grund darin, daß wir unser Land in der Gerechtigkeit lieben wollten, so wie wir es in der Wahrheit und in der Hoffnung zu lieben begehrten. Darin unterscheiden wir uns von euch, wir waren anspruchslos. Ihr begnügtet euch damit, der Macht eurer Nation zu dienen, und wir träumten davon, der unseren ihre Wahrheit zu schenken. Ihr wart es zufrieden, der Realpolitik zu dienen, und wir bewahrten in unseren schlimmsten Verirrungen verschwommen den Begriff einer Politik der Ehre, die wir heute wiederfinden. Wenn ich ‹wir› sage, meine ich nicht unsere Machthaber. Die Machthaber sind belanglos.
Ich sehe, wie Sie hier wieder lächeln. Sie haben den Worten immer mißtraut. Ich auch, aber noch mehr mißtraute ich mir selber. Sie versuchten, mich auf die Bahn zu locken, die Sie selber eingeschlagen hatten und auf der der Geist sich des Geistes schämt. Schon damals folgte ich Ihnen nicht. Aber heute wären meine Antworten von mehr Gewißheit getragen. Was ist Wahrheit? sagten Sie. Zweifellos, aber wir wissen zumindest, was Lüge ist: das eben habt ihr uns gelehrt. Was ist Geist? Wir kennen sein Gegenteil, den Mord. Was ist der Mensch? Aber da gebiete ich Ihnen Einhalt, denn das wissen wir. Er ist jene Kraft, die schließlich die Tyrannen und Götter hinwegfegt. Er ist die Kraft der Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit des Menschseins haben wir zu bewahren, und unsere Gewißheit kommt heute daher, daß sein Schicksal und das unseres Landes miteinander verknüpft sind. Wenn nichts einen Sinn hätte, möchten Sie recht haben. Aber es gibt etwas, das Sinn behält.
Ich kann nicht oft genug wiederholen, daß sich hier unsere Wege trennen. Wir hatten eine Vorstellung von unserem Land, die ihm seinen Platz inmitten anderer Größen, der Freundschaft, des Menschentums, des Glücks, unseres Verlangens nach Gerechtigkeit zuwies. Das führte uns dazu, streng mit ihm zu sein. Aber zum Schluß hatten doch wir recht. Wir haben ihm keine Sklaven gegeben, wir haben seinetwegen keine Konzessionen gemacht. Geduldig haben wir gewartet, bis wir klar sahen, und haben im Elend und im Schmerz die Freude erfahren, gleichzeitig für alles kämpfen zu können, was wir lieben. Ihr dagegen kämpft gegen jenen ganzen Teil des Menschen, der nicht dem Vaterland gehört. Eure Opfer sind ohne Bedeutung, weil eure Größenordnung falsch ist und eure Werte nicht am richtigen Platz stehen. Nicht nur das Herz wird bei euch verraten. Der Geist rächt sich. Ihr habt den Preis, den er fordert, nicht gezahlt, der Klarsicht ihren schweren Tribut nicht zugebilligt. Vom Grund der Niederlage aus kann ich Ihnen sagen, daß dies euer Verderben ist.
Lassen Sie mich indessen lieber folgende Geschichte erzählen. Irgendwo in Frankreich fährt eines Morgens früh ein von bewaffneten Soldaten bewachter Lastkraftwagen elf Franzosen aus einem Gefängnis, das ich kenne, zum Friedhof, wo sie erschossen werden sollen. Unter den elf befinden sich fünf oder sechs, die nicht von ungefähr dabei sind: eine Flugschrift, ein paar Verabredungen und – schlimmer als alles andere – die Ablehnung. Sie verharren unbeweglich im Innern des Gefährts, gewiß von Angst erfüllt, doch von einer gewöhnlichen Angst, wenn ich so sagen darf, jener Angst, die jeden Menschen angesichts des Unbekannten befällt, einer Angst, mit der der Mut fertig wird. Die anderen haben nichts verbrochen. Und das Wissen, daß sie irrtümlich oder als Opfer einer gewissen Gleichgültigkeit sterben, macht ihnen diese Stunde schwer. Unter ihnen ein Junge von sechzehn Jahren. Sie kennen das Gesicht unserer Halbwüchsigen, ich will nicht davon sprechen. Dieser hier ist von Angst besessen und überläßt sich ihr, ohne sich zu schämen. Setzen Sie nicht Ihr verächtliches Lächeln auf, er klappert mit den Zähnen. Aber ihr habt ihm einen Geistlichen mitgegeben, dessen Aufgabe es ist, den Männern die entsetzliche Zeit des Wartens zu erleichtern. Ich glaube sagen zu können, daß Männern, die man umbringen wird, ein Gespräch über das zukünftige Leben keine große Hilfe bedeutet. Es ist zu schwer, zu glauben, daß das Massengrab nicht allem ein Ende macht, und so sitzen die Gefangenen stumm auf dem Wagen. Der Geistliche hat sich dem in seinen Winkel verkrochenen Jungen zugewendet. Er wird ihn besser verstehen. Der Junge antwortet, klammert sich an diese Stimme, die Hoffnung kehrt zurück. Im stummen Grauen genügt es zuweilen, daß ein Mensch spricht; vielleicht wird er alles in Ordnung bringen. «Ich habe nichts getan», sagt der Junge. «Ja», antwortet der Geistliche, «aber darum geht es nun nicht mehr. Du mußt dich darauf vorbereiten, tapfer zu sterben.» – «Es ist nicht möglich, daß man mich nicht versteht.» – «Ich bin dein Freund und vielleicht verstehe ich dich. Aber es ist zu spät. Ich werde bei dir sein und der liebe Gott auch. Du wirst schon sehen, es ist ganz leicht.» Der Junge hat sich abgewendet. Der Geistliche spricht von Gott. Glaubt der Junge an ihn? Ja. Dann weiß er also, daß nichts mehr wichtig ist verglichen mit dem Frieden, der auf ihn wartet. Aber gerade dieser Friede jagt dem Jungen Angst ein. «Ich bin dein Freund», wiederholt der Geistliche.
Die anderen schweigen. Man muß sich auch um sie kümmern. Der Pfarrer nähert sich ihrer stummen Gruppe und dreht dem Jungen einen Augenblick den Rücken zu. Der Wagen rollt mit einem leise schmatzenden Geräusch über die taunasse Straße. Stellen Sie sich die graue Stunde vor, den Morgengeruch der Männer, das Land, das man nicht sieht, sondern dank dem Ächzen eines Karrens, dank einem Vogelschrei erahnt. Der Junge schmiegt sich an die Plane, und sie gibt ein bißchen nach. Er entdeckt einen schmalen Durchgang zwischen dem Verdeck und der Karosserie. Er könnte hinausspringen, wenn er wollte. Der andere dreht ihm den Rücken zu, und die Soldaten vorne sind vollauf damit beschäftigt, sich im trüben Morgen zurechtzufinden. Er überlegt nicht, er zieht die Plane weg, schlüpft durch die Öffnung, springt. Kaum hört man, wie seine Füße den Boden berühren, wie eilige Schritte sich entfernen, dann nichts mehr. Die Erde verschluckt das Geräusch seiner Flucht. Doch das Klatschen der Plane, die feuchte Morgenluft, die in den Wagen dringt, veranlassen den Geistlichen und die Verurteilten, sich umzukehren. Eine Sekunde lang mustert der Priester die Männer, die ihn schweigend anschauen. Eine Sekunde, in der der Mann Gottes entscheiden muß, ob er auf seiten der Henker oder seiner Berufung gemäß auf seiten der Märtyrer steht. Aber schon hat er an die Wand geklopft, die ihn von seinen Kameraden trennt. «Achtung!» Er schlägt Alarm. Zwei Soldaten stürzen in den Wagen und halten die Gefangenen in Schach. Zwei andere springen auf die Straße und laufen querfeldein. Ein paar Schritte vom Wagen entfernt steht der Geistliche breitbeinig auf dem Asphalt und versucht, ihnen mit dem Blick durch den leichten Nebel zu folgen. Auf dem Wagen horchen die Männer auf die Geräusche dieser Jagd, vernehmen die unterdrückten Zurufe, einen Schuß, Stille, dann wieder Stimmen, die immer näher kommen, und schließlich dumpfe Schritte. Der Junge wird zurückgebracht. Er ist nicht verletzt, aber von diesem feindlichen Dunst umzingelt, plötzlich mutlos, hat er sich selbst aufgegeben und ist stehengeblieben. Seine Wächter tragen ihn mehr, als daß sie ihn führen. Sie haben ihn ein bißchen geschlagen, nicht heftig. Die Hauptsache steht noch bevor. Er hat keinen Blick, weder für den Geistlichen noch für sonst jemand. Der Priester sitzt nun neben dem Fahrer. Ein bewaffneter Soldat nimmt im Innern seinen Platz ein. In einem Winkel des Wagens geschleudert, sitzt der Junge da, er weint nicht. Er schaut zu, wie zwischen dem Verdeck und dem Fußboden von neuem die Straße sich abrollt, über der der Tag anbricht.
Ich kenne Sie, Sie werden sich den Rest sehr gut ausmalen können. Aber Sie müssen wissen, wer mir diese Geschichte erzählt hat. Es war ein französischer Priester. Er sagte: «Ich schäme mich für jenen Menschen und bin froh, mir sagen zu dürfen, daß kein französischer Priester bereit gewesen wäre, seinen Gott in den Dienst des Mordes zu stellen.» Das stimmt. Aber jener Geistliche dachte wie Sie. Es schien ihm selbstverständlich, auch seinen Glauben dem Dienst seines Landes unterzuordnen. Bei euch sind selbst die Götter mobilisiert. Sie sind auf eurer Seite, wie ihr sagt, aber gezwungenermaßen. Ihr unterscheidet nichts mehr, ihr seid nur noch ein gespannter Bogen. Und jetzt kämpft ihr einzig mit den Hilfsmitteln des blinden Zorns, schenkt den Waffen und den Heldentaten mehr Beachtung als den Ideen, seid hartnäckig darauf bedacht, alles zu verwirren, euer Scheuklappendenken zu verfolgen. Wir dagegen sind vom Geist und seinem Zögern ausgegangen. Dem Zorn gegenüber waren wir nicht stark genug. Aber jetzt ist der Umweg vollendet. Ein toter Junge hat genügt, damit wir dem Geist den Zorn hinzufügten, und von nun an sind wir zwei gegen einen. Ich will Ihnen noch ein Wort über den Zorn sagen.
Denken Sie zurück. Angesichts meines Erstaunens über den plötzlichen Wutausbruch eines Ihrer Vorgesetzten haben Sie mir gesagt «Auch das ist richtig. Aber Sie verstehen das nicht. Den Franzosen fehlt eine Tugend: der Zorn.» Nein, das ist es nicht, aber wir Franzosen sind heikel, was die Tugenden anbelangt. Wir üben sie nur, wenn es not tut. Das verleiht unserem Zorn die Stummheit und die Kraft, die zu spüren ihr erst anfangt. Und mit dieser Art von Zorn, der einzigen, die ich an mir kenne, will ich zum Schluß mit Ihnen reden.
Denn ich habe es Ihnen schon gesagt: die Gewißheit bedeutet nicht die Fröhlichkeit des Herzens. Wir wissen, was wir bei diesem langen Umweg verloren haben, wir kennen den Preis, mit dem wir die bittere Freude bezahlen, in Einklang mit uns selbst zu kämpfen. Und weil wir ein ausgeprägtes Gefühl haben für das, was nicht wiedergutzumachen ist, enthält unser Kampf ebensoviel Bitterkeit wie Zuversicht. Der Krieg befriedigte uns nicht. Unsere Gründe waren nicht reif. Den Krieg ohne Uniform, den hartnäckigen, kollektiven Kampf, das wortlose Opfer hat unser Volk gewählt. Das ist der Krieg, den es sich selber gegeben und nicht von stumpfsinnigen oder feigen Regierungen empfangen hat, der Krieg, in dem es sich wiederfindet und in dem es für eine bestimmte Vorstellung kämpft, die es von sich selber hegt. Aber dieser Luxus kommt es entsetzlich teuer zu stehen. Auch hier wieder hat unser Volk ein größeres Verdienst als das Ihre. Denn seine besten Söhne sind es, die fallen. Dieser Gedanke peinigt mich am meisten. Der Krieg ist ein Hohn, der zugleich die Vorteile des Hohns in sich birgt. Der Tod schlägt überall und aufs Geratewohl zu. Im Krieg, den wir führen, macht der Mutige sich selber zur Zielscheibe, und die ihr jeden Tag erschießt, verkörpern unseren reinsten Geist. Denn eure Naivität entbehrt nicht eines ahnungsvollen Zugs. Ihr habt nie gewußt, was es zu wählen galt, aber ihr wißt, was zerstört werden muß. Und wir, die wir uns Verteidiger des Geistes nennen, wir wissen doch, daß der Geist sterben kann, wenn die ihn zerschmetternde Kraft stark genug ist. Aber wir vertrauen auf eine andere Kraft. In den schweigenden, schon von dieser Welt abgewandten Gestalten, die ihr mit Kugeln durchlöchert, glaubt ihr das Gesicht unserer Wahrheit zu entstellen. Aber ihr rechnet nicht mit der Hartnäckigkeit, die Frankreich dazu treibt, im Verein mit der Zeit zu kämpfen. Eine verzweiflungsvolle Hoffnung hält uns in den schweren Stunden aufrecht: unsere Kameraden werden ausdauernder sein als die Henker und zahlreicher als die Kugeln. Sie sehen, die Franzosen sind des Zornes fähig.
Dezember 1943
Dritter Brief
Ich habe zu Ihnen bisher von meinem Land gesprochen, und vielleicht hatten Sie zu Beginn den Eindruck, meine Sprache habe sich geändert. Dem ist in Wirklichkeit nicht so. Nur geben wir den gleichen Worten nicht den gleichen Sinn; wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache.
Die Worte nehmen immer die Farbe der Handlungen oder der Opfer an, zu denen sie Anlaß geben. Und bei euch gewinnt das Wort Vaterland einen blutigen, blinden Widerschein, der es mir auf immer entfremdet, während wir das gleiche Wort mit der Flamme einer Erkenntnis begaben, wo der Mut größere Kraft erfordert, wo aber der Mensch sein Menschsein ganz erfüllt. Sie werden schließlich begreifen, daß meine Sprache sich wirklich nicht geändert hat. Sie war schon vor 1939, was sie auch heute noch ist.
Das Bekenntnis, das ich Ihnen ablegen will, wird es Ihnen zweifellos am besten beweisen. Während dieser ganzen Zeit, da wir hartnäckig und schweigend nur unserem Land dienten, haben wir eine Idee und eine Hoffnung nie aus den Augen verloren, sie stets in uns lebendig erhalten: Europa. Allerdings haben wir seit fünf Jahren nicht mehr davon gesprochen. Und zwar weil ihr zuviel Geschrei darum machtet. Auch hier sprachen wir nicht die gleiche Sprache; unser Europa ist nicht das eure.
Aber bevor ich Ihnen sage, was es ist, will ich Ihnen zumindest versichern, daß sich unter unseren Gründen, euch zu bekämpfen (und euch zu besiegen), vielleicht kein tieferer befindet als unser Bewußtsein, nicht nur in unserem Land verstümmelt, in unserem lebendigsten Fleisch getroffen, sondern auch unserer schönsten Bilder beraubt worden zu sein, da ihr sie der Welt in einem hassenswerten und lächerlichen Zerrspiegel vorgeführt habt. Am unerträglichsten ist es, das entstellt zu sehen, was man liebt. Und um diesem Begriff von Europa, den ihr den Besten unter uns gestohlen und mit dem euch genehmen empörenden Sinn erfüllt habt, seine Frische und seine Wirksamkeit in uns zu erhalten, bedürfen wir der ganzen Kraft der besonnenen Liebe. So gibt es ein Adjektiv, das wir nicht mehr gebrauchen, seitdem ihr die Armee der Knechtschaft europäisch nennt, aber wir tun es, um eifersüchtig den Sinn rein zu erhalten, den es weiterhin für uns besitzt und den ich Ihnen auseinandersetzen will.
Ihr sprecht von Europa, aber der Unterschied besteht darin, daß für euch Europa ein Besitz ist, während wir uns von ihm abhängig fühlen. Ihr habt erst von dem Tag an so von Europa gesprochen, an dem ihr Afrika verloren hattet. Das ist nicht die richtige Art zu lieben. Der Boden, auf dem so viele Jahrhunderte ihre Zeugnisse hinterlassen haben, ist für euch nur ein Zwangsaufenthalt, während er für uns immer unsere schönste Hoffnung darstellte. Eure zu plötzliche Leidenschaft setzt sich aus enttäuschter Wut und Notwendigkeit zusammen. Dieses Gefühl gereicht niemand zur Ehre, und vielleicht verstehen Sie nun, warum kein Europäer, der dieses Namens würdig ist, etwas davon wissen will.
Ihr sagt Europa, aber ihr meint soldatenreiches Land, Getreidespeicher, dienstbare Industrien, gelenkten Geist. Gehe ich zu weit? Zumindest weiß ich dies eine: wenn ihr von Europa sprecht – selbst wenn ihr es am aufrichtigsten meint und euch von euren eigenen Lügen mitreißen laßt –, könnt ihr nicht umhin, an eine Schar gefügiger Nationen zu denken, die von einem Deutschland der Herren einer großartigen und blutigen Zukunft entgegengeführt wird. Ich möchte, daß Ihnen dieser Unterschied ganz deutlich wird: für euch ist Europa jener von Meeren und Bergen umgürtete, von Stauwehren durchzogene, von Bergwerken unterhöhlte, von Ernten strotzende Raum, in dem Deutschland eine Partie spielt, deren einziger Einsatz sein eigenes Schicksal ist. Für uns jedoch ist Europa jener Boden, auf dem sich seit zwanzig Jahrhunderten das erstaunlichste Abenteuer des menschlichen Geistes abspielt. Es ist jene einzigartige Arena, in der der Kampf des abendländischen Menschen gegen die Welt, gegen die Götter, gegen sich selber, heute den Höhepunkt seines wilden Wogens erreicht. Sie sehen, die beiden Auffassungen lassen sich nicht miteinander vergleichen.
Fürchten Sie nicht, daß ich die Themen einer alten Propaganda wieder gegen Sie ins Feld führe: ich berufe mich nicht auf die christliche Tradition. Das ist ein anderes Problem. Auch davon habt ihr zuviel geredet und euch dabei als Roms Verteidiger aufgespielt; ihr habt euch nicht gescheut, für Christus eine Werbetrommel zu rühren, die ihm seit dem Tag, da er den Judaskuß empfing, nicht mehr neu ist. Aber die christliche Tradition ist nur eine unter den Traditionen, die Europa geschaffen haben, und ich bin nicht befugt, sie euch gegenüber in Schutz zu nehmen. Dazu brauchte es die Veranlagung und die Neigung eines Gott hingegebenen Herzens. Sie wissen, daß dies bei mir nicht der Fall ist. Aber wenn ich mir erlaube, zu denken, daß mein Land im Namen Europas spricht und daß wir mit dem einen gleichzeitig auch das andere verteidigen, dann stehe auch ich in meiner Tradition, einer, die sowohl ein paar großen Individuen als auch einem unerschöpflichen Volk eigen ist. Meine Tradition hat zwei Häupter, den Geist und den Mut, sie hat ihre Geistesfürsten und ihr zahlloses Fußvolk. Beurteilen Sie nun selber, ob dieses Europa, dessen Grenzen vom Genie einiger weniger und vom Wesenskern all seiner Völker umrissen werden, sich von jenem farbigen Klecks unterscheidet, den ihr euch auf provisorischen Karten angeeignet habt.
Erinnern Sie sich: als Sie sich einmal über meine Empörung lustig machen wollten, sagten Sie: «Don Quichotte ist nicht stark genug, wenn Faust ihn besiegen will.» Darauf habe ich Ihnen erwidert, daß weder Faust noch Don Quichotte dazu geschaffen seien, einander zu besiegen, und daß die Kunst nicht dazu da sei, Böses in die Welt zu bringen. Sie liebten damals übertriebene Vergleiche und sagten weiter, man müsse wählen zwischen Hamlet und Siegfried. Zu jener Zeit wollte ich nicht wählen, und vor allem schien mir, das Abendland sei ausschließlich in diesem Gleichgewicht zwischen Kraft und Erkenntnis angesiedelt. Sie jedoch machten sich nichts aus Erkenntnis, Sie sprachen einzig von Macht. Heute sehe ich in mir selber klarer und weiß, daß auch Faust Ihnen nichts nützen wird. Denn wir haben uns in der Tat mit dem Gedanken abgefunden, daß in gewissen Fällen eine Wahl nötig ist. Aber unsere Entscheidung wäre nicht bedeutsamer als die eure, wenn sie nicht im Bewußtsein getroffen worden wäre, daß sie unmenschlich ist und daß die geistigen Werte ein unteilbares Ganzes bilden. Wir werden es später verstehen, zu einen, und das habt ihr nie verstanden. Sie sehen, ich komme immer wieder auf den gleichen Gedanken zurück: wir haben einen weiten Weg hinter uns. Aber wir haben diese Idee teuer genug bezahlt, um das Recht zu besitzen, sie nicht aufzugeben. Aus diesem Grunde sage ich, daß euer Europa nicht das richtige ist. Es hat nichts, das einen oder begeistern könnte. Das unsere ist ein gemeinsames Abenteuer, in dem der Geist weht, und das wir euch zum Trotz fortführen werden.
Ich habe nicht viel hinzuzufügen. Manchmal geschieht es, daß ich in jenen kurzen Ruhepausen, die die langen Stunden des gemeinsamen Kampfes uns vergönnen, unvermittelt an all die Orte in Europa denken muß, die ich gut kenne. Es ist ein herrliches, aus Leid und Geschichte geschaffenes Land. Ich gehe wieder auf die Pilgerfahrten, die ich mit allen abendländischen Menschen unternommen habe: die Rosen in den Kreuzgängen von Florenz, die goldenen Zwiebeldächer von Krakau, der Hradschin mit seinen toten Palästen, die barocken Statuen auf der Karlsbrücke über der Moldau, die lieblichen Gärten von Salzburg. All die Blumen und die Steine, die Hügel und die Landschaften, in denen die Zeit der Menschen und die Zeit der Welt die alten Bäume mit den Bauwerken haben verwachsen lassen! Mein Gedächtnis hat die übereinandergelagerten Bilder verschmolzen, um ein einziges Antlitz daraus zu machen, das meiner großen Heimat. Und mein Herz schnürt sich zusammen, wenn ich dann denke, daß seit Jahren auf dieses kraftvolle und gequälte Gesicht euer Schatten fällt. Und doch haben Sie und ich ein paar dieser Orte gemeinsam besucht. Damals ahnte ich nicht, daß wir sie eines Tages von euch befreien müßten. Und in gewissen Augenblicken der Wut und der Verzweiflung bedaure ich, daß im Kreuzgang von San Marco die Rosen weiterhin blühen, daß die Tauben sich in Schwärmen vom Salzburger Dom lösen und daß auf den kleinen schlesischen Friedhöfen die Geranien unermüdlich ihre roten Blüten treiben.
Aber in anderen Augenblicken, den einzig wahren, freue ich mich darüber. Denn all diese Landschaften, diese Bäume und diese Ackerfurchen, der älteste Erdboden, beweisen euch jedes Frühjahr, daß es Dinge gibt, die ihr nicht im Blut ersticken könnt. Mit diesem Bild kann ich aufhören. Es würde mir nicht genügen, zu denken, daß alle großen Toten des Abendlandes und dreißig Völker auf unserer Seite stehen: ich könnte der Erde nicht entbehren. Und so weiß ich, daß alles in Europa, Landschaft und Geist, euch in aller Ruhe, ohne wirren Haß, mit der bedächtigen Kraft des Siegers ablehnt. Die Waffen, über die der europäische Geist gegen euch verfügt, sind die gleichen, die auch diese unaufhörlich in Ernten und Blüten wiedergeborene Erde besitzt. Der Kampf, den wir führen, ist des Sieges gewiß, weil ihm die Hartnäckigkeit des Frühlings eignet.