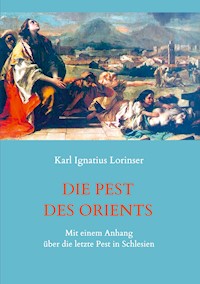
Die Pest des Orients. Mit einem Anhang über die letzte Pest in Schlesien 1708-1712. E-Book
Karl Ignatius Lorinser
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In "Die Pest des Orients", einem der bekanntesten Werke zu diesem Thema, behandelt Dr. Karl Ignatius Lorinser (1796-1853) die Ursachen und die Eindämmung von Pestepidemien. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf die klimatischen Bedingungen, die einen Pestlauf befördern, sowie auf die wirkungsvollsten Maßnahmen zur Verhütung und Eindämmung bereits entstandener Ausbrüche. Ein angehängter Originalbericht über die letzte Pestepidemie in Schlesien rundet das Werk ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt.
Erstes Buch.
I. Bedürfnis und Veranlassung, Stoff und Methode der Untersuchung.
II. Die Griechen.
III. Ibn Sina und die Arabisten.
IV. Nicolaus Massa, Fracastoro, Foreest und Victor de Bonagentibus.
V. Fioravanti, Massaria, Alpini und Porta.
VI. Paracelsus.
VII. Johannes Baptista van Helmont.
VIII. Athanasius Kircher.
IX. Plater, Sennert, Bocangel, Sydenham und Diemerbroek.
X. Die Franzosen bei der Pest in der Provence.
XI. Guastaldi, Muratori, Mead und Kanold.
XII. Chenot, Ferro, Howard und Russell.
Zweites Buch.
XIII. Pathologischer Charakter von Ägypten.
XIV. Heimat und Bereich der Pest.
XV. Das Beulenfieber, die ursprüngliche oder niedere Form der Pest.
XVI. Höhere oder vollendete Form der Pest.
XVII. Verhältnis des Beulenfiebers zur vollendeten Pest.
XVIII. Die Empfänglichkeit.
XIX. Die Schädlichkeit.
XX. Miasma, Mephitis und Contagium.
XXI. Seuchengang der Pest in Ägypten.
XXII. Seuchengang außerhalb Ägypten.
XXIII. Ansteckung, Verbreitung und Wanderung der Pest.
XXIV. Falscher Gegensatz und natürliches Verhältnis der Seuchen.
Drittes Buch.
XXV. Läßt sich die Pest ausrotten? Ist sie von Europa abzuhalten?
XXVI. Neue Erfahrungen ü. d. Ausbruch und die Beschränkung der Pest.
XXVII. Vorkehrungen im Orient.
XXVIII. Vorkehrungen an den Küsten Europas.
XXIX. Vorkehrungen auf dem europäischen Festlande.
XXX. Allgemeines Verfahren beim Ausbruch der Pest.
Anhang.
Die letzte Pest in Schlesien 1708–1712.
Die Pest des Orients.
Erstes Buch.
I. Bedürfnis und Veranlassung, Stoff und Methode der Untersuchung.
IN unsern Tagen eine Revision der Pestlehre anzustellen, ist aus mehr als einem Grunde nötig und wünschenswert. – Während man die immer noch drohende Gefahr durch Erweiterung und Verstärkung der Schutzwehren fernzuhalten sucht, und hier alle Vorkehrungen auf die Beschränkung und Vernichtung des Pestcontagiums gerichtet sind, wird das ganze Quarantäne-System von vielen, besonders in Frankreich, als ein schädlicher, dem jetzigen Zeitgeist widerstrebender Überrest verjährten Irrtums betrachtet, welcher mit den Fortschritten der Zivilisation und Industrie nicht länger vereinbar, und deshalb zu Gunsten des Handels aufzugeben sei. In Deutschland haben wir gelesen, daß bei dem heutigen Verkehr der Menschen auch die Ausbreitung der Pest nicht mehr gehindert werden könne, nachdem der Versuch mißlungen war, die Fortschritte der Cholera zu hemmen. Im Parlament von England ist noch vor kurzem die Behauptung vernommen worden, daß neun Zehntel der Ärzte die Pest für keine ansteckende Krankheit halten. – Sind auch dergleichen Stimmen und Wünsche bis jetzt noch von keiner Regierung erhört worden, die für das Wohl ihrer Völker wacht, so erfordern sie doch eine Antwort, durch welche die Wahrheit ans Licht gestellt und das Verfahren der Gesundheitspolizei gerechtfertigt wird. Das bloße Berufen auf die Praxis von Jahrhunderten reicht zu dieser Rechtfertigung nicht mehr hin, da eben die Erfahrung selbst es ist, welche jetzt geleugnet oder in Zweifel gestellt wird.
Und da sich kein Übel mit Bewußtsein verhüten läßt, wenn die Bedingungen seiner Entstehung unbekannt sind, so muß auch der Ursprung und Fortgang der orientalischen Pest nach Maßgabe der jetzt zu Gebote stehenden Mittel von neuem untersucht, und die Regel der Hygiene durch die Lehre der Pathogenie, die Praxis durch die Theorie begründet werden.
Um so nötiger wird dieses erscheinen, wenn man weiß, wie sehr in neuer Zeit das Studium der Pest von den meisten Ärzten hintangesetzt und fast vergessen worden ist, in Ländern besonders, die von dem gewöhnlichen Schauplatz der Seuche entfernter als andere sind.
Als Zeichen und Folge dieser Vergessenheit gibt sich kund, daß in den Hand-und Lehrbüchern der Medizin die schrecklichste aller Seuchen jetzt entweder mit gänzlichem Stillschweigen übergangen, oder auf die oberflächlichste Weise abgefertigt wird. Viele haben sich gewöhnt, in der Pest einen Feind zu erblicken, der, schon geschlagen, in den letzten Zügen liegt, und andere sprechen von demselben wie von einer Antiquität, die nur noch von geschichtlicher Bedeutung ist. Bei der Mehrzahl hat die Unkenntnis eine Sicherheit erzeugt, deren Folgen sich mit Schrecken zeigen würden, wenn der noch immer lauernde Geier des Orients abermals Gelegenheit fände, sich mit seiner alten Wut auf den unvorbereiteten Teil des europäischen Kontinentes zu stürzen.
Es ist aber nicht allein die besondere, aus dem Zweifel und der Unwissenheit entspringende Gefahr, sondern auch die Wissenschaft selbst, die heute verlangt, daß die Ärzte sich wieder einem Gegenstande zuwenden, den sie mit wenigen Ausnahmen schon zu lange außer Acht gelassen haben. Wir leben in einer Epoche, in welcher die Ereignisse uns nötigen, den Grund und das Verhältnis der Seuchen schärfer als jemals ins Auge zu fassen; die alten und abgenutzten Begriffe dieses Teils der Pathologie haben sich in ihrer ganzen Blöße und Mangelhaftigkeit gezeigt, die Notwendigkeit einer Reform in dieser Beziehung ist von vielen Seiten anerkannt, und die neuen Versuche, das Rätsel der Ansteckung zu begreifen, gehen ohne Zweifel aus einem wahren und unabweislichen Bedürfnis hervor. Ist dieses aber zu befriedigen, und die Lehre von den epidemischen und ansteckenden Krankheiten besser zu begründen, wenn die erste unter ihnen fast unbeachtet bleibt? – Die Pest ist der Inbegriff und das Protypon aller fieberhaften Seuchen; sie ist die Krankheit, welche im eminenten Sinn den ganzen Organismus ergreift, und nach der verschiedenen Beschaffenheit ihrer äußeren Bedingungen und der ihr unterworfenen Individuen als ein wahrer Proteus erscheint; zugleich aber ist sie diejenige, deren große Gewalt eine Reihe von bedeutungsvollen Wirkungen viel bestimmter und erkennbarer hervortreten läßt, als dies bei irgendeiner anderen Seuche wahrgenommen wird. Sie ist daher auch vorzüglich geeignet, ein richtigeres Verständnis in die Seuchenlehre zu bringen, und unter allen hierher gehörigen Krankheiten in jeder Hinsicht die lehrreichste, die man betrachten kann.
Aus diesen Gründen scheint es zweckmäßig und ganz an der Zeit zu sein, einen Versuch zu wagen, die uralte Krankheit im Lichte der neuen Erfahrung und Wissenschaft darzustellen, und wenigstens die Kenntnis einer Sache zu erleichtern, die für den Staatsmann und für den Arzt in gleichem Grade wichtig ist. Wie groß aber und vielfach die Schwierigkeiten sind, und welche Erfordernisse dazu gehören, um auf dem Standpunkt und nach dem Bedürfnis der heutigen Medizin eine klare Übersicht des Wirklichen und Wahren in der Pestlehre zu gewinnen, den überreichen Stoff zu bewältigen, und in die Masse verworrener, sich wechselseitig widersprechender Ansichten und Tatsachen Einheit und Zusammenhang zu bringen, davon hat nur derjenige einen Begriff, der zum Versuch sich selbst auf dieses weite und klippenvolle Meer hinausgewagt hat. Fehlt es dabei noch an den äußeren Mitteln, sich zurechtzufinden, und an dem rechten Kompaß des Geistes, so nehmen die Hindernisse zu, je weiter die Untersuchung fortgesetzt wird, bis man über kurz oder lang entweder abgeschreckt sich wieder zurückwendet, oder bei fernerem Beharren Schiffbruch leidet. Denn die Pest sowohl in ihrem Mutterlande als auch außerhalb desselben gründlich zu beobachten, die ihr entgegen gestellten Schutzwehren überall zu sehen und zu prüfen, und eine genügende Kenntnis der ganzen hierher gehörigen Literatur zu erwerben, sind nur die äußeren Bedingungen und Vorbereitungen für einen solchen Versuch, und schon allein so viel umfassend, daß kaum ein Einzelner sie zu erfüllen imstande ist, auch wenn ihn die glücklichste Gelegenheit und bei dem größten Fleiß das längste Leben begünstigt hätte. Und wäre es möglich, was noch keinem zuteil geworden, in den Besitz des vollen zum Werke dienenden Materials zu gelangen: wie schwer und wichtig ist erst die von inneren Bedingungen abhängige Sichtung und Bearbeitung desselben! Bei jedem Schritt begegnet man Zweifeln und Fragen, auf welche die Weisheit der Zeit nur eine halbe oder keine Antwort zu geben hat, und wie sehr man sich auch beschränken und vornehmen mag, das bloße Dasein und die Verbindung der äußeren Kausalmomente und Wirkungen festzustellen, so ist man doch unwillkürlich auf den allgemeineren und tieferen Grund der Erscheinungen hingewiesen, und zu Erklärungen genötigt, ohne welche der Zusammenhang, den man gesucht oder gefunden, nicht einmal sichtbar und verständlich wird. So allgemeine Schwierigkeiten, mit welchen sich mehr oder weniger noch besondere und individuelle verbinden, können von einem Unternehmen auf diesem Gebiete jeden Schriftsteller abhalten, der sich der Aufgabe in vollem Umfang bewußt ist, und die Beschränktheit seiner Kräfte kennt.
Niemals würde der Verfasser des gegenwärtigen Buches diese Bedenken überwunden haben, wenn nicht die Neigung und der Zufall ihn einen Teil jener Bedingungen hätte erfüllen lassen, die zur Beurteilung eines solchen Gegenstandes unerläßlich sind. Schon lange mit dem Studium und der Bekämpfung der Seuchen beschäftigt, und einst durch seltene Gunst in Stand gesetzt, die Mittel und Anstalten kennenzulernen, durch welche die Pest getilgt und abgewendet wird, allmählich auch in den Besitz einer Sammlung von Pestschriften gelangt, die nur in den wenigsten Bibliotheken gefunden werden mag, glaubte der Verfasser nicht ohne allen Beruf an dieses Werk zu gehen, und jetzt dasselbe wenigstens als Beitrag zu einem besseren nicht länger zurückhalten zu dürfen, nachdem seit dem Beginn seiner Untersuchungen fast sieben Jahre verflossen sind; ein Zeitraum, freilich zu kurz für die Sache selbst, aber zu lang für einen, der noch anderes zu vollbringen hat. Die Arbeit wurde gefördert und der Vorsatz oft von neuem befestigt durch die Betrachtung, daß theoretische Irrtümer leicht um so gefährlicher für die Praxis sind und werden können, je weniger noch diese selbst auf einem allgemein anerkannten und sicheren Fundament der Wahrheit ruht, und daß es unter der großen Menge von Schriften doch nur äußerst wenige gibt, die außer der Beschreibung der Krankheit und der Angabe der Arzneien sich auch ausführlich über die Hauptsache, d. h. über die Mittel zur Unterdrückung und Abwehr der Pest, verbreitet hätten. Sowohl das Ermessen der zu Gebote stehenden Zeit und Kraft, als auch die vorwaltende praktische Richtung erforderten jedoch, die Untersuchung auf den ätiologischen und hygienischen (polizeilichen) Teil der Pestlehre einzuschränken, und selbst bei dieser Begrenzung konnte in der Literatur nur auf solche Werke Rücksicht genommen werden, die in nächster Beziehung zu den Punkten standen, deren Erläuterung vorzüglich wichtig und nötig zu sein schien. Hierbei ist ohne Zweifel noch manche Schrift, die gute Dienste hätte leisten können, unbenutzt geblieben, weil sie aller Mühe ungeachtet nicht zu erlangen war; eine Schuld, die weniger den Verfasser selbst, als seine abgeschiedene Lage trifft.
Die bei der Untersuchung und Darstellung befolgte Methode sollte dem gegenwärtigen Zustand und dem Bedürfnis der Pathogenie und Hygiene entsprechen, ohne zu unfruchtbaren Betrachtungen zu führen, oder einer gedankenlosen Empirie zu dienen. – Die Hoffnung, durch bloße Begriffe ein lebendiges Werk zu erzeugen, und eine wahrhafte Erneuerung der ganzen oder auch eines Teils der Medizin auf spekulativem Wege herbeizuführen, ist so häufig schon getäuscht und vereitelt worden, daß gegen alle Versuche dieser Art die größte Gleichgültigkeit, ja selbst eine entschiedene Abneigung eingetreten ist, mit solchem Erfolge, daß heute ein ärztlicher Schriftsteller fast um so größere Anerkennung findet, je mehr er sich hütet, in den Verdacht der Spekulation zu fallen, und über die Entwicklung und den Zusammenhang der Erscheinungen zur Einsicht zu gelangen – als ob eine echte, von Tatsachen ausgehende Theorie der Medizin unmöglich, und der Arzt für immer verurteilt sei, auf der untersten Stufe der Naturforschung stehen zu bleiben. Desto eifriger und fast ausschließlich hat man sich auf die Beobachtung des sinnlich Wahrnehmbaren geworfen, und durch die vielfältigste Unterscheidung der Einzelheiten die Heilkunst zu bereichern geglaubt. Allein auch dieses Bestreben, weil nur auf das Äußere und den Anschein der Dinge gerichtet, vermag der Wissenschaft keinen Gehalt und Bestand zu geben; die fort und fort vermehrten, mit unendlicher Geschäftigkeit zu Tage geförderten Materialien sind zu einer drückenden und unabsehbaren Last geworden, und schon beginnt man einzusehen, daß in einer solchen, zum Teil gedankenlos und irrtümlich angehäuften Masse ein innerer Zusammenhang nicht zu finden, eine wahre Befriedigung nicht zu erwerben sei. Denn wo die sinnliche und skeptische Betrachtungsweise allgemein und vorherrschend geworden ist, da folgt von selbst, daß alle Prinzipien in Frage stehen, die größte Verschiedenheit der Ansichten und Meinungen eintreten, und in diesen ein unsicheres Hin- und Herschwanken sich zeigen muß. Es gibt daher kaum eine in die Heilkunst einschlagende Lehre mehr, in Hinsicht deren die Meinungen sich alle gleich verhielten, keinen Grundsatz, der nicht geleugnet, und nur eine kleine Zahl von Tatsachen, die nicht bestritten würde.
Oft jedoch erzeugt ein dringendes Bedürfnis seinen Gegenstand, aus der Verwirrung stellt sich eine neue Ordnung her, und die Anarchie wird die Mutter einer wohltätigen Wiedergeburt. Auf jenem Bedürfnis und auf der Gewißheit, daß die gegenwärtige Zeit in Hinsicht aller Wissenschaften eine wichtige Periode des Überganges ist, beruht auch im ärztlichen Gebiet die Hoffnung einer Entwicklung, in welcher mitten unter vielen hinfälligen Auswüchsen bessere und fruchtbare Keime vorbereitet werden. Hier aber kommt es vorläufig nicht sowohl auf neue Erfindungen und Gedanken an, sondern es handelt sich vor allem um die Ermittlung und Feststellung dessen, was von Anfang bis auf unsere Tage als erworbene Wahrheit zu betrachten, und was dagegen als Irrtum auszuscheiden und als nutzlos zu beseitigen ist; eine Aufgabe, die nicht anders erfüllt werden kann, als wenn die uns überlieferte Summe der Tatsachen und Ansichten kritisch geprüft, und die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen durch Analyse und Kombination unter bestimmte allgemeine Gesichtspunkte und auf ihren einfachsten Ausdruck, d. h. auf ihren Begriff, und ihr sogenanntes Gesetz zurückgebracht wird. Die Haupterfordernisse also, ohne welche die Wissenschaft aus der Verwirrung nicht zu retten, und eine bessere Grundlage nicht zu gewinnen ist, sind erstlich die Geschichte, die als der eigentliche Boden und als die Einleitung zu allem Wissen hier die Tatsachen und Erscheinungen des kranken Lebens, wie die Veränderungen des ärztlichen Wissens und Wirkens aufzuzeigen hat, und dann die Philosophie, insofern sie, ausgehend von der Grundbeschaffenheit des Menschen, bei wissenschaftlichen Untersuchungen und Darstellungen überhaupt den Irrtum zu erkennen und zu meiden, die Wahrheit aber zu finden und festzuhalten lehrt. Die Geschichte gibt gewissermaßen das körperliche Element für die Wissenschaft her, ihre Frucht und ihr Ergebnis soll die Erfahrung sein; die Philosophie hingegen soll als das geistige Element die Erfahrung mit der Idee beseelen, also, daß beide wechselseitig sich bedingend und ergänzend miteinander übereinstimmen, die Erfahrung der Idee nicht widerstreite, und die Idee in der Erfahrung sich bewähre.
Diese Übereinstimmung – das Ziel der wissenschaftlichen Medizin – ist weder durch die sinnliche Erkenntnis des äußerlich Wahrnehmbaren, noch in dem Kreise abstrakter Begriffe zu erreichen. Denn das bloße sinnliche Erkennen läßt die Ursache und den Zusammenhang, das Selbständige und Substantive der Dinge unberührt; es lehrt ausschließlich nur das Erscheinende, Äußere und Adjektive kennen, und auch dieses nur in seinem Verhältnis zu anderen Außendingen und zu uns selbst; das abstrakte Denken aber, allein und abgelöst von der Erfahrung, verliert in den gemachten Begriffen nur zu leicht seinen wahren Grund und Gegenstand aus den Augen; es versteigt sich in gehaltlose Träume und Hirngespinste, und wird gefährlich für das Leben, wenn es die abgezogenen Begriffe als das Wesen der Dinge selbst betrachtet. Der rechte Weg zum Ziel wird nur dann gefunden, wenn die empirische und die rationelle Methode zu einer einzigen verschmelzen, und in dieser Vereinigung zur historisch-kritischen sich steigern, bei welcher der Gegenstand durch die Geschichte der Erscheinungen und Tatsachen, sowie durch die wahre Philosophie des Lebens erleuchtet werden kann, und somit eine festere Grundlage und vollständigere Erkenntnis möglich wird. Auf geschichtlichen Boden und mit philosophischer Kritik sollte daher auch die Lehre von den Seuchen gegründet werden, die von Zeit zu Zeit die Welt in Schrecken setzen, vorzüglich die Lehre von einer Seuche, welche noch immer das Haupt und die furchtbarste unter allen, einen Namen führt, womit von jeher alles, was dem Menschen Gefahr und Verderben bringt, bezeichnet worden ist.
Mit Rücksicht auf das hier angezeigte Bedürfnis des Lebens und der Wissenschaft, wenngleich nicht mit einem Erfolge, der überall den Verfasser selbst befriedigen könnte, soll in gegenwärtiger Schrift versucht werden, zu prüfen und darzulegen, was wir heute über den Ursprung und die Abwendung der Pest in Wahrheit wissen und benutzen können. Und da die Kunde um diese Dinge nicht als ein Ergebnis von gestern, sondern als die entwickelte Frucht von Jahrhunderten betrachtet werden muß, hierbei aber eine Prüfung vieler Tatsachen bisher unterblieben, und zum Verständnis derselben ein fester Gesichtspunkt ohne Rückblick auf die Vergangenheit nicht zu gewinnen ist, so scheint es zweckmäßig zu sein, daß wir zur Einleitung die Hauptzüge dieser Lehre, wie sie die Vorfahren allmählich erzeugt und überliefert haben, in Betrachtung ziehen, hierauf uns gleichsam in die Mitte des Gegenstandes selbst versetzen, mit Hilfe der alten und neuen Erfahrung uns im Einzelnen zurechtzufinden, und dieses auf das Allgemeine zu beziehen suchen. Indem wir also zuvor den werdenden Stoff unserer Lehre in seiner Entfaltung verfolgen, und dann den gewordenen in seiner Gliederung betrachten, schlagen wir die zwei verschiedenen Wege ein, welche, jeder gründlichen Forschung unentbehrlich, bei einem Ziel zusammentreffen müssen. Damit nun zuerst erhelle, wie und durch welche Geister die Lehre von der Entstehung, Verbreitung und Abwehr der Pest gebildet worden, welche Veränderungen sie erfahren, welche Wirkungen sie hervorgebracht hat, muß der schriftliche Nachlaß derjenigen befragt werden, die unter einer Wolke von Nachfolgern gleichsam als Häupter und Anführer die Gestaltung dieser Lehre vorzüglich bestimmt und auf die Richtung derselben wesentlichen Einfluß ausgeübt haben. Dann soll der Ursprung und das Mutterland der Pest aus der Krankheitsform, aus den ursächlichen Momenten und aus dem Seuchengange nachgewiesen, die Verbreitung erklärt, und das Verhältnis zu anderen Seuchen angegeben werden. Endlich haben wir die Einrichtungen zu beschreiben, welche nach den Ergebnissen der Pathogenie und nach den Erfahrungen der Hygiene zur Verhütung dieses Übels heilsam oder schädlich sind.
II. Die Griechen.
ZU allen Zeiten war der Ausdruck Pest ein allgemeiner Name, mit welchem nicht nur ein bestimmtes Leiden, sondern fast jede tödliche Seuche ohne Unterschied bezeichnet wurde. Dieser Name ist zwar auch auf die Krankheit, welche hier betrachtet werden soll, schon bei ihrem ersten Erscheinen übertragen worden, aber nicht so ausschließlich, daß nicht bis auf den heutigen Tag auch andere verderbliche Seuchen so genannt worden wären, und dies ist der Grund, warum dieselbe zur genaueren Unterscheidung noch besonders als die morgenländische, levantische, Drüsen- oder Beulenpest (Pestis orientalis, inguinaria) bezeichnet wird.
Wie gering auch unsere Kenntnis ist von den alten Pesten, welche nach dem Zeugnis der heiligen Schrift1 die Ägypter unter dem Pharao, die Philister und die Israeliten zu Davids Zeit befallen, oder nach den Geschichten von Herodot, Thukydides, Livius, Diodor u. a. in Asien, Italien und Griechenland gewütet haben, so geht doch aus allen noch vorhandenen Erwähnungen hervor, daß jene Seuchen in mancher Hinsicht anders gestaltet, und nicht von allen den Erscheinungen begleitet waren, die jetzt als die sichersten und deutlichsten Kennzeichen dieser Krankheit angesehen werden. Die Geschichtschreiber sind hier viel wichtigere Zeugen als die griechischen Ärzte, welche die Pest nirgends ausführlich beschrieben, davon nur kurz und oberflächlich, im allgemeinen oder gelegentlich bei andern Krankheiten gehandelt haben, gleichsam als hätten sie nur von fern und auf der Flucht darüber reden gehört.
In dieser Sache steht sogar Hippokrates bei weitem seinem Zeitgenossen Thukydides nach, und von Galenus wird gesagt, daß er das Übel lieber fliehen als beobachten und beschreiben wollte.
Jene alten Pesten waren zwar von den allen bösartigen Fiebern gemeinschaftlichen Symptomen begleitet, sie zeichneten sich aber stets durch ungemein heftige Entzündungen aus, die auf der äußeren wie auf der inneren Körperfläche entstanden, oft mit Eiterung oder Brand und zuweilen mit Verlust einzelner Organe sich endigten. Die Entzündungen zeigten sich teils in großer Ausdehnung auf der äußeren Haut (ignes sacri), oft kleinere oder größere Blasen und Pusteln hervorbringend, die in Eiterung übergingen; teils erschienen sie mehr begrenzt, aber um so heftiger an einzelnen Stellen als Karbunkel, oder weiter entwickelt als Geschwüre, häufig auch die Augen oder die Hände und Füße, so wie die Gegend der Geschlechtsteile ergreifend, innerlich aber hauptsächlich die Organe des Atemholens, die Mund- und Rachenhöhle einnehmend. So war die athenische Pest (430 J. vor Christus) nach der Beschreibung des Thukydides mit roter und dunkelblauer Haut voll kleiner Blasen, mit Entzündung (Röte und Brennen) der Augen und des Schlundes, mit heftigem Husten und Heiserkeit, mit Entzündung und oft mit Brand der Glieder, zuweilen mit Verlust derselben, so wie der Augen, verbunden2. Ebenso hat auch Hippokrates unter den Erscheinungen der Pestseuche bösartige Haut Entzündungen, Augen-Entzündungen und Vorfall der Augenlider, Mundgeschwüre und Entzündung der Zunge, Schmerzen im Schlunde, verhindertes Sprechen (Heiserkeit?), Hautausschläge und Karbunkel hervorgehoben, obgleich er nur im allgemeinen von den pestartigen Krankheiten spricht. Die Hautentzündung soll sich mit kleinen Geschwüren oft über den ganzen Körper, vorzüglich über den Kopf verbreitet haben, glücklich, wenn es zur Eiterung kam, meistens aber tödlich, wenn die Entzündung zurücktrat und verschwand. In der großen Pest unter dem Kaiser Antonin, welche das römische Reich drei Jahre verheerte und durch die Kriegerschar des Lucius Verus aus dem Orient nach Europa gebracht worden war, sind als vorwaltende Symptome eine pustulöse Hautentzündung, heftiger Husten und Heiserkeit, übler Geruch und bösartige Röte des ganzen Mundes, der Zunge und des Schlundes wahrgenommen worden3.
Um die Mitte des dritten Jahrhunderts kamen bei der schrecklichen, im Morgen- und Abendlande verbreiteten Pest, wegen welcher der heilige Cyprian, Bischof von Karthago, eine Ermahnung an die Christen schrieb4, wiederum heftige Schlund- und Augenentzündungen, brandiges Verderben, zuweilen auch Verlust einzelner Glieder, und als Folge davon verhindertes Gehen, Taubheit und Erblindung vor. Von derselben Art war ohne Zweifel auch die Krankheit, welche um das J. 263 das volkreiche Alexandrien verödet, und über deren gewaltige Ansteckung der Bischof Dionysius aufmerkwürdige Weise sich geäußert hat5. Und bald nach dem Anfang des vierten Jahrhunderts sah man, wie Eusebius berichtet, mit einer Pest zu Alexandrien dieselben Erscheinungen – heftige Hautentzündung, bösartige Geschwüre und Karbunkel, Bräune, Entzündung und Verlust der Augen – wiederkehren, ganze Häuser verlassen, und die Krankheit von einem auf den andern übergehen6. Endlich ist auch die Pest, welche im fünften Jahrhundert unter dem Kaiser Marcian aus dem Orient bis an die Donau gedrungen, mit (entzündlicher) Anschwellung der Körper, mit einem tödlichen Husten, mit Augenentzündung und als deren Folge mit Erblindung verbunden gewesen7.
Diese Symptome, welche gewöhnlich mit einer brennenden Hitze und meistens auch mit Erbrechen oder Durchfall zusammentrafen, werden von den gleichzeitigen Schriftstellern einstimmig als die charakteristischen und beständigen Merkmale jener Seuchen betrachtet; dagegen ist in den Beschreibungen nirgends die Rede von den in den Weichen, unter den Achseln und hinter den Ohren vorkommenden Beulen oder Drüsengeschwülsten, an welchen wir heute das Dasein der Pest am sichersten erkennen. Thukydides erwähnt nur, daß die Krankheit, wenn schon das Schwerste überstanden war, sich von dem Haupte nach dem ganzen Leibe zog und in den äußersten Teilen die Scham, die Hände und die Füße ergriff, so daß manche mit dem Verlust dieser Glieder davonkamen. Und die Bemerkung des Hippokrates, daß in der Gegend der Geschlechtsteile und Weichen Geschwülste und viele Geschwüre zum Vorschein gekommen, muß vielmehr auf die allgemeinen zu brandigem Verderben geneigten Entzündungsgeschwülste bezogen werden, weil zuvor von ihm angeführt ist, daß diese nicht nur den Kopf, sondern auch die Arme und Schenkel oder andere Teile des Körpers entblößen und zerstören, am schlimmsten aber unter allen sich erweisen, wenn sie die Schamgegend ergreifen. Diese Erklärung wird von Galen bestätigt, der nirgends von eigentlichen Beulen spricht, wohl aber bemerkt, daß bei der Pest die Gegend der Geschlechtsteile von der Entzündung befallen werde.
Alle schweigen überdies gänzlich von einer Geschwulst der Achsel- und Ohrdrüsen, welche doch, wenn sie vorhanden gewesen wäre, nicht unbemerkt hätte bleiben können. Und wenn sich auch von Galen keine genauen Beobachtungen über eine Krankheit erwarten lassen, vor welcher er aus Rom und Aquileia geflohen sein soll, so würden doch Thukydides, der in der Beschreibung der Seuche sehr ausführlich ist, Hippokrates, der das Bezeichnende hervorzuheben pflegt, und auch die späteren Berichterstatter so auffallende, an drei verschiedenen Orten entstehende Beulen nicht übersehen haben, wenn solche wirklich die Krankheit begleitet hätten.
Bei der Pest, wie sie heute erscheint, sind diese Beulen als die zuverlässigsten und beständigsten Merkmale angesehen, dagegen fehlen bei derselben jene allgemeinen Entzündungen der äußeren Oberfläche, es fehlen die heftigen Augenentzündungen, die oft Erblindung, der Brand, der oft die Zerstörung und den Verlust der Glieder zur Folge hatte, es fehlen die bösartige Entzündung des Mundes, der Zunge, des Schlundes und der Luftwege, in der Regel fehlt auch der Husten und die Heiserkeit. Daher hat man geschlossen, daß die Beulenpest eine neue, erst im sechsten Jahrhundert entstandene Krankheit sei, und aus dieser Voraussetzung sind die kühnsten, aber nicht die glücklichsten Folgerungen sowohl in Hinsicht der Hygiene, als auch der Pathogenie hervorgegangen.
Der Meinung von diesem angeblich neueren Ursprung der Beulenpest stehen indessen die Zeugnisse des Rufus von Ephesus und des Aretaeus entgegen, nach welchen es keinem Zweifel unterliegen kann, daß wahre Pestbeulen schon lange vor dem sechsten Jahrhundert die Seuche zuweilen begleitet haben. In den für verloren geachteten Fragmenten des Oribasius, welche vor wenigen Jahren der gelehrte Angelo Mai unter den Schätzen der Vatikanischen Bibliothek wieder aufgefunden und bekannt gemacht hat, ist aus dem ersten Jahrhundert eine Stelle jenes Rufus, eines Zeitgenossen des Kaisers Trajan, enthalten, die offenbar hierher gehört. Da heißt es, daß die sogenannten Pestbeulen am tödlichsten und hitzigsten sind, und am häufigsten in Libyen, Ägypten und Syrien entstehen und beobachtet werden. Zugleich erfährt man, daß von diesen Beulen früher noch ein Dioskorides und ein Posidonius in einem Buche über die zu ihrer Zeit in Libyen ausgebrochene Pest gehandelt haben, mit welcher ein brennendes Fieber, Aufregung des ganzen Körpers, Schmerzen, Delirien und Auffahren von großen, trockenen, aber nicht eiternden Beulen sowohl an den gewöhnlichen Stellen (in den Weichen?), als auch an den Kniekehlen und Ellenbogen verbunden waren. Weiterhin folgt noch eine andere Stelle desselben Rufus, wo er die unschädliche, in einem gewissen Lebensalter an der Scham entstehende Beule von der Pestbeule unterscheidet, und die Untersuchung beider als nützlich empfiehlt, damit man die erstere als eine gefahrlose, die pestartige aber mit Voraussicht und Aufmerksamkeit behandle. Und der Kappadocier Aretaeus, der zu Ende des ersten Jahrhunderts blühte, und nach dem Hippokrates als der genaueste Nosograph bekannt ist, erwähnt ausdrücklich „der gefährlichen und höchst bösartigen Pestbeulen in den Weichen, welche die Griechen Bubonen nennen“. Dieselben kommen im sechsten Jahrhundert bei der großen Pest, welche nach ihrem Anfang die von Pelusium, sonst auch die Justinianische heißt, laut dem Bericht des Bischofs Evagrius und des Procopius allgemein vor, und seit dieser Zeit ist die Seuche nicht wiedergekehrt, ohne beständig die nämlichen Merkmale zu zeigen. Von den Ärzten aber ist unseres Wissens Paul von Ägina, im siebenten Jahrhundert, der erste, welcher die drei verschiedenen Stellen, in den Weichen, Achseln und hinter den Ohren, deutlich bezeichnet, an welchen die Beulen auszubrechen pflegen.
Wie vieles auch in Hinsicht der alten Pesten noch geschichtlich zu erforschen übrig bleibt, so erhellet doch schon hinlänglich, daß diejenigen Schriftsteller, welche die Beulen in sämtlichen Pesten des Altertums zu erblicken wähnen, sich eben so sehr im Irrtum befinden, als die andern, welche die Beulenpest erst für eine Ausgeburt des sechsten Jahrhunderts erklären. In der Pest des Thukydides und in allen, die ihr ähnlich und im Laufe von acht Jahrhunderten gefolgt sind, berechtigt uns nichts, auf das Dasein der Beulen zu schließen; aber neben dieser Form hat wenigstens fünf bis sechs Jahrhunderte eine Beulenpest existiert, welche, wenn der von Rufus angeführte Dioskorides, wie es wahrscheinlich, der ältere dieses Namens, ein Alexandriner und Zeitgenosse des Antonius und der Cleopatra gewesen8, schon vor Christi Geburt in Afrika beobachtet worden. Endlich ist die Pestform des Thukydides gegen das Ende des fünften Jahrhunderts gänzlich verschwunden, und die des Dioskorides hat seit dem sechsten das Feld allein behauptet.
Es fragt sich nun, ob diese Formen durchaus verschieden, oder so nahe miteinander verwandt gewesen sind, daß man die Beulenpest als eine im Verlaufe der Zeit zu Stande gekommene Abart und Metamorphose der älteren oder ursprünglichen Form betrachten darf. Zuvörderst möchte zu beachten sein, daß diese wie jene nach den Angaben der Schriftsteller aus einer und derselben Weltgegend, nämlich aus dem Orient, hervorgegangen, und meistens in Ägypten, Libyen und Äthiopien zuerst bemerkt worden ist, sowie denn auch in Hinsicht der Ansteckung und der dadurch verursachten großen Verheerung und Tödlichkeit wohl keine der andern nachgestanden hat. Ebenso unbedenklich darf angenommen werden, daß die Symptome eines bösartigen Fiebers und die zu diesem sich leicht hinzugesellenden Ausleerungen nach oben oder unten beiden Formen gemeinsam, der wichtigste Unterschied aber hauptsächlich nur in der Art und dem Sitz der Hautausschläge und Entzündungen begründet gewesen ist. Indessen sind die unterscheidenden Merkmale der ersten Form, wenigstens teilweise und unvollkommen entwickelt, auch bei der Beulenpest beobachtet worden, und noch in späteren Zeiten gleichsam als Andeutungen oder als Überreste jener gewaltigen Entzündungen erschienen, mit welchen die Krankheit im Altertum begleitet war. So bemerkt man anstatt der heftigen Augenentzündung, die oft mit Blindheit und Verlust des Organes endigte, noch heute wenigstens eine Röte der Augen, die wie Blutstreifen anzusehen und von neueren Beobachtern als charakteristisch angegeben ist. Noch in der Beulenpest unter Justinian sind nach dem Bericht des Procopius Mund- und Halsentzündungen und Blutauswurf vorgekommen; ja der tödliche, mit blutigem Auswurf verbundene Husten ist während der großen Pest des vierzehnten Jahrhunderts in verschiedenen Ländern aufs neue beobachtet worden. In der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sah Jacob Ricci, Wundarzt des alten Pestlazaretts zu Venedig, nach Eröffnung der Beulen in den Weichen fast immer bösartige Entzündungen (erysipelata mala estiomena) und brandiges Verderben der Gliedmaßen erfolgen. Um dieselbe Zeit wurden auch gewisse Pusteln auf der Zunge und besonders am Gaumen, sowie verhindertes Schlucken noch von Nicolaus Massa als Kennzeichen angeführt, auf die man bei der Untersuchung der Pestkranken zu achten habe9. Die kleinen Blasen auf der Haut, so häufig in den alten Pesten wahrgenommen, zeigen sich nach Wolmar noch heute bei vollblütigen Kranken als Frieselbläschen (pustulae vesiculares), die einen schwarzen Punkt in der Mitte und einen roten Rand im Umkreise haben, gewöhnlich aber erst nach dem Tode gefunden werden. Alle diese Erscheinungen erinnern bedeutungsvoll an die Symptome in der alten Zeit, sowie hinwiederum in der Entzündung, die nach dem Thukydides, Hippokrates und Galen so häufig um die Geschlechtsteile entstand, wenigstens schon eine vorwaltende Neigung zu Ablagerungen in dieser Gegend sich nicht verkennen läßt. Erwägt man überdies, daß die Beulen im sechsten Jahrhundert zum Teil mit den alten Symptomen verbunden waren, in der Folge aber, nachdem die brandigen Entzündungen schon längst nicht mehr beobachtet wurden, als die auffallendsten Erscheinungen immer deutlicher und häufiger bezeichnet werden, so mögen überwiegende Gründe vorhanden sein, die Beulenpest für eine Abart oder Metamorphose der älteren Pesten anzusehen, wie ähnliche Veränderungen in der Form wohl auch bei andern Krankheiten vorgekommen sind.
Das sechste Jahrhundert, in welchem diese schon lange vorbereitete Metamorphose auf eine furchtbare Weise sich im Großen entwickelt hat, ist in der Geschichte der Krankheiten, sowie der menschlichen Leiden überhaupt, als eines der merkwürdigsten genugsam bekannt. Das Gedränge der Völker, die blutigen Kriege und der Einsturz der Reiche wurden zu derselben Zeit auch von den heftigsten Wehen der Natur begleitet. Ungewöhnliche Ereignisse in dem Erdkörper und seiner Atmosphäre waren zwar dem Ausbruch großer Seuchen stets vorangegangen, aber kaum jemals so mächtig und vielfach eingetreten, als um diese Zeit. Die Erde wankte fast alljährlich während der ganzen Regierung Justinians, die Städte Berytus, Seleucia, Anazarbus u. a. wurden zerstört, Konstantinopel erschüttert, und viele tausend Menschen im Jahre 529 allein unter den Trümmern von Antiochien begraben. Die Erdbeben wechselten mit vulkanischen Ausbrüchen und verwüstenden Überschwemmungen ab, der Nil bedeckte die Niederungen Ägyptens länger als seit Menschengedenken, die Luft wurde durch Hitze und schädliche Dünste verdorben, der Untergang der Welt als bevorstehend angesehen. Bereits im Jahre 531, als am nächtlichen Himmel der Komet Lampadias gesehen wurde, soll die Pest, man wußte nicht woher, nach Konstantinopel gekommen sein, damals aber weder beträchtliche Verbreitung erlangt, noch viele Menschen getötet haben. Die große Seuche nahm ihren Anfang erst um das Jahr 542, und von dieser versichert Procopius, daß sie ursprünglich zu Pelusium in Ägypten erschienen sei, und dann allmählich auf Syrien, Kleinasien und die benachbarten Länder übergehend, immer jedoch von den Seeküsten anfangend, fast ganz Europa entvölkert, viele Jahre fortgedauert, und in Konstantinopel während ihrer größten Wut täglich mehr als zehntausend Menschen dahingerafft habe. Außer dem heftigsten Kopf- und Seelenleiden waren Mund- und Halsentzündung, Husten und Blutauswurf, schwarze Petechien und Pestbeulen in den Weichen, in den Achseln oder bei den Ohren als die wichtigsten Symptome zu bemerken. Die Seuche dauerte mit kurzen Unterbrechungen, und abwechselnd bald dieses bald jenes Land überziehend, fast bis zu Ende des Jahrhunderts fort, d. h. die Ausbrüche derselben wiederholten sich so oft, und die Invasionen folgten so schnell aufeinander, daß manche Städte, z. B. Antiochia, drei- bis viermal davon heimgesucht wurden10.
In diesem Zeitraum mag die Form der Krankheit, wie auch Schnurrer vermutet, während der verschiedenen Invasionen allmählich sich anders gestaltet haben, und man fühlt sich geneigt zu glauben, daß das Übel zuletzt als reine Beulenpest erschienen, und deshalb Lues inguinaria genannt worden sei.
Seitdem ist kein Jahrhundert vergangen, in welchem diese Plage den großen, um das mittelländische Meer sich herumziehenden Länderkreis unter vor- und gleichzeitigem Eintritt anderer Naturereignisse nicht wiederholt betroffen hätte; tausend Jahre aber mußten fast vergehen, bevor das Abendland Ärzte hervorbrachte, welche den düsteren Unhold näher zu erforschen fähig gewesen wären, oder auch nur mit schärferem Auge anzuschauen gewagt hätten. Während dieses langen Mittelalters sind die Araber die ersten gewesen, die, im Besitz der Schriften Galens und auch dem Mutterlande der Pest am nächsten stehend, einige Kenntnisse über dieselbe gesammelt und hinterlassen haben, vor allen Ibn Sina, dessen Leben dem zehnten und elften Jahrhundert angehört.
III. Ibn Sina und die Arabisten.
ES ist zweifelhaft, ob dieser Wesir – der in der Medizin wie ein Despot geherrscht und selbst die abendländischen Ärzte über fünf Jahrhunderte in der Sklaverei erhalten – die Pestseuche selbst beobachtet, oder nur die Lehren seiner Vorgänger und Zeitgenossen darüber zusammengetragen hat. Indessen können wir sicher sein, daß die in verschiedenen Stellen seines Kanons enthaltenen Aussprüche dasjenige umfassen, was man damals und noch viel später über diesen Gegenstand wirklich gewußt und fast als untrüglich angesehen hat.
Nach dem Kanon entsteht die Pest zunächst durch ein bösartiges Verderben der Luft, welches in der wesentlichen Substanz derselben, nicht aber in quantitativen Veränderungen gegründet ist. Ein solches Verderben kommt auch im faulenden Wasser vor, und wird überhaupt die Fäulnis genannt. Reine Luft kann freilich ebensowenig wie reines Wasser faulen; allein die Atmosphäre, die wir atmen, ist niemals rein, sondern stets mit einer Menge von wäßrigen, dunstigen, erdigen und feurigen Teilen gemischt, durch welche die Fäulnis vermittelt wird. Diese und die Pest ereignen sich gewöhnlich zu Ende des Sommers und im Herbst; zuweilen strömt auch die verdorbene Luft aus dem Innern der Erde hervor, oder wird durch die Winde aus Gegenden herbeigeführt, wo sich Sümpfe, Niederungen und unbegrabene Leichen befinden. Eine vorausgehende Nässe mit darauf folgender Hitze, und das beständige Wehen der Südwinde sind ebensowohl Ursachen als Vorzeichen der Pest. Überhaupt sind die entfernteren Ursachen der pestartigen Fieber in den Himmelskörpern, die näheren in irdischen Dispositionen zu suchen; aus dem Zusammenwirken beider wird in der Luft eine große Menge Feuchtigkeit und durch diese die Fäulnis erzeugt, die dem ganzen Organismus, besonders aber dem Herzen feindselig ist. Derselben Wirkung ist es zuzuschreiben, daß als Vorzeichen der Pest die unterirdischen Tiere ihre Schlupfwinkel verlassen und auf der Oberfläche der Erde zum Vorschein kommen, so wie auch durch die Fäulnis um diese Zeit die Frösche sich vervielfältigen und die Vermehrung der Insekten begünstigt wird. Besonders ist die Pest zu fürchten, wenn der Himmel und die Luft an einem Tage sich mehrere Male verändern, hierauf bei trüber Witterung die Südwinde einige Tage stärker wehen, und dann eine heitere Woche mit großer Hitze am Tage und kalten Nächten folgt. Dies war die arabische Ansicht von der Entstehung der Pest.
In der Beschreibung der Symptome zeigt es sich deutlich, daß Ibn Sina die Krankheit noch nicht genau als eine eigentümliche zu unterscheiden wußte, und über die ältere, allgemeine und unbestimmte Ansicht hinauszugehen nicht imstande war. Weil Galen die Beulenpest nirgends beschrieben, wohl aber unter dem Namen pestartiger Fieber verschiedene bösartige Krankheiten zusammengefaßt hatte, so wagte auch der Sohn des Ali nicht, obwohl er dazu berechtigt gewesen wäre, die ihm bekannt gewordene Krankheit als eine besondere einzuführen; er begnügte sich, dieselbe unter die galenischen Begriffe von den pestartigen Fiebern und Apostemen mit einzuschieben, um so den Einteilungsgründen seines Meisters vollkommen treu zu bleiben. In Folge dieser unterwürfigen Rücksicht sind die allgemeineren Symptome – ein kleiner und schneller Puls, starke Hitze, großer Durst, Trockenheit der Zunge, Spannung des Unterleibes, Angst und Unruhe, Schlaflosigkeit, Irresein, Ausschläge und Geschwüre, Durchfall, klebriger Schweiß, Krämpfe und Kälte der Gliedmaßen – bei den Zufällen der pestartigen Fieber angeführt, die wichtigeren Bubonen aber in einem ganz andern Buche unter den äußerlichen Krankheiten von ihm beschrieben, wodurch das Bild der Krankheit gleichsam zerrissen worden ist.
In dem Abschnitt nämlich, der von den Apostemen, der Drüsen handelt, wird als eine Art derselben unverkennbar die Pestbeule (Althohoin) bezeichnet, und dabei bemerkt, daß diese während der Pest und in verpesteten Gegenden häufig sei, und in den Weichen, unter den Achseln und hinter den Ohren zu erscheinen pflege.
Die im Anfang rote und späterhin gelbe Beule wird dabei als heilsam, die schwarze als todbringend, jede aber als gefährlich geschildert, weil sie durch die Arterien nachteilig auf das Herz wirken, Störungen im Blutumlauf, Erbrechen und Bewußtlosigkeit hervorbringen. Nach diesen sehr deutlichen Angaben hat Ibn Sina ohne Zweifel die Beulenpest im Sinn gehabt, wenngleich von ihm zur Abwehr und Verhütung derselben nur Arzneien angeraten und einige diätetische Regeln empfohlen werden, und nirgends ersichtlich ist, daß er die ansteckende Eigenschaft dieser Krankheit erkannt, oder auch nur von fern geahnt hat11.
Seine Nachfolger haben sich nicht beeilt, eine Berichtigung oder Vermehrung dieser dürftigen Kenntnis herbeizuführen. Bis in das sechzehnte Jahrhundert hin ein bestand die ärztliche Pestlehre fast in der bloßen Erklärung und Wiederholung dessen, was Ibn Sina im Kanon, Galen von den pestartigen Fiebern, und Hippokrates besonders im dritten Buche von den Volkskrankheiten gesagt und hinterlassen hatten. Indessen war die Ansteckung, besonders während der Herrschaft des schwarzen Todes im vierzehnten Jahrhundert, zu deutlich und furchtbar erschienen, als daß sie länger unbeachtet hätte bleiben können12. Aber nicht die Natur, sondern die Schriften der Toten wurden befragt, damit man die Pest erkennen und heilen lerne; ein fruchtloses Bemühen, durch welches die Sache nicht weiter gefördert, und stets nur in demselben Kreise umgetrieben wurde. Wenn auch diese Schriften zu nützlichen Anhaltspunkten dienen mochten während des langen chaotischen Zustandes, in welchem aus der gärenden Mischung sehr verschiedener alter und neuer Elemente erst wieder eine Zukunft für die Wissenschaften sich gestalten sollte, so hat doch die Geschichte gelehrt, daß der ins Lateinische übersetzte Ibn Sina im Allgemeinen nicht minder schädlich für die Medizin, als der nach Europa gebrachte arabische Aristoteles für die Philosophie gewesen ist; wie denn auch die erstere, und besonders die Pestlehre, überhaupt nichts wahrhaft Neues gewinnen konnte, als in der Folge bei der wieder erwachten Neigung zur griechischen Gelehrsamkeit und Philologie die galenischem und hippokratischen Bücher allgemein verbreitet, und gleichsam mit zum Kanon erhoben wurden. Nur durch den Mangel einer tüchtigen einheimischen Grundlage läßt sich das beharrliche Festhalten an der wieder aufgefundenen fremden erklären, und so groß ist die blinde Verehrung jener alten, zum Teil verfälschten Schriften gewesen, daß Galen und Ibn Sina inmitten des neuen Europas und ungeachtet aller Veränderung der Krankheiten die Ärzte fortwährend in Fesseln erhalten. die unbefangene Naturbetrachtung verhindert und somit auch die freie Entwickelung der Medizin zurückgehalten haben. Daher ist in der ärztlichen Literatur dieses Zeitraumes weder Leben noch Eigentümlichkeit zu finden; unter dem Joch der Heiden und Mohammedaner schien die Heilkunst zum Stillstand verurteilt, und das regenerative Prinzip derselben unterdrückt und fast getötet zu sein. Die ganze Wissenschaft hatte einen stereotypischen Charakter angenommen, und dieser ist es, der uns auch in allen damals verfaßten Pestschriften entgegentritt.
Der beste Gewinn, zu welchem die Ärzte fast wider ihren Willen gelangten, war die sich überall dem Volke aufdringende Beobachtung, daß die Pest von den Kranken auf die Gesunden durch Ansteckung überging.
Von dieser Wahrheit waren im vierzehnten Jahrhundert Gentilis von Foligno13, Guy von Chauliac 14, Galeazzo di Santa Sofia15, im fünfzehnten Chalin de Vinario16, Michael Savonarola17 und der Mönch Jacobus Soldus18 vollkommen überzeugt.
Schon im Jahre 1347, als der schwarze Tod seine Verheerungen in Europa begann, hatten handeltreibende Seefahrer vier Schiffe voll Pestkranker aus der Levante nach Genua gebracht, und die Krankheit mit reißender Schnelligkeit im Hafen und in der Stadt verbreitet. Daher verwehrten im folgenden Jahre die Genueser verdächtigen Schiffen das Landen, und diese mußten nach Pisa und andern Seestädten segeln, die weniger vorsichtig mit den Ankömmlingen auch die Pest empfingen19. In Venedig wurde (1374) durch den Visconte Bernabo verordnet: Jeder Pestkranke solle aus der Stadt aufs Feld gebracht werden, um dort zu sterben oder zu genesen; die einem Pestkranken beigestanden, sollen zehn Tage abgesondert bleiben, bevor sie wieder mit Gesunden in Gemeinschaft kommen; die Geistlichen sollen die Kranken untersuchen und den Abgeordneten anzeigen; wer die Pest hereinbringe, dessen Güter sollen der Kammer verfallen sein, ja wer außer den dazu bestimmten Menschen auch nur unberufen sich den Pestkranken nähere, habe Vermögen und Leben verwirkt. In der Folge (1383) wurde allen Reisenden aus verpesteten Gegenden der Eintritt ins venezianische Gebiet unter ähnlicher harter Androhung untersagt, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß durch solche Maßregeln das Übel mit Erfolg beschränkt werden konnte, wie auch Mailand im Jahre 1348 durch strenge Torsperre und Verrammlung dreier Häuser, in welchen die Krankheit ausgebrochen war, sich eine Zeit lang von dem großen Sterben frei erhielt.
Die Vorschriften wurden im Jahre 1399 teils erneuert, teils auch vermehrt, und die Lüftung der Häuser, sowie die Reinigung und Verbrennung der verpesteten Gerätschaften, Kleider u. dergl. vorgeschrieben. Ein eigener Gesundheitsrat, aus drei Edlen bestehend, war in Venedig schon im Jahre 1485 (nach Howard 1448) eingesetzt, und diesem wurde später (1504) das Recht über Leben und Tod der Übertreter eingeräumt. Wahrscheinlich zu gleicher Zeit mit der Errichtung dieser Behörde wurden in einiger Entfernung von der Stadt auf Inseln die ersten Pestlazarette angelegt, in welchen alle aus verdächtigen Orten herkommende Fremde zurückgehalten wurden. Zeigte sich die Pest in der Stadt selbst, so schaffte man die Kranken mit ihren Familien nach dem sogenannten alten Lazarett, wo sie mit Arznei- und Lebensmitteln versehen wurden, und wenn sie genasen, samt allen, die mit ihnen in Verbindung gestanden, noch vierzig Tage in dem auf einer anderen Insel gelegenen neuen Lazarett verbleiben mußten20.
Die Gesundheitspässe kamen nicht erst während der Pest von 1527 auf, sondern wurden ohne Zweifel schon früher verlangt; gewiß war der Gebrauch und die Verfälschung derselben bereits im Jahre 1523 bekannt. Die Ärzte überließen die Wahl und Anordnung aller dieser hygienischen Vorschriften der Obrigkeit, und die Aufzeichnung derselben den Chronikschreibern, fest an den alten Satzungen haltend und sich sorgfältig hütend, in Schriften Dinge zu berühren, die über den Inhalt und die Auslegung ihrer kanonischen Bücher hinauszugehen schienen.
IV. Nicolaus Massa, Fracastoro, Foreest und Victor de Bonagentibus.
ERST im Jahre 1540 wagte es ein venezianischer Arzt, Nicolaus Massa21, von der Fürsorge des Staates in Hinsicht der Pest ein besonderes Kapitel zu schreiben, und der Gesetze und Einrichtungen zu erwähnen, die lange schon in Venedig bestanden, und vor aller Theorie daselbst allmählich aus der Erfahrung sich gebildet hatten. Als die wichtigsten Punkte bezeichnet er die oberste Anordnung und Leitung aller Maßregeln durch einen beständigen Gesundheitsrat, die Einziehung sicherer Nachrichten über den Gesundheitszustand der Nachbarländer, die Zurückweisung aller aus verdächtigen oder verpesteten Orten kommenden Fremden, die Quarantäne für dergleichen Schiffe, die Sorge für Reinheit der Luft und gesunde Nahrungsmittel, die Errichtung zweier Hospitäler, des einen für die Kranken, des andern für die Genesenen und Verdächtigen, endlich auch die Einführung einer allgemeinen Totenschau. Als Vorzeichen der künftigen Pest werden nach der alten Tradition besondere Konstellationen am Himmel, Kometen und Sternschnuppen, ungewöhnliche Wechsel in der Atmosphäre, Erdbeben, Gewitter und Regengüsse, Überschwemmungen, Nebel und Südwinde, Unregelmäßigkeit der Jahreszeiten, Vermehrung der Heuschrecken, Fliegen und Würmer, der Frösche, Kröten und Schlangen, Hervorkommen der unterirdischen Tiere, Absterben der Fische, schädliche Dünste in der Luft, Verderbnis des Getreides, der Früchte und Futterkräuter, allgemeine Neigung zur Fäulnis und bösartige Fieber angeführt, in der Pathogenie aber die hergebrachten Grundsätze noch mit einer ängstlichen Strenge festgehalten.
Um so höher ist das Verdienst derjenigen zu schätzen, welche gegen das Ende dieser durch Galens und Ibn Sinas Zauber verlängerten Gefangenschaft der Geister die schwere Befreiung begonnen, und den Weg zu einer selbständigen Betrachtung der Krankheiten wieder vorbereitet haben. Unter diesen ist zuerst und vorzüglich der als Dichter, Mathematiker und Arzt des Konziliums zu Trient berühmte Fracastoro zu nennen (geb. 1482, gest. 1553). Zwar nicht ohne große Vorsicht wagte er auf eigenem Wege fortzugehen, und es schien ihm, wie er selbst gesteht, keine geringe Anmaßung zu sein, zuvörderst von Galen, und dann auch von dem damals hochverehrten Montanus abzuweichen, in welchem jener gleichsam durch eine Art Seelenwanderung von neuem wiedergeboren war; dennoch siegte die bessere Überzeugung, und neue Wahrheiten wurden ans Licht gebracht, welche selbst die spätere Zeit sich nicht rühmen kann, beträchtlich erweitert zu haben. Vornehmlich in seiner Lehre von der Ansteckung hat Fracastoro22 auch in Hinsicht der Pest viel hellere Ansichten aufgetan, das pestartige Fieber (febris pestilens), zu welchem er überdies zwei neue Erscheinungen, den englischen Schweiß und das Fleckfieber, zählt, von dem wahren Pestfieber (febris vere pestifer) und namentlich von der Drüsenpest bestimmter unterschieden, die schon im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert deutlicher erkannte Ansteckung scharfsinnig untersucht, und ihre dreifache Weise durch Berührung (contactus), durch Träger (fomites) und weithin durch die Luft (ad distans) nachgewiesen, die Verhütung des Ansteckens als das Erste und Notwendigste bei der Kur bezeichnet, die Gefährlichkeit der verpesteten Sachen und Menschen an Beispielen gezeigt, vergleichungsweise die Rinderpest nicht übersehen, und selbst die große in späteren Zeiten wieder vergessene Wahrheit verkündet, daß alle pestartigen Krankheiten im Anfang unter einer milderen und schleichenden Form erscheinen.
Wenn wir den sächsischen Bergarzt Georg Agricola23 übergehen, dessen viel belobte Schrift weniger durch Neuheit der Gedanken, als durch eine gelehrte Darstellung ausgezeichnet ist, so schließt sich hier in nächster Folge der redliche Peter Foreest aus Alkmar an (geb. 1522, gest. 1597), der in Italien und Frankreich zum Arzt gebildet, während der Pest zu Delft (1557 und 1558) sich Dank und Verdienste erworben, mit offenem Sinn und ausgezeichneter Gabe zum Beobachten besonders die vielfachen Symptome und die begleitenden Erscheinungen betrachtet, und, auch das früher schon Bekannte verständig ordnend, eigentlich zuerst ein treues deutliches Bild von der Krankheit entworfen hat, so daß durch seine und Fracastoros Arbeiten in Wahrheit die Sache weiter als jemals gefördert, und einer Schar von Sammlern und Nachschreibern der reichste Vorrat überliefert worden ist. Fürs Erste wurde so viel gewonnen, daß die Pest auch in der Wissenschaft als eine ansteckende Krankheit anerkannt, von andern Fiebern der Form nach genauer unterschieden, und somit eine dauernde Grundlage für die weitere Erforschung gegeben war.
Um diese haben vor allen die Venezianer im sechzehnten Jahrhundert sich hoch verdient gemacht, weil sie bei ihrem großartigen Verkehr mit der Levante öfter als andere Nationen Gelegenheit hatten, die Pest zu sehen und zu bekommen, glücklicherweise aber auch in ihrem Gebiet eine der berühmtesten Arzneischulen der damaligen Zeit besaßen, durch welche Umstände nunmehr die Lehre von der Seuche einen raschen Aufschwung gewann, und ihrem praktischen Ziel um vieles näher kam.
Es war im Jahre 1556, als Victor de Bonagentibus, Arzt zu Venedig, eine an Umfang zwar geringe, nach ihrem Inhalt aber wichtige Abhandlung erscheinen ließ, welche man wegen der größeren Sachkenntnis, mit der sie geschrieben ist, und wegen des darin entwickelten, fast immer das Rechte treffenden, der Zeit vorauseilenden Scharfsinns eher für ein Werk des achtzehnten als des sechzehnten Jahrhunderts halten möchte24.
Diese merkwürdige, wie es scheint, in Deutschland ganz unbekannte Schrift untersucht in zehn Abschnitten ebensoviele Hauptpunkte der Pest, und ist dem Ritter Marini gewidmet, welcher damals, der Hochschule von Padua vorstehend, von den Schrecken der Seuche rings umgeben war. Schon in der Zueignung spricht sich neben wahrer Bescheidenheit der gesunde Verstand und die hohe Erfahrenheit des Verfassers aus. Gegen alle damalige Gewohnheit will er kein neues Präservativ- oder Heilmittel preisen, denn bei keiner anderen Krankheit gebe es so viele erdichteten Schutz- und Arzneimittel, als bei dieser; bei keiner sei auch das Urteil schwieriger, der Versuch betrüglicher, die Gelegenheit flüchtiger; ja man könne überzeugt sein, daß die meisten, welche sich neuer und besonderer Mittel rühmten, durch dieselben nicht nur immer mehr Kranke verderben, sondern auch die gewissenlosen Empiriker, die ihnen folgen, noch verwegener und kühner machen. Von Fracastoro und Agricola könne man lernen, wie die Gattung der Pestkrankheiten in mehrere, nach ihrer Entstehung und Verbreitung verschiedene Arten zerfällt. Diejenige aber, welche von selbst aus allgemeiner Luftverderbnis entsteht, sei niemals von ihm beobachtet worden, obwohl sie öfters bei den Ägyptern und Indern vorkomme, welchen überhaupt das Ferment der Pesten zugeschrieben werde. Häufiger sei bei uns die Pest, deren Zunder und Keim (fomes et seminarium) anderswo aus irgendeinem fauligen Verderben entstanden, durch unvorsichtige oder schlechte Menschen aus einem Lande oder Orte in andere gebracht, und weit und breit ausgestreut wird, wie dies noch vor kurzem in Istrien, dann auch in Venedig und jetzt in Padua der Fall gewesen. Sie pflege wieder aufzuleben, wenn nicht ihre Keime zugleich mit den Verbreitern derselben vollständig beseitigt werden.
Die Meinung der Ärzte, welche (damals fast einstimmig) mit Galen auch ein hektisches Pestfieber annehmen, und um die Erklärung desselben sich unablässig bemühen, sei fruchtlos und ohne Grund, weil die für diese Annahme herbeigezogenen Stellen nur nach Galenischen Begriffen und von anderen Krankheiten verstanden werden dürfen, bei einem so schnell verlaufenden Übel aber, wie die Beulenpest, an ein hektisches Fieber nicht zu denken sei. Als die sichersten und am meisten in die Augen fallenden Zeichen dieser Krankheit habe man außer den plötzlichen Todesfällen hauptsächlich die Beulen in den Weichen und an anderen Stellen, die Parotiden, und die an verschiedenen Teilen ausbrechenden Karbunkel, Striemen und Flecke zu betrachten, unter welchen die blauen oder schwarzen als die gefährlichsten erscheinen. Wenn auch nicht mehrere oder alle, so pflegen doch einige dieser Zeichen vorhanden zu sein; doch ereigne es sich zuweilen, daß sie, innerlich verborgen, nicht zum Ausbruch gelangen, und an den Toten, welche plötzlich ohne Fieber oder schon am ersten Tage sterben, kaum ein einziges wahr-genommen werde. Von der schlimmsten Vorbedeutung sei es, wenn die Beulen schmerzlos sind, und bald nach ihrem Erscheinen wieder verschwinden, wogegen ihre Ausbildung immer am meisten zu wünschen bleibe, obwohl die Krankheit niemals ihren falschen, unbeständigen Charakter verliere. Die künftige Seuche vorherzusehen, womit so viele sich beschäftigten, sei vielmehr eine göttlich-prophetische als eine menschliche Sache, und am wenigsten sicher bei einer Krankheit, die nur durch zufällige Verbreitung ihres Zunders (fomite) die Menschen ergreift. – Erstaunen müsse man wahrlich darüber, daß die Griechen und Araber über die vorbauende Kur, insofern die Krankheit durch Ansteckung entsteht, auch nicht ein Wort verloren haben, da doch hier die erste aller Sorgen auf Absonderung der Kranken, Erneuerung der Luft, Wechsel des Aufenthalts, der Betten und Kleider, und auf die gänzliche Vernichtung oder Verbrennung der letzteren gerichtet sein müsse. – Am meisten haben die warmen, feuchten, mit weiten Poren begabten Menschen die Krankheit zu fürchten, weniger die straffen, kalten und trockenen Naturen; Einzelne gebe es, die bei geringer oder fehlender Empfänglichkeit entweder schwer oder niemals von der Pest befallen werden, und den Zunder derselben in den Kleidern, ja selbst auf der eigenen Haut, ohne zu erkranken, umhertragen können, anderen aber, mit welchen sie zufällig oder unvorsichtig zusammenkommen, die Ansteckung und den Tod zu bringen fähig sind. Daher verbiete, wer eingeschlossen lebt, dem Fremden das Haus; wer aber auswärts zu tun hat, der suche sich durch Essig und ähnliche Dinge zu schützen, wenn auch diese nicht von der Gefahr befreien. – Unter den leblosen Gegenständen seien die der Fäulnis widerstehenden dichten und harten Körper, z. B. Kupfer, Silber, Gold, Edelsteine und dergleichen, zur Mitteilung der Krankheit nur selten geeignet und am leichtesten zu reinigen; gefährlicher erweisen sich die zur Fäulnis geneigten, so wie die porösen, biegsamen und klebrigen Dinge, am schlimmsten unter allen aber Pelzwerk, Felle, Federn und Baumwolle, im geringeren Grade auch Seide, Flachs, Hanf, Leder und einige Hölzer, Leinwand und Tücher; welche Sachen nur dann ohne Gefahr gebraucht und erhalten werden können, wenn sie wohl durchlüftet und gewaschen der Sonne und Luft durch vierzig Tage ausgesetzt, und während dieser Zeit mit den Dienern, welche die Reinigung besorgen, keine Neuerungen vorgenommen werden.
Hier haben wir also, was früher kein Schriftsteller zu geben versuchte, ein Verzeichnis der sogenannten pestfangenden Sachen, eine im Ganzen sehr richtige Einteilung derselben nach ihrer verschiedenen Empfänglichkeit, und die Grundregeln für das in der Folge noch weiter ausgebildete und so wichtig gewordene Quarantänesystem. Auf jene Reinigung dringt unser Verfasser um so mehr, weil er selbst im Jahre 1528 durch verpestete Leinwand, die zufällig unter einen Haufen schon mit Lauge gereinigter Wäsche geraten war, zwölf Menschen von verschiedenem Alter und Geschlecht, die sich dieser Wäsche bedienten, sterben gesehen. Endlich zeigt derselbe, wie bei der Heilung eine Menge kostbarer ausländischer und der Verfälschung unterworfener Mittel durch wirksameren einheimischen Vorrat zu ersetzen; und wie die Pest zu Ende des Sommers und im Anfang des Herbstes, wenn die Hitze noch fortwährt, und die Nässe hinzukommt, immer am tödlichsten sei. – Kein Arzt der früheren Zeit hat diese Krankheit in Beziehung auf die Hygiene mit solcher Klarheit aufgefaßt, als Victor de Bonagentibus, und ohne Zweifel ist seine Schrift, wie sie von den zu Venedig schon damals gemachten Erfahrungen und Anstalten ein wichtiges Zeugnis gibt, auf die bessere Einrichtung der letzteren selbst wieder zurückwirkend, von dem heilsamsten Einfluß gewesen, da die Quarantäne daselbst bald auch für andere Städte Muster und Beispiel geworden ist. Sollte aber jemand der Meinung sein, daß diesem Schriftsteller wegen Dinge, die uns heute so bekannt und geläufig sind, hier ein zu großes Lob gespendet werde, der lese die inhaltsleeren und quacksalberischen Pestschriften, die selbst unter berühmten Namen in einer der unsrigen viel näher liegenden Zeit geschrieben sind, und er wird mit Hochachtung gegen einen Arzt erfüllt werden, welcher mitten im sechzehnten Jahrhundert so viele wohltätige Wahrheiten gelehrt hat, und dafür mit dem Dunkel der Vergessenheit bedeckt worden ist.
V. Fioravanti, Massaria, Alpini und Porta.
WIE nun Wahrheit und Irrtum, Gutes und Schlechtes überhaupt sich wechselseitig herausfordern und nebeneinander geltend zu machen suchen, so bildet auch zur Lehre des bescheidenen Buonagente die Ansicht des ruhmredigen Leonardo Fioravanti25 den entschiedensten Gegensatz. Es darf aber dieser Bologneser hier um so weniger ganz mit Stillschweigen übergangen werden, da er gewissermaßen als Ahnherr oder erster Repräsentant einer Meinung erscheint, der es bis heute nicht an Anhängern gefehlt hat, davon abgesehen, daß auch dem Irrtum gewöhnlich noch ein Element der Wahrheit beigemischt ist, und diese selbst erst durch die Beleuchtung ihres Gegensatzes klarer und verständlicher wird. Ohne von dem Dasein eines fremden Contagium nähere Kenntnis zu nehmen, leitet Fioravanti den Ursprung der Pest im Allgemeinen von einer schlimmen Luftbeschaffenheit, und diese wieder von einem Verderben der drei anderen Naturelemente her. Als Ursachen ihrer großen Verbreitung werden weder die Ansteckung noch der ungehinderte Verkehr, sondern hauptsächlich der Mangel an zeitiger ärztlicher Hilfe, die Verlassenheit und Absonderung der Menschen, die Furcht und der Schrecken von ihm angeführt. Daher verwirft er die Sperre der Häuser, das Verbrennen der Kleider, die Errichtung von Pestlazaretten, und ähnliche furchterregende oder strenge Maßregeln als völlig unzweckmäßig, und empfiehlt von allen das Gegenteil. Weil die Pest zu Bologna im Jahre 1527 nicht weiter sich verbreitete, nachdem gegen das Ende derselben die drückenden Beschränkungen aufgehoben wurden, so schließt er voreilig, daß derselbe glückliche Erfolg nicht ausgeblieben wäre, wenn die Aufhebung der Maßregeln schon zu Anfang der Seuche stattgefunden, und dadurch die Furcht sich vermindert hätte. – Richtig zwar ist behauptet, daß in den Häusern, Gerätschaften, Kleidern und dergleichen das Pestgift sich nicht (beständig) erhalten kann, weil sonst die Pest in jeder Stadt, wo sie einmal herrscht, kein Ende nehmen würde; richtig wird auch darauf hingewiesen, daß jederzeit die Seuche wieder aufgehört, ohne eine Spur zu hinterlassen, auch da, wo sie am grausamsten gewütet; wenn aber Fioravanti sich mit diesen Gründen begnügt, um das Contagium stillschweigend zu verleugnen, die Reinigung und Vernichtung der angesteckten Sachen in allen Fällen für überflüssig zu erklären, und von den durch die Erfahrung gebotenen Vorsichtsregeln leichtsinnig abzuraten, wenn er dann in Folge solcher Ansicht und trotz aller Erfahrung das Heil in einem Haufen von seltsam und willkürlich zusammen geworfenen Arzneien zu finden wähnt, und übrigens die Orte, wo die Pest regiert, mit guten Worten ermutigen und kaum auf andere Weise behandeln will, als ob daselbst der Schnupfen herrsche, so wissen wir genug, um einen so viel verneinenden Mann weder für einen guten Beobachter, noch für einen scharfen Denker zu halten.
Solche Grundsätze konnten jedoch in Italien um so weniger Wurzel fassen, je öfter man hier Gelegenheit fand, zu erfahren und einzusehen, von welchem großen Einfluß auf die Gesundheit und das Leben des Volkes die richtigere Ansicht über die Entstehung und Verbreitung der Pestseuche ist. Diese war im Jahre 1575 von Trient nach Verona, Mantua, Mailand und Venedig gedrungen, sie setzte ihre Verheerung in der Halbinsel bis 1580 fort, und die lange Dauer schien zum Teil durch die Meinung einiger Ärzte verschuldet zu sein, welche mit Fioravanti und Mercurialis dem Übel einen einheimischen Ursprung zuschrieben, und die Ansteckung entweder nicht erkannten oder nicht genugsam zu würdigen verstanden. Dagegen wurde Alexander Massaria26 der Retter seiner Vaterstadt Vicenza, indem er zeigte, daß die ersten Kranken daselbst durch verpestete Kleider aus Padua angesteckt worden, dann aber auch nachwies, daß in der Stadt zuvor keine ähnliche oder bösartige Krankheit geherrscht, und überdies die Klöster und alle Personen, welche sich durch Einschließung dem Verkehr entzogen, nicht aufgehört hatten, sich einer guten Gesundheit zu erfreuen. In Folge seiner Ratschläge wurde in Vicenza strenge Obhut eingeführt, die Absonderung der Kranken und Verdächtigen in Lazaretten und Quarantänehäusern beizeiten durchgesetzt, und dadurch bewirkt, daß die Stadt nur wenig von der Pest zu leiden hatte. In denselben für Italien so unheilvollen Jahren scheint auch Diomedes Amicus27, Arzt zu Piacenza, den Stoff zu seinem Buche über die herrschenden Krankheiten gesammelt zu haben, welches zwar im Ganzen wenig Neues enthält, jedoch als eine lehrreiche und ziemlich vollständige Darstellung der damaligen Pestlehre auch in geschichtlicher Hinsicht lesenswert ist.
Für die Pathogenie waren keine weiteren Fortschritte zu erwarten, so lange das Übel nicht auch auf dem Boden seiner entfernten Heimat beobachtet wurde. Dies geschah zuerst und zum Glück für die Wissenschaft durch den berühmten Prosper Alpini (geb. 1553, gest. 1616), welcher in Begleitung eines venezianischen Konsuls (1580) nach Ägypten ging, sich drei Jahre zu Kairo aufhielt, und nach seiner Rückkehr eine Zeit lang in Genua die Gesundheit des Andreas Doria besorgte, dann aber dem Vaterlande wiedergegeben, bis zum Tode eine der ersten Zierden der paduanischen Hochschule blieb. Dieser geistvolle Mann hat durch die trefflichen Beobachtungen, die seiner medizinischen Beschreibung von Ägypten zugrunde liegen28, so vieles Licht über die Entstehung der Pest verbreitet, daß eigentlich mit ihm eine neue Epoche in der Kenntnis dieses Gegenstandes beginnt, wenn auch manche seiner auf irrigen Voraussetzungen oder voreiligen Schlüssen beruhenden Ansichten heute nicht mehr haltbar sind.
Mit der treuesten Aufmerksamkeit betrachtet Alpini das Klima, den Boden, die Luft, die Wohnplätze, Gewässer und Pflanzen dieses Landes, so wie die Eigenschaften, Kenntnisse, Sitten und Krankheiten der Bewohner, um alles, was er erfahren kann, in einer klaren und lebendigen Schilderung seinen Kunstgenossen in Europa zu hinterbringen, überall Veranlassung findend, durch vielfache Bemerkungen entweder seine Gelehrsamkeit oder seinen Scharfsinn zu üben. Rügt er auch zuweilen mit Nachdruck die Armut und Unwissenheit der ägyptischen Medizin, so verschmäht er doch nicht, selbst von den Barbaren zu lernen, und in dieser Beziehung den europäischen Ärzten heilsame Winke zu erteilen; alles, und auch die zur Darstellung gewählte Gesprächsform muß ihm dienen, um seine Schrift zu einem ebenso mannigfaltigen als anziehenden Gemälde zu machen. In Hinsicht der Pest ist sein Verdienst hauptsächlich deshalb zu rühmen, weil er die erste näher erkannt, und nachgewiesen hat, in welchem innigen und sehr bestimmten Zusammenhange das Entstehen und Verschwinden der Seuche in diesem ihrem Mutterlande mit den Verhältnissen des allgemeinen Naturlebens steht, und wie regelmäßig diese Verhältnisse mit der Seuche wechseln und zusammentreffen. Er brachte in Erfahrung, daß die Pest in Ägypten nicht beständig herrscht, sondern in gewissen Perioden erscheint, und dann gewöhnlich nur vom Anfang des Septembers bis zum Juni dauert; er sah mit Erstaunen, daß sie jedesmal plötzlich erlischt, sobald die Sonne in das Zeichen des Krebses tritt, und der Nil mit dem Eintritt der Nordwinde zu steigen beginnt, und daß um diese Zeit auch alle verpesteten Sachen aufhören, ansteckend zu sein. Durch diese Entdeckungen, welche bald zur vollen Erkenntnis einer bis dahin noch tief verschleierten Wahrheit geführt hätten, wenn sie von andern eifriger verfolgt und besser verstanden worden wären, ist Alpini mit Recht als eine der ersten Autoritäten in der Pestlehre bekannt geworden; da wir aber auf seine Beobachtungen noch oft und ausführlich zurückkommen müssen, so genügt es, die ihm gebührende Stelle vorläufig hier bezeichnet zu haben.





























