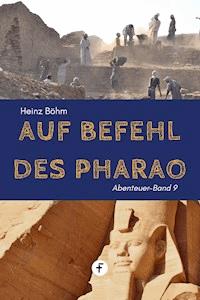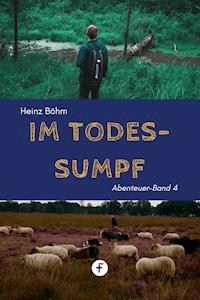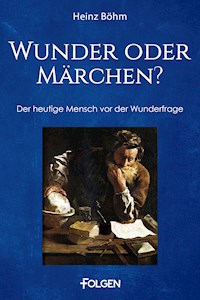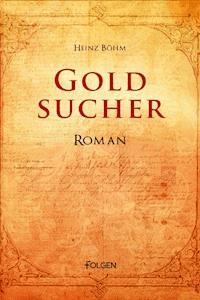Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Frühling 1505: Der schwarze Tod hält Erfurt fest in seinem grausamen Griff. Die Pest fordert unzählige Opfer, und auch in der nahegelegenen Stadt Gotha bleibt niemand von ihrer todbringenden Welle verschont. Pater Hieronymus, ein frommer und pflichtbewusster Mönch, widmet sein Leben der Pflege der Kranken und der Seelsorge der Überlebenden. Unermüdlich kämpft er gegen die tödliche Seuche, überzeugt, dass er im Dienste Gottes handelt. Doch fünfzehn Jahre später wird er nach Erfurt versetzt – und findet sich plötzlich in einem neuen, ebenso bedrohlichen Sturm wieder: Die Reformation nimmt Fahrt auf. Für Pater Hieronymus, einen entschiedenen Gegner dieser neuen Lehre, ist Martin Luthers Bewegung eine ketzerische Bedrohung der wahren Kirche. Mit aller Entschlossenheit stellt er sich gegen die reformatorischen Ideen, die sich immer weiter ausbreiten. Er predigt leidenschaftlich gegen die „Irrlehren“, diskutiert mit Gelehrten, warnt vor Abtrünnigkeit – und greift schließlich auch zu drastischeren Mitteln, um den alten Glauben zu verteidigen. Doch die größte Herausforderung seines Lebens kommt nicht aus der Theologie, sondern aus seiner eigenen Familie. Sein geliebter Neffe, den er sich als künftigen Priester wünscht, verliebt sich in die bildhübsche und kluge Elisabeth – eine junge Frau, die nicht nur sein Herz, sondern auch eine ganz andere Zukunft für ihn im Sinn hat. Für Hieronymus, der seinen Glauben über alles stellt, ist dies ein schwerer Schlag. Wird sein Neffe den kirchlichen Pfad verlassen? Wird die Liebe stärker sein als der Glaube? Zerrissen zwischen Loyalität, Überzeugung und persönlichen Hoffnungen, trifft Pater Hieronymus eine folgenschwere Entscheidung – eine, die nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch das seines Neffen und der jungen Elisabeth für immer verändern wird. Ein mitreißender historischer Roman über eine Zeit des Umbruchs, über fanatischen Glauben, über Liebe und die Kraft der Veränderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Pestglocke
Eine Erzählung aus der Zeit der Reformation
Heinz Böhm
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Heinz Böhm
Cover: Eduard Rempel, Düren
ISBN: 978-3-95893-030-8
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Kapitel 1: Ein streitbarer Pater
Kapitel 2: Der schwarze Tod
Kapitel 3: Flucht aus Gotha
Kapitel 4: Wohin mit der Schuld?
Kapitel 5: Von Zerbst nach Erfurt
Kapitel 6: Zu den Lutherischen übergelaufen
Kapitel 7: In doppelter Lebensgefahr
Kapitel 8: Begegnung in Freiburg
Kapitel 9: Traumhochzeit
Kapitel 10: Gefährdete Berufung
Kapitel 11: Eine »sündige« Liebe
Kapitel 12: Abgrund der Verworfenen
Kapitel 13: Befreiende Gerechtigkeit
Kapitel 1
Ein streitbarer Pater
Über den grünenden Feldern jubilierten die Lerchen. Wie eine blaue Schale wölbte sich der Himmel über dem weiten Land. Der Horizont verschwamm im flimmernden Dunst. Nur wer scharfe Augen hatte, vermochte die Türme der Stadt Gotha zu erkennen. Zwischen Gotha und Erfurt zog sich die Straße hinweg, über baumlose Hügel, durch Mulden, eingesäumt von sich lang hinziehenden Hecken. Blauköpfige Meisen turnten im blattlosen Geäst, jedoch hier und da schimmerten schon blühende Schlehenhecken von den Hängen herunter.
Mitten in dieser Einöde mischten sich andere Töne in das Trillern der aufsteigenden Lerchen. Knarrend malten die Räder eines flachen Bauernwagens ihre Spuren in den lockeren Sand der Straße. Auf dem Bock des Wagens saß ein junger Mann, vermummt in einer Decke aus hartem Stoff, aber eben dadurch vor dem kühlen Frühlingswind geschützt, der durch Mark und Bein pfiff. Nur noch eine knappe Stunde, dann war er am Ziel seiner Fahrt angelangt. Etwas von der Freude der singenden Lerchen klang auch in seinem Herzen wider.
Seine Gedanken eilten vier Tage zurück. Wie hatten die Kirchgänger von Gotha am heiligen Osterfest ihre Augen aufgerissen, als ihn Pater Hieronymus, vor dem Kirchenportal stehend, mit dem gnädigen Winken seiner Hand zu sich kommen hieß. Missbilligend schüttelten zwei Herren des Gothaer Stadtrates ihre Köpfe darüber, dass diesem Verwalter des Findel- oder Armenhauses, wie man es nannte und kannte, solche Ehre erwiesen wurde.
»Ich freue mich«, hallte die Stimme des Paters unter dem mit Ornamenten geschmückten Portal wider, »dass du es schaffst, sie alle, Sonntag für Sonntag in die heilige Messe zu bringen. Und nicht wie Schnecken, die eine Schleimspur hinterlassen, sondern mit einer Freude und Andacht, wie sie wohl jedem schicklich ist, den die Glocken zur heiligen Messe einladen.«
Gabriel Breuer, wachen Bewusstseins, wohl wissend, dass er nicht zuerst von der Gunst des Paters abhängig war, sondern in erster Linie von den Stadträten Gothas, antwortete betont laut, damit alle zuhörten, die es hören sollten. »Ich danke Euch, Pater Hieronymus. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich den Jungen nicht einschärfe, welche Wohltaten sie dem Rat der Stadt und dem Wohlwollen der heiligen Kirche zu verdanken haben.« Ein schneller Seitenblick, und Gabriel Breuer gewahrte den Blick der beiden Männer. Das rechte Wort im rechten Augenblick.
Gleichwohl wusste er, wie wenig er im Urteil dieser reichen Männer galt. Jedoch sollten sie noch erkennen, wie recht sie getan hatten, ihn für das Findelhaus auszuwählen. Er liebte die gefräßigen kleinen Burschen, denen sich alle Bürgerhäuser verschlossen hatten und die man um eines zukünftigen Gotteslohnes seit nahezu fünfundzwanzig Jahren aus dem Schmutz enger Gassen und schmutziger Winkel, in ein so genanntes Armenhaus gebracht hatte.
1480 hatte ein Bürgermeister der Stadt vor Rat und Kirche den Antrag gestellt, solch eine Einrichtung für die Ärmsten der Armen zu schaffen. Nur zögernd hatte man zugestimmt, war jedoch inzwischen stolz, eine Stätte vorzeigender, christlicher Nächstenliebe zu betreiben.
Nach dem älteren, rasch gestorbenen Vorgänger, hatte man Gabriel Breuer für diesen Posten ausgesucht. Er selbst kannte die Armut, und von Kindesbeinen an war er mit harter Arbeit vertraut. Oft von blauen Flecken einer starken Vaterhand gezeichnet, wenn immer er versuchte, sich auf irgendeine Weise den aufgebürdeten Pflichten zu entziehen.
Indessen schritten die beiden Ratsherren auf den Pater zu, wobei sie auch den jungen Verwalter des Armenhauses mit freundlichen Blicken bedachten. Eine Seltenheit, wie ein Stück Fleisch im Eintopf seiner Schützlinge.
Pater Hieronymus versah seit drei Jahren seinen Seelsorgedienst in einem Bezirk Gothas, nahe an der Stadtmauer. Sein heiliger Ernst, mit dem er die Leute ermahnte, dabei aber die Reichen keineswegs schonte, brachte ihm in der letztgenannten Gruppe nicht gerade Freunde ein. Ihm lag nicht viel an Menschengunst, und als ihm, wie durch einen Wetterwechsel, sonniges Wetter zuteil wurde, nahm er es ganz gelassen hin. Wodurch hatte sich die Stimmung mancher Reicher ihm gegenüber gewandelt? Weniger durch die Fürsorge ihm günstig gesonnener Heiliger, als vielmehr durch eine rein menschliche Fügung. Sie erfuhren nämlich, dass ihr Seelsorger, Pater Hieronymus, ein Schwager des einflussreichsten Ratsherrn, Caspar Mechler aus Erfurt, war. Dieser Caspar Mechler hatte, wie es gespitzte Ohren vernommen hatten, die Tochter eines Naumburger Hand-werkers geheiratet. Sie galt als das schönste Mädchen der Stadt.
Durch Zufall erfuhr Pater Hieronymus, welchem Umstand er den warmen Wind der reichen Bürger verdankte. Wie auch immer. Von Zufall hielt der Seelsorger ohnehin nichts, und nicht erst als Pater setzte er auf die Heiligen, durch deren Vermittlung er seinen Lebensweg vorgezeichnet sah.
Aus ihrer überirdischen Perspektive griffen sie ein, sehend und wissend, was für die Menschen am besten war. Geradezu beängstigend nahe erfuhr der Pater an einem seiner stolzesten Kirchgänger, wie dessen Leid und Glaubenszweifel anderen zu Brot und Obdach verhalfen.
Zwischen den Städten Gotha und Erfurt, etwas südlich hinunter nach Arnstadt, lebte auf seinem Stammschloss Ernst Moritz von Trolsheim, dessen Vater von den Bauern unter dem Beinamen »der Grausame« gefürchtet war. Durch einen harten Landvogt und dessen Helfershelfer ließ er seine Leibeigenen überwachen, und wehe dem Mann, Frau oder Kind, den sie bei Wild- oder Fischfrevel erwischten! Noch heute – nach knapp dreißig Jahren – erzählte man unter Schauern, wie er einen armen Tagelöhner brutal zusammenschlagen ließ, nur weil er zwei Forellen aus dem Bach gefischt hatte.
Und sein Sohn, der heutige Herr von Schloss Trolsheim? Auch da erlebte das Gesinde am eigenen Leib, wie er in den Spuren seines Vaters wandelte. Nicht so offen, wie es sein Vater getan hatte, versuchte er, zumindest vor den Ratsherren Gothas, den Eindruck zu erwecken, als sei er aus edlerem Holz als sein gefürchteter Vater geschnitzt. Seinen Untergebenen aber begegnete er ohne Maske.
Dass er gleichwohl kaum einen Gottesdienst in der Stadtkirche von Gotha versäumte, das überstieg die Fassungskraft derer, die ihn kannten. Pater Hieronymus ahnte nichts von dem Doppelleben dieses Mannes. Es hätte auch keiner gewagt, den Riss zwischen Sein und Schein des Schlossherrn aufzuzeigen. Wer sollte es offenbar machen? Selbst die Heiligen schwiegen. Oder waren sie nur Marionetten, die wohl manchen Seufzer hörten, unzählige Tränen sahen, aber nicht eingriffen, um den Bedrängten zu helfen?
Keiner der Betroffenen sprach es laut aus, jedoch, darauf vertrauend, erwarteten alle ein Wunder von oben. Und es geschah. Pater Hieronymus fügte gelegentlich dem lateinischen Teil des Gottesdienstes einige Minuten biblischer Ermahnungen in deutscher Sprache hinzu. Er wollte sich von seinen Hörern verstanden wissen. Wer aber war, bis auf wenige Ausnahmen, der lateinischen Sprache und Schrift kundig?
Bei solch einem Gottesdienst wurde Ernst Moritz von Trolsheim von einem Wort getroffen. Dem Einschlafen nahe, denn er hatte bis in die Nacht mit Freunden gezecht, riss ihn ein Wort des Predigers aus seiner Gleichgültigkeit. Eindringlich stellte der Pater eine Frage in den Raum, herausfordernd, danach in einer längeren Pause verharrend. »Ist Gott vielleicht selbst ungerecht?« Unzählige Augen waren auf ihn gerichtet. Durfte ein Mensch überhaupt solch eine Frage stellen? Wie eine lösende, erlösende Antwort kam die Stimme des Predigers. »Nimmermehr!«, hallte es von den Wänden der Kirche wider. »Gott ist in sich selbst ein Meer der Gerechtigkeit. Gleichwohl möchte ich einige Sätze des heiligen Augustinus anführen – und nun hört genau hin! Immer geschieht der Wille dieses gerechten Gottes. Wäre er noch Gott, wenn ihn schwacher Menschenwille hindern könnte, zu tun, was er tun will?«
Dieser Satz bohrte sich in Ernst Moritz von Trolsheim fest. Schwacher Menschenwille? Was vermag er? Ohne Beugung unter Gott bleibt er vermessener Frevel. Nicht allein in seinem Widerstand gegen Gott, auch in der Macht, andere Menschen bis aufs Blut zu knechten. Der reiche Schlossherr sah sie alle vor sich. Sie alle fürchteten ihn mehr als den gerechten Gott. Immer dann, wenn er sie rufen ließ und wozu er sie rufen ließ. Junge, hübsche Mägde, alle, die ihm gefielen und die er später, wenn er ihrer überdrüssig geworden war, wie zerbrochenes Spielzeug wegwarf.
Dem ersten Pfeil folgte ein zweiter: »Wenn du Gott deinen Willen verweigerst, bleibt er dann nicht auch Gott? Ganz gewiss, aber nicht mehr für dich, sondern ganz gegen dich.« Kaum wagte der gespannt Zuhörende die Folgerung zu ziehen, als der Pater seine Befürchtung bestätigte. »Hört es, ihr Menschen, und fleht auf euren Knien zu den Heiligen. Fleht, dass euch nicht widerfahre, was Gott zu beschließen sich vornimmt. Über die Jahrhunderte hinweg soll euch die Stimme des heiligen Augustinus, über meine Stimme hinweg, aufrütteln. Gott hat sich, so sagt der Heilige, die Menschen wie Gefäße erwählt. Die einen zu seiner Ehre, die anderen zur Unehre. Auch alle unsere Verdienste sind dem Feuer preisgegeben. Wer verloren ist, bleibt verloren, er mag tun, was er kann; wer gerettet ist, bleibt gerettet, mag er tun, was er kann.«
In den nächsten Wochen geschah eine Verwandlung im Leben des reichen Schlossherrn. Wie eine drohende Wand hing es über ihm. Hatte er zunächst die quälenden Gedanken mit Wein, Weib und allerlei Lust zu vertreiben gesucht, so fühlte er sich mehr und mehr einem Menschen gleich, der wie in einen dunklen Brunnen abgeseilt wird. Schrecklich allein der Gedanke, dass Gott ihn unwiderruflich verworfen hatte. Kein Heiliger, auch nicht die heilige Jungfrau, vermochte nur einen Funken Licht in seine Seele zu senken. Seine innere Not steigerte sich bis an die Grenze des Erträglichen.
An einem Abend ließ er alle seine Untergebenen in den geräumigen Schlosssaal kommen. Wie Hühner, über denen der Habicht kreist, drängten sie sich in die hinterste Ecke des Saales.
Sie ahnten nicht, was sie erwartete, denn dergleichen war noch nie geschehen, dass ihre rohen Füße den Saal betreten hatten. Umso überraschter atmeten sie unter den Worten ihres harten Feudalherrn auf. »Wir sind alle vor Gott brennbares Stroh. Wir alle, Arme, Reiche, jeder, der ein menschlich Antlitz trägt. Das hat mir Gottes Wort in einer Predigt aufgedeckt …«
Unaufgefordert schob sich die Menschentraube aus der Saalecke ein Stück auf die Mitte zu. Sie standen ihrem Herrn gegenüber. Mit einer Gebärde, als wollte er selbst predigen, hob er beide Hände und hielt sie dann wie leere Schalen den Leuten entgegen.
»Fortan sollt ihr alle einen besseren Herrn haben.« Fassungsloses Staunen zeichnete sich auf den meisten Gesichtern ab, doch dann begannen ihre Augen zu leuchten. Sie hatten sich nicht verhört. Gespannt erwarteten sie, dass er noch etwas hinzufüge, doch er winkte mit beiden Händen ab. »Ihr könnt jetzt gehen!«
Während sich der Saal leerte und zwei Diener die vielen Kerzen löschten, kämpfte Ernst Moritz von Trolsheim einen kurzen Kampf. Gewiss, er hatte einen besseren Herrn angekündigt, aber gleichwohl versäumt, sich für seine Untaten zu entschuldigen. ›Das brauchst du nicht!‹, fiel er sich selbst in seine Gedanken. ›Das wäre des Guten zu viel.‹ Außerdem entließ er seine Untergebenen nur mit wohlmeinenden Worten, selbst noch daran zweifelnd, ob er sein Versprechen auch einlösen könnte.
In den folgenden Wochen hielt er sein Versprechen. Ein warmer Strom schien die bisherige Eiszeit zwischen dem Herrn und seinen Knechten zu beenden. So wie die Angst aus den Gesichtern der anderen wich, empfand es Ernst Moritz von Trolsheim, schaute ihn auch das Angesicht Gottes wieder freundlich an. Was wollte er mehr?
Die Angst, Gott habe ihn für alle Ewigkeit verworfen, wich einer getrosten Gelassenheit. So schien es nur eine Folge zu sein, dass so manche Gebete wie duftender Weihrauch zu Gott emporstiegen, zugleich aber auch die Heiligen fleißig mit bedacht wurden, Gott möge das Herz ihres Brotherrn nicht aufs Neue einfrieren und zu Stein werden lassen.
Über die Weihnachtswochen bis ins neue Jahr hinein versanken Schloss, Park und die weiten Felder und Wälder um Trolsheim in einer dicken Schneedecke. Eisige Winde fegten über das weite Land, glitzernde Kristalle vor sich hertreibend. Jedoch wohltuend erfuhren sie die Freundlichkeit des Schlossherrn.
Im Verlauf der vergehenden Wochen, so Mitte Februar des Jahres 1505, stellte Ernst Moritz von Trolsheim bei sich selbst eine Veränderung fest. Zum Glück verbarg er die Empfindungen, besonders vor seiner Gemahlin Maria, jene Empfindungen fleischlicher Begierde, wie er sie früher alltäglich gehabt und ohne Skrupel ihnen nachgegeben hatte.
Allerdings wagte er nicht, aus purer Angst vor Gott, von den Frauen zu fordern, was seine Lust begehrte. Diese Spannung, einerseits sein Begehren nur in Bildern zu stillen, zugleich aber von der Frage gepeinigt, ob ihn Gott nicht doch als ein Gefäß der Unehre erwählt habe, machten ihn zutiefst unglücklich.
Seine Gemahlin Maria bemerkte den innerlichen Zwiespalt ihres Mannes zuerst. Nach jener Erschütterung durch die Predigt des Paters erfreute sie sich einige Monate lang der Zuneigung und Liebe ihres Mannes, gewahrte aber schon bald, wie er sich von seiner früheren Art einspinnen ließ. So flehte sie zu den Heiligen und versprach, was sie nur versprechen konnte.
Offensichtlich vergeblich. Mit der schwindenden Angst vor Gott, holte Ernst Moritz von Trolsheim sein altes Leben stetig, aber wirksam zurück.
Plötzlich fand er die Liebe seiner Frau lästig, versuchte aber, sein Erkalten mit nichts sagenden Ausreden zu begründen: Arbeit, Geschäfte, Verpflichtungen und was ihm gerade gelegen kam. Sie aber wusste, dass er ihr weniger aus Liebe treu war, vielmehr aus einer unterschwelligen Furcht heraus, Gott könnte sich aufs Neue als unbestechlicher Zeuge in sein Leben drängen. Frau Maria spürte, auf die Dauer konnte die Angst kein tragfähiges Fundament ihrer Liebe zueinander sein und wohl auch nicht stark genug, seine alten Leidenschaften nur auf die Fantasie zu begrenzen.
Zunächst aber brachen nur seine Augen die Ehe. Maria sah seine Blicke, die in unberechenbarer Glut besonders die jungen Frauen verfolgten. War es nur noch eine Frage der Zeit, bis …?
An einem kalten Vorfrühlingstag im März gewannen die Sätze des heiligen Augustinus solch eine Macht über ihn, als hätte sie ihm der Heilige unwiderruflich als sein persönliches Schicksal offenbart. Diese Angst, für immer von Gott getrennt zu werden, wirkte sich bis ins Leibesleben des Schlossherrn aus.
Während seine Frau schlief, lag er wach, und verwirrende Gedanken verfingen sich wie in einem Spinnennetz. Sollte ihm das Schicksal bestimmt sein, Gefäß der Unehre zu sein, wie der Heilige zwischen zwei Gefäßen unterschieden hatte, dann war es letztlich egal, ob er dieses Gefäß mit Ehebruch und anderen Lastern füllte oder aber sich in Verzicht und geistlichen Tugenden übte. Hatte denn der himmlische Herr in freier Entscheidung es so beschlossen, dass er, Ernst Moritz von Trolsheim, ein Gefäß der Unehre sei, wer wollte dem widerstehen?
Dann brachten ihn die guten Werke Gott kein Stück näher, so wenig ihn seine Laster von Gott entfernten. Mit dieser Logik, seinem Fleisch alles zu erlauben, wurde sein Weg frei, alles zu tun, was er begehrte, jedoch überwog die Angst vor dem unerbittlichen Richter, Jesus Christus. Wie der Schlossherr unter den Menschen geherrscht, dessen Willen sich bisher überall brutal durchgesetzt hatte, hing jetzt wie ein welkes Blatt im Windhauch des Stärkeren. Ohnmächtig ausgeliefert, den geringsten Heiligen beneidend, kämpfte Ernst Moritz von Trolsheim einen aussichtslosen Kampf.
Endlich, endlich, in den ersten Tagen der angebrochenen Passionszeit, spannte er seine Pferde vor den Wagen und fuhr hinüber nach Gotha. Die Gewissheit, von Gott und dem Erlöser, Jesus Christus, verworfen zu sein, lag wie ein Fluch über ihm. Traf ihn dieser Fluch etwa aus dem bösen Blut seiner Vorfahren? Er erinnerte sich des langen schweren Todeskampfes, mit dem sein Vater diese Welt verlassen hatte.
In einem kahlen Raum, an dessen frisch gekalkter Wand das Kreuz des Erlösers sich abhob, saß der starke Mann zitternd vor seinem Seelsorger, den Kopf gesenkt und von schweren Gedanken geplagt, die ihm auch der sakrale Raum nicht nehmen konnte. Die dunklen Augen des Paters schauten auf die gebeugte Gestalt ihm gegenüber. Was mochte diesen harten Mann bewogen haben, nur wegen eines Gespräches die vielen Stunden von Schloss Trolsheim nach Gotha unter die Räder seines Wagens zu nehmen? Zwischen ihnen stand die Stille wie eine unübersteigbare Mauer.
Schließlich begann der Besucher zu sprechen. »Seit Wochen schleppe ich eine Last mit mir herum …, die jeden Tag an Gewicht zunimmt. Darum bin ich herübergekommen, um sie endlich loszuwerden oder sie wenigstens zu teilen.«
»Seit Wochen«, wiederholte der Pater, »und nun haltet Ihr es nicht mehr aus.« Der Seelsorger erwartete, der andere würde ihm beichten, wie er durch seinen Jähzorn an einem seiner Leibeigenen schuldig geworden sei, jedoch diese Vermutung traf nicht zu.
Ernst Moritz von Trolsheim blickte auf, genau in die dunklen Augen seines Gegenübers. »Ihr selbst, Pater Hieronymus, hattet den verwundbaren Pfeil auf der Sehne Eures Bogens.«
»Ich selbst? Das müsst Ihr schon näher erklären.«
»Durch Eure kurze Predigt, Pater Hieronymus. Es waren einige Sätze des heiligen Augustinus, die meinen harten Panzer durchbohrten. Jeder Satz blieb in meinem Gewissen hängen.«
Ihre Blicke tauchten wieder ineinander. »Ihr wisst wohl, welche Sätze ich meine.«
»Ich kann es mir denken. Jene Worte von den zwei Gefäßen, die sich Gott erwählt. Die einen zur Ehre Gottes, die anderen …«
Erregt unterbrach ihn der Beichtende. »Zu den anderen gehöre ich!«
Pater Hieronymus hörte den Schmerz in der Stimme seines Besuchers heraus. ›Wie unberechenbar sucht sich Gottes Wort doch die Menschen heraus‹, dachte er. Wie oft hatte er diese kräftige, in kostbare Pelze gehüllte Gestalt des reichen Mannes gesehen und gefürchtet. Nahe an der blasphemischen Grenze denkend, als habe selbst Gott an diesem stolzen Mann seinen Meister gefunden. Nun hockte er ihm gegenüber, gezeichnet mit dem Brandmal des Psalmsängers, der die bedrohliche Nähe Gottes in den Satz fasst: »Denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drückt mich!«
Die Stimme des Schlossherrn riss den Pater aus seinen Gedanken. »Und zu denen gehöre ich, versteht Ihr, unverwechselbar ich!«
»Wer hat Euch diese Gewissheit vermittelt?«
Ernst Moritz von Trolsheim beugte sich vor, sodass die angegrauten Haare seiner Pagenfrisur in seine gefurchte Stirn fielen. »Wie meint Ihr das, Pater Hieronymus?«
»Wie ich es sage. Wer hat Euch diese Wahrheit vermittelt, dass Ihr – von Gott verworfen seid?« Wie Steinblöcke setzte er jedes Wort einzeln vor den Besucher hin.
»Eure Predigt!«
Der Pater lächelte. »Alle haben die gleichen Worte gehört. Gewiss, Gott kann tun, was er will, und niemand vermag seinen Ratschluss zu ändern.«
Ernst Moritz von Trolsheim zog die Augenbrauen hoch. »Ist denn meine Angst nicht einleuchtend?«
»Ja und nein«, antwortete der Pater. Der Besucher unter-drückte seinen aufsteigenden Unwillen. Diese sophistischen Spiralen der Theologen zu verstehen, war noch nie seine Stärke gewesen. »Ihr seid also fest davon überzeugt, dass Gott Euch durch den heiligen Augustinus seinen Willen erschlossen hat?«
Ernst Moritz von Trolsheim sah die dunklen Augen des anderen wie zwei unergründliche Spiegel.
»Ja, so muss es wohl sein«, antwortete er zögernd. Er vermied das Wort Gewissheit, aus der Angst heraus, der Pater würde es in brutaler Offenheit bestätigen. Nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil. Unerwartet kam die Antwort des Seelsorgers, sowohl dem Inhalt nach als auch mit letzter Überzeugung.
»Ihr seid gewiss, aber ich will Euch ungewiss machen!«
Ernst Moritz von Trolsheim hielt seine linke Hand hinter das Ohr. Über sein fleischiges Gesicht huschte ein verstehendes Lächeln. »Ungewiss wollt Ihr mich machen. Ist das so zu verstehen, dass ich mich auch geirrt haben könnte?«
»Ungefähr so«, bestätigte der Pater. »Denn die Angst, von Gott verworfen zu sein, solches genau wissen zu wollen, wäre die gleiche Vermessenheit, als wenn jemand behaupten wollte, er sei sich des ewigen Lebens ganz gewiss. Beides«, so fuhr der Pater fort, »ist im Ratschluss Gottes verborgen.«
Aus dem Gesicht des Reichen wich die Angst, wie das Dunkel vor dem Licht der Sonne weicht. »Dann habe ich mich wohl die lange Zeit umsonst gefürchtet; gefürchtet, von Gott verworfen zu sein«, nannte er den tiefsten Grund seiner Angst.
»Umsonst nur soweit, dass Gott uns weder das eine noch das andere wissen lässt«, beugte Pater Hieronymus einem schädlichen Übermut vor. Offensichtlich hatte Gott in seiner Weisheit diesem lebenslustigen Patron die aufweckende Daumenschraube zugemutet.
Beide blickten auf das Kreuz des Erlösers, dann deutete der Besucher mit einer Gebärde auf den Gekreuzigten hin. »Und bleibt uns nur die Ungewissheit. Auch angesichts seiner Leiden?«
Schärfer als gewollt, antwortete der Pater: »Habt Ihr nicht verstanden, was ich Euch zu erklären versuche?«
»Schon, schon«, versicherte der Besucher, verwundert da-rüber, warum sich der Seelsorger so aufregte.
»Bedenkt, Ernst Moritz von Trolsheim«, schaltete der Pater nun auf sanftesten Ton, »wie göttlich weise der Schöpfer handelt, indem er dem Menschen beides verbirgt, sowohl die Gewissheit unseres ewigen Heils als auch die unserer ewigen Trennung von Gott.«
Nahezu beschwörend redete der Pater auf seinen Besucher ein. »Gott kennt uns Menschen besser, als wir uns selbst kennen. So, wie die Heilsgewissheit den Menschen oberflächlich und leichtsinnig werden ließe, so nähme ihm andererseits die Gewissheit ewiger Verlorenheit jeden Funken Lebensfreude. Die einen wären verzweifelt, die anderen dagegen hochmütig. Gott aber will, dass wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen.«
Hier nickte Ernst Moritz von Trolsheim dem Pater als ein »gebranntes Kind« beistimmend zu. Noch nachträglich rannen die Schauer über seinen Rücken. »Von dem Ersteren wüsste ich wohl ein dickes Buch zu schreiben.«
»Nun seht Ihr, Ernst Moritz von Trolsheim«, nickte der Pater freundlich, wobei er mit seinen Augen andeutete, dass wohl das Wesentlichste zwischen ihnen besprochen sei.
Der Besucher verstand diese Blicke, schob seinen Stuhl zurück und stellte sich auf seine stabilen Beine. ›Säulen‹, registrierte der Pater, ›die alsobald wackelten, wenn Gott ihnen das Fundament entzöge.‹
»Ihr habt mir sehr geholfen, Pater Hieronymus, mich durch Ungewissheit auf andere Weise ganz gewiss zu machen.«
Während sich die beiden gegenüberstanden, arbeiteten die Gedanken des Seelsorgers wie ein Mühlenrad. Ihm war jetzt schon gewiss, dass der reiche Mann hinfort mehr in den Opferkasten klingeln ließ, aber hatte Gott ihm nur deswegen seine Hand erdrückend aufgelegt? Wie schnell konnte es geschehen, dass der Schlossherr von Trolsheim mit neuen Gedanken seinen alten Lastern wieder Raum gab. Dass er um seiner Umgebung willen mehr sein wollte, als er im gelebten Leben war.
Plötzlich kamen dem Pater, als habe ihn jemand dazu aufgefordert, verwegene Gedanken, die auszusprechen jetzt die beste Gelegenheit war. Und so wagte er einen Vorstoß. »Ich sprach von einem Gott wohlgefälligen Leben. Hat Gott es nicht gerade den Heiligen offenbart, dass sie, um ihrer Treue willen, vor seinem Angesicht seine besondere Gunst erfuhren? Der heilige Franziskus wurde den Armen ein Armer; könnte nicht auch ein Reicher für die Armen etwas werden?« Beide grinsten sich wie zwei Verschworene an.
»Und nach welcher Seite hattet Ihr gedacht, Pater Hieronymus?«
»Ich möchte es mit einer alttestamentlichen Geschichte sagen.«
»Wie es Euch beliebt.«
»Der Prophet Elia wurde von gefräßigen Raben gespeist. Sie brachten, was er fürs Überleben brauchte. Könnte Euch Gott nicht auserwählt haben, gefräßige Raben zu versorgen, ja Rabenkinder, die noch keine Nestwärme entbehren können?«
Überraschend schnell schaltete der Besucher. »Ihr meint die zwölf bis vierzehn Raben im Armenhaus, nahe der Stadtmauer?«
Vor einiger Zeit hatte Pater Hieronymus das Findelhaus mit seinem Verwalter und der alten Köchin genannt. »Sie alle leben von den Brosamen, die von der Stadträte Tisch fallen.«
In den Augen des Schlossherrn glänzten Tränen. Er massierte seine wulstigen Lippen, dabei murmelte er: »Sollte Gott mich darum in die Angst gestoßen haben, damit ich den Ärmsten der Armen von meinem Überfluss geben soll?«
Auch des Seelsorgers Augen schimmerten feucht. »Gott wird Euch diese Wohltaten vergelten, dessen bin ich gewiss.«
»Er hat bereits damit begonnen; denn der Druck meiner Angst ist nahezu gewichen. In den nächsten Tagen schon erwarte ich den Verwalter des Findelhauses.«
Und so geschah es. Seitdem war Gabriel Breuer bereits zum dritten Mal von Gotha hinüber nach Schloss Trolsheim gefahren, um für seine hungrigen Raben Lebensmittel abzuholen. Und er hatte noch keinen Groschen oder gar Gulden dafür bezahlt. Es fiel sogar immer etwas für ihn selbst ab. Unten in der Küche bekam er eine kräftige Mahlzeit, von der die Hausgemeinschaft seiner ihm anvertrauten Kinder nur träumen konnte.
So war es durchaus verständlich, wenn ihn das Getriller der Lerchen an diesem Frühlingsmorgen als fröhliche Zugabe seines Schöpfers begleitete. Er bog von der breiten Hauptstraße in einen steinigen Hohlweg ab. Der Frühlingswind zerrte an seinen Kleidern.
Weit vor ihm schnitten hohe Randfichten ihre Schatten in die sonnigen Felder. Alles Eigentum des Wohltäters Ernst Moritz von Trolsheim.
Was hatte diesen Mann nur so verwandelt? Denn hinter vorgehaltener Hand waren so manche Gerüchte kursiert … Und manche hätten es beschworen, dass es Tatsachen und keine Gerüchte waren. Gabriel Breuer kniff die Augen vor dem Sonnenlicht zusammen. Er sah die Blicke seiner Jungen, wie sie vor der Haustür standen und ihm freudig nachwinkten. Er liebte seine gefräßigen Raben, wie die Köchin sie liebevoll nannte.
Sie, die keinen Pfennig aus ihren Hosen schüttelten, hatten den Alten dennoch ein Kapital voraus, ihre Jugend und die damit verbundene Zuversicht. Wie anfällig solch ein Kapital sein kann, brachten die nächsten Stunden ans Licht, doch noch war es den Jungen selbst und dem fröhlich Kutschierenden verborgen.
Eine Windböe wirbelte Staub über die Felder und jagte als graue Wolke dem schnaubenden Pferd entgegen. Gabriel Breuer drückte den zerbeulten Hut tief in seine Stirn. »Hü, Brauner, beeil dich, mit dem launischen April ist nicht gut Kirschen essen!«
Kapitel 2
Der schwarze Tod
Heftige Hagelschauer verhinderten, dass Gabriel Breuer noch am gleichen Tage zurück nach Gotha fahren konnte. Als habe er eine Verzögerung geahnt, hatte er der Witwe Anna und seinem Knecht Julius gesagt, es könne wohl sein, dass er eine Nacht auf Trolsheim verbringen müsse und erst am anderen Tag nach Gotha zurückkehren würde. »Er wird ja dann auch Futter für die hungrigen Raben bringen«, entgegnete Witwe Anna, die für wenige Pfennige am Tage als Köchin des Findelhauses eingestellt worden war.
Nicht nur so einfach zwischen die anderen hineingeschoben, sondern durch den Beschluss der Gothaer Ratsherren für diese Aufgabe ausersehen. Dagegen half der frühere Köhler Julius ohne besondere Berufung durch die Ratsherren, allein auf die Bitte des Verwalters hin, so gut er es mit seiner Beinbehinderung noch schaffte, ihm zur Hand zu gehen.
Er sah schon verwegen aus, dieser einstige Köhler. In den ersten Wochen umschlichen die Jungen des Findelhauses die sonderbare und unheimliche Gestalt des Mannes, und auch er vermutete hinter dem Gekicher der Jungen und den mancherlei Gebärden, dass sie nur ihn meinen konnten. Dann aber entdeckten sie hinter seiner knorrigen Schale seine guten Absichten.
Es war an irgendeinem der langen Winterabende. Sie saßen rings um den Kamin, in dem Holzofen knisterte es und Funken sprühten, während der Köhler plötzlich zu erzählen begann. Er sprach von einem furchtbar gräulichen Wolf, den wohl das Wolfsrudel verstoßen hatte und der nun als unberechenbarer Einzelgänger um einsame Höfe und auch um seine Köhlerhütte schlich. Die Jungen folgten gespannt dem Erzählenden. In seinen Augen spiegelten sich die Flammen des Kaminfeuers. Alexander, ein blonder Bursche von knapp dreizehn Jahren, hielt die längeren Erzählpausen des Köhlers nicht aus und forderte, ganz im Sinn der anderen handelnd, »und dann und dann …?«
»Ja, dann, dann«, spann Julius den Faden weiter, »dann verlor ich meinen treusten Wächter, meinen herzensguten Troll.« Er lachte, jedoch hatten die Jungen den Eindruck, wenn er stattdessen geweint hätte, wäre er ehrlicher gewesen. »Kann man das von einem Tier überhaupt sagen?« Alle Jungen nickten ihm zu.
Seit jenem Abend war das Eis zwischen Julius und den Jungen gebrochen, obwohl es just in diesen Tagen und Wochen Flüsse und Seen mit harter Kruste bedeckte. In den ersten Tagen des Advents waren sie überraschend von Pater Hieronymus und zwei Herren aus dem Stadtrat besucht worden. Welch ein Glanz für das Armenhaus. Pater Hieronymus verteilte nach dem Abendbrot noch runde Fladen würzigen Lebkuchens, überzuckerte Nüsse, und er versprach, am heiligen Christfest sie wieder zu besuchen. Er hatte sein Versprechen gehalten, doch inzwischen waren darüber über drei Monate vergangen.
Allerdings hätte keines der beschenkten Kinder sagen können, welches Motiv den Feudalherrn bewog, sie so treu zu versorgen. Tatsache war nur, dass sie sein Schenken täglich als ein handgreifliches Brotwunder erlebten. Warum dieser Reiche sie mit Lebensmitteln versorgte und dem Verwalter sogar zugesagt hatte, für noch weitere Arme einen Trakt anzubauen, das erfuhren sie weder von Gabriel Breuer noch von ihrer Köchin Anna. Obwohl sie, hinsichtlich anvertrauter Geheimnisse, ihren undichten Kesseln glich, also fast nichts für sich behalten konnte, in dieser Sache blieb sie stumm wie ein Karpfen. Ihre Raben vermuteten, dass sie selbst gern gewusst hätte, warum sich der Schlossherr in Barmherzigkeit übte, und sie trafen mit dieser Vermutung voll ins Schwarze. Es blieb in der Tat ein Geheimnis zwischen Ernst Moritz von Trolsheim und Pater Hieronymus.
Die Witwe Anna glaubte, der Schlossherr habe ein Gelübde getan, für die Jungen des Findelhauses zu sorgen. Hatte er etwa den Zorn der Heiligen auf sich herabbeschworen, dass er sich durch gute Werke erneut um ihrer aller Gunst bemühte? Wer aber konnte das, außer ihm selbst, genau wissen?
Wahrscheinlich noch Pater Hieronymus, den man nach der Sonntagsmesse mit dem Gutsherrn und dessen Gemahlin, Maria, oft zusammenstehen sah. Wie auch immer, was wirklich zählte, waren die Lebensmittel, die Gabriel Breuer für die stets hungrigen Mäuler herbeischaffte.
»Wo er nur heute bleibt?«, fragte sich die Köchin des Armenhauses. Sie stand vor dem offenen Kamin, über dem eine Handbreit von der Glut entfernt ein Kessel hing. Wie weiße Spiralen stiegen die Rauchwolken durch den schmalen Schlund nach oben. Die Köchin nahm einige Hände voll des geschroteten Korns und streute es in das siedende Wasser. Mit einem geschnitzten Holzlöffel rührte sie geduldig den Inhalt, bis er sich zu einem grauen Brei verdickte. Neben dem Kamin stand ein Regal, auf dessen oberem Brett ein irdener Krug stand. Er war noch halb mit Milch gefüllt. Sie streckte sich und umfasste den Henkelgriff. Kurz eine Geruchsprobe, indem sie ihre Nase über die Öffnung steckte und schnupperte. ›Noch nicht sauer.‹ Sie goss die Milch in den blubbernden Kessel und rührte, bis die weißen Streifen sich ganz mit dem Brei verbunden hatten.
Sie hielt im Rühren inne und lauschte. Unverkennbar die klappernden Holzschuhe ihrer Nachbarin, deren Haus dicht an der Stadtmauer stand. Was wollte die denn schon wieder?
Der Inhalt des Topfes warf Blasen. Witwe Anna nahm einen Feuerhaken und scharrte die Glut unter dem Kessel auseinander. Neugierig durchquerte sie den Raum, der mit zwei rußenden Wandfackeln notdürftig beleuchtet war. Wenn auch immer die Nachbarin auftauchte, schien sie aus den Falten ihres langen Rockes eine Neuigkeit hervorzuzaubern. Ihre gekrümmte, hagere Gestalt beugte sich über die Schwelle des Hauses.
»Ist was passiert, Elsa?«, fragte die Köchin. Sie erschrak über die weit aufgerissenen Augen der Nachbarin.
Die andere nickte mit dem Kopf, während sie beide Hände in den weiten Ärmeln ihres Kleides verbarg. »Der schwarze Tod in Erfurt! Schon fliehen die ersten Reichen aus der Stadt, um ihr Geld und ihr Leben zu retten, wird berichtet.«
Beide standen sich gegenüber, und als habe sie jemand aufgefordert, jede Tuchfühlung zu vermeiden, rückten sie voneinander weg. »Und bei uns in Gotha?«
»Meinst du, der schwarze Tod verschont uns?« Sie trat näher an die andere heran und flüsterte. Wie leicht könnte einer der Jungen etwas aufschnappen. »Im Kreuzgang des Augustiner-klosters soll ein Mönch so einfach zusammengebrochen sein, und außerdem«, ihre Stimme zitterte wie Grashalme im Wind, »auf dem Hauptmarkt, nahe bei der Löwenburg, hat eine Frau sich schreiend den Kopf gehalten und ist nach einigen Schritten in die schmutzige Gosse gefallen.«
Die Frau zog hörbar die Luft ein. Wortlos deutete sie zum Stadttor hinüber. Einen Steinwurf von der Mauer entfernt, in Richtung auf die Felder, sprangen lodernde Lichtpunkte auf und ab. Sie verbanden sich zu einem Knäuel, und ihr gebündelter Schein schälte eine Mauer aus dem Dunkel heraus. Es war die Vorderfront des so genannten Siechenhauses.
Nach einer Pestepidemie vor einigen Jahrzehnten war nach Beschluss des Stadtrates, unterstützt von der Kirche, ein Siechenhaus errichtet worden. Davon eine knappe halbe Stunde entfernt, der so genannte Pestfriedhof. Nur verwegene Männer wagten sich bei Anbruch der Dämmerung noch in die Nähe des Pestfriedhofs.
Ein unerschrockener Landsknecht, der weder Tod noch Teufel fürchtete, wusste zu berichten, dass in mondhellen Nächten die Pesttoten klagend zwischen den Gräbern wandelten und mit hohlen Stimmen nach Wasser schrien.
Noch während die beiden Frauen gebannt durch die Halb-rundung des Stadttores starrten, hinüber zu dem Siechenhaus, vor dem sich immer mehr Menschen mit ihren brennenden Fackeln einfanden, nahte aus dem Dunkel der Innenstadt ein gespenstischer Zug. Über das Kopfsteinpflaster rumpelte ein flacher Wagen, von vermummten Gestalten gezogen.
Die zwei Frauen wären am liebsten in den Schutz des Hauses geflohen, doch, wie verwachsen mit der Schwelle, standen sie und sahen dem Zug entgegen. Zwei Männer in langen Gewändern schritten vorneweg, und der Schein ihrer Fackeln geisterte über die eng zusammengewachsene Häuserreihe.
Trotz ihrer Angst atmeten die Frauen erleichtert auf, als der Wagen an ihnen vorüberknarrte. Die drei Menschen auf dem Wagen lagen eng aneinander gepresst, doch noch nicht zugedeckt, wie man es nur bei Toten zu tun pflegte. Hinter dem Wagen gebeugte Schatten, Gebete murmelnd oder weinend. Ohne Zweifel die Verwandten der Kranken. Hoffentlich nicht Pestkranke.
Die zwei Frauen schauten sich an, und ihre Blicke nährten einander mit Hoffnung. Beide bewegte der gleiche Gedanke. Einem Beschluss des Stadtrates zufolge, hielt man in Gotha und den umliegenden größeren Orten daran fest, in drei Fällen die Glocken läuten zu lassen: bei ausbrechender Feuersbrunst, bei Naturkatastrophen und beim Ausbruch einer Seuche. Wobei man das Läuten der Pestglocke am meisten fürchtete. Die beiden Frauen sahen einander kurz an. Was sie insgeheim fürchteten, sprach keine von ihnen aus.
Es war die bedrückende Angst, in die Stille des Abends könnte der eherne Klang der Pestglocke von der Klosterkirche über die Dächer der Stadt schallen. Als sich das Poltern des Wagens in der Ferne verlor, wurde es doppelt still.
Nachdem sich die Nachbarin mit scheuer Gebärde bekreuzigt hatte, eilte sie, klappernd wie sie gekommen war, die nächtliche Straße entlang.
Die Köchin lief in den Küchenraum zurück. Die zwei Fackeln an der Wand knisterten, und schwarze, dünne Rußsäulen stiegen unter die Decke. In der Türöffnung erschien einer der Jungen, Vorhut der anderen hungrigen Kinder. »Deckt schon den Tisch. Gleich können wir essen!«, rief sie dem Jungen zu. Der verschwand, und die Frau näherte sich der Feuerstelle.
Glimmend zwischen verkohltem Holz, lagen noch einige Scheite, an dessen weißen Rändern die Glut emporkroch, aber keine Kraft mehr hatte, neue Flammen zu entfachen. Der Kornbrei im Kessel war dick und noch lauwarm.
Sie wandte sich nach dem Geräusch um, das von der Tür her ihre Ohren erreichte. Im Türrahmen stand der Knecht Julius. »Kannst den Kessel rüberbringen, Julius.« Unschlüssig stand er da, dann tappte er, ein wenig schwankend, auf die Feuerstelle zu. »Habt ihr keinen Hunger?«, fuhr sie ihn an.
»Mir brummt der Schädel, Anna, und mein ganzes Gesicht glüht, als hätte ich in der Julisonne gelegen. Weiß Gott, wo das herkommt!«
Zu beider Glück verhinderte die Dunkelheit des Raumes, dass Julius nicht erkannte, wie die Frau unter seinen Worten zusammenzuckte. Dann brauchte sie nichts zu bekennen und er nichts zu befürchten. Noch nichts zu fürchten, was ihr im Bruchteil von Sekunden durch den Kopf raste. »Sollte er … Nein, das durfte einfach nicht geschehen!«
Hell stand die Gestalt eines Baders vor ihr, den sie, damals war es unbetroffene Neugierde, nach den ersten Zeichen des schwarzen Todes gefragt hatte. Er antwortete ihr mit einer Leidenschaft, die Angst machte. Warum aber erwachten jetzt die Worte des Baders, und zwar so eindringlich, als hätte sie ihn erst gestern gefragt?
»Warum schaust du mich so seltsam an?«, fragte der Köhler, indem er den Kessel aus seiner Verankerung mit der an der Decke hängenden Kette loslöste.
»Komm, wir nehmen den Kessel und tragen ihn gemeinsam hinüber.«
»Erst musst du mir meine Frage beantworten!«, beharrte er eigensinnig. Beharrlich übertönte die Stimme des Baders die des Knechtes Julius. Er hatte bewusst den Namen »Pest« vermieden und nannte sie einfach »sie«, so wie man eine böse Frauenperson einfach »sie« nennt. »Sie« fängt als leichtes Fieber an, begleitet von drückenden Kopfschmerzen. Später kommen Schmerzen in den Achselhöhlen, den Leisten und in den Ohren dazu. Wie dicke Krötenaugen bilden sich harte Beulen, die mit rasenden Schmerzen entweder nach einiger Zeit aufbrechen oder – wenn das nicht geschieht – den Betroffenen einem schrecklichen Tod ausliefern. Manche Ärzte haben die Beulen mit Gewalt aufschneiden oder ausdrücken wollen, dabei sind ihnen die Patienten unter lauten Schmerzensschreien einfach weggestorben.
»Na, ich warte!«, riss die Stimme des Köhlers sie aus ihren Gedanken. Sie hörte seine Ungeduld wohl heraus. Anstatt direkt zu antworten, stellte sie eine Frage. »Kopfschmerzen, Fieber, sagst du. Schmerzt es auch in einer Achselhöhle – oder hinter einem Ohr?«
»Warum, warum fragst du das?« Seine Stimme versagte. »Denkst du etwa …«, schwer quälte er über seine Lippen, »die Pest?«
Er trat nahe an sie heran. Warm streifte sie der Atem des Mannes. Eklig, ein Hauch üblen Verwesungsgeruchs. Sie trat einen Schritt zurück und wehrte ihn mit beiden Händen ab. »Du weißt mehr als ich«, jammerte er. Dabei versuchte er, ihre Handgelenke zu umklammern.
»Wag es! Ich schreie, dass die ganze Stadt zusammenläuft.« Erschrocken taumelte er zurück. So, als habe ihm jemand den Tod durch den Henker mitgeteilt.
»Dann ist es wahr!« Dieses Mal sprach er das furchtbare Wort nicht aus.
»Julius, ich habe es selbst erst durch die Nachbarin erfahren. Ob es stimmt, wer weiß. Du kennst sie ja.«
»Was hast du gehört, Anna?« Seine Gestalt straffte sich. »Ich will die Wahrheit wissen«, bettelte er.
»Wie du willst, Julius. Nicht bei uns in Gotha, aber in Erfurt soll sie ausgebrochen sein. Hier noch nicht!«
Der Mann barg seinen Kopf in beide Hände. »Hier noch nicht. Der schwarze Mörder hat Schwingen, die schneller als die eines Falken sind.«
Beide hörten sie Geräusche. In der Türöffnung standen einige der Jungen. »Wir haben Hunger«, sagten sie, »Hunger haben wir.«
Mitten in der Nacht schrak Gabriel Breuer aus unruhigem Schlaf auf. Man hatte ihm auf Schloss Trolsheim im Gesinde-haus eine Kammer zugewiesen, die er mit zwei Knechten teilte. Am liebsten wäre er gestern Abend noch nach Gotha zurückgefahren, doch heftige Hagelschauer, vermischt mit Schnee und Regen, ließen manche Abschnitte der Straße zwischen Gotha und Trolsheim zu einer Wagenfalle werden. So jedenfalls erzählte ihm einer der Knechte und gab ihm den guten Rat, wenn schon Aufbruch, dann nicht in die Nacht hinein. Schon oftmals seien nach solchen Frühlingsstürmen die Wege und Felder zugeweht gewesen.