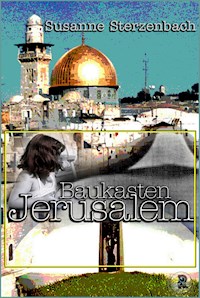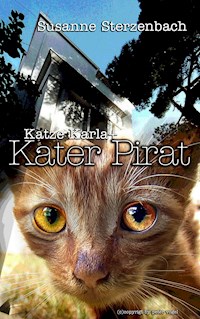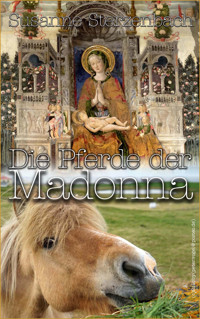
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
CMB - diese drei Buchstaben beschäftigen die Familie Miranda seit Jahrhunderten. Hat das Geheimnis mit den Drei Heiligen Königen zu tun, Caspar, Melchior, Balthasar? Die Kölner Archivarin Basiliki wird von ihrem Vater beauftragt, uralte Spuren wieder aufzunehmen, in Griechenland, Italien, Algier, Jerusalem, Istanbul. Sie findet tiefe Verletzungen und große Liebesgeschichten - auch ihre eigene. Die Geschichte der Mirandas ist auch ein spannendes historisches Abenteuer, von der Vertreibung der Juden aus Spanien über die Reise der Reliquien der Drei Heiligen Könige nach Köln, die Machenschaften der Kreuzritter auf Rhodos, die Herrschaft der Piraten in Algier, einer Flucht in die Sahara und zweifelhaften Entdeckungen in italienischen Kirchen und Klöstern. Immer wieder kehrt Basiliki aber zu ihrer Familie auf die griechische Insel Samos zurück, in das kleine Restaurant in den Bergen, genießt die paradiesische Landschaft und lernt in einem Lager an der Küste auch die Flüchtlinge von heute kennen. Die Lösung des Familienrätsels aber wartet in der Schweiz. "Geschichten weben das Leben und den Zusammenhalt von Familien."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Susanne Sterzenbach
Die Pferde der Madonna
Inhaltsverzeichnis
Impressum
„Denn am Ende sind wir alle pilgernd Könige zum Ziel.“
(Goethe, 1821)
Samos
Als die Fähre in Karlóvassi einlief, sah ich schon von der Reling auf dem ersten Deck, dass mein Vater sehr müde war. Er lehnte an seinem alten verbeulten Pickup, der einmal blau gewesen war und hatte die Augen halb geschlossen.
Ich winkte ihm zu, aber er hatte mich noch nicht entdeckt. Ein fröhliches Gerenne und Geschubse begann auf dem Schiff. Die Ferien hatten begonnen und Schüler, Studenten, Lehrer aus Athen oder von anderen Inseln kamen nach Hause oder wollten bei Freunden auf Samos ihren Urlaub verbringen. Alle versuchten, über die engen Treppen möglichst gleichzeitig in den Frachtraum und zu ihren Koffern zu gelangen. Und auch ich machte jedes Jahr mit, kehrte jedes Jahr heim, ließ mir jedes Jahr das Herz wärmen von dem Durcheinander und dem Wiedersehensjubel an Land. Wobei man in meinem Fall dieses Mal kaum von Jubel sprechen konnte. Mein Vater umarmte mich wortlos, drückte mich an sich und wollte mich gar nicht mehr loslassen. „Ist etwas passiert, Babas?“ Er schüttelte den Kopf und schob mich ein wenig von sich. Wenigstens war der Glanz noch in seine schwarzen Augen, dieses Funkeln, das er der Legende nach schon hatte, als er auf die Welt kam. Seine Eltern hatten ihn Diamantis genannt. Wahrscheinlich hätte es in keiner anderen Sprache der Welt einen passenderen Namen gegeben. Und uns standen viele Sprachen zur Verfügung.
Mein Vater wuchtete meinen gelben Koffer auf die Ladefläche, ich stieg ein und wir fuhren durch Karlóvassi hinaus in die Berge.
„Und“, fragte mein Vater, „wie war es?“ Ich hatte Station gemacht bei meinem jüngsten Bruder Constantin, der an der Ägäis-Universität auf Lesbos Kulturmanagement studierte. „Hat er die Semester-Prüfungen bestanden?“ Er hatte alles geschafft, wie immer. Aber diesmal machte er noch ein Praktikum im Tourismusverein, Sommer-Konzerte organisieren, ein Theaterfestival vorbereiten. „Er kommt in zwei Wochen, ich soll ganz herzlich grüßen.“ Ich erzählte Babas nicht, dass ich meine liebe Mühe hatte, Constantin von seiner fixen Idee abzubringen. Mein Bruder hatte sich in den Kopf gesetzt, nach dem Examen nach Samos zurück zu kehren und die Insel zum Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Ägäis zu machen.
„Constantin, die Leute wollen wandern auf Samos, baden, essen, Wein trinken. Da kannst Du mal ein paar Konzerte organisieren, aber davon leben kannst du nicht. Und ich weiß schon, wie das dann ausgeht.“
„Und warum nicht?“ raunzte er mich an. „Das ist doch Familien-Tradition.“
Eben. Von Hause aus sind wir samiotische Weinbauern, und verstehen auch etwas von Gemüse. Die Trauben für unseren erdigen, trockenen Rosé gedeihen ab einer Höhe von achthundert Metern. Und damit wir Wein, Paprika, Tomaten, Auberginen und Gurken nicht mühsam an irgendwelche Zwischenhändler verhökern müssen, verarbeiten wir sie lieber in unserem eigenen Restaurant. Schon unsere Yaya, die Mutter meines Vaters, führte das kleine Haus mit den lindgrünen Stühlen auf der Platia von Vourliotes, hoch oben in den Bergen. Da sie nicht gleichzeitig kochen, bedienen, abwaschen und nebenbei noch auf das Baby Diamantis aufpassen konnte, bekam mein Vater ein Einmachglas mit Vanillepudding vorgesetzt, aus dem er den lieben langen Tag mit den Fingern diesen köstlichen Stoff angeln konnte. Er war damit zufrieden und störte nie. Und es störte ihn auch nicht, dorthin zurück zu kehren.
Wie fast alle Inselbewohner hatte er sein Glück in Übersee gesucht. Zusammen mit meiner Mutter und der ältesten Tochter war er nach Australien ausgewandert und hatte neun Jahre lang Andenken verkauft. Keine griechischen Andenken, australische Souvenirs am Rande eines Naturparks: Kängurus aus Holz und Keramik, Boomerangs, Didgeridoos im Kleinformat, T-Shirts mit Down-Under-Aufdrucken. Und auf einmal wollte er zurück nach Samos, auf einmal hatte ihn das Heimweh eingeholt, auf einmal wollte er wieder in die Vergangenheit eintauchen. Wir haben nicht alle mitgemacht. Mein ältere Schwester Maria ist noch fünfzehn Jahre in Australien geblieben, hat dort aber treu und brav einen Griechen geheiratet und ihre beiden Mädchen geboren. Und heute lebt auch sie wieder auf der Insel, in Sichtweite meiner Eltern. Constantin und ich waren zu klein, um selbst zu entscheiden. Wir mussten also mit zurück in eine Vergangenheit, die wir nicht kannten. Und es war verdammt schwer, das alles wieder hinter sich zu lassen, als wir erwachsen wurden. Ich lebe heute als Bibliothekarin und Archivarin in Köln, und ich schwöre, dass ich nicht auf Samos leben werde, dass ich nicht an lindgrünen Tischen bedienen werde und auf gar keinen Fall meinem Bruder dabei helfen werde, eine Tradition fortzuführen, die nichts mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Mir sollte eine andere Aufgabe zufallen, von der ich zum Glück noch nichts ahnte in diesen ersten Augenblicken der Wiedersehensfreude.
„Basiliki“, sagte mein Vater – ich heiße Basiliki nach meiner Großmutter - „ich werde diesen Sommer deine Hilfe brauchen. Ich muss jeden Morgen um fünf Uhr in die Reben, es ist Grünschnitt-Zeit, sonst gehen sie kaputt, aber das weißt du ja. Und mittlerweile bin ich abends zu müde, um in der Küche zu stehen.“
Ja, ja, ich wusste. Aber bis vor kurzem hatte es ihm nichts ausgemacht. Die Fleischgerichte waren Babas ganzer Stolz. Er zauberte die Weinsauce, den Ingwerfonds für sein berühmtes Schweinefleisch-Ragout. Den Winter verbrachte er damit, sich neue Rezepte auszudenken und von meiner Mutter vorkosten zu lassen. Ich warf ihm einen besorgten Blick zu, aber er reagierte nicht. Wir waren in die kurvige Straße eingebogen, die fünf Kilometer hinaufführt durch Pinien, Zypressen und Oliven. Es ist eine paradiesische Landschaft, wo Wein und Honig fließen, wo Feigen und Zitronen leuchten und die Luft gesättigt ist vom Aroma der Kräuter.
Rechts unter uns lag die hellblaue Kuppel der schönsten Marien-Kapelle der Insel, in der uralte Fresken vom Geheimnis des Glaubens erzählen.
In Vourliotes parkten wir kurz vor dem Buswendeplatz und gingen die wenigen Meter bis zur Platia zu Fuß. Ich blieb immer wieder stehen, um den atemberaubenden Blick auf das tiefblaue Meer zu genießen. Eine Wohltat für die Augen, die mich mein geliebtes Kölner Stadtarchiv vergessen ließ. Meinen Rollkoffer hatte sich mein Vater nicht nehmen lassen, aber da es bergab ging, lief er fast von alleine. Rechts und links begrüßten mich die Nachbarn aus Vorgärten und geöffneten Fenstern.
Und schließlich doch der Wiedersehensjubel. „Basiliki!“ Mein Mutter Eleni kam mit einem Freudenschrei aus dem dunklen Restaurant gestürzt und warf sich in meine Arme. Die Gäste auf den lindgrünen Stühlen und die nebenan auf den meeresblauen der Konkurrenz lächelten gerührt. Ich hielt sie ganz fest, meine kleine, zarte Mutter und spürte ihre Wärme. Eleni Miranda war schon Mitte fünfzig, wirkte aber immer noch wie ein junges Mädchen. Gertenschlank, mit langen schwarzen Locken. Sie konnte Kleider tragen, aus denen ich schon mit vierzehn herausgewachsen war. Sie war eines jener seltenen Wesen, dessen Alter man nicht an Falten ablesen konnte, sondern daran, dass die Gesichtszüge immer weicher wurden. Die Gäste liebten Eleni, alle liebten Eleni, weil sie eine große Herzlichkeit ausstrahlte. Sie konnte einem Fremden ihr selbst gemachtes Zitronenkompott mit der gleichen Liebe servieren wie sie ihre Enkelkinder auf dem Schoß wiegte. Sie war eine Gastgeberin von außergewöhnlichem Talent. Und ein Mensch von tiefer Traurigkeit, einer angeborenen Melancholie. Wenn sie sich zwischen Bestellungen und Servieren kurz an den Stammtisch im Restaurant setzte, schauten ihre Augen unvermittelt in ganz andere Welten, und sie sagte dann zum Beispiel: „Warum dürfen die Menschen nicht sterben ohne zu leiden?“ Wir waren daran gewöhnt und machten uns keine Sorgen um sie. Trotzdem, je älter ich selbst wurde, desto öfter stellte ich mir die Frage, ob meine Mutter vielleicht sehr krank war und das vor uns verheimlichte.
Jetzt aber strahlte sie und zog mich ins Haus. „Wir essen gleich zusammen, wenn ich bei den letzten Mittagsgästen abkassiert habe.“
Ich ließ mich zufrieden auf das Sofa unter dem Fernseher fallen und trank einen großen Schluck vom familieneigenen Rosé. Urlaub! Mein Vater saß auf der anderen Seite des Stammtisches und sah sich die Nachrichten an. Der größte Teil unseres Familienlebens hatte sich an diesem Tisch abgespielt. Ein fast quadratischer Tisch aus dunklem Holz, an dem gegessen, gespielt und gearbeitet wurde. An der Wand hingen die Fotos der Familiengeschichte. In der Mitte Großvater Giorgos mit dem Fes auf dem Kopf. Er musste einst wie so viele Samioten aus der griechischen Kolonie in Istanbul auf die Insel fliehen.
„Ich habe angefangen, einen Atlas unserer Familiengeschichte zu zeichnen“, sagte mein Vater, der meinem Blick gefolgt war. Ich nickte nur. Erst viel später wurde mir die Bedeutung dieses Satzes bewusst. Aber da war es schon zu spät. Für den Moment war das keine ungewöhnliche Ankündigung, mein Vater war der Hüter des Stammbaumes und der Legenden, die unsere Familie zusammen hielten, so weit verstreut auf dem Globus sie auch lebten. Als Kind dachte ich, dass die Mirandas nur überlebt hatten, weil einer immer von ihnen erzählte. Und wenn mein Vater eines Tages damit aufhörte, wäre es vorbei mit uns. Ich ahnte nicht, wie recht ich damit haben sollte.
„Madame, l’addition, s’il-vous-plaît ». Meine Mutter brachte dem Gast die Rechnung und parlierte noch eine Weile auf Französisch mit ihm. Es war die Sprache ihrer Kindheit in Kongo-Brazzaville. Dort war sie aufgewachsen als Tochter eines griechischen Waffenhändlers, der die falsche Seite beliefert hatte und deswegen vor der Militärdiktatur in Athen zunächst nach Frankreich floh und dann in Kongo-Brazzaville an anderen schwelenden Konflikten gut verdiente. Man sprach nicht viel über diesen lang verstorbenen Vater, der zu wenig mit den einfachen Genüssen des Lebens zu tun hatte, wie sie meine Eltern liebten.
Aber es gab kleine Verbeugungen vor der französischen Kultur, die Eleni auf einer Klosterschule in Brazzaville geprägt hatte. „Eleni und Diamantis, Spécialités du Pays“ nannten meine Eltern daher ihr Restaurant. So stand es auf dem Schild, das mein Vater jedes Jahr liebevoll restaurierte und mit der neuesten Speisekarte versah. Es verlieh dem kleinen Restaurant auf der Platia einen besonders weltläufigen Charme, der auch besondere Kunden anzog. Sonst war Englisch die Umgangssprache mit den Touristen, Deutsch sprach man nebenan bei den meeresblauen Stühlen.
Meine Mutter deckte für uns den schattigen Tisch unter den Bougainvillea direkt neben der Eingangstür. So hatte man den ganzen Platz im Blick und sah mögliche Gäste schon von weitem heran schlendern. Wir aßen Salat aus dem Bauerngarten, mit Paprika, Tomaten und diesen wunderbaren neonorangefarbenen Karotten, die mich immer noch faszinierten. Dazu einen cremigen Feta-Käse in Olivenöl mit Thymian bestreut. Ich sah zum Nachbarhaus hinauf, das einen rechten Winkel mit unserem Restaurant bildete. Alles war fest verschlossen. „Ist meine Schwester verreist?“
„Maria verbringt die Ferien mit den Kindern bei den Großeltern in Australien, du kannst bei ihr wohnen, hat sie gesagt.“
Meine Mutter sah mich forschend an, sie wusste ganz genau, was für eine Zumutung das für mich war. Eingesperrt im Dorf wie früher, ein ewig schlechtes Gewissen, weil ich meinem Vater nicht im Garten half oder meiner Mutter nicht im Restaurant. Fünf Kilometer rauf und runter für jede Besorgung, zum Baden, um Freunde zu treffen. Ich wohnte normalerweise unten am Strand in der Villa von Freunden und kam zwei Mal in der Woche mit dem Bus zum Essen in die Berge. Manchmal machte ich auch einen Stadtbummel mit meiner Mutter in Vathi, und wir kauften ihr neue Mädchenkleider. Ferien auf lindgrünen Stühlen, das kam gar nicht in Frage.
„Hier, das soll ich dir geben.“ Meine Mutter holte den Hausschlüssel aus ihrer Rocktasche und einen Autoschlüssel. „Ein lindgrüner Panda, steht neben dem Feuerwehrauto. Du sollst ihn nur vollgetankt wieder zurück stellen, hat sie gesagt.“
Ich war sprachlos. Was wollten sie von mir? Ich konnte mich frei bewegen, aber ich sollte hier oben wohnen. Die Sache mit dem Auto war eindeutig ein Druckmittel.
„Du hast doch deinen Computer dabei?“, fragte mein Vater.
Die Sache wurde immer mysteriöser, er hatte sich noch nie für meine Arbeit interessiert. Dachte ich.
„Ja, aber was soll ich damit hier. Unten komme ich damit wenigstens problemlos ins Netz.“
„Du sollst nur das tun, was du sonst auch tust. Aufschreiben und archivieren. Unsere Familiengeschichte.“
Istanbul
Jakob Miranda fühlte sich nicht wohl. Den ganzen Tag schon pfiff der Wind um die Ecken von Häusern, Kirchen, Synagogen und Moscheen. Es war kalt, bald würde es schneien wie jedes Jahr in Istanbul. Nicht viel, nur ein wenig, aber gerade genug um die Kälte sichtbar zu machen. Er hatte die Füße auf den Rand eines Beckens mit warmer Asche gestellt, das ihm die Dienerin unter den Schreibtisch geschoben hatte. Eine warme Pelzdecke hüllte ihn ein, und hinter ihm knisterte leise ein Feuer aus duftenden Pinienzweigen und Rosmarin im Kamin. Jakob Miranda wusste, dass die Kälte in ihm saß, sie kroch durch Arme und Beine immer näher an sein Herz. Es würde erstarren, nur eine Frage der Zeit. Eine Frage von Stunden? Er wusste es nicht. Wenigstens noch eine Stunde, murmelte er, und versuchte mühsam mit klammen Fingern, ein Blatt Papier mit seiner gestochenen, klaren Schrift zu bedecken. Das Schriftstück sollte das friedliche Zusammenleben seiner Familie schützen, und ihr großes Geheimnis endlich enthüllen. Helena, Amin und Manuel waren so gefestigt im Leben, dass er ihnen die Wahrheit zutrauen konnte. Aber warum traute er sie sich selbst nicht zu? Warum rief er sie nicht zu sich, jetzt in diesem Augenblick, um ihnen von Angesicht zu Angesicht den Traum seines Lebens, vielleicht seinen größten Fehler zu gestehen? So lange sie ihm noch in dieser Welt vergeben konnten.
Noch einmal tauchte er den Federkiel ins Tintenfass. Um seinen Besitz machte er sich keine Sorgen, er hinterließ geregelte Verhältnisse, eine gut eingeführte Karawanserei wenige Schritte oberhalb des Bosporus-Hafens, die jeden Abend Kaufleute aus aller Welt mit ihren Waren aufnahm, beherbergte und beköstigte, und vor Dieben und korrupten Beamten schützte.
„...wenn sie in seiner linken Hand die eingestochenen Zeichen CMB sehen, dann werden sie Dir glauben. Du wirst wissen, wie Du sie mit der Wahrheit versöhnen kannst. Nur Du und meine geliebte Basiliki haben je davon gewusst. Sie ist nun schon seit zehn Jahren nicht mehr unter den Lebenden, und mir bleibt nur sehr wenig....“ Der Federkiel stockte, die Hand verkrampfte sich, der Herzschlag setzte aus. Jakob Miranda rutschte auf den Holzboden und riss den Stuhl mit sich. Jakob Miranda, geachteter Bürger der Stadt Istanbul, Vorsteher der großen Synagoge, Luxuswaren-Lieferant des Sultans, Freund des Patriarchen, Berater des Mufti, war so eben im Alter von siebzig Jahren gestorben. „Vater?“ Das laute Poltern hatte Helena alarmiert, Jakobs Tochter, die nebenan in der Bibliothek arbeitete. Sie verstand, was sie sah, aber sie konnte es nicht fassen. Noch schützte der Schock ihre Seele vor Trauer und Schmerz. Mechanisch tat sie, was zu tun war, schloss ihrem Vater die Augen und murmelte ein Kaddisch, bevor sie ihre Brüder holte.
Samos
„Babas, warum tust du das? Geht es dir nicht gut, bist Du krank?“ Mein Vater antwortete nicht, sondern zeichnete weiter an einem Stadtplan von Istanbul im 16. Jahrhundert mit den Häusern und der Karawanserei der Mirandas. Er war wie besessen von der Idee, dass nichts verloren gehen dürfe. Kein Detail der Familiengeschichte sollte in Vergessenheit geraten. Bisher war alles in seinem Kopf gespeichert. Aufgesogen wie ein Schwamm hatte er von Kindesbeinen an die Erzählungen seines Vaters, seiner Onkel, seines Großvaters. Jetzt presste er diesen Schwamm aus, holte die kleinsten Kleinigkeiten aus den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses. Nicht einmal er selbst wusste, ob ihn jemand beauftragt hatte oder ob er die Verantwortung in sich selbst gefunden hatte – er war der Hüter der Geschichte und er hatte dafür zu sorgen, dass sie eines Tages auch ohne ihn weiter ging. Das machte mir Sorgen.
Mir kam es so vor, als ob er mir sein Testament, die Summe seines Lebens und der Leben unserer Ahnen diktierte, weil er täglich mit seinem Tod rechnete. Was auch immer ihn trieb, es war so stark, dass er völlig ungewöhnliche Dinge tat.
Eines Morgens überraschte er mich mit einem Scanner, den er ganz allein in Vathi gekauft hatte. Mein Vater, der keinen Computer besaß und nicht wusste, wie man eine E-Mail schreibt. „So, jetzt kannst Du meine Zeichnungen gleich in die richtigen Kapitel einfügen.“
Ich war sprachlos. Als er dann auch noch eine externe Festplatte und einen Stick auspackte – „du machst immer nur eine Kopie, das ist zu wenig“ - wäre ich fast in Tränen ausgebrochen.
„Babas, was soll das? Was ist so wichtig, was ist so eilig, dass wir alles doppelt und dreifach sichern müssen? Ich kann dich doch jederzeit fragen, wenn etwas fehlt. Und wenn, es ist doch nur eine Familien-Geschichte.“
Ich wusste, dass ich ihn provozierte. Aber ich wollte jetzt endlich wissen, was los war. Und wenn er es nur im Ärger rauslassen würde, bitteschön. Aber wieder hatte ich mich getäuscht. Diamantis Miranda sah mich nur traurig an und schüttelte den Kopf. „Du kannst mich eben nicht jederzeit fragen. Schon heute kann ein Erdbeben alles verwüsten, oder ich kann einen Unfall haben, oder, oder, oder.“
„Aber das hat dich bisher nicht beunruhigt, warum jetzt?“
„Ach, Basiliki. Vielleicht weil ich älter werde, vielleicht weil ich immer so müde bin. Vielleicht auch, weil ich hoffe, das Geheimnis unserer Familie doch noch zu lösen. Indem ich alles noch einmal von vorne erzähle. Irgendwo muss der Schlüssel liegen, irgendwas haben wir alle übersehen.“
Ich hielt meinen Vater für völlig verschroben. Sogar für verwirrt, obwohl er mit Ende fünfzig dafür zu jung war. Aber er rührte mich auch, und ich war mir einfach nicht sicher, ob ihn nicht doch große Ängste quälten.
Da es ihm offensichtlich gut tat, schrieb ich also. Jeden Morgen saßen wir zwei Stunden am Stammtisch und er erzählte.
Dann tranken wir ein kleines Gläschen Rosé, und ich fuhr im lindgrünen Panda hinunter an den Strand. Manchmal kam ich zum Abendessen schon zurück, manchmal schlief ich auch bei Freunden und kam erst am nächsten Morgen zum Schreiben wieder ins Restaurant. Niemand belästigte mich, keiner bat mich, in der Küche zu helfen oder Unkraut im Garten zu jäten. Es war ihnen wirklich ernst.
Istanbul
Helena, Amin und Manuel saßen über den Brief gebeugt, den ihr Vater nicht hatte fertig schreiben können.
„Wenn wir wenigstens wüssten, an wen er geschrieben hat, Wohin dieser Brief geschickt werden sollte, dann hätten wir eine Chance, diesen „einzigen, der das Geheimnis kennt“ zu finden“, sagte Amin. "Warum fehlt die Anrede?" Helena hatte es wieder und wieder erklärt: " Er schrieb die Namen immer am Schluss, um sie besonders kalligraphisch zu gestalten. Als Verbeugung vor dem Empfänger." Hunderte Male hatten sie das seit dem Tod von Jakob Miranda schon durchgespielt: Hätten sie einen Anhaltspunkt, könnten sie die durchreisenden Händler in der Karawanserei befragen, könnten ihnen Briefe mitgeben, könnten sie bitten zu suchen.
Helena hatte sämtliche Familien-Chroniken durchgesehen, hatte in, hinter und unter Schubladen und Regalen nach Papieren gesucht, hatte zwei Geheimfächer gefunden mit Schmuck ihrer verstorbenen Mutter, aber sonst nichts.
„Ich glaube“, sagte sie, „wir müssen dort suchen, wo unsere Familie herkommt. Wir müssen die alten Wurzeln finden, wenn wir wissen wollen, was darunter liegt.
„Wie soll das gehen?“ Manuel schüttelte ärgerlich den Kopf, und drehte das Ende seines langen Pferdeschwanzes um die rechte Hand.
„Vater ist aus Spanien geflohen, weil alle Juden verfolgt wurden. Dahin können wir auf keinen Fall zurück.“
„Du schon!“ warf Helena ein. Womit sie einerseits recht hatte, denn Manuel war zum Christentum konvertiert und hatte sich mit vierzehn taufen lassen. Der Vater hatte ihn fast dazu gedrängt. Er wollte allen Eiferern beweisen, dass sogar in der eigenen Familie verschiedene Religionen gut miteinander auskommen. Aber auch Manuel hatte recht: „Ich bin genauso beschnitten wie Amin, wenn sie mir übel wollen, werden sie mir nicht glauben. Und du weißt, dass in Toledo jetzt die Inquisition herrscht. Ich habe keine Lust auf dem Scheiterhaufen zu enden.“
Für Amin kam Spanien auch nicht in Frage. Er war mit Duldung und Unterstützung des Vaters Muslim geworden, was ihm viele Dinge in Istanbul erleichterte. Aber nicht im Land der allerkatholischsten Majestäten, die die Muslime 1492 zusammen mit den Juden aus dem Land gejagt hatten. Doch – so erklärte es Jakob seinen Kindern immer wieder – dafür war Konstantinopel 1453 von den muslimischen Mamelucken eingenommen worden und zum gastfreundlichen, weltoffenen Istanbul geworden, das sie aufnahm, ja geradezu auf sie gewartet hatte und zu ihrer Herzensheimat wurde. Gerne zitierte Jakob einen Autor aus dem 12. Jahrhundert, der sich sein Heimweh nach Istanbul von der Seele schrieb: „Oh, dreimal glückliche Stadt, Auge des Universums, Schmuck der Welt, weit strahlender Stern, Leuchtfeuer der irdischen Sphäre.“ (nach William Dalrymple, „From the Holy Mountain“, S. 27)
Jakob Miranda war immer sehr stolz gewesen, auf sein „Drei-Religionen-Haus“. „Der Beweis, dass ich meine Kinder zu selbständigen, unabhängig denkenden Menschen erzogen habe. Im Übrigen genoss er die handfesten Vorteile, die diese Vielfalt ihm einbrachte. Händler und Kunden, ganz gleich welcher Herkunft und welcher Religion, fühlten sich in Mirandas Karawanserei willkommen. Jeder fand seinen Gebetsraum und ein Essen, dass koscher oder hallal war. Oder am Freitag das Fleischverbot respektierte.
„Aber ich könnte nach Jerusalem reisen und Mutters Schwester besuchen. Vielleicht weiß Tante Rahel etwas“, schlug Helena vor. Ihre beiden Brüder sahen sie nachdenklich an.
Und Helena spürte, was ihr Vater gemeint haben könnte, als er „das friedliche Zusammenleben schützen“ wollte. Amin und Manuel hatten kein Problem damit, dass ihre große Schwester Helena alleine nach Jerusalem reisen wollte. Sie war schon oft verreist, sie ritt auf Pferden und Kamelen, sie war sattelfest und seefest und sie wusste sich notfalls zu wehren. Sie hatte auf Wunsch ihres Vaters fechten und schießen gelernt. Deswegen sah Helena nicht Sorge in den Augen ihrer Brüder, sondern Misstrauen. Das hatte es bisher zwischen ihnen nicht gegeben.
Helena war klug, sie hatte Philosophie und Mathematik studiert, hatte Vaters Bücher geführt, wusste mehr über seine Gefühle als die Söhne, das war alles nichts Neues, ihre Brüder hatten sie immer dafür bewundert und oft um ihren Rat gefragt. Aber jetzt konnte es einen Vorsprung bedeuten. Manuel und Amin hielten ihre Schwester für fähig, das Geheimnis ihres Vaters im Alleingang zu lösen. Würde sie mit ihnen teilen, wie sie es immer getan hatte? Manuel war überzeugt, dass der Unbekannte den Schlüssel zu etwas sehr Kostbarem besitzen musste, zu einem Schatz, zu Wechseln oder Schmuck. Amin glaubte eher an Ländereien, die ihnen der geheimnisvolle Fremde übereignen sollte. Ländereien in Übersee, in den neuen spanischen Kolonien, wo man jetzt so viel Gold und Silber fand. "Aber es geht doch um einen Menschen!’’ protestierte Helena. "'Wenn sie die Zeichen in seiner Hand sehen, werden sie Dir glauben.' Sind wir gemeint oder andere? Welche Bedeutung hat dieser Mensch für die Mirandas?"
„Wenn wir wenigstens wüssten, was CMB bedeuten soll“, murmelte Amin, der von der Jerusalem-Reise ablenken wollte.
„Aber das wissen wir doch.“ Manuel verstand einfach nicht, warum sein Bruder sich auf diese Frage versteifte. Wieder und wieder hatte er ihm das erklärt.
„Es heißt Caspar, Melchior, Balthasar wie die drei heiligen Könige.“
„Oder Christus mansionem benedicat– Christus segne dieses Haus“, fügte Helena hinzu.
„Das glaube ich nicht.“ Amin klang geradezu bockig. „Warum sollte ein Jude einen christlichen Code benutzen. Es muss etwas anderes heißen.“
Ahnte er etwas, war er auf einer Spur? Auch Helena konnte sich gegen das aufkeimende Misstrauen nicht wehren.
Jerusalem
Helena ritt durch das große Damaskustor in die Altstadt hinein. Die langen braun-weißen Ohren ihres Esels bewegten sich aufmerksam hin und her. Helena kam sich ein wenig vor wie Jesus, der auf einer Eselin in Jerusalem einzog. Aber das war dann doch reichlich vermessen. Es mochte auch an der festlichen Atmosphäre liegen, denn es war Palmsonntag und alle Kirchen waren mit Palmzweigen geschmückt. Frauen und Kinder trugen Palmwedel in die Messe, um sie weihen zu lassen.
Helena liebte diese Stadt, weil sie Juden, Christen und Muslimen heilig war. Kein Krieg und kein Eroberer hatten den Geist Jerusalems auslöschen können. Zur Zeit saß ein Türke auf dem Thron, Jerusalem war Provinzhauptstadt im Reich der Mamelucken. So gesehen war Helena als Untertanin des Sultans von Istanbul hier keine Ausländerin. Trotzdem hatte sie ein Empfehlungsschreiben des Serails bei sich, wie immer wenn sie nach Jerusalem kam.
Sie suchte und kaufte seltene Bücher und Handschriften für ihn, eine Aufgabe, die ihr Vater viele Jahre lang neben seiner Karawanserei erfüllt hatte. Weniger aus Geschäftssinn als aus Liebhaberei, denn Jakob Miranda war selbst ein besessener Leser und Sammler. Helena hatte seine Leidenschaft geerbt und schließlich auch seine Aufgabe. In Jerusalem fand sie eine vielsprachige und weltumspannende Auswahl von Werken, für die sie sonst einmal um den Globus hätte reisen müssen: Armenische Christus-Legenden, Märchen auf Urdu und Hindi. Paschtunische Rezepte, spanische Heldensagen, schottische Minnelieder, arabische Abhandlungen über Pferde, lateinische Messbücher, griechische Philosophen, hebräische Geschichtsbücher. Die Satteltaschen waren schon prall gefüllt.
Auf der Rückreise wollte sie den Landweg nehmen, auf dem Meer würde es bald zu stürmisch werden. Sie würde eine kleine Karawane zusammenstellen müssen. Vier Last-Kamele für die Bücher und eines für Stoffe und Gewürze. Sie würde Begleiter brauchen, Kamelführer und einen Koch. Oder sie schloss sich einer größeren Gruppe an, am besten Händlern auf dem Weg in ihre Karawanserei in Istanbul. Obwohl...Helena blickte sich um. „Schöne Teppiche, guter Preis.“ „Echter Schmuck von echten Beduinen. Dein Preis ist mein Preis.“ „Stoffe, schöne Frau, wunderbare Stoffe, meine Prinzessin.“ Die Stimmen der Händler hoben und senkten sich, die Worte flogen hin und her, geöffnete Hände winkten Willkommen und zeigten den Weg ins Innere der Ladenlabyrinthe. Helena winkte zurück, lächelte, schüttelte den Kopf. Es war alles wie immer, und schließlich hatte sie sich nur eingebildet, dass sie beobachtet wurde. Auf dem Schiff von Istanbul nach Jaffa war ihr ständig ein schwarz gekleideter Mönch begegnet, lange Kutte, tief ins Gesicht gezogene Kapuze. Wie ein Schatten schlich er durch die Gänge. Ein Mönch auf dem Weg nach Jerusalem, eigentlich nichts Besonderes. Und doch hätte sie schwören können, dass sie ihn gesehen hatte, wie er aus ihrem Zelt auf dem Oberdeck schlüpfte. Es fehlte nichts, es war auch nichts durchwühlt oder verändert in ihrem Gepäck. Vielleicht lagen die Kämme und Klammern auf ihrer kleinen Reisetruhe etwas anders als am Morgen, aber was hatte das schon zu bedeuten.
Warum war sie so nervös? Dass sie sich verfolgt fühlte, war ihre eigene Schuld. Sie hatte sich davon geschlichen wie eine Diebin, hatte sich eine Passage für die „Rose von Istanbul“ besorgt, ohne ihren Brüdern etwas zu sagen. Nicht einmal verabschiedet hatte sie sich, aus lauter Angst, Manuel und Amin könnten sie zurückhalten. Warum sollten sie das tun? Was geschah mit ihnen? Wie konnte ein unfertiger Brief das Vertrauen zwischen den Geschwistern so schnell ins Wanken bringen? Sie selbst hatte das Vertrauen ihrer Brüder am meisten getäuscht, Helena machte sich da nichts vor. Vorsichtig tastete sie nach dem silbernen Ring, den sie unter dem Handschuh am linken Mittelfinger trug. Sie hatte ihn in einem der Geheimfächer mit dem Schmuck ihrer Mutter gefunden und ihren Brüdern gezeigt. Auf der Innenseite waren drei Buchstaben eingraviert: CMB.
Istanbul
Manuel tobte. „Wie kannst Du unsere eigene Schwester bespitzeln lassen? Das lasse ich nicht zu. Das hätte Vater nie gewollt.“ „Sei still!“ Amin zog seinen Bruder in ein Kontor. „Nicht vor den Kunden.“ Im Hof der Karawanserei herrschte das übliche frühabendliche Chaos. Mit den letzten Sonnenstrahlen drängten Händler, Kamele, Pferde, Diener und Waren durch das riesige eisenbeschlagene Holztor. In der Mitte stand Tutak, Hausdiener seit dreißig Jahren, und dirigierte das Durcheinander mit Armen, Beinen und Worten, bis alles in geordneten Bahnen lief.
Die Muslime legten ihre bunten Teppiche in dem Viertel des Hofes aus, wo sie am nächsten gen Mekka lagen. Die Christen lagerten schräg gegenüber. Zwischen ihnen die jüdischen Händler aus Europa und Asien, und das letzte Viertel war bunt gemischt. Aramäer, Inder, Griechen – alle, die sich nicht speziell einer Religion zugehörig fühlten und bestimmten Essensvorschriften folgen wollten. Nicht ganz dazu passte eine schwarze Gestalt, die sich auf einer Wolldecke niedergelassen hatte. Ein Mönch offensichtlich, mit einer weiten Kapuze, die sein Gesicht verdeckte.
Die Tiere waren in der Mitte des Hofes angepflockt, in der Nähe der Tränke. Eimer mit Futter waren vorbereitet. Ab und zu ging ein kleiner Junge mit einer Schaufel durch die Reihen und sammelte Pferdeäpfel und Kamelfladen auf. Waren sie getrocknet, wurde damit das Wachfeuer in der Nacht unterhalten.
Rund um den Hof liefen Arkaden, wo jedes „Viertel“ einen Trog mit Wasser zum Waschen fand. Tische und Bänke für das Essen waren vorbereitet, die Küchen lagen hinter den Arkaden im kühlen Gebäude. Es duftete bereits nach Lammbraten mit Pflaumen, nach Wildschweinkeule und nach Kräutersuppe.
„Also, was soll das?“ wiederholte Manuel aufgebracht.
„Beruhige dich, beruhige dich. Ich wollte einfach nur auf dem Laufenden sein. Wir sollten doch genauso viel zur gleichen Zeit wissen, wie unsere kluge Schwester. Schließlich hat sie versucht, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Nicht wir.“
„Trotzdem. Ich finde das schäbig.“
„Du hättest vielleicht recht, wenn mein schwarzer Freund da draußen, wirklich nur mit den Nachrichten der ersten Tage zurück gekommen wäre: Büchereinkäufe, Essen mit der Tante, Synagoge mit der Tante, Büchereinkäufe, Essen mit der Tante, Stoffekaufen mit der Tante, Shabbes mit der Tante, Bücher, Spaziergang mit der Tante.“
„Was soll das? Machst Du dich lustig über mich?"
„Nein, mein Lieber. Schau dir das an!“
Amin zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Tasche seines Kaftans. „So eines hat sie bei einem Spezialhändler für Papiere und Pergamente erstanden.“
Manuel starrte verwirrt auf das Blatt Papier. Amin faltete es auseinander und hielt es seinem Bruder genau vors Gesicht.
„Na, und. Es ist leer. Blank.“
„Fast.“ Amin schob eine brennende Kerze auf dem Tisch zu sich heran und hielt das Papier gegen die Flamme. „Siehst Du es jetzt?“ Ein Wasserzeichen wurde sichtbar.
„CMB“, murmelte Manuel überrascht.
„Und weißt du, woher das Papier kommt? Von einem See in Deutschland, den sie Bodensee nennen.“
„Wir können unsere Augsburger Bankiers fragen, wo der liegt.“
„Ja, Tutak kann zum Gesandten der Fuggers beim italienischen Turm gehen. Und der Mönch hat einen Mitbruder in Jerusalem, der weiter auf unsere Schwester achtet."
„Woher hat sie das gewusst?“, fragte Manuel nachdenklich. Die Antwort würde er erst viele Jahre später erfahren. Ein steinernes Dröhnen erfüllte die Luft, der Boden zitterte und bebte unter ihnen, das Haus schwankte, knirschte, ächzte. Die Brüder stürzten ins Freie, und hinter ihnen brach die Karawanserei in tausend Stücke.
Jerusalem
Ein anderes Beben erschütterte Jerusalem.
Es war Karfreitag. Tausende von Pilgern schoben sich durch die enge Via Dolorosa, fielen immer wieder auf die Knie, beteten laut in vielen Sprachen. An Station II, „Jesus nimmt das Kreuz auf sich“, hatten sich Ordensleute aus Spanien und Italien versammelt. Man sah die schwarz-weiße Tracht der Dominikaner, das Braun der Franziskaner, das Schwarz der Benediktiner. Sie führten Gruppen von einfachen Gläubigen an, die Kutten aus Sackleinen angelegt hatten und schwere Kreuze schulterten. Schwerfällig schwankten sie vorwärts, gestützt von der Masse der Pilger rechts und links. An Station III ließen sie sich zu Boden fallen, begleitet von den Gebeten der Mönche. Einer las mit lauter Stimme aus der Passionsgeschichte: „Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes“. Ein Seufzen und Stöhnen ging durch die Menge.
Helena fand das Karfreitags-Schauspiel schaurig. Es erinnerte sie an die Geschichten ihres Vaters aus Spanien, der ihr die Prozessionen in Córdoba und Toledo geschildert hatte. Semana Santa – da floss Blut, weil die Menschen sich geißelten, wie Jesus gegeißelt worden war. Der Jude war von seinen jüdischen Mitbürgern gefoltert worden. Es war schon in Spanien ein gefährlicher Tag für Juden gewesen. Man blieb lieber zu Hause, um niemanden zu provozieren. Juden, Christusmörder! Das schrie sich gut, das schrieb sich gut an Mauern und wenn man einen zu fassen bekam, um so besser.
Und das war in Spanien geschehen, wo doch Muslime, Christen und Juden angeblich so vorbildlich zusammen gelebt hatten.
Wie gefährlich war es erst in Jerusalem? Helena hatte nicht darüber nachgedacht. Sie hatte sich mit Idris, einem geschätzten arabischen Kalligraphen, im Hof der Omaryie-Schule getroffen und ihm das Papier mit dem Wasserzeichen gezeigt. Er hatte es gegen die Sonne hin und her gewendet. „Dein Freund, der Papierhändler weiß nur, dass er es von deutschen Mönchen gekauft hat, die am Bodensee mehrere Klöster haben.“
„Aber dann weiß er doch sehr viel“, meinte Idris. „Was willst Du mehr?“ „Ich möchte wissen, was die Buchstabe bedeuten.“
„Du meine Güte, das kann alles bedeuten: Es können die Initialen des Besitzers der Papiermühle sein, oder seiner Schutzheiligen.“
„Oder seiner Töchter, die er zufällig Caterina, Margareta und Barbara genannt hat oder der Drei Heiligen Könige.“
„Eben.“ Idris breitete hilflos seine Arme aus. „Ich habe auch nicht mehr Anhaltspunkte.“
Enttäuscht faltete Helena ihr Musterpapier wieder zusammen. Der Orangenbaum, unter dem sie saßen, malte zarte Schatten darauf. „Ich kann Dir lediglich raten, wo Du weiter fragen kannst.“ Idris strich sich über den feinen, kurz geschnittenen Bart.
„Wenn es um die Heiligen Drei Könige gehen sollte, dann wende Dich an die Abessinier oben auf der Grabeskirche.“ „Wenn es um die Deutschen geht, dann geh zum Johanniter-Hospiz. Es gehört zwar Engländern, aber in der Karwoche beherbergen sie immer viele Gäste aus anderen Ländern.“
„Danke, Idris. Das mache ich sofort.“ Beide Orte lagen nur wenige Schritte entfernt. Helena wollte sich verabschieden. Da drangen von außen laute Schreie in den friedlichen Hof der Koranschule. „Kreuzige ihn, kreuzige ihn.“
Erschrocken sah Idris nach der Sonne. „Helena, es ist die dritte Stunde. Sie beginnen da draußen ihre Prozession mit dem Urteil des Pontius Pilatus und dem Geschrei des jüdischen Mobs, der Jesus am Kreuze sehen wollte. Geh da jetzt nicht durch. Du könntest für den Tod des einen Juden büßen müssen.“
„Woran sollten sie denn sehen, dass ich Jüdin bin? Das merkt doch keiner.“ Entschlossen reichte sie Idris die Hand.“
„Und außerdem ist keiner von denen, die du fragen könntest, jetzt zu Hause. Sie beten in der Via Dolorosa oder in den Kirchen.“
Helena überlegte kurz. Da war was dran. Sie musste in zwei Stunden wieder kommen, wenn Grabesstille herrschte, Totenruhe bis zum Ostersonntag. Wenn alle sich zurück gezogen haben würden in ihre Häuser, Zimmer und Zellen, dann würde sie die antreffen, die sie fragen könnte.
„Komm“, sagte Idris, „ wir gehen zusammen so lange zu einem Freund und trinken Tee. Bis dahin werden wir es schon schaffen.“ Er nahm Helena am Arm und schob sich mit ihr an den Hausmauern entlang, seitlich an der endlosen Schlange der Pilger vorbei, bis sie die Armenische Kirche erreicht hatten.
„Bleib hier im Eingang stehen“, hatte Idris gesagt, „ich sehe nur eben nach, ob er hier drin ist. Mein Freund ist hier Hausmeister. Aber normalerweise schicken sie das muslimische Personal am Feiertag nach Hause.“
Helena lehnte an der sonnengewärmten Wand und dachte an ihre Vorfahren in Spanien, für die der Karfreitag immer ein schwarzer Freitag gewesen war.
Ein ohrenbetäubender Knall zerriss die dichte Klangwolke der Gebete, die sich in der engen Gasse gefangen hatte. Noch einer, und noch einer. Es wurde geschossen. Instinktiv schob sich Helena eng an die Mauer gedrückt auf die Portal-Nische der Kirche zu. Aber sie kam nicht weit. Panik verwandelte die enge Gasse in einen Hexenkessel. Die Masse der Pilger versuchte irgendwohin zu fliehen und verknäulte sich dabei in ein unentwirrbares Chaos. Nach vorne, wer noch laufen konnte, nach unten wer hinfiel, nach oben, wer auf Mauern und Fenstersimse klettern konnte, nach hinten, wer von Schüssen oder Fäusten getroffen wurde. Durch die Menge kämpften sich schwarze Gestalten, die lange Umhänge trugen und Wollmützen über das Gesicht gezogen hatten, die nur Mund, Nase und Augen frei ließen. Sie schossen wahllos in die Prozession, warfen Steine nach den Mönchen, rissen die Pilger an den Haaren zu Boden, traten mit ihren Stiefeln auf ihre Köpfe ein. Eine Gruppe der flüchtenden Pilger hatte den Eingang zur armenischen Kirche entdeckt und rannte auf Helena zu. Sie würden sie einfach umreißen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und wenn die Schwarzen ihnen folgten, dann würden sie keinen Unterschied machen. Helena rutschte an der Mauer zu Boden, um sich möglichst klein zu machen und wollte ihren Kopf mit den Armen schützen. Da riss sie plötzlich jemand an einem Arm nach oben. „Komm, schnell.“
Idris zerrte sie um die Ecke durch eine kleine Tür ins Innere der Kirche. Sie hörten, wie die verzweifelten Pilger versuchten, sich schreiend durch das Haupttor zu drängen. Viel zu viele auf einmal, nur die allerersten würden es schaffen. Aber schon riss Idris Helena weiter vorwärts, hinter dem Altar entlang, in einen Gang hinein, eine Treppe hinunter. Das Geschrei wurde leiser. Sie mussten jetzt unter der Gasse sein. Idris ließ sie los und blieb kurz stehen, um wieder zu Atem zu kommen. „Was bedeutet das alle, wo sind wir?“, fragte Helena. Sie zitterte am ganzen Leib.
„Es sind die Jungen Muslime. Sie haben den Christen Rache geschworen, weil sie ihnen Jerusalem wegnehmen.“
„Wieso wegnehmen, Jerusalem gehört doch allen.“ „Ja, aber immer den einen etwas mehr als den anderen. Mehr den Christen und mehr den Juden. Für uns bleibt fast nichts. Aber komm jetzt.“
Idris ging vor Helena einen dunklen Gang entlang, an wenigen Stellen erleuchtet durch Tageslicht, das durch winzige Scharten fiel. Rechts und links waren Nischen in die Wände eingelassen für Särge. Eine geheime Grabkammer, wie es so viele in Jerusalem gab. Hier versteckten die ersten Christen ihre Toten vor den Römern. Am Ende des Ganges drang ein wunderbarer Duft zu ihnen, nach Brot und Kuchen. Eine zweite Treppe führte wieder hinauf, und tatsächlich standen sie mitten in einer Bäckerei. Verwirrt starrte Helena auf die Bleche, auf denen sich Pistazien- und Mandelplätzchen stapelten. Ein Lehrling holte gerade ein großes Blech mit weißen Hefebroten aus dem Ofen.
„Danke, Idris“, sagte Helena. „Vielen Dank.“ Idris nickte. „Das war knapp.“ Der Bäcker, ein Jude namens David, begrüßte sie und bot ihnen Gebäck an. „Zucker beruhigt die Nerven“, meinte er. Es sind schon alle Arten von Flüchtlingen hier durchgekommen, und es hat immer geklappt.“ Sogar einen süßen starken Tee gab es dazu. „Warum hört man gar nichts von der Straße?“, frage Helena. „Weil wir hier im Backraum sind, und der liegt etwas unter dem Niveau der Via Dolorosa. Das war nicht immer eine Bäckerei, sondern lange eine Art geheime Herberge. Deswegen liegt zwischen uns und dem Laden vorne auch noch ein ganzes Labyrinth an Gängen, Stufen und Treppen.