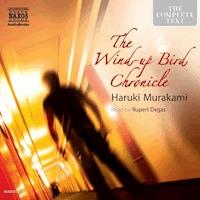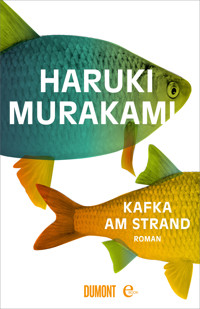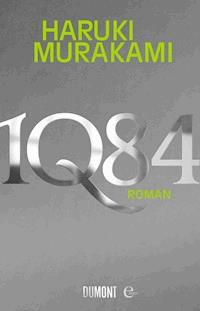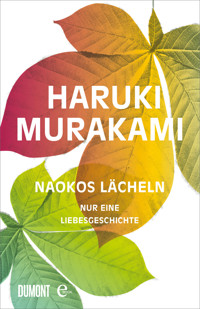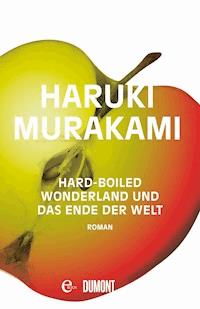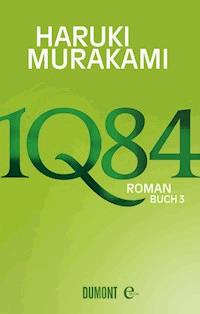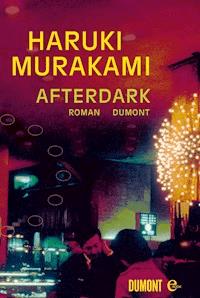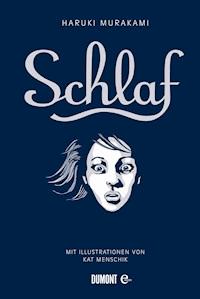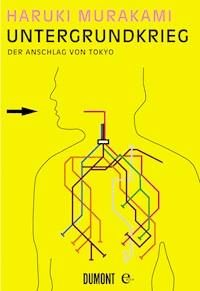9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Murakamis Rekordbestseller – ein Epos um Freundschaft, Einsamkeit und Schuld! Der junge Tsukuru Tazaki ist Teil einer Clique von fünf Freunden, deren Mitglieder alle eine Farbe im Namen tragen. Nur Tsukuru fällt aus dem Rahmen und empfindet sich – auch im übertragenen Sinne – als farblos, denn anders als seine Freunde hat er keine besonderen Eigenheiten oder Vorlieben, ausgenommen vielleicht ein vages Interesse für Bahnhöfe. Als er nach der Oberschule die gemeinsame Heimatstadt Nagoya verlässt, um in Tokio zu studieren, tut dies der Freundschaft keinen Abbruch. Zumindest nicht bis zu jenem Sommertag, an dem Tsukuru voller Vorfreude auf die Ferien nach Nagoya zurückkehrt – und herausfindet, dass seine Freunde ihn plötzlich und unerklärlicherweise schneiden. Erfolglos versucht er wieder und wieder, sie zu erreichen, bis er schließlich einen Anruf erhält: Tsukuru solle sich in Zukunft von ihnen fernhalten, lautet die Botschaft, er wisse schon, warum. Verzweifelt kehrt Tsukuru nach Tokio zurück, wo er ein halbes Jahr am Rande des Suizids verbringt. Viele Jahre später offenbart sich der inzwischen 36-jährige Tsukuru seiner neuen Freundin Sara, die nicht glauben kann, dass er nie versucht hat, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Von ihr ermutigt, macht Tsukuru sich auf, um sich den Dämonen seiner Vergangenheit zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tsukuru Tazaki blickt im Alter von 36 Jahren auf ein entgleistes Leben zurück. Freunde, Heimat, Liebe sind nur leere Worte für ihn. Seine Mitmenschen bleiben ihm fremd, allenfalls für Bahnhöfe und Züge bringt er ein vages Interesse auf. Als er Sara kennenlernt, die in einem Reisebüro arbeitet, öffnet er sich zum ersten Mal seit langem einer anderen Person. Die Geschichte, die Tsukuru ihr erzählt, ist die Geschichte eines Verstoßenen. Sie handelt von Geborgenheit und Grausamkeit, Vertrauen und Verrat. Sara ist erschüttert. Wenn ihre Beziehung eine Chance haben soll, beschwört sie ihn, dann muss er sich auf eine Reise in seine Vergangenheit begeben, auf die Suche nach dem Ursprung einer Wunde, die niemals verheilte, und vier Farben, die sie ihm zugefügt haben. »Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki« folgt einem Mann ohne Leidenschaften bei dem Versuch, sein verlorenes Leben zurückzuerobern. Der japanische Rekord-Bestseller, der mit der höchsten Erstauflage aller Zeiten startete und sich bereits in der ersten Woche über eine Million Mal verkaufte, ist ein monumentaler Roman über Freundschaft und Liebe, Schmerz und Schuld.
Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im DuMont Buchverlag.
HARUKI MURAKAMI
DIE PILGERJAHRE DES FARBLOSEN HERRN TAZAKI
Roman
Aus dem Japanischen
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
›Shikisai wo motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi‹
bei Bungeishunjū, Tokio
© 2013 Haruki Murakami
eBook 2014
© 2014 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ursula Gräfe
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Johner
Autorenfoto: © Markus Tedeskino
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8773-6
www.dumont-buchverlag.de
1
Vom Juli seines zweiten Jahres an der Universität bis zum Januar des folgenden Jahres dachte Tsukuru Tazaki an nichts anderes als an den Tod. Er wurde in jenem Jahr zwanzig, was jedoch keinen nennenswerten Einschnitt für ihn bedeutete, denn zu der Zeit war ihm der Gedanke, sich das Leben zu nehmen, der nächste und natürlichste. Bis heute wusste er nicht, warum er den letzten Schritt nie vollzogen hatte. Denn die Schwelle vom Leben zum Tod zu überschreiten wäre damals so leicht für ihn gewesen, wie ein rohes Ei zu schlucken.
Vielleicht war seine Sehnsucht nach dem Tod zu wahrhaftig und zu tief, um tatsächlich den Versuch zu machen, sich umzubringen. Zudem konnte er sich keine konkrete Todesart vorstellen. Auch wenn dieses Problem eher zweitrangig war. Hätte es in seiner Reichweite eine Tür gegeben, die direkt in den Tod führte, er hätte sie ohne Zögern aufgestoßen. Ohne zu überlegen, als natürliche Konsequenz. Doch glücklicher- oder unglücklicherweise konnte er eine solche Tür nicht finden.
Tsukuru Tazaki überlegte oft, ob er damals nicht besser gestorben wäre. Dann würde diese Welt nicht mehr existieren. Ein verlockender Gedanke. Ohne die Existenz dieser Welt wäre das, was jetzt als Realität erschien, keine Realität mehr. So wie die Welt für ihn nicht mehr existieren würde, würde auch er für die Welt nicht mehr existieren.
Zugleich konnte Tsukuru nie richtig begreifen, warum er damals dem Tod so nah gekommen war. Es hatte zwar einen konkreten Anlass gegeben, aber warum hatte das Verlangen zu sterben solche Macht über ihn gehabt und ihn fast ein halbes Jahr umfangen gehalten? Umfangen – ja, das war genau das richtige Wort. Wie dieser Mann in der Bibel, der von einem Wal verschlungen worden war und in dessen Bauch überlebt hatte, war Tsukuru in den Magen des Todes gestürzt und hatte Tag für Tag in dessen dunkler, dumpfer Höhle verbracht. Ohne jedes Zeitgefühl.
Er hatte gelebt wie ein Schlafwandler oder wie ein Toter, der noch nicht gemerkt hatte, dass er tot war. Wenn es Morgen wurde, stand er auf, putzte sich die Zähne, zog sich irgendwelche Sachen an, fuhr mit der Bahn zur Universität und schrieb bei den Vorlesungen mit. Er bewegte sich mittels dieses Zeitplans vorwärts, wie jemand, der von einem Orkan überfallen wird, sich von einer Straßenlaterne zur nächsten hangelt. Er sprach mit niemandem, wenn es nicht sein musste, und sobald er zurück in seiner Wohnung war, setzte er sich auf den Boden und lehnte sich an die Wand, um seine Gedanken um den Tod oder die Abwesenheit von Leben kreisen zu lassen. Und gähnend tat sich vor ihm der schwarze Schlund der Verzweiflung auf, der bis in die Tiefen der Erde reichte. Er sah ein wirbelndes, sich zu einer festen Wolke verdichtendes Nichts, während drückende Stille auf seinem Trommelfell lastete.
Wenn Tsukuru nicht an den Tod dachte, dachte er an gar nichts. Was ihm nicht sonderlich schwer fiel. Er las keine Zeitung, er hörte keine Musik, Appetit hatte er auch keinen. Nichts, was auf der Welt geschah, war für ihn von Bedeutung. Hatte er keine Lust mehr, in der Wohnung zu sitzen, schlenderte er ziellos durch die Nachbarschaft. Oder er ging zum Bahnhof, setzte sich auf eine Bank und beobachtete endlos das Ankommen und Abfahren der Züge.
Jeden Morgen duschte er und wusch sich die Haare. Zweimal in der Woche machte er die Wäsche. Auch Reinlichkeit war einer der Pfeiler, an denen er sich festhielt. Wäsche waschen, baden, Zähne putzen. Auf seine Ernährung achtete er allerdings kaum. Mittags aß er in der Mensa, davon abgesehen nahm er nur wenig zu sich. Gegen den Hunger kaufte er in einem nahe gelegenen Supermarkt ein paar Äpfel und etwas Gemüse. Mitunter biss er einfach in einen Laib Brot und schüttete die Milch direkt aus der Packung in sich hinein. Vor dem Schlafengehen trank er – sozusagen als Medizin – ein kleines Glas Whisky. Glücklicherweise vertrug er nicht viel, sodass die geringe Menge zum Einschlafen ausreichte. Er träumte nie etwas. Jeder Traum glitt sofort, ohne Halt zu finden, den Abhang seines Bewusstseins hinunter ins Reich des Nichts.
Der Auslöser für die starke Anziehungskraft, die der Tod auf Tsukuru Tazaki ausübte, war eindeutig. Seine vier engsten Freunde hatten ihm eröffnet, dass sie ihn niemals wiedersehen oder mit ihm sprechen wollten. So unvermittelt wie erbarmungslos. Ohne ihm den Grund für ihr hartes Urteil mitzuteilen. Und er hatte nicht zu fragen gewagt.
Die fünf Freunde hatten gemeinsam eine staatliche Oberschule in einem Vorort von Nagoya besucht. Anschließend hatte Tsukuru seine Heimatstadt verlassen, um in Tokio zu studieren. Insofern hatte das Zerwürfnis keine peinlichen Auswirkungen auf seinen Alltag. Er brauchte nicht zu fürchten, ihnen zufällig auf der Straße zu begegnen. Aber das war bloße Theorie. Denn eigentlich verschärfte die räumliche Trennung Tsukurus Schmerz, und er litt umso mehr. Die Entfernung und seine Einsamkeit verbanden sich zu einem Kabel von mehreren Hundert Kilometern Länge, straff gespannt von einer gewaltigen Winde. Über diese Leitung erreichten ihn Tag und Nacht komplizierte Botschaften. Sirrend und mit wechselnder Intensität wie das scharfe Pfeifen des Windes, der durch Bäume fegt, bohrten sie sich in seine Ohren.
Die drei Jungen und die beiden Mädchen hatten sich in der zehnten Klasse eher zufällig zusammengefunden, waren aber bis zum Ende der Schulzeit eine verschworene Gruppe geblieben. Als Hausaufgabe für Sozialkunde hatten in den Sommerferien mehrere Projekte zur Auswahl gestanden, unter anderem die Betreuung von Grundschülern, die im Unterricht nicht gut mitkamen. Die fünf waren die Einzigen aus ihrer Klasse von fünfunddreißig, die sich für dieses von einer katholischen Einrichtung ins Leben gerufene Projekt entschieden und an dem dreitägigen Sommerlager vor den Toren der Stadt Nagoya teilnahmen. Die Kinder wuchsen ihnen so sehr ans Herz, dass sie die Arbeit später aus eigenem Antrieb fortsetzten.
In ihrer Freizeit unternahmen sie Wanderungen, spielten Tennis, fuhren auf die Halbinsel Chita zum Baden oder trafen sich bei jemandem zu Hause, um zu lernen. Oder (was am häufigsten vorkam) sie steckten irgendwo die Köpfe zusammen und redeten endlos. Sie hatten keine bestimmten Themen, aber der Gesprächsstoff ging ihnen nie aus.
Bei den freimütigen Gesprächen, die sie in den Arbeitspausen führten, stellte sich heraus, dass die fünf charakterlich und in ihren Ansichten gut zusammenpassten. Sie vertrauten einander ihre Hoffnungen und Probleme an. Nach dem Sommerlager hatten alle fünf das Gefühl, genau am rechten Ort zu sein und wahre Freunde gefunden zu haben. Die jeweils anderen vier zu brauchen und von ihnen gebraucht zu werden gab ihnen das Gefühl ausgewogener Freundschaft. Es war wie bei einer zufälligen, aber gelungenen chemischen Verbindung. Selbst bei Verwendung der exakt gleichen Inhaltsstoffe würde kaum noch einmal das gleiche Ergebnis zustande kommen.
Auch nach den Ferien arbeiteten die Freunde noch an zwei Wochenenden im Monat mit den Kindern, lernten, lasen und trieben Sport mit ihnen. Außerdem halfen sie im Garten und beim Anstreichen des Gebäudes oder reparierten Spielgerät. So führten sie das Projekt etwa zweieinhalb Jahre bis zu ihrem Schulabschluss weiter.
Allerdings beinhaltete die Zusammensetzung der Gruppe von Anfang an ein gewisses Spannungsverhältnis. Hätten sich zwei Paare gebildet, wäre einer zwangsläufig zum fünften Rad am Wagen geworden. Diese Möglichkeit schwebte wie eine feste, kleine Lenticulariswolke ständig über ihnen. Dennoch kam es nie dazu, und es gab auch keine Anzeichen, dass es je dazu kommen würde.
Ich weiß nicht, ob man es einen Zufall nennen kann, aber alle fünf stammten aus der oberen Mittelschicht und wohnten am Stadtrand. Ihre Eltern gehörten zu den sogenannten geburtenstarken Jahrgängen, und die Väter waren entweder selbstständig oder in namhaften Firmen angestellt. An der Ausbildung der Kinder wurde nicht gespart. Die Familienverhältnisse wirkten zumindest nach außen hin geordnet, Eltern, die geschieden waren, gab es nicht, und die Mütter waren meist zu Hause. Da die Schule eine Aufnahmeprüfung verlangte, war der allgemeine Notendurchschnitt recht hoch. Die Lebensumstände der fünf Freunde wiesen also mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf.
Allerdings hatten die anderen vier eine weitere zufällige Gemeinsamkeit, die Tsukuru Tazaki als Einziger nicht teilte. In jedem ihrer Nachnamen kam eine Farbe vor. Die beiden Jungen hießen Akamatsu – Rotkiefer – und Oumi – blaues Meer. Die beiden Mädchen Shirane – weiße Wurzel – und Kurono – schwarzes Feld. Nur der Name Tazaki beinhaltete keine Farbe, und Tsukuru fühlte sich deshalb von Anfang an ein wenig ausgeschlossen. Natürlich war es keine Frage des Charakters, ob jemand eine Farbe in seinem Namen hatte oder nicht. Das wusste er schon. Aber er fand es doch schade, und zu seinem eigenen Erstaunen kränkte es ihn sogar etwas. Die vier anderen nannten einander natürlich sofort nach ihren Farben: Aka, Ao, Shiro und Kuro. Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Nur er blieb weiterhin bloß Tsukuru. Immer wieder überlegte er, wie schön es gewesen wäre, wenn auch er eine Farbe in seinem Namen gehabt hätte. Dann wäre alles perfekt gewesen.
Aka war ein hervorragender Schüler mit ausgezeichneten Noten. Obwohl er nie besonders viel lernte, gehörte er in allen Fächern zu den Besten. Aber er bildete sich nichts darauf ein, sondern achtete immer sehr darauf, sich nicht vorzudrängen. Als würde er sich für seinen überragenden Intellekt schämen. Doch wie man es bei kleinen Menschen häufig findet (er war nicht größer als einen Meter sechzig), neigte er dazu, keinesfalls nachzugeben, wenn er sich einmal zu etwas entschlossen hatte, und war es noch so nebensächlich. Es kam häufig vor, dass er wegen unsinniger Vorschriften oder Kompetenzfragen ernsthaft wütend auf einen Lehrer wurde. Er verlor nicht gern und reagierte beleidigt, wenn er im Tennis geschlagen wurde. Auch wenn man ihn nicht gerade einen schlechten Verlierer nennen konnte, wurde klar, dass er eingeschnappt war. Die anderen lachten über seine Reizbarkeit und zogen ihn damit auf. Bis Aka zum Schluss selber lachen musste. Sein Vater hatte eine Professur für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Nagoya.
Ao war Stürmer in einer Rugby-Mannschaft und verfügte über eine beneidenswerte Konstitution. In der zwölften Klasse wurde er Kapitän seiner Mannschaft. Er hatte breite Schultern und einen massigen Brustkorb, eine ausgeprägte Stirn, einen großen Mund und eine kräftige, fleischige Nase. Er war ein aggressiver Spieler und hatte ständig Verletzungen. In der Schule war er nicht gerade fleißig, aber er hatte ein heiteres Gemüt, und viele mochten ihn. Er sah den Menschen gerade in die Augen und sprach mit lauter, fester Stimme. Er verfügte über einen erstaunlichen Appetit, und ihm schien alles hervorragend zu schmecken. Er redete nie schlecht über andere und konnte sich Namen und Gesichter auf Anhieb merken. Er war ein guter Zuhörer, und andere zu motivieren war seine Stärke. Tsukuru konnte sich noch erinnern, wie Ao vor jedem Rugby-Match mit seinen Spielern einen Kreis bildete und sie anfeuerte.
»Auf geht’s, wir gewinnen!«, schrie er. »Niederlage kommt nicht infrage!« Das war sein Schlachtruf.
»Niederlage kommt nicht infrage!«, antworteten die Spieler und stürmten aufs Feld.
Dennoch war sein Rugby-Team nicht besonders erfolgreich. Er selbst war ein taktisch geschickter, sehr athletischer Spieler, aber seine Mannschaft war nur mittelmäßig. Nicht selten wurde sie von den Teams der privaten Oberschulen geschlagen, die durch ihre Stipendien die besten Spieler des Landes auf sich vereinigen konnten. Doch am Ende eines Spiels machte Ao sich nicht viel daraus, ob sie gewonnen oder verloren hatten. »Das Wichtigste ist der Wille zum Sieg«, pflegte er zu sagen. »Im richtigen Leben kann man auch nicht immer gewinnen. Manchmal gewinnt man, und manchmal verliert man eben.«
»Und manchmal fällt das Spiel wegen Regen aus«, sagte Kuro, die einen Hang zur Ironie hatte.
Ao schüttelte mitleidig den Kopf. »Du verwechselst Rugby mit Tennis oder Baseball. Rugby fällt nie wegen Regen aus.«
»Ihr spielt auch, wenn es regnet?«, sagte Shiro erstaunt. Sie interessierte sich gar nicht für Sport und hatte keine Ahnung.
»Ja, natürlich«, schaltete sich Aka ein. »Rugby-Spiele werden nie unterbrochen, auch wenn es noch so schüttet. Deshalb ertrinken auch jedes Jahr so viele Spieler bei den Turnieren.«
»Wie schrecklich!«, rief Shiro.
»Dummerchen, merkst du nicht, dass er dich auf den Arm nimmt?«, sagte Kuro entnervt.
»Wir schweifen ab«, sagte Ao. »Ich will nur sagen, dass verlieren zu können auch eine Fähigkeit ist.«
»Und du bemühst dich, sie jeden Tag zu üben«, sagte Kuro.
Shiro hatte die schönen Züge klassischer japanischer Schönheiten und war groß und schlank. Sie hatte eine Figur wie ein Model und langes tiefschwarz glänzendes Haar. Viele drehten sich im Vorübergehen unwillkürlich nach ihr um. Allerdings schien ihre Schönheit sie selbst etwas zu überfordern. Shiro war ein ernstes, schüchternes Mädchen und konnte mit der Aufmerksamkeit anderer nicht gut umgehen. Sie spielte sehr gut Klavier, hatte aber Hemmungen, es vor Fremden zu tun. Richtig glücklich wirkte sie nur, wenn sie den Kindern aus dem Projekt Klavierunterricht gab. Niemals sonst hatte Tsukuru sie so entspannt und heiter gesehen. Einige Kinder hätten eine natürliche musikalische Begabung, sagte sie, die aber im normalen Unterricht nicht zum Vorschein komme, und es sei schade, wenn sie verborgen bliebe. Die Schule besaß jedoch nur ein äußerst antiquiertes Klavier. Also starteten die fünf eine Spenden- und Sammelaktion für ein neues Klavier und suchten sich Jobs für die Ferien. Und in der zwölften Klasse im Frühjahr waren ihre Bemühungen dann von Erfolg gekrönt, und es gelang ihnen, einen Flügel zu erwerben. Schließlich berichtete sogar eine Zeitung über ihr Projekt.
Shiro war für gewöhnlich still. Aber sie war sehr tierlieb, und wenn das Gespräch auf Hunde oder Katzen kam, taute sie auf und wurde ganz redselig. Sie träumte davon, Tierärztin zu werden, doch Tsukuru konnte sich einfach nicht vorstellen, wie sie einem Labrador mit dem Skalpell den Bauch aufschnitt oder ihren Arm in den Anus eines Pferdes steckte. Shiros Vater hatte eine gynäkologische Praxis in Nagoya.
Kuro sah kaum besser aus als der Durchschnitt. Doch ihre lebhafte Ausstrahlung verlieh ihr einen besonderen Charme. Sie war groß und füllig und hatte schon mit sechzehn einen üppigen Busen. Sie war sehr unabhängig und hatte eine starke Persönlichkeit. Sie dachte und sprach schnell. In den geisteswissenschaftlichen Fächern waren ihre Noten exzellent, aber in Mathematik und Physik leider grauenhaft. Ihr Vater war Steuerberater, aber sie war ihm nicht die geringste Hilfe. Und Tsukuru musste ihr oft bei den Hausaufgaben in Mathematik zur Seite stehen. Kuro machte gern sarkastische Bemerkungen, sie hatte einen einmaligen Sinn für Humor, und eine Unterhaltung mit ihr war immer lustig und anregend. Sie war eine unermüdliche Leserin und hatte ständig ein Buch in der Hand.
Shiro und Kuro waren seit dem siebten Schuljahr in einer Klasse, kannten sich also schon lange, bevor die fünf eine Clique geworden waren. Zusammen gaben die beiden ein hübsches Bild ab: die schüchterne, musisch begabte Schöne und die witzige, scharfsinnige Zynikerin. Ein unverwechselbares und faszinierendes Duo.
Tsukuru Tazaki war der Einzige in der Gruppe, der über keine besonderen individuellen Eigenschaften oder Talente verfügte. Seine Noten lagen im oberen Durchschnitt. Er hatte kein großes Interesse am Lernen, aber da er dem Unterricht aufmerksam folgte, kam er mit einem Minimum an Vor- und Nachbereitung aus. Das hatte er sich schon in seiner Kindheit angewöhnt. Wie das Händewaschen vor dem Essen und das Zähneputzen danach. Daher kam er in allen Fächern, auch wenn seine Noten nicht aufsehenerregend waren, ohne größeren Aufwand gut mit. Solange es keine Probleme gab, machten seine Eltern kein übermäßiges Wesen um seine Noten und verschonten ihn mit Nachhilfestunden und Ähnlichem.
Er hatte nichts gegen Sport, aber er trat keinem Verein bei. Allerdings spielte er mit Verwandten oder Freunden Tennis, lief Ski oder ging schwimmen. Er hatte regelmäßige Gesichtszüge und bekam das auch manchmal von Leuten gesagt, was im Grunde heißen sollte, dass er »nicht so schlecht« aussah. Er selbst fand sein Spiegelbild immer wieder langweilig und nichtssagend. Er hatte kein Interesse an Kunst und keine nennenswerten Fähigkeiten oder Hobbys. Er sprach langsam, errötete häufig, war ungewandt im gesellschaftlichen Umgang und aufgeregt, wenn er jemandem zum ersten Mal begegnete.
Seine hervorstechende Eigenschaft, wenn man es so nennen wollte, bestand darin, dass seine Familie die wohlhabendste war. Seine Großmutter mütterlicherseits war eine zumindest regional recht berühmte Schauspielerin gewesen. Tsukuru hatte jedenfalls keine besondere Begabung, auf die er stolz sein oder mit er sich vor anderen hervortun konnte. Zumindest fand er das. Er war in allem mittelmäßig. Oder farblos.
Es gab nur eine Sache, die man vielleicht als sein Hobby hätte bezeichnen können. Tsukuru Tazaki liebte es über alles, sich Bahnhöfe anzuschauen. Warum, wusste er nicht, aber sie faszinierten ihn, seit er denken konnte. Riesige Bahnhöfe mit Hochgeschwindigkeitszügen ebenso wie kleine ländliche mit nur einem Gleis oder Güterbahnhöfe. Alles, was mit Bahnhöfen zu tun hatte, zog ihn unwiderstehlich an.
Als Kind hatten ihn wie alle Jungen Modelleisenbahnen begeistert, aber seine wahre Vorliebe galt weder den perfekt nachgebauten Lokomotiven und Waggons noch den komplizierten Gleisstellungen noch der ausgeklügelten Planung der Anlage, sondern den ganz normalen kleinen Modellbahnhöfen. Es faszinierte ihn, zuzusehen, wie die Züge diese Bahnhöfe passierten oder allmählich ihre Geschwindigkeit drosselten, um dann exakt am Gleis zu halten. Er stellte sich das Kommen und Gehen der Fahrgäste vor, hörte die Durchsagen und die Signale beim Abfahren der Züge und sah die energischen Gesten der Bahnbeamten vor sich. Realität und Fantasie vermischten sich in seinem Kopf, bis er beinahe vor Aufregung zitterte. Warum Bahnhöfe ihn in solche Begeisterung versetzten, konnte er niemandem erklären. Und selbst wenn, hätte man ihn ohnehin nur für ein sehr seltsames Kind gehalten. Mitunter fand Tsukuru ja sogar selbst, dass mit ihm einiges nicht stimmte.
Obwohl er keine besonderen Eigenschaften besaß und die Neigung hatte, stets am liebsten den mittleren Weg einzuschlagen, schien er sich von den Menschen um ihn herum zu unterscheiden. Er hatte etwas an sich, das nicht als normal zu bezeichnen war. Diese widersprüchliche Erkenntnis seiner selbst hatte ihn von Jugend an verwirrt. Nun war er sechsunddreißig, und sie tat es noch immer. Manchmal mehr, manchmal weniger.
Mitunter fragte Tsukuru sich, warum er überhaupt in die Clique aufgenommen worden war. Wozu konkret brauchten ihn die anderen? Wären die vier ohne ihn nicht vielleicht sogar unbeschwerter gewesen? Oder hatten sie es nur noch nicht bemerkt? Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis es ihnen bewusst wurde. Je mehr Tsukuru darüber nachdachte, desto weniger verstand er es. Den eigenen Wert bemessen zu wollen ähnelte dem Versuch, eine Substanz zu wiegen, für die es keine Maßeinheit gab. Wo sollte da der Zeiger einrasten?
Er schien jedoch der Einzige zu sein, den diese Frage beschäftigte. Denn es war ganz offensichtlich, dass es den anderen Spaß machte, ihn dabeizuhaben. Für ihre Unternehmungen mussten sie eben genau fünf sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ebenso wie ein Pentagon erst durch fünf gleich lange Seiten entsteht. Es war ihren Gesichtern deutlich anzusehen.
Dann war Tsukuru Tazaki stolz und glücklich, ein unentbehrlicher Teil dieses Fünfecks zu sein. Er liebte seine vier Freunde und das Gefühl von Einigkeit, wenn er mit ihnen zusammen war. Wie junge Bäume Nährstoffe aus der Erde ziehen, erhielt Tsukuru die Nahrung, die er in der Pubertät brauchte, von seinen Freunden. Sie gab ihm die Kraft für sein Wachstum und war ein Wärmespeicher für Notzeiten in seinem Körper. Doch im Grunde seines Herzens lebte er ständig in der Furcht, irgendwann aus dieser vertrauten Gemeinschaft zu fallen oder ausgestoßen und allein zurückgelassen zu werden. Wie ein düsterer, unheilvoller Felsen bei Ebbe aus dem Meer auftaucht, stieg diese Angst immer wieder in ihm hoch.
»Du hast dich also schon, als du noch ganz klein warst, für Bahnhöfe interessiert«, sagte Sara Kimoto verwundert.
Tsukuru nickte unsicher. Er wollte nicht, dass sie ihn für einen eigenbrötlerischen Fachidioten hielt, der ständig wieder von seiner Arbeit und seinem Ingenieurstudium anfing. Aber im Grunde war es ja wirklich so. »Ja, schon als Kind«, gab er zu.
»Hört sich nach einem ziemlich konsequenten Lebensweg an.« Sie sagte es amüsiert, aber ohne negativen Unterton.
»Ich kann nicht erklären, warum es ausgerechnet Bahnhöfe sein müssen.«
Sara lächelte. »Das ist sicher eine Berufung.«
»Mag sein«, sagte Tsukuru.
Wie waren sie überhaupt auf dieses Thema gekommen? Was damals passiert war, lag schon so lange zurück, und er hätte es am liebsten ganz aus seinem Gedächtnis getilgt. Aus irgendeinem Grund bestand Sara darauf, mehr über seine Schulzeit erfahren zu wollen. Wie er als Schüler gewesen sei und was er gemacht habe. Und ehe er sichs versah, hatte er im Eifer des Gefechts von seinen Freunden erzählt. Den farbigen vieren und dem farblosen Tsukuru Tazaki.
Die beiden saßen in einer kleinen Bar am Rand von Ebisu. Sie hatten eigentlich in ein kleines Lokal mit japanischen Spezialitäten gehen wollen, das Sara kannte, aber sie hatte keinen Appetit, da sie spät zu Mittag gegessen hatte. Also sagten sie die Reservierung ab und beschlossen, fürs Erste einen Cocktail zu nehmen und Käse und Nüsse dazu zu knabbern. Tsukuru hatte nichts dagegen einzuwenden, da er selbst nicht besonders hungrig war. Er war ohnehin kein großer Esser.
Sara war zwei Jahre älter als Tsukuru und in einem großen Reisebüro beschäftigt. Sie organisierte Gruppenreisen ins Ausland und flog deshalb häufig dienstlich nach Übersee. Tsukuru arbeitete bei einer Eisenbahngesellschaft. Seine Abteilung war für die Planung von Bahnhöfen (seine Berufung) im westlichen Kanto-Gebiet, also Tokio und Umgebung, zuständig. Zwar standen sie beruflich in keiner direkten Beziehung, aber da sie im weiteren Sinne etwas mit dem Transportwesen zu tun hatten, waren beide zu einer Einweihungsparty von einem von Tsukurus Vorgesetzten eingeladen worden. Sie hatten E-Mail-Adressen ausgetauscht und waren seither vier Mal miteinander aus gewesen. Beim dritten Mal waren sie nach dem Essen in seine Wohnung gegangen und hatten Sex gehabt. Alles hatte sich ganz natürlich ergeben. Das war vor einer Woche gewesen. Ein vielversprechender Verlauf. Wenn es so weiterging, würde sich vielleicht eine feste Beziehung zwischen den beiden entwickeln. Er war sechsunddreißig, sie achtunddreißig Jahre alt. Selbstverständlich war das etwas ganz anderes als eine Schülerliebe.
Von Anfang an übte Saras Gesicht eine seltsame Anziehungskraft auf Tsukuru aus, auch wenn sie nicht im herkömmlichen Sinne schön war. Ihre vorstehenden Wangenknochen gaben ihr ein etwas eigensinniges Aussehen, und ihre Nase war schmal und ein wenig spitz. Aber ihr Ausdruck war äußerst lebendig, und das zog ihn an. So weiteten ihre schmalen Augen sich bisweilen ganz plötzlich, wenn etwas ihr Interesse erregte, und zwei schwarze, von Neugier erfüllte Pupillen blitzten darin auf.
Tsukuru hatte an seinem Rücken eine außergewöhnlich empfindsame Stelle. Sie war unsichtbar, diese wundersam weiche und verborgene Stelle, die er selbst nicht berühren konnte. Aber wenn er es am wenigsten erwartete, machte sie sich plötzlich bemerkbar, als würde jemand mit dem Finger darauf drücken. In solchen Momenten wurde in seinem Inneren eine Substanz freigesetzt und über die Blutbahn in jeden Winkel seines Körpers transportiert, die ihn zugleich körperlich und geistig erregte.
Als er Sara das erste Mal begegnet war, hatte er das Gefühl gehabt, dass sich unsichtbare Finger mit aller Kraft auf diese Stelle pressten. An jenem ersten Abend hatten die beiden sich ziemlich lange unterhalten, aber er wusste nicht mehr, worüber. Das Einzige, woran er sich erinnerte, war die plötzliche Empfindung am Rücken und die erstaunliche, kaum zu beschreibende Erregung, die seinen Körper und Geist ergriffen hatte. Er fühlte sich einerseits gelöst, andererseits angespannt. Tsukuru Tazaki dachte mehrere Tage lang darüber nach, was das wohl zu bedeuten hatte. Aber über abstrakte Dinge nachzudenken war nie seine Stärke gewesen. Also schickte er Sara eine Mail und lud sie zum Essen ein. Um zu erkunden, was diese Gefühle und diese Erregung bedeuteten.
Ebenso sehr wie Saras Aussehen gefiel ihm die Art, wie sie sich kleidete. Ihre Sachen waren schlicht und schön geschnitten. Und sie fühlte sich offensichtlich wohl darin. Der Gesamteindruck war unauffällig, aber er konnte sich gut vorstellen, dass die Auswahl ihrer Garderobe sie ziemlich viel Zeit und ein erhebliches Maß an Überlegung kostete. Der passende Schmuck und ihr Make-up waren elegant und dezent. Auf seine eigene Kleidung legte Tsukuru keinen besonderen Wert, aber es hatte ihm schon immer gefallen, wenn eine Frau gut angezogen war. Er wusste es zu schätzen wie schöne Musik.
Seine beiden älteren Schwestern achteten sehr auf ihre Kleidung und hatten, bevor sie zu einer Verabredung gingen, den kleinen Tsukuru häufig beiseitegenommen und ihn gefragt, wie er dieses oder jenes Kleidungsstück finde oder ob dieses zu jenem passte. Warum, wusste er nicht, aber er hatte stets ernsthaft seine Meinung als Mann geäußert. Und meist hatten seine Schwestern auf den kleinen Bruder gehört, und er hatte sich darüber gefreut. So hatte er sich einen Blick für weibliche Garderobe angeeignet.
Während Tsukuru an seinem Highball nippte, stellte er sich insgeheim vor, wie er Sara ihr Kleid ausziehen würde. Den Haken öffnen und sacht den Reißverschluss herunterziehen. Er hatte erst ein Mal mit ihr geschlafen, aber der Sex mit ihr war schön und befriedigend gewesen. Angezogen wie nackt wirkte Sara um fünf Jahre jünger, als sie war. Sie hatte helle Haut, ihre Brüste waren nicht groß, hatten aber eine hübsche runde Form. Es war schön, ihre Haut zu streicheln und sie in den Armen zu halten, nachdem er mit ihr geschlafen hatte. Natürlich reichte das nicht aus. Das wusste Tsukuru. Wenn man etwas bekommen hatte, musste man auch etwas geben. Nur so entstand eine Verbindung zwischen zwei Menschen.
»Wie war denn deine Schulzeit?«, fragte Tsukuru Tazaki.
Sara zuckte mit den Schultern. »Nicht aufregend. Eigentlich sogar ziemlich langweilig. Ich kann dir irgendwann davon erzählen, aber jetzt möchte ich lieber deine Geschichte hören. Was ist aus den fünf Freunden geworden?«
Tsukuru rollte einige Nüsse in seiner Handfläche herum und steckte ein paar davon in den Mund.
»Wir hatten uns nicht abgesprochen, aber es gab stillschweigende Vereinbarungen. Eine davon war, dass wir möglichst alles immer zu fünft machten. Wir wollten es vermeiden, dass zum Beispiel nur zwei von uns etwas zusammen machten. Denn sonst, so fürchteten wir, würde unsere Gruppe bald auseinanderfallen. Wir mussten eine nach innen konzentrierte Einheit sein. Wie soll ich sagen, wir versuchten, unsere vollkommen harmonische Gemeinschaft zu erhalten. Nichts sollte diese Harmonie stören.«
»Eure vollkommen harmonische Gemeinschaft?«
In der Frage lag echtes Erstaunen.
Tsukuru errötete ein wenig. »Na ja, Schüler denken sich gern solche komischen Sachen aus.«
Sara musterte ihn mit leicht geneigtem Kopf. »Ich finde das nicht komisch. Aber welches Ziel hatte denn diese Gemeinschaft?«
»Wie gesagt, war es anfangs unser Ziel, Kindern zu helfen, die Lernschwierigkeiten hatten. Das war der Ausgangspunkt, und es hatte natürlich weiter große Bedeutung für uns. Aber mit der Zeit wurde wahrscheinlich unsere Gemeinschaft zum Ziel.«
»Das Ziel war also die Existenz und der Erhalt eurer Gemeinschaft.«
»Wahrscheinlich.«
»Sie war euer Universum«, sagte Sara mit zusammengekniffenen Augen.
»Universum – ich weiß nicht«, sagte Tsukuru. »Aber damals war es uns eben wichtig, die besondere Chemie zwischen uns zu schützen. Wie man eine Streichholzflamme vor dem Wind schützt.«
»Chemie?«
»Die Kraft, die zufällig entstanden war. Unter gewissen Umständen, die nicht wiederholbar waren.«
»Wie der Urknall?«
»Urknall ist vielleicht etwas übertrieben«, sagte Tsukuru.
Sara nahm einen Schluck von ihrem Mojito und inspizierte die Form des Minzblatts von allen Seiten.
»Ich war immer auf privaten Mädchenschulen, also habe ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie es auf gemischten Schulen zugeht. Ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen. Ihr fünf habt streng darauf geachtet, dass die Einheit eurer Gruppe nicht gestört wurde. Darum ging es im Grunde doch?«
»Ich weiß nicht, ob ›streng‹ hier das richtige Wort ist. Das ist vielleicht auch etwas übertrieben. Aber es stimmt, wir haben uns bemüht, zwischengeschlechtliche Beziehungen auszuklammern.«
»Aber das blieb unausgesprochen?«, sagte Sara.
Tsukuru nickte. »Wir hatten ja kein Buch mit Verordnungen oder so.«
»Und wie war das für dich? Hast du dich nicht zu Shiro oder Kuro hingezogen gefühlt, wenn ihr die ganze Zeit zusammen wart? Nach dem, was du erzählst, waren sie doch sehr attraktive Mädchen.«
»Sie waren wirklich bezaubernd. Jede für sich. Ich würde lügen, wenn ich behaupten wollte, ich hätte mich nicht von ihnen angezogen gefühlt. Aber ich habe versucht, möglichst nicht an sie zu denken.«
»Möglichst?«
»Ja, so gut es eben ging«, sagte Tsukuru. Er hatte das Gefühl, wieder ein wenig zu erröten. »Und wenn ich unbedingt an sie denken musste, dachte ich an die beiden als eine Einheit.«
»Wie das?«
Tsukuru hielt inne und suchte nach den passenden Worten. »Ich kann es nicht gut erklären. Wie an eine Art fiktive Existenz. Eine Idee ohne festen Körper.«
»Aha«, sagte Sara beeindruckt. Dann ließ sie sich die Sache einen Moment lang durch den Kopf gehen. Sie schien noch etwas sagen zu wollen, aber dann überlegte sie es sich anders und hielt den Mund fest geschlossen. Erst nach einer Weile sprach sie wieder.
»Du hast nach dem Abitur Nagoya verlassen und bist nach Tokio auf die Uni gegangen. Stimmt doch, oder?«
»Ja«, sagte Tsukuru. »Seitdem lebe ich hier.«
»Was ist aus den anderen vieren geworden? «
»Sie sind auf dortige Universitäten gegangen. Aka hat Wirtschaftswissenschaften studiert. An der Fakultät seines Vaters. Kuro hat an einer renommierten Frauenuniversität ein Anglistik-Studium absolviert. Als Rugby-As bekam Ao einen Studienplatz an einer bekannten Privat-Uni, auch in Wirtschaftswissenschaften. Shiro haben sie überredet, auf Tiermedizin zu verzichten und an einer Musikhochschule Klavier zu studieren. Ihre Unis lagen alle so nah, dass sie zu Hause wohnen bleiben konnten. Ich bin als Einziger auf die Technische Hochschule in Tokio gegangen.«
»Warum wolltest du nach Tokio?«
»Ganz einfach. Dort lehrte der beste Professor für Bahnhofsarchitektur. Das ist ein besonderes Fach und unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Architekturstudium, also hätte es nichts genützt, wenn ich einfach Ingenieurwesen und Architektur studiert hätte. Ich musste mir einen Spezialisten suchen.«
»Ein festes Ziel erleichtert das Leben«, sagte Sara.
Tsukuru pflichtete ihr bei.
»Und die anderen vier sind in Nagoya geblieben, weil sie eure harmonische Gemeinschaft nicht aufgeben wollten?«
»Als wir in die zwölfte Klasse kamen, haben wir viel über unsere jeweiligen Pläne geredet. Außer mir wollten alle in Nagoya bleiben und dort auf die Uni gehen. Keiner hat es so deutlich gesagt, aber es war klar, dass sie es taten, weil sie die Gruppe nicht auseinanderreißen wollten.«
Aka hätte bei seinen hervorragenden Noten ganz leicht auf die Universität Tokio gehen können, und seine Eltern und seine Lehrer ermunterten ihn dazu. Auch Ao mit seinen sportlichen Fähigkeiten hätte eine Empfehlung für eine landesweit anerkannte Uni bekommen können. Zu Kuro hätte ein weltstädtischeres Leben mit mehr intellektuellen Anreizen gepasst. Sie hätte auf jeden Fall auf eine Privat-Uni in Tokio gehen können. Nagoya war natürlich auch eine Großstadt, aber es war nicht zu leugnen, dass es im Vergleich zu Tokio in kultureller Hinsicht dort ziemlich provinziell zuging. Dennoch hatten sich alle außer Tsukuru entschlossen, in Nagoya zu bleiben. Alle drei blieben bei der Wahl ihrer Unis unterhalb ihrer Möglichkeiten. Nur Shiro hätte wohl auch ohne die Gruppe Nagoya nie verlassen. Sie war kein Typ, der freiwillig in die Welt hinausging, um neue Anreize zu suchen.
»Wenn sie mich fragten, was ich machen würde, sagte ich, ich hätte mich noch nicht fest entschieden. In Wirklichkeit wusste ich genau, dass ich in Tokio studieren würde. Auch ich wäre gern bei meinen Freunden in Nagoya geblieben, was in vieler Hinsicht auch einfacher gewesen wäre. Meine Familie war ebenfalls dafür und hoffte insgeheim, ich würde nach der Uni in die Firma meines Vaters einsteigen. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht ging, würde ich es später bereuen. Ich wollte unbedingt bei diesem Professor studieren.«
»Ich verstehe«, sagte Sara. »Und wie fanden es die anderen, als du nach Tokio gingst?«
»Bis heute weiß ich nicht, was sie wirklich dachten. Vielleicht waren sie enttäuscht. Denn durch meine Abreise ging ja unser Zusammengehörigkeitsgefühl verloren.«
»Die Chemie stimmte nicht mehr.«
»Früher oder später hätte sich die ohnehin geändert.«
Aber als seine Freunde erfuhren, dass Tsukurus Entschluss feststand, machten sie keinen Versuch, ihn davon abzubringen. Im Gegenteil, sie ermutigten ihn. Tokio liege nur anderthalb Stunden mit dem Shinkansen entfernt. Er könne doch jederzeit schnell zurückkommen. Außerdem, sagten sie halb im Scherz, würde er vielleicht sowieso durch die Aufnahmeprüfung fallen. Tatsächlich musste Tsukuru, um diese zu bestehen, zum ersten Mal in seinem Leben ernsthaft lernen.
»Und wie ging es mit der Gruppe weiter, als ihr mit der Schule fertig wart?«, fragte Sara.
»Am Anfang lief alles sehr gut. Ich fuhr in den Frühjahrs- und Herbstferien, in den Sommerferien, zu Neujahr und überhaupt immer, wenn ich an der Uni freihatte, sofort nach Nagoya, um mit den anderen zusammen zu sein. Wir waren noch genauso eng befreundet wie früher.«
Sobald Tsukuru nach Hause kam, traf er sich mit seinen Freunden, und sie hatten sich unendlich viel zu erzählen. Sie waren die bewährte Fünfergruppe. (Hatten nicht alle fünf Zeit, trafen sie sich natürlich auch zu dritt oder zu zweit.) Die vier in Nagoya nahmen ihren Freund stets umstandslos wieder auf, als hätte es nie eine Unterbrechung gegeben. Zumindest hatte Tsukuru nie den Eindruck, dass die vertraute Atmosphäre von früher sich verändert hatte oder ein unsichtbarer Riss entstanden war. Er war glücklich. Und deshalb machte es ihm auch überhaupt nichts aus, dass er in Tokio nicht einen Freund hatte.
Sara musterte Tsukuru interessiert. »Du hast dich in Tokio mit niemandem angefreundet?«
»Es hat irgendwie nicht geklappt. Warum, weiß ich nicht«, sagte Tsukuru. »Ich bin von Natur aus kein sehr geselliger Typ. Aber ich schotte mich auch nicht ab oder so. Damals wohnte ich zum ersten Mal in meinem Leben allein und konnte tun und lassen, was ich wollte. Es waren unbeschwerte Tage für mich. Ich vertrieb mir die Zeit damit, mir die zahllosen Bahnhöfe in Tokio anzusehen und ihre Bauweise zu studieren. Ich zeichnete einfache Skizzen und notierte, was mir auffiel.«
»Klingt unterhaltsam«, sagte Sara.
Aber die Tage an der Universität waren weniger unterhaltsam. Auf dem Lehrplan standen kaum Vorlesungen zu seinem Spezialthema, und der größte Teil des Unterrichts war banal und langweilte ihn fast zu Tode. Trotzdem nahm er an fast allen Veranstaltungen teil, immer im Hinterkopf, wie schwer es gewesen war, auf diese Universität zu kommen. Er lernte eifrig Deutsch und Französisch und übte im Sprachlabor englische Konversation. Sprachen zu lernen war eine neue Entdeckung für ihn. Aber es gab in seiner Umgebung keinen einzigen Menschen, der sein persönliches Interesse erregte. Verglichen mit der bunten Gruppe seiner vier Freunde aus der Schulzeit erschienen ihm alle anderen Menschen flach und ohne Persönlichkeit. Kein einziges Mal begegnete er jemandem, den er gern näher kennengelernt oder mit dem er sich gern länger unterhalten hätte. Daher verbrachte er den Großteil seiner Zeit in Tokio allein. Immerhin las er deshalb viel mehr als früher.
»Hast du dich denn nicht einsam gefühlt?«, fragte Sara.
»Nun ja, ich war vielleicht ziemlich isoliert, aber besonders einsam fühlte ich mich nicht. Ich nahm das eher als einen natürlichen Zustand hin.«
Er war noch jung und wusste nicht viel von der Welt. Tokio war neu für ihn, und viele Dinge funktionierten anders als dort, wo er bisher gelebt hatte. Die Unterschiede waren größer, als er vorausgesehen hatte. Die Ausmaße der Stadt waren unüberschaubar, und was sie enthielten, war zu vielfältig und auswuchernd. Ganz gleich, was er tat, die Auswahl war überwältigend. Die Menschen hatten eine eigene Art zu sprechen, und die Zeit verging zu schnell. Es gelang ihm nicht, ein ausgewogenes Verhältnis zu seiner Umgebung herzustellen. Dabei hatte er damals noch einen Ort, an den er zurückkehren konnte. Er brauchte nur am Bahnhof Tokio in den Shinkansen zu steigen und war in anderthalb Stunden wieder an dem vertrauten Ort der »vollkommenen Harmonie«. Dort, wo die Zeit friedlich dahinfloss und seine Freunde auf ihn warteten.
»Und wie ist es jetzt? Hast du ein ausgewogenes Verhältnis zu deiner Umgebung gefunden?«, fragte Sara.
»Ich bin seit vierzehn Jahren bei meiner Firma. Ich bin nicht unzufrieden mit meiner Stelle, meine Arbeit gefällt mir. Mit den Kollegen komme ich gut aus. Es gab auch ein paar Frauen in meinem Leben. Auch wenn ich aus verschiedenen Gründen mit keiner zusammengeblieben bin, war das nie ausschließlich meine Schuld.«
»Und du bist allein, fühlst dich aber nicht sonderlich einsam.«
Es war noch früh, und die beiden waren die einzigen Gäste. Ein Klaviertrio spielte leisen Jazz.
»So ist es wohl«, sagte Tsukuru nach kurzem Zögern.
»Aber es gibt keinen Ort mehr, an den es dich zurückzieht, nicht wahr? Keinen vertrauten Ort der vollkommenen Harmonie.«
Tsukuru dachte nach. Obwohl er darüber eigentlich nicht nachzudenken brauchte. »Nein, den habe ich nicht mehr«, sagte er leise.
Es war in den Sommerferien seines zweiten Jahres an der Universität, als er erfuhr, dass er diesen Ort für immer verloren hatte.
2
Es geschah also in seinem zweiten Studienjahr. In jenem Sommer trat eine radikale Veränderung in Tsukuru Tazakis Leben ein. Wie die Flora vor und hinter einem steilen Bergkamm eine ganz und gar andere sein kann.
Kaum hatten die Ferien begonnen, war er wie immer mit kleinem Gepäck in den Shinkansen gestiegen. In Nagoya angekommen, rief er sofort seine Freunde an, erreichte jedoch keinen von ihnen. Sicher waren sie gemeinsam unterwegs. Er hinterließ bei allen eine Nachricht, schlenderte allein durch die Stadt und schlug die Zeit tot, indem er sich einen Film anschaute, der ihn nicht besonders interessierte. Nachdem er mit seiner Familie zu Abend gegessen hatte, rief er nochmals seine Freunde an. Es war noch keiner von ihnen zurück.
Am Vormittag des folgenden Tages rief er erneut an, aber auch diesmal traf er keinen von den vieren an. Wieder hinterließ er die Nachricht, sie mögen ihn doch bitte zurückrufen. Die jeweiligen Familienmitglieder versprachen, es auszurichten. Doch in ihrem Tonfall schwang etwas mit, das ihn beunruhigte. Am ersten Tag war es ihm nicht so aufgefallen, aber ihre Stimmen klangen anders. Als vermieden sie es, freundlich zu ihm zu sein, oder als könnten sie gar nicht schnell genug auflegen. Besonders Shiros zwei Jahre ältere Schwester verhielt sich viel schroffer als sonst. Tsukuru hatte sich immer gut mit ihr verstanden (sie wirkte gar nicht wie eine ältere Schwester und war sehr hübsch) und häufig die Gelegenheit genutzt, ein bisschen mit ihr zu flirten, wenn er Shiro anrief. Zumindest hatten sie sich immer freundlich begrüßt. Aber jetzt legte sie hastig und geradezu angewidert auf. Nachdem er ein weiteres Mal bei allen angerufen hatte, kam Tsukuru sich vor, als trüge er ein gefährliches Virus in sich.
Ihm wurde klar, dass etwas nicht stimmte. In seiner Abwesenheit musste irgendetwas vorgefallen sein, das die anderen auf Distanz hielt. Etwas Unangenehmes. Aber so sehr er auch grübelte, ihm fiel nicht ein, was es gewesen sein könnte.
Er verspürte einen anhaltenden Druck auf der Brust, als stecke dort etwas fest, das er weder ausspucken noch herunterschlucken konnte. Er ging den ganzen Tag nicht aus dem Haus und wartete, dass das Telefon klingelte. Er versuchte, sich zu beschäftigen, konnte sich aber auf nichts konzentrieren. Er hatte den vieren wiederholt ausrichten lassen, dass er wieder in Nagoya sei. Normalerweise hätten seine Freunde ihn sofort angerufen und mit Neuigkeiten überschüttet. Doch das Telefon schwieg hartnäckig.
Gegen Abend überlegte er, ob er von sich aus noch einmal anrufen sollte. Aber dann ließ er es. In Wirklichkeit waren die anderen bestimmt zu Hause, hatten sich aber verleugnen lassen, weil sie nicht mit ihm sprechen wollten. »Wenn Tsukuru Tazaki anruft, sagt, ich bin nicht da«, hatten sie ihre Familien angewiesen. Deshalb hatten diese auch so unbehaglich geklungen.
Aber warum?
Er konnte sich keinen Grund vorstellen. Das letzte Mal gesehen hatten sie sich während der Feiertage im Mai. Als Tsukuru wieder nach Tokio zurückfuhr, hatten die vier ihn sogar noch zum Bahnhof gebracht und ihm ausgiebig nachgewinkt wie einem Soldaten, der an die Front zog.
Danach hatte Tsukuru mehrere Briefe an Aos Adresse geschrieben. Shiro hatte manchmal Probleme mit dem Computer, daher schrieb er klassische Briefe und verschickte sie per Post. Ao übernahm die Rolle des Vermittlers und leitete Tsukurus Briefe an die anderen Mitglieder der Gruppe weiter. So konnte er es sich sparen, vier ähnliche Briefe zu verfassen. Meist schrieb er über sein Leben in Tokio. Was er gesehen, welche Erfahrungen er gemacht, was er dabei empfunden hatte. Und dass er sich bei allem, was er tat, wünschte, seine Freunde könnten dabei sein, und so empfand er es wirklich. Ansonsten schrieb er nichts von Bedeutung.
Auch die vier hatten immer wieder Briefe an Tsukuru geschrieben, in denen sie nie irgendetwas Negatives erwähnten und nur ausführlich ihre gemeinsamen Unternehmungen in Nagoya schilderten. Offenbar genossen sie das Studentenleben in ihrer Heimatstadt in vollen Zügen. Ao hatte einen gebrauchten Honda Accord gekauft (die Rückbank sehe aus wie eine Hundetoilette, so verschmiert sei sie) und sie hatten einen Ausflug an den Biwa-See gemacht. Fünf Leute passten bequem in den Wagen (solange keiner von ihnen zu fett sei). Schade, dass Tsukuru nicht dabei gewesen sei. Aber sie freuten sich schon auf das Wiedersehen im Sommer. So die letzte Botschaft. Sie war ihm aufrichtig erschienen.
In dieser Nacht konnte er nicht schlafen. Er war viel zu aufgeregt, und zu viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Das heißt, eigentlich war es nur ein Gedanke, der verschiedene Formen annahm. Wie jemand, der die Orientierung verloren hat, bewegte Tsukuru sich unablässig im Kreis und gelangte immer wieder an seinen Ausgangspunkt. Bald steckte er fest und konnte weder vor noch zurück. Es war wie bei einem Schraubenkopf ohne Schlitz – er wusste nicht mehr, wo er noch ansetzen sollte.
Erst gegen vier Uhr morgens schlief er ein, wachte jedoch schon um kurz nach sechs wieder auf. Essen konnte er nichts. Er trank ein Glas Orangensaft, das einen leichten Brechreiz hervorrief. Seine Familie zeigte sich besorgt über seine plötzliche Appetitlosigkeit, doch er redete sich mit einer milden Magenverstimmung heraus.
Wieder blieb er den ganzen Tag zu Hause. Lag neben dem Telefon und las. Oder besser gesagt, versuchte zu lesen. Kurz nach Mittag rief er wider besseres Wissen noch einmal bei seinen Freunden an. Er ertrug es einfach nicht länger, in dieser Ungewissheit darauf zu warten, dass jemand sich bei ihm meldete.
Das Ergebnis war dasselbe: Man richtete ihm mit teilnahmsloser, bedauernder oder neutraler Stimme aus, der Betreffende sei nicht zu Hause. Tsukuru bedankte sich knapp, aber höflich und legte auf. Diesmal hinterließ er keine Nachrichten. Genau wie er diesen Zustand auf die Dauer nicht ertrug, würden seine Freunde es vielleicht auch nicht ertragen, sich weiter verleugnen zu lassen. Oder zumindest würden ihre Familien, die das Telefon beantworten mussten, bald den Dienst verweigern. Tsukuru rechnete damit, dass irgendwann eine Reaktion eintreten würde, wenn er immer wieder anrief.
Wie erwartet erhielt er gegen acht Uhr abends einen Anruf von Ao.
»Es tut mir leid, aber ich muss dich bitten, nicht mehr anzurufen. Keinen von uns«, sagte Ao übergangslos. Kein »Hallo«, kein »Wie geht’s?«, kein »Lange nicht gesehen«. Die Einleitung war nur eine Floskel.
Tsukuru schluckte, wiederholte den Satz im Kopf und überlegte hastig. Er versuchte, eine Gefühlsregung aus Aos Tonfall herauszuhören. Doch was er sagte, klang nicht anders als eine offizielle Bekanntmachung und bot nicht den geringsten Zugang zu seiner Gefühlslage.
»Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch anrufe, werde ich es natürlich nicht mehr tun«, erwiderte Tsukuru fast automatisch. Er hatte es unbeeindruckt und kühl sagen wollen, aber seine Stimme klang wie die eines Fremden. Die Stimme von jemandem, der irgendwo in einer fernen Stadt lebte und dem er noch nie begegnet war (und auch nie begegnen würde).
»Wir bitten darum«, sagte Ao.
»Ich habe nicht die Absicht, mich aufzudrängen«, sagte Tsukuru.
Ao gab weder einen Seufzer noch einen zustimmenden Laut von sich.
»Ich will nur den Grund wissen.«
»Den wirst du von mir nicht erfahren«, sagte Ao.
»Von wem dann?«
Auf der anderen Seite der Leitung herrschte kurz Schweigen. Ein Schweigen wie eine dicke Mauer. Ein leichtes Schnauben ertönte. Tsukuru wartete, während er Aos flache, fleischige Nase vor sich sah.
»Kannst du dir den Grund nicht selbst denken?«, fragte dieser endlich.
Tsukuru war einen Moment lang sprachlos. Was redete Ao da? Was sollte er sich selbst denken? Was denn noch denken? Er war ja vor lauter Grübeln schon kaum noch er selbst.
»Schade, dass es so gekommen ist«, sagte Ao.
»Sind alle dieser Meinung?«
»Ja, alle finden das schade.«
»Komm schon, sag, was war los?«, fragte Tsukuru.
»Frag dich doch mal selbst«, sagte Ao. Seine Stimme zitterte leicht vor Zorn und Traurigkeit. Aber das dauerte nur einen Moment. Tsukuru legte auf, bevor ihm eine Antwort einfiel.
»Und mehr hat er nicht gesagt?«, fragte Sara.
»Es war ein ganz kurzes Gespräch. Genauer kann ich es nicht widergeben«, sagte Tsukuru.
Sie saßen an einem kleinen Bartisch.
»Konntest du danach noch mal mit ihm oder einem von den anderen sprechen?«, fragte Sara.
Tsukuru schüttelte den Kopf. »Nein.«
Sara blickte ihm forschend ins Gesicht. Als bemühe sie sich, etwas zu erkunden, das nicht den Gesetzen der Vernunft entsprach.
»Mit gar keinem?«
»Ich habe keinen von ihnen je wiedergesehen.«
»Aber wolltest du denn nicht wissen, warum sie dich so plötzlich aus der Gruppe ausgestoßen haben?«
»Tja, wie soll ich sagen, damals war mir alles ziemlich egal. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen, und ich durfte nicht mehr rein. Den Grund dafür haben sie mir nicht gesagt. Was konnte ich schon tun, wenn sie es alle so wollten?«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Sara, und man sah es ihr an. »Es kann doch ein Missverständnis gewesen sein. Womöglich hättest du es sogar aufklären können. Hast du das nicht bedauert? Deine besten Freunde zu verlieren, vielleicht wegen irgendeiner Lappalie?«
Sie hatte ihren Mojito ausgetrunken. Sie gab dem Bartender ein Zeichen, ließ sich die Weinkarte geben und bestellte einen Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley. Tsukuru hatte seinen Highball erst zur Hälfte geleert. Das Eis war geschmolzen, das Glas beschlagen und der Deckel nass und aufgequollen.
»Zum ersten Mal in meinem Leben verweigerte jemand so radikal den Umgang mit mir«, sagte Tsukuru. »Noch dazu meine vier besten Freunde, denen ich mehr vertraute als jedem anderen und die mir so nah waren, als wären sie ein Teil von mir. Mein Schock war so groß, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich war völlig außerstande, der Ursache oder einem möglichen Missverständnis nachzugehen. Es war, als wäre etwas in mir durchtrennt worden.«
Saras Wein und ein neuer Teller mit Nüssen wurden gebracht. Sie sprach erst wieder, als der Bartender gegangen war.
»Ich habe eine solche Erfahrung noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, wie entsetzlich du damals gelitten hast. Natürlich konntest du dich nicht sofort wieder fangen. Aber nachdem eine gewisse Zeit verstrichen und der erste Schreck vergangen war, hättest du doch etwas unternehmen können. Ein solches Rätsel kann man doch nicht auf sich beruhen lassen. Das muss dich doch beschäftigt haben.«
Tsukuru schüttelte den Kopf. »Am nächsten Morgen fuhr ich unter einem Vorwand mit dem Shinkansen nach Tokio zurück. Ich wollte keinen Tag länger in Nagoya bleiben. Nur weg, etwas anderes konnte ich nicht denken.«
»Ich an deiner Stelle wäre geblieben, bis ich den Grund herausgefunden hätte«, sagte Sara.
»Die Kraft hatte ich nicht«, erwiderte Tsukuru.
»Aber wolltest du denn nicht die Wahrheit wissen?«