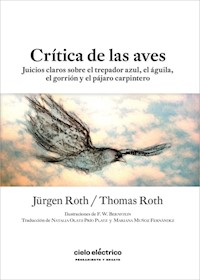Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Monsenstein und Vannerdat
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bei Jürgen Roth wird man nachgerade zum Bierbuchtrinker, ohne jemals einen zur Beschwernis werdenden Textkater davonzutragen, hingegen ein euphorisch stimmender Wörterschwips unter keinen Umständen ausbleibt, und ob der wahrlich wundervielfältigen Bierlobpreisungen der ein oder andere Griff ins Spezialitätenregal nicht ausbleibt, worauf denn die Hochstimmung von Hopfen und Malz glorios begleitet und unterfüttert wird. Schon mancher bekennende Weintrinker hat nach Roths Bierpoesielektüre seine jahrzehntealten Vorräte traubenvergorener Trophäen jäh in den Ausguss gekippt, um hernach nur noch dem Hopfensud zu huldigen und den lieben Mann im Mond einen guten Gott sein zu lassen. So oder ähnlich! Nach "Bier! Das Lexikon", "Bier! Das neue Lexikon", "Bier! Die CD", "Die Poesie des Biers" und der schon fast unverschämt überbordend erweiterten 2. Auflage derselbigen Poesie des Biers, kommt nun schlicht und ergreifend "Die Poesie des Biers 2" mit ausschließlich neu gebrauten Texten. Jürgen Roth, 1968 geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in Tübingen und an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo er später auch promovierte. Heute lebt Jürgen Roth als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main und veröffentlicht regelmäßig sprachkritische Beiträge in den Zeitschriften konkret, taz, Titanic und anderen Publikationen. Ein Schwerpunkte seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist das Bier. So schrieb er mit Michael Rudolf "Bier. Das Lexikon" sowie alleine "Bier. Das neue Lexikon" (beide Reclam Leipzig) und "Die Poesie des Biers" (Oktober Verlag). Derzeit ist Jürgen Roth Deutschlands bekanntester Biertester.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roth
Die Poesie des Biers 2
Jürgen Roth
Die Poesie des Biers 2
Mit Gastbeiträgen von Marco Gottwalts und Thomas Kapielski sowie Gesprächen mit Eckhard Henscheid und Gerhard Polt
© 2014 Oktober Verlag, Münster
Der Oktober Verlag ist eine Unternehmung des
Verlagshauses Monsenstein und Vannerdat OHG, Münster
www.oktoberverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Henrike Knopp
Umschlag: Thorsten Hartmann
unter Verwendung eines Gemäldes von Metulczki (»Trinkgedächtnisse,
Rudolf-Leonhard-Straße 2«, 2013, Acryl auf Leinwand, 24,5 cm x 20,5 cm, © Metulczki, Leipzig)
Photos auf den Seiten 42, 43, 44, 45 und 46: Thomas Kapielski
Photos des Bildteils: Jürgen Roth
Herstellung: Monsenstein und Vannerdat
ISBN: 978-3-944369-33-4
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Good men drink good beer.
Hunter S. Thompson
Alßdan vergessend mehr zu drincken / Sah man die Vier / wie fromme schaf / Zu grund vnd auff die bänck hin sincken /Beschliessend jhre frewd mit schlaf.
Georg Rodolf Weckherlin
Nicht ohne Grund habe ich gesagt, daß im Bier ein gewisses göttliches Getränk enthalten sei.
Palladas
Inhalt
Eidetische Biere
Die sieben heiligen Schlucke
Wolkengewölle, dahin und wieder daher
Das elektronische Huhn
Lehnen wir ab
Bierschatten – Von Thomas Kapielski
Quatsch! Klar. Sowohl als auch. Logisch
Vom Sinnlichkeitsvorreiter zur Sushibarbegeisterung
Abhocken
Konrad Duden, Oskar Werner und Dr. Potthoft – Von Marco Gottwalts
Ein Überbleibsel
Die rote Schlange von Izmir
Die richtige Wahrheit
Sinntal oder: Ali Baba und die vierzig Zwerge
Wie wär’s mit der nächsten Melodie?
Alle meine Vanessas
Ich könnte mir gut vorstellen, Weihnachten mit Katrin Müller-Hohenstein zu verbringen
Das Pumpernickelporter
Der Lenin und wer da alles
Alle Franz Xavers
Kleinbürger im Konjunktiv
Antarktis
Enthusiasmierende Beweger
Bierstandort Deutschland
Diskobierabend mit Dreschflegeln
Der leichte Wind
Es gibt Glück
Anhang: Marken und mehr
Nachweise
Eidetische Biere
»Genaugenommen gibt es ›die Kunst‹ gar nicht. Es gibt nur Künstler«, beginnt Ernst H. Gombrichs Standardwerk Die Geschichte der Kunst, und ein paar Zeilen später weist Gombrich alles Gerede »über das ›Wesen der Kunst‹« als schädlich und töricht zurück.
Damit hätten wir das.
Also reden wir über den Künstler Metulczki. Als ich vor einigen Jahren zum erstenmal einiger Bilder aus seiner Serie »Bierleben«, die nun unter dem Titel »Trinkgedächtnisse« firmiert, ansichtig wurde, verschlug es mir buchstäblich beinahe den Atem. Die Präzision und die Leuchtkraft der meist kleinformatigen Acryl-Schellack-Lasurgemälde wirkten auf mich – und sie tun es bis heute unvermindert – epiphanisch, salvatorisch und beglückend zugleich. Das profane Wunder, das sich in zwei Biergläsern bezeugt, die, in warmes Licht gehüllt, auf einem Tresen oder einem hölzernen Kneipentisch stehen beziehungsweise ruhen wie Zeugen einer Welt ohne Kapital, Börse, Staat und Bürokratie – ja, tja, es ist eben: ein Wunder der Wirklichkeit selbst, eine Erscheinung dessen, was ist und zugleich sein sollte, ein Mirakel, das sich im Kleinteiligen, Mißachteten zeigt und deshalb schlicht von Wahrheit kündet, vom – mit Aristoteles und keinesfalls Richard D. Precht zu reden – guten Leben; das, Kürnbergers/Adornos Diktum vom Leben, das nicht mehr lebt, zum Trotz, in Trinkwirtschaften alten Stils noch eine Zufluchtsstätte findet; und auf Metulczkis verschwommenen, ins Abstrakte tendierenden »Kühlschrankbildern«, übermalten und mehrfach übergossenen und überklebten Alltagsphotoimpressionen von gesichtslosen Herumstehern und -hängern und -hockern und Säufern und Tippelbrüdern, schmerzlich konterkariert wird.
Hie das Lichte, Exakte, Plastische, Gegenständliche, das in seiner »Zuhandenheit« (Heidegger) schier sprachlos machend Schöne und Besänftigende; da das Amorphe eines intoxikierten Lebens, das Metulczki, ohne uns mit sozialpädagogischen Implikationen zu behelligen, festhält, womöglich auch transzendiert.
Das Stilleben war in der durchweg bewunderungswürdigen protestantisch-holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts das am stärksten ausdifferenzierte Genre. Da »konnte der Künstler sich aussuchen«, schreibt Gombrich, »was er gerne malen wollte, und die Gegenstände so auf dem Tisch anordnen, wie es ihm paßte. So wurde die Bildgattung zu einem wunderbaren Experimentierfeld für malerische Probleme.«
Hier war der Maler wohl zum erstenmal frei – befreit von den Diktaten seiner Auftraggeber, von den Potentaten, die schmeichelhaft-repräsentative Porträts bestellten, von geschichtlichen Großerzählungen und Mythenstoffen. In der Konzentration auf die Dinge vollzog sich die Suspendierung der Herrschaft, und so konnten »ganz uninteressante Gegenstände ein vollendetes Bild ergeben« (Gombrich).
Ich zögere keinen Augenblick, Metulczki an die Seite eines Willem Kalf oder eines Vermeer zu stellen, dem Gombrich attestierte, reine »Wunder« geschaffen zu haben. Die harmonischen Licht-Schatten-Kontraste, die Reflexe und Brechungen, die wie naturgegeben in sich vollendeten Farb-Form-Kompositionen, die »Körperlichkeit« der Gläser, Stühle, Tische und angeschnittenen Räume – all das läßt die »Trinkgedächtnisse« bisweilen photographisch wirken, was, wie man hört, in der vermaledeiten »Kunstszene« heute kein Malus mehr ist.
»Dinge sichtbar zu machen, die schon sichtbar waren, aber nicht gesehen wurden« (Sandra Markewitz) – diesem Ziel galten Siegfried Kracauers Studien über die »Errettung der äußeren Wirklichkeit«. Metulczki setzt sie fort und ist dabei völlig glaubwürdig. Er hat jedes einzelne der zu sehenden Biere höchstselbst getrunken – und dabei vermutlich als allererster Maler das eidetische Bier entdeckt.
»Eidos« bezeichnet bei Aristoteles, in Abgrenzung zur bloßen Materie (»hyle«), die »inseiende Form«, das Allgemeine am je besonderen Stofflichen. Das Wesen des Bieres wird geschaut, an Hand des angeschauten einzelnen Gegenstandes (Bierglases). Metulczkis Bier- Eidetik folgt dergestalt der von Edmund Husserl entwickelten phänomenologischen Methode der eidetischen Reduktion: des Erfassens evidenter Phänomene, die es der Intuition zufolge tatsächlich gibt. Durch reines Schauen, das »intentionale Erlebnis« unter Ausschluß aller Vorurteile (»Epoché«), erschließt sich die Wesenhaftigkeit der Dinge – respektive das Wesen (»Eidos«) des Bieres. Bierphänomenologie also ist Husserl zufolge: »Wesensschau des Gegebenen«.
Da allerdings schwer zu sagen ist, was das Wesen des Bieres schlechthin ausmacht, ordert Metulczki immer wieder ein Glas Bier, schaut es schweigend an, photographiert es, trinkt es und malt es hinterher, in mehreren Schichten. Und wenn Ernst H. Gombrich angesichts der holländischen Meister erläutert: »Sie waren es, die uns gelehrt haben, das Malerische in der vertrauten Umgebung zu suchen«; sie »konnten ohne dramatische Effekte auskommen; sie malten einfach ein Stück Welt, wie sie es sahen« – dann sage ich: Metulczki, dieser »Hexenmeister« (Gombrich über Rembrandt), macht eine Welt, eine Wirklichkeit, eine Wesenhaftigkeit sichtbar, die bislang niemand gesehen hat und doch jeder kennt.
Und wie er das macht, das ist ein Wunder, das bewundert werden soll. Nein, muß.
Die sieben heiligen Schlucke
»Trink es mit den Augen!« Fergal Murray, Braumeister im Stammhaus von Guinness in Dublin, hebt das Glas und nimmt einen Schluck. Dann setzt er es behutsam auf dem rötlich schimmernden Holztresen ab und sagt: »Weiche Textur. Es ist die weiche Textur.«
Die weiche Textur. Die sei es. Das sei es, was die Biertrinker der Welt, unabhängig davon, welchen Alkoholgehalt das Guinness habe (in Afrika trumpft es, da die Leute nach »Impact« verlangten, mit acht Prozent auf), an jenem Stout schätzen, das die Gemeinde seiner Verehrer seit mehr als zweihundertfünfzig Jahren zum Schwärmen bringe, auch deshalb, weil man, ergänzt Murray, an Geschmacksmoden keinerlei Konzessionen mache. Brauer, bleib bei deiner Rezeptur, und Murray erläutert, es sei ihm sogar ausdrücklich untersagt, mit anderen als den glänzend bewährten Geschmackstönungen zu experimentieren.
Das Guinness ist eine Weiterentwicklung des klassischen englischen Porters, eines dunklen, röstmalzigen Vollbieres, und dennoch ist Guinness eine urirische Angelegenheit. Sein Erfinder, besser: sein Schöpfer, Arthur Guinness, wird adoriert wie eine Art Nationalheiliger. Das zumindest suggerieren die öffentliche und die mit einem gewissermaßen unaufdringlichen Aplomb unterbreitete Meinung des Unternehmens, das nach wie vor in Dublins ältestem Arbeiterviertel produziert, in den Liberties, westlich des Cathedral Districts.
Wir unterstellen Furgal Murray nicht, daß er schnöde werbliche Interessen verfolgt, wenn er uns zum Toast auffordert: »Gedenkt dieses Mannes! Gedenkt Arthur Guinness’! Nicht des Bieres! Welch ein Genie! Welch ein Genie!« Wir sind artig und nehmen den zweiten Schluck. »So schmeckt ein jahrhundertelang gewachsenes Erbe«, betont Murray noch einmal, und er hat ja recht. Erbe hin oder her, es schmeckt, quirlig, leicht sämig, solide im Körper, feinfühlig und gleichwohl stark bittergehopft, auf den Aromahopfen zur Abrundung kann man getrost verzichten. Es schmeckt bereits zur Mittagszeit, und zwar vorzüglich, zweifelsohne – was wir allerdings schon vorher wußten.
Ein Guinness zu trinken ist ein gesamtsensorisches Erlebnis, ein komplexer Akt der Perzeption, versucht uns Murray zu vermitteln. Man müsse sehen, was ein Guinness ausmache, »ein Guinness-Trinker trinkt zuerst mit dem Auge, denn ein Guinness ist ein Kunstwerk«. Der Erschaffung des Kunstwerkes durch das Zapfen sei daher ein gerüttelt Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Man befolge also geflissentlich folgende sechs Schritte: 1) Das saubere Glas konzentriert beäugen. 2) Das Glas mit vier Fingern und dem Daumen umklammern. 3) Das Glas im Fünfundvierzig-Grad- Winkel unter den Zapfhahn halten und bis zum Rand füllen. 4) Das Glas absetzen, zwei Minuten nicht berühren und »dabei beobachten, wie das Bier zum Leben erweckt wird«, wie sich der cremige Schaum durch die erwachenden und aufsteigenden Bläschen zu bilden und zu stabilisieren beginnt. 5) Kurz bis zur Oberkante nachzapfen. 6) Glas auf den Tresen stellen.
Und schließlich, 7): trinken – unbedingt in gerader Körperhaltung, den Ellbogen fünfundvierzig Grad abgewinkelt. Andernfalls entrate der Ritus des Trinkens der Würde und des Stolzes. Im übrigen, beendet Fergal Murray seinen Vortrag, werde ein Glas Guinness in exakt sieben gleichen Zügen geleert, was sich hinterher an sieben gleichmäßig angeordneten Schaumringen ablesen lassen müsse.
Mit diesen unantastbaren Regeln im Gepäck machen wir uns auf die Suche nach geeigneten Stätten, um dem Ritual der sieben heiligen Schlucke zu frönen. In der Grafton Street, Dublins Haupteinkaufsstraße, die den Park St. Stephen’s Green und das Trinity College an der Nassau Street verbindet, säumen Bettler und Immigranten, die mit Piktogrammen auf Pappdeckeln auf Fastfood- und Kleidungsläden hinweisen, die herausgeputzten Häuserzeilen. Ja, »überall herrscht tiefe Depression« (Spiegel), aus dem »keltischen Tiger« Irland ist, man hört es – obschon jüngst irgendwer Signale der Besserung wahrgenommen haben will – unablässig, eine »getretene Katze« (Spiegel) geworden, »täglich macht eine Kneipe in Irland dicht« (taz), die »Konsumphantasien« (Le Monde diplomatique) sind passé, heute laufe man wieder durch das altbekannte »Armenhaus« (taz).
Wir biegen von der Grafton Street rechts ab in die Duke Street. Linker Hand blitzen goldene Lettern auf einer schwarzen Fassadenvertäfelung: The Duke. Einmal, ein einziges Mal über Dublin schreiben, ohne James Joyce zu erwähnen? Eher denken wir bei der Sahara an Orangenbäume.
Joyce kehrte regelmäßig im Duke ein, einem großräumigen Pub mit zahlreichen Sitznischen und weitgeschwungenen Tresen. Vom Trinity College brauchte er zu Fuß zwei Minuten hierher. Es ist halb eins, wir trinken unser erstes public Pint Guinness. Es kostet 4,70. Irland ist das teuerste Land der Eurozone. Das verstehe einer.
Das Glas schmiegt sich in die Hand. Vier Finger und der Daumen halten es im Klammergriff. Das Auge, das mittrinken soll, schaut den seidigsten Bierschaum aller Zeiten. Das Ohr vernimmt ein saumleises Bitzeln. Die Nase erhascht die noble Bittere. Die Zunge gibt sich den weichen Wirbeln des rubinroten Zaubertranks hin. Gottgefällig rinnt der ruhmreiche Rotz den Hals hinunter.
Der Geist eines Getränks, er offenbart sich, wer hätte es gedacht, im Trinken, jedoch zudem im Blick, im Rückblick darauf, was man gerade getan hat. Ein angetrunkenes Glas Guinness, das vor einem thront, erfüllt einen mit majestätischer Zufriedenheit, und es fordert stumm: Komm, weiter geht’s, aber mit der Ruhe!
»Enjoy Guinness sensibly«, ermahnt uns ein Schriftzug auf der Markise unter dem Markenlogo mit der Harfe, das Dublin beherrscht wie die Gier die Wall Street. Sensibly, logisch, genieße mit Verstand, nicht mit Gefühl. Ralf Sotscheck, seit 1985 Irland-Korrespondent der taz, gibt in seinem Dublin-Buch Die blaue Tür mit der Nummer sieben (Wien 2009) preis, man müsse im Pub nur den Zeigefinger heben, dann erhalte man in kürzester Zeit ein Guinness. Sotscheck weiter: »Weicht die Qualität des Guinness auch nur eine Nuance vom hohen Anspruch der Trinker beiderlei Geschlechts ab, so nimmt der Wirt das Pint anstandslos zurück – selbst wenn das Glas schon fast leer ist, weil die halbe Kneipe davon probiert und dem Gebräu Ungenießbarkeit bescheinigt hat.«
Die halbe Kneipe besteht jetzt aus uns und einer Mittfünfzigerin, einer irischen Fremdsprachenlehrerin. Zu beanstanden ist nichts. Im Gegenteil. »Großartiges Zeug!« prostet sie uns zu. »Es macht dich sachte betrunken. Die Krise? Vergiß sie! Wir haben Guinness!«
Kürzlich war zu lesen, die irische Regierung appelliere mal wieder an die Bevölkerung, sich durch Eigeninitiative aus dem Sumpf zu ziehen. Und bei einer solchen Gelegenheit erinnert man bevorzugt an das Jahr 1959, als Guinness aus Anlaß des zweihundertsten Geburtstages eine berühmt gewordene Werbekampagne lancierte: Auf dem Atlantik ließen die PR-Strategen 150.000 Guinness-Flaschen über Bord gehen. In jedem Gebinde steckten eine Botschaft des »Büros von Neptun« und eine Bastelanleitung, mit deren Hilfe sich die Flasche zu einer Schreibtischlampe umbauen ließ. Noch heute tauchen die Guinness-Leuchten rund um den Erdball auf, und Premierminister Enda Kenny verweist gerne auf diese Geschichte. Sie soll den Iren vor Augen führen, daß man »Unternehmergeist, Kreativität und Erfindungsreichtum« entwickeln müsse.
Ja, Guinness und die Werbung. Die Qualität der »samtschwarzen Muttermilch der Iren« (Guinness) allein dürfte nicht sicherstellen, daß täglich weltweit zirka zehn Millionen der in fünfzig Ländern gebrauten Pints über die Tresen wandern. Als »legendär« werden die Werbeaktionen eines Unternehmens bezeichnet, das längst nicht mehr irisch ist und zu dem in London ansässigen Getränkekonzern Diageo gehört, der den Globus auch mit Tausenden von Schnapsmarken beglückt.
1929 trat Guinness zum erstenmal werblich in Erscheinung, mit dem Spruch »My Goodness my Guinness«. Ein Jahr später startete man eine Plakatkampagne. Auf einem der Motive bringt ein Knappe St. Georg, im Harnisch auf seinem Pferd sitzend, auf einem Tablett ein Glas Guinness, nach dem der Drachentöter erwartungsfroh die Hand ausstreckt. Bildlegende: »Guinness for strength«.
Die Sentenz »Guinness is good for you« stammt von der Krimiautorin Dorothy L. Sayers. Mit derlei einprägsamen Formeln begnügt man sich indes schon lange nicht mehr. Die PR-Maschinerie läuft ununterbrochen auf Hochtouren, und seinen Höhepunkt erreicht der Vermarktungsrummel seit 2009 jedes Jahr am »Arthur’s Day« Ende September. Dann stemmen, verbreiten die bierologischen Spin Doctors, in praktisch ganz Irland und in Asien, der Karibik, in Rußland, Deutschland, Schweden und andernorts um genau 17.59 Uhr Ortszeit, flankiert von Musikveranstaltungen und sonstigen Festivitäten und selbstverständlich vom Fernsehen begleitet, Millionen die Gläser in die Höhe, gedenkend »Uncle Arthur«, der am 23. September 1759 den über neuntausend Jahre laufenden Pachtvertrag für das Grundstück an der Liffey unterschrieben hatte.
Das imposante, 1904 im Stil der Chicagoer Schule errichtete Storehouse auf dem Brauereigelände, in dem einst der größte Maischbottich der Welt untergebracht war und heute allerlei multimedialer Klimbim rund ums Brauen in Augenschein genommen werden darf, sei, prahlt die Werbeabteilung, das meistbesuchte Ausflugsziel in Dublin. Nicht minder brüstet man sich damit, »daß Guinness-Konsumenten pro Pub-Besuch mehr Geld für Essen und Trinken ausgeben als der durchschnittliche Biertrinker«.
Wir können das bestätigen. Wir haben die Duke Street gequert und hocken vor dem Davy Byrne’s, vor, tja, der Stammkneipe von Joyce. Im Innenbereich recht geschmacklos-nüchtern, läßt es sich draußen gut aushalten, umgeben von Einheimischen mit zerzaustem Haar und in ausgebleichten Sakkos, die vor ihren schwarzen Flüssigkeitszylindern allesamt die Kunst der Bedachtsamkeit zelebrieren. Jetzt darf es ruhig auch mal ins Glas regnen. Das ist das Dubliner Gefühl.
Im Ulysses kommt das Davy Byrne’s als »moral pub« ordentlich weg. Allerdings schrieb Joyce 1906: »Die Dubliner sind die hoffnungsloseste, nutzloseste und widerspruchsvollste Rasse von Scharlatanen, der ich je auf der Insel oder auf dem Kontinent begegnet bin. Der Dubliner verbringt seine Zeit mit Schwatzen und Rundgängen durch die Bars, Schenken und Spelunken […], und nachts, wenn nichts mehr reingeht und er mit Gift angefüllt ist wie eine Kröte, stolpert er aus einem Nebenausgang und geht, geleitet vom instinktiven Wunsch nach Standhaftigkeit, die geraden Häuserfronten entlang […]. Er ertastet sich den Weg ›mit dem Arsch‹, wie wir auf englisch sagen. Da haben Sie Ihren Dubliner.«
Vor dem Davy Byrne’s sind Guinness Nummer zwei und drei fällig, wir wollen nicht von Lokal zu Lokal hetzen. Siebenhundert Wirtshäuser soll es in Dublin noch geben, »auf dreihundertfünfzig Einwohner kommt ein Pub, doch an Wochenenden reicht das manchmal nicht aus« (Sotscheck).
Im Davy Byrne’s hielt sich desgleichen Flann O’Brien auf, der »bessere Joyce«, wie viele behaupten. Eine Zeitgenossin O’Briens erzählte Harry Rowohlt, dem deutschen Übersetzer dieses Genies, mal: Er »ließ sich morgens kurz auf dem Amt sehen und ging dann zum Arbeiten über die Liffey in eine seiner Stammkneipen. Alle zwei Stunden kam ein Bürobote, um frische Akten zu bringen und erledigte Akten abzuholen. Nachmittags, nach getaner Arbeit, verließ er die Kneipe und begab sich unendlich vorsichtig mit three o’clock list (Drei-Uhr-Schräglage) in die nächste.«
Das tun wir ihm gleich, jedoch noch wacker im Lot. Wir schlendern Richtung Liffey, vorbei am Trinity College, Ziel: der Bezirk Temple Bar, das Greenwich Village Dublins, hinter der monströs häßlich ins gregorianische Architekturensemble hineingepflockten Central Bank.
In den achtziger Jahren wollten die Stadtväter das verwahrloste Viertel planieren, um ebenda einen Busbahnhof zu bauen. Heute wird das Vergnügungsquartier penibel gepflegt, die kleinen Geschäfte und die Händler von früher sind verschwunden.
Sieben mal sieben Schlucke Guinness – so lautet unser Auftrag. Wir lassen The Bankers und The Quays links liegen und konzentrieren uns auf The Temple Bar. Während das wie eine Miniaturburg und zwischen Neubauten in der Bridge Street einige Gehminuten weiter westlich ein wenig verloren wirkende Brazen Head das älteste Pub Irlands ist, gilt The Temple Bar mit ihrer schmucken roten, umlaufenden Halbfassade als beliebtestes Lokal der Insel.
Die Kellner tragen T-Shirts, auf deren Rücken »Working« steht, als müßten sie sich vom ausufernden Geselligkeitsgewusel samt Livemusik in den verkastelten Räumen ostentativ distanzieren. Wir wenden uns im »Biergarten«, das heißt im mit Heizpilzen ausstaffierten, lichten Innenhof wieder dem flüssigen Nationalsymbol zu. Geschmacklich läßt es kein Gran nach, aber bei 5,50 pro perfect Pint denken wir fünfeinhalb Sekunden lang ernsthaft darüber nach, uns der »größten Whiskeysammlung Irlands« zu widmen.
Nummer vier und fünf laufen, ordnungsgemäß auf vierzehn Schlucke verteilt, in uns hinein. Als »Redemption Song« erklingt, wird es uns zuviel der Atmosphäre, und wir fliehen den Süden Dublins, um in den schäbigeren Norden der Kapitale zu gelangen, genauer: zum John Kavanagh am Friedhof Glasnevin.
Der Taxifahrer lobt das Gravediggers, wie der Laden im Volksmund heißt, überschwenglich. »Linken Eingang benutzen!« hatte uns Ralf Sotscheck angewiesen. Er sitzt bereits da, direkt an der Tür, in einem Ambiente, in dem man sich hundertfünfzig Jahre zurückversetzt wähnt.
Kein Gedudel, kein Eventgetue. Einzig und allein eine betörende Stimmenkakophonie über altmodischem Gestühl. Der Duft von Irish Stew. Gestaffelt leuchtende Biergläser.
In manch einem Pub durften Frauen bis vor kurzem kein großes Bier bestellen, erklärt Ralf Sotscheck und zeigt auf das Snug zur Rechten, einen Nebenraum mit eigenem Zugang zum Tresen, in dem sich einst die Damen und die Geistlichen aufzuhalten hatten. Mittlerweile findet es nicht allein Jasmine Guinness, das Supermodel aus der Dynastie, »sexy, wenn Frauen Guinness trinken«.
Zügig vertilgen wir das »vielleicht beste Guinness der Stadt«, wie Sotscheck meint, in Flaschenwurfweite zum Grab von Brendan Behan, der sich sein ganzes Leben inständig »für die Kunst interessierte, wie man zwei Dutzend Flaschen Bier köpft«.
»Guinness hat seit jeher am eigenen Mythos herumgeschraubt«, sagt Sotscheck. »Man denke zum Beispiel an den Werbespot, in dem dreißig Sekunden lang ein schwarzer Bildschirm zu sehen war, bis eine Off-Stimme brummte: ›Die vergangenen dreißig Sekunden Dunkelheit wurden Ihnen von Arthur Guinness ins Haus gebracht.‹«
Wir erinnern uns an einen Satz von Fergal Murray: »Jeder spricht überall auf der Welt nur gut über Guinness.« Sotscheck lacht. »Klar, und was ist mit dem grauenhaften Hellen, dem Harp, das sie außerdem brauen? Mein Schwager ist nach neun Gläsern Harp mit Magenbluten im Krankenhaus gelandet. Der Arzt fragte ihn: ›Haben Sie Harp getrunken?‹ Mein Schwager bejahte. Da sagte der Arzt: ›Dachte ich mir, Sie haben eine Harpattack.‹«
Mag sein, daß, wie Anthony Burgess monierte, in Dublins Pubs »zuviel geredet« wird. Aber reden macht durstig – eine angenehme Reziprozität. Wir ordern regelwidrig ein achtes Guinness, und allmählich haben wir uns »in eine weiche […] Stimmung getrunken«, von der es bei Brendan Behan des weiteren heißt: »Jeder war jedermanns Freund, und das ist das größte Glück, das wir auf dieser Welt haben, wenn es auch nicht immer leicht und gewiß ist, ob man diesen Zustand erreicht.«
Wir haben ihn erreicht.
Wolkengewölle, dahin und wieder daher
Er freue sich »sehr auf dieses ernsthafte, tannendunkle Gebirge«, schrieb Karl Immermann vor einer Wanderung zum Ochsenkopf und anschließend nach Wunsiedel. »Gott gebe schönes Wetter.«
Wir wissen nicht, wie der Wettergott dann gestimmt war, aber die meteorologischen Realitäten im östlichen Oberfranken sind – sogar im Hochsommer – zumeist ernüchternd, manch einer behauptet: beschämend. Schon in der Gegend von Bayreuth quetschen sich für gewöhnlich aschige und bedrohlich finstere Wolkenknäuel und -kleckse in- und übereinander, fürwahr wütend wirkt das. Auf Aufhellungen zu hoffen ist in der Regel sinnlos, das Fichtelgebirge kennt in Sachen Witterung selten Spaß.
»Die Gegend um Wunsiedel ist sehr kalt«, hielt Immermanns Zeitgenosse Ludwig Tieck im berühmten Briefwechsel mit seinem Freund Wilhelm Heinrich Wackenroder über ihre »Pfingstreise von 1793 durch die Fränkische Schweiz, den Frankenwald und das Fichtelgebirge« fest. Hätten die beiden Erlanger Studenten ausschließlich das granitene Rumpfgebirge durchstreift, die nachträgliche Korrespondenz wäre nicht zum Gründungsdokument der deutschen Romantik geworden.
»Man nennt diese Gegend ›das bayerische Sibirien‹«, sagt der aus Hof stammende Theaterregisseur und -dramaturg Helmut Schödel. »Das Gefühlsleben der Menschen hat Frostbeulen, und ihre Sprache ist knapp, schroff und karg.«
Die Wölfe kehren zurück, wird erzählt. Die Raubtiere benötigen dünnbesiedelte Habitate, und das Fichtelgebirge entvölkert sich seit Jahren geradezu. Eine Stadt wie Selb liegt gewissermaßen in Agonie, die Porzellanindustrie weithin am Boden. Ortskerne veröden und zerbröseln, Wunsiedel soll zu einer Stadt der Senioren werden. Vor dem Fall der Mauer kamen wenigstens noch die Westberliner und machten Urlaub. Auch vorbei.
An der Autobahn hinter Bayreuth prangt ein Schild: »Genußregion Oberfranken – Land der Brauereien«. Kurz nach Bad Berneck, wo ein Getränkemarkt mit dem Slogan »Lust auf Durst?« verzweifelt um Kundschaft buhlt, kasteln uns Fichtenrigipswände ein. Über uns hetzen Wolkengewölle dahin und wieder daher.
Bischofsgrün kauert im Holz. »Das Wetter war sehr trübe, und es regnete sogar etwas«, klagte Tieck. »Wir kamen in eine ziemlich uninteressante Gegend. Das Wetter ward immer unangenehmer; ein kalter, schneidender kleiner Regen trieb uns entgegen; ein feuchter Nebel stieg aus den Bergen und Wäldern auf.« Und jetzt schiebt sich der Nebel wie ein Schleier über den schummerigen Fichtelsee und eine einsame, herzergreifend stille Landschaft, deren herbe Schönheit, da müssen wir Tieck widersprechen, an manchen Ecken beinahe Züge von Amönität gewinnt.
Eine Viertelstunde Fahrt gen Osten, durch einen undurchdringlichen Forst, nach Wunsiedel. Eine »gute, lichte Stadt« sei sein Geburtsort, meinte Jean Paul, Kollege Tieck hielt dafür: »Die Stadt ist klein. […] Sie hat ein sonderbares Aussehen«, während Reisegefährte Wakkenroder das unbestechliche Urteil fällte: »Die Straßen gehen bergauf, die Häuser sind ziemlich gut.«
Die Straßen gehen auch wieder bergab, und einige Häuserzeilen im Zentrum, herausgeputzt, lakkiert, poliert, sind tatsächlich schön anzusehen. Doch die »Stadt der Brunnen«, die auf Grund der hiesigen Niederschlagsmengen keines künstlichen Zulaufs bedürfen, empfängt uns mit energisch verwitternden Häuserwänden, heruntergewirtschafteten hölzernen Fensterläden und Hoftoren, unlesbaren Wegweisern, graubraunen, geduckten, merkwürdig zusammengewürfelten Bauten, mit Geschäften mit Billigstangeboten und mit der stillgelegten Sechsämtertropfen-Manufaktur.
Von der Gaststätte Schelter, eigentlich: Gaststätte Wiesental, in Wintersreuth war im Vorfeld die Kunde gegangen, von einer schlichten Bauern- und Brotzeitwirtschaft, wie es sie kaum mehr gebe. Ein Kleinod des Unprätentiösen sei die Schelter, früher ist sie geführt worden vom Schelters Gorch, vom Georg Schelter, heute regieren der Sohn, der Metzgermeister Rudi, und die alte Frau Schelter in der Küche, und im Schankraum hat die Anni das Sagen, Rudis Frau.
Also wieder Richtung Osten, allerdings bloß ein paar Kilometer. Wintersreuth. Im Mai, im Juni, im Juli kann hier Winter sein. Felder und Wiesen ziehen sich wie Samt übers sanfte Tal. Bachbäume, Buschsäume, Obstbaumsolitäre vor Fichtenparavents, die naßglänzende Straße schlängelt sich durch übermütig sprießendes Grün, der Himmel ergraut in allen denkbaren Anthrazittönen, der Nebel schleicht umher.
Neben dem unauffälligen Wirtshaus ein kleiner, ordentlich eingefeuchteter Biergarten mit Blick auf die mild geböschte Umgebung – und, inmitten einer Wiese, ein kniehoch hölzern eingezäunter Kräutergarten, ein Sinnbild für Franken. »Nichts will hier imponieren«, lobte der Reiseschriftsteller Horst Krüger Ende der siebziger Jahre Franken, »das andere, stille Deutschland«. Und wir schließen uns ihm an: »Ich bin jedesmal wieder erstaunt, daß es so etwas gibt: intakte Provinz, eine unzerstörte Region.«
»Wos wollts ’n ihr?« Wenn jemand bodenständig freundlich, gutmütig forsch ist, dann die Anni Schelter. Aus dem ganzen Landkreis kommen sie hierher, Ärzte, Arbeiter, Angestellte. Dieses Elysium, heißt es, sei stets vollbesetzt. Zur Mittagszeit stehen die Leute Schlange, um an die konkurrenzlos günstigen Edelspeisen zu gelangen, abends bevölkern Wurstbrotesser, Plauderbedürftige, Dämmerschoppentrinker und andere Spezialkräfte die segensreiche Normalkneipe.
»Do hast a Bea!« Es kann passieren, daß das Bier, wenn Anni es auf den Holztisch knallt, überschwappt. Das Interieur ist von jener Art, daß man es nicht zu beschreiben braucht – ehrwürdig, einfach. Warum verschwinden allerorten solche Lokalitäten? Warum werden sie von der Welt verschluckt? Warum muß alles, was eben nur scheinbar überkommen ist, weg? Zugesperrt, abgerissen werden? Im Namen des Fortschritts, der Walter Benjamin zufolge die Katastrophe ist, in der wir uns eingerichtet haben? Und die wir daher nicht mehr sehen?
Von legendären Schlachtschüsseln, von Schweinernem auf höchstem Niveau, von seraphischer Sülze und gnadenreichem Büchsenfleisch, von Bratwürsten, die man vergolden möchte, von Stockfisch und vielem anderen geht die Rede – ohne Ausnahme im Familienbetrieb hergestellt. Wir bestellen die Spezialität des Hauses, angebratene Göttinger mit Sauerkraut, das hier durch die Beigabe von Kartoffelstärke zu einem deliziös cremigen Gericht gerät und uns wie ein synästhetisches Echo auf die zauberhaft spröde Gegend mit ihren Rundungen, Wiesenbuchten und Waldbögen dünkt.
Nun will man nichts mehr – außer etliche redliche, gezapfte Biere von örtlichen Brauinstituten zu trinken und betört-belemmert den halb auf düsterfränkisch, halb auf oberpfälzisch geführten Debatten über Wagner-Inszenierungen in Bayreuth zu lauschen. Denn wie schrieb Jean Paul? »Sie sahen erfreut dem Freuen zu.«
Ja, das ist es, das Jean Paulsche »Vollglück in der Beschränkung«, Schutz findend vor den Unbilden der Zeit, der Welt und des Wetters, in der Schelter in Wintersreuth.
Das elektronische Huhn
»Bayreuth trotz Bier und Gegend unaushaltbar.« Jean Pauls bekanntes Diktum gilt hier und heute, im Biergarten der Schloßgaststätte in der unter Markgräfin Wilhelmine mit allerhand Schnickschnack wie Grotten und Ruinentheater ausstaffierten Eremitage, in keiner Weise. Das Einnordungsbier mundet vorzüglich, das Essen auch, und man wähnt sich wahrlich in jenem »Vorhimmel«, den Jean Paul pries.
Der von beinahe unermeßlicher Liebe zu den kleinen Leuten erfüllte poetische Enzyklopädist wollte ohne Bier nicht sein. Er kenne »keinen Gaumen-, nur Gehirnkitzel«, notierte er, »und steigt mir eine Sache nicht in den Kopf, so soll sie auch nicht in die Blase«.
Bloß sehen, riechen, lauschen – dem leis’ knisternd in sich zusammensinkenden Bierschaum über einem rechtschaffen goldenen Flüssigkeitszylinder. Höheres, meint man zuweilen, gibt es kaum. Derweil erzählt die Kulturwissenschaftlerin und -managerin Karla Fohrbeck, die ein Büro in Jean Pauls letzter Wohnstätte unterhält, im »Schwabacher Haus« in der Friedrichstraße, den Antipreußen und Antimilitaristen par excellence habe »Disziplin überhaupt nicht interessiert«, und sie fügt hinzu: »Ich denke, er brauchte diesen Schwebezustand, den er durchs permanente Biertrinken erzeugte, um es hier auszuhalten.«
Jean Paul labte sich am »Zaubergürtel« der Natur, am »so grün angestrichenen Präsentierteller von Gegend« und an den »wie schimmernden, aus dem Äther gesunknen« Baulichkeiten, und wahr bleibt, was Ludwig Börne in seiner Denkrede am 2. Dezember 1825 aussprach: »Er sang nicht in den Palästen der Großen, er scherzte nicht mit seiner Leier an den Tischen der Reichen. Er war der Dichter der Niedergeborenen, er war der Sänger der Armen«, und er verachtete die Indolenz des Adels.
Gleichwohl litt er unter den »illiterarischen« Inhabitanten: »Bayreuth hat einen Fehler, daß zu viele Bayreuther darin wohnen.« Das hat man ihm offenbar verziehen. Jean Paul sei heute, sagt Karla Fohrbeck, eine der maßgeblichen Initiatoren des Ende 2012 fertiggestellten, rund zweihundert Kilometer langen Jean-Paul-Wegs von Joditz bei Hof bis zum Felsengarten Sanspareil im Kulmbacher Land, »die Corporate-Identity-Figur für Oberfranken«: »Sie nehmen ihn als einen der ihren wahr.«
Für allerlei touristische Werbung hält Jean Paul mittlerweile her. Wird er dadurch wieder öfter gelesen, soll es so sein. Auf dem nach ihm benannten Wanderweg informieren Textstelen und -tafeln an hunderteinundsechzig Stationen über Leben und Werk. Die sich von Norden nach Südwesten durch Oberfranken schlängelnde Route sei »eine Energielinie«, erläutert Karla Fohrbeck, sie sei »das geistige Rückgrat der Region« und »die geheime Lebensader des alten Markgrafentums Bayreuth-Brandenburg«.
Vierzehn Kilometer nordöstlich von Bayreuth führt der Jean-Paul-Weg durch Goldkronach. Eine erste Ansiedlung an der Handelsstraße nach Böhmen datiert man ungefähr auf das Jahr 1000, seit Mitte des 13. Jahrhunderts war das Städtchen im Besitz des Grafen von Andechs, ein Jahrhundert später fiel es an die Nürnberger Burggrafen, 1792 wurde es preußisch.
Wem weniger nach einer »Kultwanderung«, wie es im üppigen Begleitbuch zum Jean-Paul-Weg heißt, zumute ist, hockt sich in oder vor einen der zwei Gasthöfe des Ortes und trinkt »ein Nößel Bier« (Jean Paul). Die Leute wollen »weg vom Eventtourismus«, sagt der Vertreter der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, Ferdinand Reb, und da sind wir hier am goldrichtigen Platz – »der stille laue Himmel« (Jean Paul) über uns, das Gesetz der Friedlichkeit in uns, des »heiligen Hinbrütens und ruhigen Anschauens« (Friedrich Schlegel).
Hier, im Nordosten Bayerns, werde nichts inszeniert, unterstreicht Ferdinand Reb. »Wenn der Fels dasteht, dann steht der da. Denn der ist echt.« Dem Hotel-Gasthof Alexander von Humboldt ist eine echte Metzgerei angegliedert, die Metzgerei Kleinheinz, die bietet zum Beispiel Brotzeitbauch und Debreziner an. In ihr riecht es sagenhaft gut, und in einer beheizten Vitrine thront ein riesiger Leberkäse, so schickt sich das. Die Metzngerei Hentschel wurde leider aufgegeben, im Schaufenster informiert ein Aushang über die nächste Zusammenkunft des Handarbeitskreises, dafür gibt es zwei echte Bäckereien, die praktischerweise beide Beck heißen. Über dem Firmenschild des »Straßen-Beck« glänzt eine goldene Brezel. Anisbrezeln sind eine Spezialität, ebenso die frischen Küchla einmal pro Woche.
»Gehst zum Beck oder zum Beck?« Nein, wir bleiben sitzen, auf der typisch fränkisch-funktionalen Terrasse des Hotels Humboldt, eingebettet in Stille. Rotbraune Schindeldächer über uns, über denen die Mauersegler Fangen spielen. Jemand stellt die Frage: »Was kann man denn zu Goldkronach noch erzählen, außer daß ein Vogel auf dem Dach sitzt?« Muß man denn?
Außer dem Gegurgel des Brünnchens zwischen den Tischen und den Bierbänken und einem zaghaft herüberwehenden Glockenschlag vernimmt man nichts. Das Bier steht stad im Glas. Die Luft kräuselt sich lind in sich. Die Welt hat zu Ende meditiert. »Die Sonne schien, da sie keine Wahl hatte, auf nichts Neues.« (Samuel Beckett) Nichts weiter braucht es, gar nichts weiter.
In einer der anrührendsten Erzählungen der deutschen Literaturgeschichte, in Jean Pauls Idylle Leben desvergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal, delektiert sich der Protagonist am »Schwalben-Scharmutzieren über sich«, »voll Durst, einen Himmel auszutrinken«. Er mißbilligt die »Hatztage, wo die ganze Erde ein Hatzhaus ist«, und pflegt in seiner herzergreifenden Milde und Bedürfnislosigkeit die »Kunst, fröhlich zu sein«, die er mit einem freundlichen Imperativ auf den Punkt bringt: »Man soll zufrieden sein mit dem, was man hat – und das mit offenen Sinnen auskosten.« Also Dinge seinlassen, gewähren lassen, sich nicht belästigen lassen durch die dummen, endlos wiederholten Wettbewerbsparolen unserer Zeit.
Goldkronach, das »Tor zum Fichtelgebirge«, hat ohne die eingemeindeten Ortsteile kaum zweitausend Einwohner. Will man die wunderbare »Trink-Leere« (Jean Paul) ein bißchen füllen, geht man gemach Ekken gucken. Auch hier verstehen es die Einheimischen selbstverständlich, abscheulichste Baumarktvorgärten und Fertigbetongaragen ins Ortsbild zu stopfen, und warum sollten sie in Goldkronach fehlen, die Waschbetonmauern an abfallenden Bürgersteigen, die Fassadenverkleidungen aus Eternit- und PVC-Paneelen, die Klinkermauerbänder, die uniform häßlichen Normtüren und -balkone, die steril gepflasterten Hofeinfahrten, die nordbayerischen Varianten dilettantischer Lüftlmalerei (besonders ein antikisierter Doppelfensterbogen mit Silberreiher und Ara überzeugt uns) und die obligatorische triste Sitzgruppe (hinter der neugotischen Pfarrkirche St. Erhard). Und natürlich muß es Baulanderschließung geben, direkt am Schloßpark, unter dem Motto »Modernes Wohnen« freilich, die gelbgrüne Wiese hat da nichts verloren, und die freie Sicht auf den Goldberg im Osten ist viel zu pittoresk.
Gleichwohl erspähen wir tröstliche Winkel: eine würdevoll verwitternde große Scheune, vor der die Malven sprießen, buschige violette Geranien vor sattgelbem Putz, eine ungeöffnete, von der Sonne illuminierte Flasche Kulmbacher Bier hinter einem Schuppen, Fenster, hinter denen sich surreal wirkende Skulpturen aus Draht und Stahlteilen zeigen, eine blitzschöne pechschwarze Schindelhausfront. An der Bayreuther Straße steht ein ob seiner Schlichtheit und klaren Form geradezu anmutiges Werkstattgebäude. An einer bemoosten Granitwand in einer Seitengasse lehnen ausrangierte Bauernhausfenster und Bauernhausfensterrahmen. Das schwarzrotgoldene Banner (das einzige in der Stadt), das in einer Blechgießkanne steckt, übersehen wir.
Am südlichen Ortsausgang schwankt eine Gartenblockhütte auf einem provisorischen Fundament aus Ytong-Steinen. An ihrem mit einer grünen Plastikplane abgedeckten Dach hängt die Frankenfahne (die einzige in der Stadt). Wenige Meter weiter zerbröselt ein weißviolettes Haus, dann erquickt uns eine schmutzige olivgrüne Gebäudlichkeit, die den Kosmetiksalon Ile de Beauté beherbergt.
Nach ein paar Schritten stoßen wir auf das 1865 gegründete Lebensmittelgeschäft Grieshammer in einem hübschen hellblauen Haus. Wir fühlen uns an unsere Kindheit im Mittelfränkischen erinnert, als wir beim Krämer für den gutmütigsten aller Großväter kühle Bauernflaschen Bier kauften: Fleisch- und Wurstgerüche im dämmrigen Geschäft, offenes Obst und Gemüse, verschlafene Lokalzeitungen, frisches Brot, und an der altmodischen Kasse sitzt ein genügsamer, grundfreundlicher Mann, der uns einen angenehmen Tag wünscht.
Von mehreren Brandkatastrophen wurde Goldkronach heimgesucht, die letzte ereignete sich 1836. Danach baute man den Ort im zurückhaltend eleganten Stil des Biedermeier wieder auf. Die Sandsteinhäuser an der leicht geschwungenen Hauptstraße und rund um den Marktplatz hinterlassen mit ihren weitgehend einheitlichen Traufhöhen, ihren Sprossenfenstern und ihren Gauben den Eindruck von bodenständiger Geschmackssicherheit.
Am malerischen Marktplatz residiert der – neben unserem Hotel – letztverbliebene Gasthof, die Goldene Krone. Das Wirtshaussterben auf dem Land ist einer der elendsten Kulturvernichtungsvorgänge unserer Tage. Die Gastwirtschaften Glückauf, Beck, Rosenau und Roter Adler schlossen in den achtziger und neunziger Jahren. »Die ganze Wirtshauskultur funktioniert nemmer.« Inge Bär, eine unprätentiös selbstbewußte, schelmisch lächelnde Frau, führt den prachtvollen Schwarzen Adler im Ortsteil Nemmersdorf. Die Wirtsstube ist umwerfend sorgsam konserviert, Braten, Gemüseeintöpfe, Bratwürste und selbstverständlich selbstgemachte Klöße bereitet sie auf einem Holzherd zu, weder Kroketten noch Pommes kommen ihr ins Haus. Frau Rausch vom Nordbayerischen Kurier nickt.
Die Feuerwehr und der Sportverein hätten ihre eigenen Lokale, erklärt Inge Bär. »Früher war der Freitag der Fortgehtag, das ist auch vorbei.« Samstagfrüh laufe es noch zwei Stunden, da rücken die Jäger und der Bulldogstammtisch an, und der sonntägliche Mittagstisch erfreue sich großer Gunst. Doch sonst?
Um dem Jammer zu trotzen, pflanzen wir uns in den Straßenbiergarten der Krone. Die Linden an der vor langer Zeit kanalisierten, den Marktplatz teilenden Kronach wiegen ihre Zweige zart, die Steineinfassungen lauschen dem wohltemperierten Rauschen des Wassers. Nie schien, scheint’s, die Sonne schöner als jetzt, und »in des Goldes Scheine« (Wagner) erfüllt uns eine geradezu »närrische Freude« (Wutz), das Maisel’s-Weißbier vor uns, dem wir sogar den Apostroph verzeihen.
Nun behauptet zwar der Förderverein für Roggen-Kultur in Weißenstadt, das unter seiner Ägide just Ende Juni eröffnete, man spitze die Ohren, Pädagogisch-Poetische Informationszentrum für Roggenkultur Rogg-In dokumentiere, daß der Roggen das »eigentliche Gold des Fichtelgebirges« sei. Allein, da beißt weder eine Fichtelgebirgsmaus einen Zwirn durch, noch kann man uns gelegentlichen Einfaltspinseln dergleichen weismachen. Das Gold des Fichtelgebirges, das niemand, irgendeinem Alberich wehrend, bewachen, sondern das man einfach bestellen muß, ist das Bier, Punkt – oder allenfalls zudem der Hafer am Rande von Goldkronach, genaugenommen ein Haferfeld, das sich im gnädigen Frühabendlicht wie verträumt und selig schlummernd an einen sanft geformten Hang schmiegt.
»Bratwöscht?« – »Jawoll.« Acht Herren hocken friedvoll drei Tische weiter, einer von ihnen, ein glücklich geerdeter, daseinstüchtiger älterer Mann, schlendert irgendwann zu uns herüber. »Sie ham sich den richtigen Platz ausg’sucht.« Er grinst wie ein Bub’. »Ein schattiges Plätzla, des is’ vernünftig. Sonst brennt’s dir des Resthirn weg.« Gülden. Jedes Wort gülden.
»Das Bier auf seine schönste Weisse«, steht auf dem Aschenbecher. Drüben werden die leuchtenden Pokale wie Monstranzen ins wacker ermattende Abendlicht gehoben. Beiläufig werfen die Bäume Schatten. Der Hausrotschwanz auf der Dachrinne macht einen Knicks, als verneige er sich vor alledem. »Genau.« – »Jawoll.« –»Genau so is’ es nämlich.«
Am nächsten Morgen Bierschinken und Göttinger Wurst zu Kaffee und Brötchen, lediglich echtes Landbrot fehlt auf dem Büffet. Die fröhlichen Damen des Hauses plaudern, gänzlich unfränkisch, ausgelassen. Item itzo diese höchst wohlige Gestimmtheit: Es genügte vollauf, »nie mehr begehrend als die Gegenwart« (Wutz), den ganzen Tag damit zu verbringen, in die Luft zu gukken, neben sich zwei, drei Flascherl Bier mit Schraubverschluß. Die säkulare Vita contemplativa, sie wäre das Naheliegendste und Einfachste, und man spürte endlich einmal die Zeit, ohne daß sie bedrohlich erschiene. Gegen Abend fielen schließlich die »Goldfäden« (Wutz) der wandersmüden Sonne aufs Turmkreuz von St. Erhard, vorm sacht wolkendurchwebten Himmelsfond.
Doch Goldkronach ist ja nicht zuletzt Alexandervon-Humboldt-Stadt, dem sollte man Rechnung tragen. Der nachmalige Universalwissenschaftler und »Wissenschaftsfürst«, dessen Ceterum censeo die Freiheit (»Alle sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt«) und der ein inständiger Anhänger der Französischen Revolution war, ward 1792 als Bergbauingenieur von Berlin aus für fünf Jahre nach Franken entsandt, um den Erzabbau in den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth zu reorganisieren. 1793 beförderte man ihn zum Oberbergmeister, im nämlichen Jahr trat er seinen Dienst in Goldkronach an.
Humboldt war bestrebt, »dieser romantischen Gegend nur einen kleinen Teil ihres Glanzes wiederzugeben«. Bereits im Januar 1794 ließ er seiner Begeisterung in einem Brief die Zügel schießen: »Mit dem Bergbau geht es überhaupt hier jetzt vorwärts. In Goldkronach besonders bin ich glücklicher, als ich es je wagen durfte zu glauben.«
Am Rande Goldkronachs wurde seit 1363 Goldbergbau betrieben, der erste schriftliche Nachweis des Namens Goldtkranach stammt aus dem Jahr 1398. Die Blütezeit der Goldgewinnung aus leicht zugänglichen Bodenschichten dauerte bis ins 15. Jahrhundert an (manche Quellen sprechen vom 16. Jahrhundert), die Schächte im Goldberg, im heutigen Stadtteil Brandholz, wo vermutlich das größte Goldvorkommen Deutschlands lag, hießen »Name Gottes«, »Unverhofft Segen Gottes«, »Schickung Gottes«, aber auch »Fauler Nickel« oder »Goldener Hirsch«.
Humboldt war – wie Jean Paul und dessen Figur des Maria Wutz (er »war allen Menschen gut«) – ein wahrer Philanthrop. Im Sinne seines Credos, »das Studium der physischen Natur mit dem der moralischen zu verknüpfen«, rationalisierte er nicht nur die Arbeitsabläufe im seit Mitte des 17. Jahrhunderts maroden Bergbau, sondern er verbesserte die Sicherheit der Hauer, Steiger und Fördermänner, führte die Bergbauhilfskasse und das »Büchsengeld« für Witwen und Waisen ein und gründete Ende 1793 in Steben auf eigene Kosten die Erste Königlich Freie Bergschule.
Der Goldbergbau verdankte Humboldt eine merkliche Renaissance, die ein gutes halbes Jahrhundert anhielt (endgültig Schicht im Schacht war allerdings erst 1925). Trotz seines Enthusiasmus gab er sich jedoch keinen übermäßigen Illusionen hin. Man dürfe »nichts von der Natur erzwingen wollen, was sie nicht leisten kann«, und die Abholzung der Wälder nannte er einen »Menschenunfug […], der die Naturordnung stört«.
Im vor zehn Jahren eröffneten, liebevoll gestalteten Goldbergbaumuseum im ehemaligen Forstamt an der Bayreuther Straße, in dem Humboldt ab und an Quartier nahm, werden in sieben übersichtlichen Abteilungen Werkzeuge, Grubenrisse, Befahrungsprotokolle, Karten, Modelle, ein nachgebauter Stollen, Gesteinsproben aus goldhaltigen Quarzgängen und anderen Montanformationen, Zeugnisse der Goldverarbeitung und viele aufschlußreiche Dokumente mehr präsentiert. Gold, erfährt man, widersteht Alkalien und Säuren, ist unzerstörbar, verliert seinen Glanz nie und symbolisiert daher Macht, Göttlichkeit und die Ewigkeit. Vielleicht bestrafte darob der Goldkönig in der Goldkronacher Goldbergsage die Gier der Menschen, die sich mit dem Edelmetall zu schmücken gedachten, mit schlimmer Not und Armut.
Vor etwa zwanzig Jahren fand in Goldkronach eine Goldwasch-WM statt, ins Leben gerufen vom damaligen, wir scherzen nicht, Bürgermeister Blechschmidt. Auf sie folgte die seither alle zwei Jahre ausgetragene Deutsche Goldwaschmeisterschaft auf dem Goldberg. Der sei, schmunzelt der zuvorkommende Rathausangestellte, der uns durchs Museum geleitet, auf Grund der »durchschlägigen Stollen« ein »Schweizer Käse«, mithin ein Beispiel für jene »durchsichtigen Berge voller Goldadern«, die wiederholt Topographien der Jean Paulschen Traumwelten sind.
Am Humboldtweg auf dem Goldberg liegen die zwei Besucherstollen »Schmutzlerzeche« (zugänglich seit 1985) und »Mittlerer Name Gottes« (seit 1993), die wie das Museum sonn- und feiertags geöffnet sind. Es empfiehlt sich, frei von Platzangst zu sein, schlüpft man in die engen Gänge hinein und versucht, ein Goldfinserl zu finden, eines der nach wie vor dort dösenden, zwischen einem halben und einem Millimeter kleinen Goldkörner.
Die Goldkronacher Goldvererzung ist das Resultat einer geologischen Singularität. Exakt durch die Stadt verläuft die Fränkische Linie, eine tiefe und lange Abbruchkante, die durch das Aufeinanderprallen des afrikanischen und des europäischen Kontinents entstand. Das Fichtelgebirge, wesentlich älter als die dusseligen Alpen, diese »Tyrolerberge bei München« (Jean Paul), die zusammenpacken und nach Hause gehen dürfen, schob die weichen Gesteine des Vorlandes von sich weg. Jene senkten sich ab, das stolze, bockelharte Fichtelgebirge hob sich an. In den nach dem geologischen Ringkampf zurückgebliebenen Rissen löste sich unter dem Einfluß von Wasser und Sauerstoff peu à peu Gold, und das chemische Element mit der Ordnungszahl 79 fand fortan in der »Wohlfühlregion Fichtelgebirge« neben vielerlei anderen Gesteinskameraden eine kommode Heimstatt.
»Daß es geologisch mal drunter und drüber ging« (Museumsfaltblatt), ist an den zahlreichen Goldkronacher Geopunkten zu studieren, zumal im Kellergewölbe des Schlosses, in dem ein aufmüpfiger Muschelkalksporn, der normalerweise hätte in der Horizontale verbleiben müssen, das Fundament des strahlend weißen Prunkgebäudes bildet.
Gudrun und Hartmut Koschyk zeichnen hier im Namen des Alexander-von-Humboldt-Kulturforums seit 2008 für Symposien, Vorträge, Konzerte, Liederabende, Ausstellungen und Theateraufführungen verantwortlich. »Daß Humboldts Genialität hier in Franken zur Entfaltung kam«, betont Hartmut Koschyk zu Recht, und er habe sich »immer gewundert, warum man so wenig aus Jean Paul gemacht hat. Der Jean-Paul-Preis wird in München verliehen.«
Sein Anliegen ist es, »Bewußtsein für Humboldt in der Region zu wecken«. Mittlerweile kämen Humboldtianer »aus China, Afrika und der arabischen Welt« in diesen »beschaulichen Ort«, in diese dörfliche Stadt, man müsse indes, wolle man den »Wegbereiter der Globalisierung«, der in dieser Kleinwuselwelt regelrecht aufblühte, den Menschen nahebringen, die hiesigen Gesangvereine und Posaunenchöre einbeziehen, was, verrät ein Blick in die Programme der Goldkronacher Kultursommer, offenbar bestens gelingt.
»Die Leute sind offen für das geistige Erbe Frankens«, für den interkulturellen Dialog, nicht minder für die Vermarktungspotentiale jener beiden Intellektualgrößen, die sich nie begegneten und die nie miteinander ein »braunes Bier« (Jean Paul) auf der Terrasse des Goldkronacher Schlosses goutierten, das grünblaugoldene Landschaftspanorama förmlich in sich hineinsaugend.
Wir treffen den Schauspieler und Rezitator Hans- Jürgen Schatz in Goldmühl, das bereits zu Bad Berneck gehört. Humboldt wohnte 1793/94 in der Alten Mühle. Im Schwarzen Roß nebenan, in fünfter Generation in Familienbesitz, kredenzt man uns zum seraphischen Steak dunkles Beck’n-Bier aus Büchenbach. Hans-Jürgen Schatz, künstlerischer Leiter der im Oktober stattfindenden ersten Jean-Paul-Tage in Bad Berneck, versucht seit 1992, die »Nachempfindbarkeit der Entstehungsbedingungen der deutschen Romantik« durch akribisch arrangierte Lesungen zu befördern und Jean Paul »durchzusetzen«. »Man braucht Ruhe, um Jean Paul zu lesen«, merkt er an, auch als Vortragender müsse man sich seine wildwüchsigen, gestrüppartigen, gewissermaßen avant la lettre postmodern mäandernden artistischen Welterkundungen »zäh erschließen«. »Doch wenn man Jean Paul kommentierend und einordnend vorstellt, sagen die Leute: ›Vorgelesen ist es gar nicht mehr so schwer.‹«
Der in sich schlingernde Schwebezustand, das ist womöglich die Jean Paulsche Lese- und Lebensempfindung. Das gute Goldkronacher Gefühl. Sehr groß ist er, mit Rilke zu raunen, der Sommer, sehr groß ist sie, die kleine »geflügelte Welt« (Jean Paul: Siebenkäs). Das Firmament blank und heiter. »Man kann die seligsten Tage haben«, schwärmt Jean Paul, »ohne etwas anderes dazu zu gebrauchen als den blauen Himmel.«
Laß uns vor die Tore der Stadt wandern, nur ein paar Meter. Laß uns behaglich die Luft und die gescheckten, sich in die Ferne hineinschmiegenden Wolken atmen. Laß uns die Untererde der Gesteine vergessen und das grüntrunkene Gehügel, Gesäume und Gebüschel schauen, das herumwackelnd’ Getier, das brummelnd und bummelnd sich wandelnde Wimmeln, die gnadenreiche Illumination all dessen, laß die Wonne Oberhand gewinnen in einem Kosmos, den Jean Paul ersonnen haben muß und aus dem man langsam, langsam herausfallen möcht’, weich und zeitverzögert.
»Weizen?« – »Ja, gerne.« Die schlanke, kleinwüchsige Bedienung der Krone kennt uns unterdessen. Ein Einwortfragesatz langt. Die Bachstelze flaniert wippend vorbei. Der Koch tritt vor die Tür und erkundigt sich beim Mittagstisch, ob es schmecke. Ein altes, dürres Weiblein, die Nachbarin, sitzt auf der Bank vor ihrem Haus und lugt.
Das zweite Weizen kommt. »Brauch’ mer net anschreib’n, oder?«
In der milchig beleuchteten Schwemme, in der die olfaktorische fränkische Signatur von Sauerkraut und Angebratenem prosaisch verwunschen herumwabert, ist sie noch einmal zu spüren, die fußläufige Weltläufigkeit der beharrlich geschmeidigen Jean Paulschen Seele, und an der Wand hängt ein Schild: »Als der Herrgott die Arbeitsstunden der Wirtsleute mit deren Einkommen verglich, drehte er sich um und weinte bitterlich.«