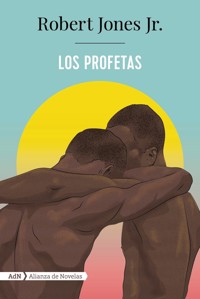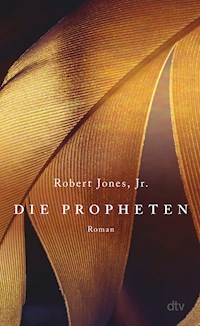
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine Hommage an James Baldwin« The New York Times Als sie sich auf der Baumwollplantage zum ersten Mal begegnen, ist Isaiah fünf Jahre alt, halb verdurstet und Samuel reicht ihm eine Kelle Wasser. Man hat Isaiah Vater und Mutter entrissen, Samuel kennt seine Eltern nicht. Die jungen Sklaven leben im Stall bei den Tieren, um die sie sich fortan kümmern. Samuel und Isaiah finden zueinander, doch ihre Liebe wird beargwöhnt und benutzt. Irgendwann ist die Katastrophe unvermeidbar. Robert Jones, Jr. lässt Unterdrückte und Unterdrücker erzählen: eine Geschichte von Entwurzelung und dem Kampf um Würde – und von Menschlichkeit, die dem Terror trotzt und ihre subversive Kraft entfaltet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Robert Jones Jr.
Die Propheten
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Simone Jakob
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Großmütter Corrine und Ruby,
für meine Großväter Alfred und George,
für meine Großonkel Milton, Charles,
Cephas und Herbert,
für meinen Vater Robert,
für meine Cousins Trebor
und Daishawn und meine Cousine Tracey,
für meine Paten Delores Marie und Daniel Lee,
für Mutter Morrison und Vater Baldwin
und für all meine Verwandten und Vorfahren, die zu den Ahnen gegangen und selbst zu Ahnen geworden sind und mich führen, beschützen und mir Dinge zuflüstern, damit auch ich Zeugnis ablegen kann.
RICHTER
Noch kennst du uns nicht.
Noch begreifst du nicht.
Wir im Dunkel sprechen in sieben Stimmen. Denn Sieben ist eine heilige Zahl. Denn wir sind heilig und werden immer heilig sein.
Das ist unumstößlich.
Am Ende wirst du begreifen. Und wirst fragen, weshalb wir dir alles nicht schon früher erzählt haben. Aber glaubst du wirklich, wir hören diese Frage zum ersten Mal?
Nein.
Doch es gibt eine Antwort. Es gibt immer eine. Aber noch hast du sie dir nicht verdient. Du weißt nicht, wer du bist. Wie kannst du da begreifen, wer wir sind?
Du bist gar nicht so orientierungslos, sondern wirst von Dummköpfen betrogen, die Schein mit Macht verwechselt haben. Sie haben alle Symbole der Herrschaft aus den Händen gegeben. Die Strafe dafür währt ewig. Dein Blut wird sich längst vermischt haben, ehe sich endlich die Vernunft durchsetzt. Oder die Welt selbst wird zu Asche verbrannt sein, was Erinnern sinnlos macht. Aber es stimmt, man hat dir unrecht getan. Und du wirst deinerseits unrecht tun. Wieder. Und wieder. Und wieder. Bis du schließlich erwachst. Deshalb sind wir hier, deshalb sprechen wir gerade mit dir.
Nun folgt eine Geschichte.
Deine Geschichte.
Genau darum geht es bei deiner Existenz. Im Hier sein, im Dort sein. Beim ersten Mal bist du nicht in Ketten gekommen. Du wurdest herzlich aufgenommen, hast Essen, Kultur und Lebenssinn mit jenen geteilt, die wussten, dass man weder Menschen noch Grund und Boden in Besitz nehmen sollte. Wir sind dazu da, dir die Wahrheit zu sagen. Aber weil du die Wahrheit noch nie gehört hast, wirst du sie womöglich für eine Lüge halten. Lügen sind liebevoller als die Wahrheit, sie umfangen dich mit beiden Armen. Dich aus ihrer Umklammerung zu befreien, ist unsere Strafe.
Ja, auch uns hat man bestraft. Uns alle. Denn niemand ist unschuldig. Unschuld ist, wie wir herausgefunden haben, das größte Verbrechen. Sie trennt die Lebenden von den Toten.
Was?
Wie war das?
Haha!
Verzeih, dass wir lachen.
Du dachtest, du gehörst zu den Lebenden und wir zu den Toten?
Haha.
SPRICHWÖRTER
Im Dunkel, auf den Knien, red ich zu ihnen.
Manchmal versteht man sie schwer. Sind schon so lang weg und benutzen immer noch die alten Wörter, die man mir fast rausgeprügelt hat. Und dass sie flüstern, machts auch nicht besser. Oder vielleicht schreien sie auch, sind aber so weit weg, dass es wie Flüstern klingt für mich. Vielleicht liegts daran. Wer weiß das schon?
Jedenfalls hab ich ein Loch gegraben, wo ich sollte, und den glänzenden Meerstein reingelegt, genau wie sie gesagt haben. Aber vielleicht hab ich was falsch gemacht, denn Massa Jacob hat dich trotzdem verkauft, obwohl er doch gesagt hat, dass ich zu seiner Familie gehör. Gehen die Toubab etwa mit ihren Familien so um? Reißen Müttern die Kinder aus den Armen und laden sie auf nen Wagen wie Ernte? Gebettelt hab ich. Vor meinem Mann hat er mich betteln lassen, und seitdem kann der Einzige, den ich je geliebt hab, mir nich mehr in die Augen gucken. Sein Blick fühlt sich an, als wärs mein Fehler und nicht der von denen.
Ich frag sie, die alten Stimmen aus dem Dunkel, nach dir. Ganz schön stolz bist du, sagen sie. Dabei, ein Mann zu werden. Hast viel von den Deinigen in dir, auch wenn dus noch nicht weißt. Bist gescheit, vielleicht mehr, als gut für dich ist. War überrascht, dass du noch lebst. Ich frag sie: Könnt ihr ihm eine Nachricht bringen? Sagt ihm, ich erinner mich an jeden Kringel auf seinem Kopf, jede Falte an seinem Körper, sogar an die kleinen zwischen den Zehen. Sagt ihm, nich mal die Peitsche kann da was dran ändern. Sie antworten nich, sagen bloß, du bist jetzt in Mississippi, wo alles, was ganz ist, kaputt gemacht wird. Keine Ahnung, warum sie mir das sagen. Welche Mutter will schon hören, dass ihr Kind totgeschunden, totgequält wird? Na ja, is auch egal. Ob hier oder da, wir alle müssen irgendwie büßen.
Seit sie dich geholt haben, hat Ephraim kein Wort mehr gesagt. Nix. Stell dir das mal vor. Ich seh, wie er die Lippen bewegt, aber es kommt einfach kein Ton raus. Manchmal will ich deinen Namen sagen, und zwar den, den wir dir gegeben haben, nicht den hässlichen von Massa, wo wir getan haben, als wärs in Ordnung. Ich stell mir vor, wenn ich deinen Namen sag, is er wieder bei mir. Aber er lässt den Kopf hängen, als hätt er ne Schlinge umn Hals, die ich nich seh, und dann bring ichs nich fertig. Was is, wenn ich deinen Namen sag, und dann is er ganz weg von mir?
Darf ich ihn mal sehen?, frag ich ins Dunkel. Oder Ephraim? Geht ja gar nich drum, dass wir ihn anfassen. Nur um nen kurzen Blick, dass wir wissen, er gehört immer noch zu uns, auch wenn er jetzt wem anders gehört. Sie sagen, Ephraim soll in eins von diesen Spiegelgläsern schauen. Und ich, was soll ich machen?, frag ich. Sie sagen, ich soll Ephraim in die Augen schauen. Wie soll ich das machen, wenn er mich doch nich mehr ansieht?, frag ich. Aber alles, was ich hör, is der Wind in den Bäumen und das Krik-krik von den Grillen im Gras.
Du gehörst zu uns. Bist einer von uns. Daran halt ich mich fest, das füllt die Leere in mir. Das schwirrt und schwirrt wie Glühwürmchen in der Nacht. Dann isses still, still wie Wasser im Brunnen. Ich bin voll. Bin leer. Voll, dann leer. So musses sein, wenn man stirbt.
Nutzt nichts, Leute anzuschreien, die einen nich hören. Sinnlos, Leuten was vorzuweinen, die deinen Schmerz nich fühlen. Für die dein Leid nur ne Messlatte ist, wie viel se dir noch aufladen können. Ich bin hier nichts. Und werd nie was sein.
Wozu hat er dich verkauft? Um dieses miese Stück Land zu behalten, wo der Geist bricht und die Seele blutet? Ich sag dir was: nich mehr lange. Nee, Sir. Nich mit mir und Ephraim, wir sin weg. Ham kein Ort, wo wir hinkönnen, nur weg. Is auch nich anders als ein Schwein schlachten. Ne scharfe Klinge, n schneller, tiefer Schnitt über die Kehle, dann isses vorbei.
Dann sind wir auch flüsternde Stimmen im Dunkel und erzählen andern, wie sich die Kinder draußen in der Wildnis durchschlagen.
Mein armes Kind! Fühlst du mich?
Ich bin Middle Anna, das is Ephraim. Wir sind deine Mam und dein Pappy, Kayode. Und du fehlst uns so sehr.
PSALMEN
Der Juli hatte versucht, sie umzubringen.
Zuerst wollte er sie verbrennen. Dann ersticken. Als alles nichts half, machte er die Luft schwül und flüssig wie Wasser, um sie zu ertränken. Doch auch das schlug fehl. Sie wurden nur verschwitzt und gereizt, auch zueinander. In Mississippi fand die Sonne sogar einen Weg in den Schatten, sodass an manchen Tagen nicht einmal die Bäume Abkühlung boten.
Und außerdem, warum sollte man sich bei dieser Hitze in die Gesellschaft von anderen begeben? Die Sehnsucht danach blieb und machte die Temperaturen irgendwie erträglich. Früher waren Samuel und Isaiah gern bei den anderen gewesen, aber dann hatten die anderen sich verändert. Anfangs hatten sie geglaubt, die verzogenen Münder, verstohlenen Blicke, das Naserümpfen und Kopfschütteln kämen daher, dass sie nach der harten Arbeit in der Scheune einen unangenehmen Geruch verbreiteten. Sie badeten oft stundenlang im Fluss, um den Jauchegestank loszuwerden. Täglich vor Sonnenuntergang, wenn die anderen erschöpft von der Feldarbeit den trügerischen Frieden ihrer Hütten aufsuchten, schrubbten sich Samuel und Isaiah mit Minzblättern, Wacholder und manchmal auch mit Root Beer, um den Gestank loszuwerden.
Aber das änderte nichts am Verhalten der anderen. Und so blieben sie lieber für sich. Sie waren nie unfreundlich, aber die Scheune wurde für sie ein Zufluchtsort, den sie selten verließen.
Ein Horn blies zum Ende der Arbeit. Ein irreführendes Signal, denn die Arbeit endete nie, sie wurde nur vorübergehend unterbrochen. Samuel stellte einen Wassereimer ab und schaute zur Scheune hinüber. Trat ein wenig zurück, um sie ganz im Blick zu haben. Sie hätte einen neuen Anstrich vertragen können, beides, die roten und die weißen Flächen. Soll sie ruhig hässlich sein, is wenigstens ihr wahres Gesicht, dachte er. Solange die Halifaxes ihn nicht dazu zwangen, würde er keinen Finger rühren.
Er ging ein paar Schritte nach rechts und schaute zu den Bäumen hinter der Scheune, in der Ferne, am anderen Flussufer. Dort versank gerade die verblassende Sonne. Dann drehte er sich nach links zur Plantage, sah die Silhouetten der Menschen, die Säcke mit Baumwolle auf dem Rücken oder dem Kopf trugen und sie auf die etwas abseits stehenden Wagen warfen. James, der Hauptaufseher, und ungefähr ein Dutzend seiner Untergebenen, standen zu beiden Seiten des stetigen Stroms von Leuten Spalier. James hatte sich das Gewehr über die Schulter gehängt; seine Männer hielten ihre mit beiden Händen und zielten damit auf die Vorübergehenden. Samuel fragte sich, ob er es mit James aufnehmen konnte. Der Toubab war zwar kräftiger und bewaffnet, aber wenn es auf einen fairen Zweikampf Mann gegen Mann, Faust gegen Faust, Mut gegen Mut hinauslief, hatte er vielleicht eine Chance. Leicht würde es nicht werden, aber mit der Kraft der Verzweiflung konnte er es schaffen.
»Packst du eigentlich auch mal mit an?«, fragte Isaiah, und Samuel erschrak.
Er fuhr herum. »Was schleichst du dich so an?«, sagte er, verlegen, weil er sich in seiner Selbstversunkenheit ertappt fühlte.
»Bin nicht geschlichen. Bin direkt auf dich zu. Du warst so mit dem Kram von anderen beschäftigt …«
»Pfff«, sagte Samuel mit einer Geste, als wollte er einen Moskito verscheuchen.
»Hilfst du, die Pferde reinzubringen?«
Samuel verdrehte die Augen. Warum war Isaiah immer so gehorsam? Oder vielleicht nicht gehorsam, aber grundlos ehrerbietig. Für Samuel war das ein Anzeichen von Ängstlichkeit.
Isaiah legte Samuel kurz die Hand auf den Rücken und ging lächelnd zurück zur Scheune.
»Na schön«, sagte Samuel leise und folgte ihm.
Sie brachten die Pferde in den Stall, gaben ihnen Wasser und etwas Heu und kehrten den Rest in der linken Scheunenecke, dort wo die Ballen lagerten, zu einem ordentlichen Haufen zusammen. Isaiah lächelte über Samuels sichtliches Widerstreben, sein Stöhnen, Seufzen und Kopfschütteln, obwohl er doch genau wusste, wie riskant das war. Andererseits waren kleine Akte des Widerstands wie Balsam an einem Ort der Tränen.
Als sie ihre Arbeit beendet hatten, war der Himmel dunkel und sterngesprenkelt. Isaiah überließ Samuel seinem Groll, ging nach draußen und beging seinerseits einen kleinen Akt des Widerstands: Er lehnte sich gegen den Holzzaun, der die Scheune umgab, und schaute zum Himmel auf. Viel zu viele Sterne, dachte er und fragte sich, ob der Nachthimmel sie eines Tages, erschöpft von seiner Last, loslassen würde, sodass sich über allem nur noch Dunkelheit wölbte.
Samuel tippte Isaiah auf die Schulter und riss ihn aus seinen Gedanken.
»Na, und wer kümmert sich jetzt gerade um anderer Leute Kram?«
»Du meinst Himmelskram?« Isaiah grinste. »Wenigstens bin ich für heute fertig.«
»Bist n guter Sklave, was?« Samuel stupste Isaiah den Zeigefinger in den Bauch.
Isaiah schmunzelte, stieß sich vom Zaun ab und ging zurück zur Scheune. Vor dem Tor blieb er stehen, hob ein paar Kiesel auf und warf sie nach Samuel.
»Ha!«, rief er und rannte in die Scheune.
»Daneben!«, rief Samuel zurück und verfolgte ihn.
Sie jagten einander durch die Scheune, Isaiah wich aus, schlug Haken und lachte, wenn Samuel vergeblich nach ihm griff. Als Samuel schließlich hochsprang und gegen Isaiahs Rücken prallte, fielen sie mit dem Gesicht voran ins frisch aufgehäufte Heu. Isaiah wand sich, versuchte sich zu befreien, doch er war schwach vor Lachen. Samuel drückte sein Gesicht mit einem Lächeln und vor sich hin murmelnd an Isaiahs Hinterkopf. Die Pferde schnaubten, ein Schwein quiekte. Die Kühe waren still, nur die Glocken um ihren Hals läuteten bei jeder Bewegung.
Nach einer Weile ergab sich Isaiah, und Samuel ließ von ihm ab. Sie drehten sich auf den Rücken und betrachteten immer noch leise keuchend und mit bebender Brust durch ein Loch im Dach den Mond, der sie beide in ein bleiches Licht tauchte. Isaiah hob den Arm, versuchte, den Mondschein mit der Hand zu verdecken. Lichtstrahlen fielen zwischen seinen Fingern hindurch.
»Einer von uns sollte mal das Dach flicken«, sagte er.
»Vergiss die Arbeit. Ruh dich aus«, sagte Samuel, schärfer als beabsichtigt.
Isaiah betrachtete Samuels Profil: die vollen Lippen, die flache breite Nase. Die gekräuselten Haare, die in alle Richtungen abstanden. Sein Blick wanderte weiter zu Samuels verschwitzter Brust – die dunkle, im Mondlicht glänzende Haut – und ließ sich von dem Auf und Ab einlullen.
Samuel drehte den Kopf und erwiderte Isaiahs zärtlichen Blick.
Isaiah lächelte. Er mochte die Art, wie Samuel mit offenem Mund atmete, die Oberlippe leicht verzogen, die Zunge von innen gegen die Wange gedrückt, als würde er etwas im Schilde führen. Er berührte Samuel am Arm.
»Müde?«, fragte er.
»Sollte ich sein. Aber nee.«
Isaiah rückte näher an ihn heran. Wo ihre Schultern sich berührten, wurde die Haut feucht. Sie rieben die Füße aneinander. Samuel begann zu zittern, ohne zu wissen, warum; er war gereizt, weil er sich bloßgestellt fühlte. Isaiah bemerkte nichts davon, sah nur lockende Bereitschaft. Er beugte sich über Samuel, der kurz das Gesicht verzog, ehe er sich entspannte. Langsam, zärtlich ließ Isaiah die Zunge über Samuels Brustwarzen gleiten, die unter seinen Lippen zum Leben erwachten. Sie stöhnten.
Es war anders als bei ihrem ersten Kuss – wie viele Jahreszeiten war das her, sechzehn oder mehr? Jahreszeiten waren leichter zu zählen als Monde, die launisch sein konnten und sich nicht zeigten. Isaiah erinnerte sich an die Zeit, in der die Äpfel so groß und rot gewesen waren wie nie zuvor oder danach – als sie gestolpert waren und sich vor Scham nicht in die Augen sehen konnten. Jetzt senkte Isaiah den Kopf und ließ seine Lippen auf Samuels verweilen. Samuel zuckte kurz zurück. Nach und nach verschwand wie immer sein Zögern. Der innere Konflikt, der ihn am Anfang zu Aggression gegen Isaiah und sich selbst trieb, hatte nachgelassen. Jetzt waren davon nur noch Spuren geblieben, in seinem Blick, in seiner Kehle. Doch sie wurden von anderen Dingen überwältigt.
Sie ließen einander keine Zeit zum Ausziehen. Isaiahs Hose hing ihm um die Knie, die von Samuel baumelte von einem Knöchel, als sie ungeduldig ineinander stießen; Isaiahs sich bewegender Hintern und Samuels wippende Fußsohlen glänzten schwach im Mondlicht auf.
Als sie voneinander abließen, waren sie längst vom Heuhaufen tiefer in die Dunkelheit gerollt, lagen ausgestreckt auf dem Boden. Zu erschöpft, um sich vom Fleck zu rühren, obwohl sie liebend gerne im Fluss gebadet hätten. In stummem Einvernehmen beschlossen sie zu bleiben, wo sie waren, zumindest, bis ihr Atem sich beruhigt hatte und die letzten Nachbeben verebbt waren.
In der Dunkelheit hörten sie das Scharren der Tiere, die gedämpften Geräusche von den Menschen in ihren Hütten, Gesang, vielleicht auch Weinen – das eine ebenso wahrscheinlich wie das andere.
Das Lachen aus dem Großen Haus dagegen war deutlich hörbar. Aus der Entfernung – zwischen ihnen und dem Großen Haus lagen mindestens zwei Wände und eine nicht unerhebliche Distanz – versuchte Samuel die unterschiedlichen Stimmen auszumachen. Ein paar kamen ihm bekannt vor.
»Is immer dasselbe. Andere Schnauze, gleiches Geschwätz«, sagte er.
»Was?«, fragte Isaiah und ließ seinen Blick vom Dach zu Samuel wandern.
»Die da drüben.«
Isaiah atmete tief ein und langsam aus. Er nickte. »Und, was sollen wir dagegen tun? Denen eins auf die Schnauze geben? Die Zunge spalten?«
Samuel lachte. »Macht die Schnauze auch nicht besser. Und die Zunge is schon gespalten. Wie bei ner Schlange. Besser abhauen. Sie hier allein rumkriechen lassen.«
»Was andres kann man nich tun: nur abhauen?«
»Wenn einem nix andres übrig bleibt.«
Samuel seufzte. Isaiah mochte die Dunkelheit fürchten, er selbst nicht. Für ihn war sie Zuflucht, er verschmolz mit ihr, war sicher, dort den Schlüssel zur Freiheit zu finden. Trotzdem fragte er sich manchmal, was aus denen wurde, die in unbekannte Wildnis flüchteten. Einige wurden zu Bäumen, vermutete er. Andere zum Schlick am Grund eines Flusses. Wieder andere verloren den Wettlauf gegen den Berglöwen. Und manche verreckten einfach. Er schwieg, lauschte Isaiahs Atemzügen. Dann richtete er sich auf.
»Kommste mit?«
»Wohin?«
»Zum Fluss.«
Isaiah drehte sich schweigend auf die Seite. Er schaute in die Richtung, aus der Samuels Stimme kam, versuchte, seine Silhouette in der Finsternis auszumachen. Alles war eine einzige dunkle Masse, bis Samuel sich bewegte und sich die Lebenden von den Toten schieden.
Was war das?
Von irgendwoher hörte man ein Kratzen.
»Haste das gehört?«, fragte Isaiah.
»Was?«
Isaiah rührte sich nicht. Das Geräusch war verstummt. Er legte den Kopf wieder auf den Boden. Wieder wollte Samuel aufstehen.
»Warte«, flüsterte Isaiah.
Samuel sog scharf die Luft ein, legte sich jedoch wieder hin. Als er es sich bequem gemacht hatte, begann das Kratzen erneut. Er hörte es nicht, doch Isaiah schaute in Richtung der Pferdeboxen. Irgendetwas nahm dort Gestalt an. Anfangs war es nur ein winziger Punkt, wie ein Stern, der wuchs und wuchs, dann wurde er zu jener Nacht, in der er auf die Plantage gebracht worden war.
Zwanzig von ihnen, vielleicht mehr, saßen zusammengepfercht auf einem Pferdewagen. Sie waren an Fußknöcheln und Handgelenken aneinandergekettet, was ihre Bewegungen schwerfällig und gleichförmig machte. Einige trugen Eisenhelme, die den gesamten Kopf umschlossen und ihre Stimmen in Echos, den Atem in Rasseln verwandelte. Die übergroßen käfigartigen Gebilde lagen auf ihren Schlüsselbeinen auf, verursachten Wunden, aus denen ihnen das Blut bis zum Nabel hinunterfloss, bis ihnen schwindelig wurde. Alle waren nackt.
Sie fuhren – Isaiahs Gefühl nach ein Leben lang – über staubige, holprige Wege; tagsüber versengte ihnen die Sonne die Haut, nachts wurden sie von Moskitos zerstochen. Wenn es in Strömen regnete, waren die Gefangenen dankbar, denn dann konnten die Leute ohne Helm trinken, wann und wie viel sie wollten, und mussten sich nicht nach den bewaffneten Wachen richten.
Als sie schließlich eines Nachts Empty erreichten – wie die Halifax Plantage unter der Hand genannt wurde –, war nichts zu sehen außer einem schwachen Lichtschimmer im Großen Haus. Dann wurden sie vom Wagen gezerrt; alle strauchelten, weil sie ihre Beine nicht mehr spüren konnten. Einige konnten sich wegen des schweren Helms nicht aufrichten. Andere wurden von der Last der Leichen zurückgehalten, an die sie gekettet waren. Isaiah war noch zu klein, um den Mann groß zu beachten, der ihn auf den Arm nahm und vom Wagen trug, obwohl er selbst unsicher auf den Beinen war.
»Hab dich, Kleiner«, sagte der Mann mit rauer Stimme. »Das hab ich deiner Ma versprechen müssen. Und dass ich dir deinen Namen sag.«
Dann wurde Isaiah schwarz vor Augen.
Als er am nächsten Morgen wieder zu sich kam, waren sie immer noch aneinandergekettet, die Lebenden wie die Toten. Sie lagen in der Nähe der Plantage. Er hatte Hunger und Durst, war der Erste, der sich aufsetzte. Da sah er sie: eine Gruppe von Leuten mit Eimern, die über einen Pfad direkt auf sie zukamen. Einige waren in seinem Alter. Sie brachten ihnen Wasser und Essen – zumindest sollte das etwas Essbares sein, und etwas Besseres würde er nicht bekommen. Schweinefleisch, das stark gewürzt war, um den ranzigen Geschmack und den Übelkeit erregenden Geruch zu überdecken.
Ein Junge näherte sich Isaiah, hielt ihm eine Schöpfkelle hin. Isaiah öffnete den Mund und schloss die Augen. Er schluckte, und süßes, warmes Wasser tropfte ihm aus den Mundwinkeln. Als er fertig war, sah er zu dem Jungen auf; das grelle Sonnenlicht zwang ihn, die Augen zusammenzukneifen, und er konnte nur Umrisse ausmachen. Der Junge trat einen Schritt zur Seite, sodass sein Körper die Sonne verdeckte. Er sah Isaiah mit großen, misstrauischen Augen an, das Kinn zu stolz gereckt für jemanden in seiner Lage.
»Willste noch mehr?«, fragte der Junge, der Samuel hieß.
Isaiahs Durst war gestillt, doch er nickte.
Als das Licht in die Dunkelheit zurückkehrte, aus der es gekommen war, betastete Isaiah seinen Körper, um sich zu vergewissern, dass er kein Kind mehr war. Er war er selbst, kein Zweifel, doch was gerade aus einem winzigen Punkt in der Dunkelheit zu ihm gekommen war, bewies, dass die Zeit verloren ging, wann und wo es ihr beliebte, und er hatte noch keinen Weg gefunden, wie man sie zurückholen konnte.
Isaiah war nicht ganz sicher, aber die Erinnerung hatte ihm bestätigt, dass Samuel und er ungefähr im gleichen Alter waren; sechzehn oder siebzehn, wenn sie alle Jahreszeiten richtig gezählt hatten. Und doch blieb so vieles zwischen ihnen unausgesprochen. Nur Schweigen konnte verhindern, dass die Seele kaputtging. Arbeiten, essen, schlafen, spielen. Vögeln mit Vorsatz. Wer überleben wollte, übermittelte Wissen und Erfahrung, indem er sie umkreiste und nie direkt ansprach. Wer war schon dumm genug, Leuten seine Wunden zu zeigen, die nur mit ungewaschenen Fingern darin herumbohrten?
Die Stille war einvernehmlich, eher ererbt als vereinbart, sicher, obwohl sie verheerende Zerstörung in sich barg. Doch dann hörte Isaiah, immer noch ganz im Bann seines zum Leben erwachten Traumes, sich sagen:
»Hast du dich je gefragt … wo deine Mam ist?«, sagte die Stimme.
Als wäre eine andere Stimme, die klang wie seine, aus seinem Mund gekommen. Seine und doch nicht seine. Wie war das möglich? Isaiah erstarrte. Rutschte näher an Samuel heran. Strich über seinen Körper, ließ die Hand auf Samuels Bauch liegen.
»War nicht so gemeint … Ich mein, ich wollt nich sagen …«
»Erst spuckst du einen an, dann willst dus zurücknehmen?«, sagte Samuel.
Isaiah war verwirrt. »Das hab ich nich gewollt. Is mir einfach rausgerutscht.«
»Klar.« Samuel seufzte.
»Ich … Hast du noch nie ne Stimme gehört und gedacht, es wär nich deine und dann war sies doch? Irgendwie? Ich weiß nich. Kanns nich erklären«, sagte Isaiah.
Vielleicht wurde er verrückt, er hatte das schon ein paarmal bei anderen miterlebt; das konnte die Plantage einem antun – die Seele zog sich zurück, um den Körper vor dem zu schützen, was er zu tun gezwungen war, aber der Mund brabbelte weiter vor sich hin. Er strich über Samuels Bauch, um sich zu beruhigen. Die Liebkosung machte sie schläfrig. Isaiah fielen die Augen zu. Fast wäre er eingeschlafen, doch wieder wurde er von seiner eigenen Stimme überrascht.
»Vielleicht erinnert sich irgendwas in dir, dein Blut oder deine Eingeweide, an ihr Gesicht?«, sagte Isaiah, überrascht über die Worte, die aus ihm heraussprudelten, als hätten sie sich lange angestaut. »Und vielleicht, wenn du in den Fluss schaust, kannst dus da sehen.«
Stille. Dann sog Samuel scharf die Luft ein.
»Möglich. Kann man nie wissen«, antwortete er schließlich.
»Aber vielleicht fühlen«, platzte Isaiah heraus.
»Hm?«
»Ich sag, vielleicht kann mans …«
»Nee. Nich du. Egal«, sagte Samuel. »Gehen wir zum Fluss.«
Isaiah wollte aufstehen, doch sein Körper wollte neben Samuel liegen bleiben.
»Ich erinner mich an meine Mam und meinen Pappy, aber nur an ihre weinenden Gesichter. Irgendwer hat mich ihnen weggenommen, und sie sind dagestanden und haben mir nachgestarrt, als wär der Himmel eingestürzt. Ich hab die Hand nach ihnen ausgestreckt, aber sie waren zu weit weg, und ich hab sie nur noch rufen hören, dann nix mehr.«
Beide waren verblüfft, Isaiah über die Erinnerung, Samuel, weil er sie zu hören bekam; beide rührten sich nicht. Sie schwiegen kurz, dann drehte sich Samuel zu Isaiah um.
»Du erinnerst dich an deinen Pappy?«
»Da war ein Mann, der mich getragen hat«, sagte Isaiah, und lauschte der Geschichte, die seine Stimme erzählte. »Nich mein Pappy. Der Mann hat gesagt, er weiß meinen Namen. Aber er hat ihn mir nie verraten.«
In dem Moment sah Isaiah, wie seine eigene Hand in die Dunkelheit griff, klein, panisch, wie damals. Vielleicht, dachte er, hatte er sie nicht nur nach seiner Mam und seinem Pappy ausgestreckt, sondern auch nach den verblassten Gestalten neben ihnen, deren Namen für immer verloren waren, deren Blut die Erde nährte und heimsuchte und deren Stimmen nur noch ein Flüstern waren. Samuel griff nach Isaiahs Hand und legte sie wieder auf seinen Bauch.
»Irgendwas is hier«, sagte Samuel.
»Was?«
»Nix.«
Isaiah strich Samuel erneut über den Bauch, was seine Stimme zu ermutigen schien, sich erneut zu Wort zu melden.
»Das Letzte, was sie mir zugerufen haben, war ›Kojote‹. Das versteh ich bis heute nich.«
»›Vorsicht‹ vielleicht?«, fragte Samuel.
»Warum sagst du das?«
Samuel öffnete den Mund, doch Isaiah sah es nicht. Er hörte auf, ihn zu streicheln, und legte den Kopf auf Samuels Brust.
»Ich will das alles gar nicht sagen«, krächzte er. Seine Wangen waren feucht, als er den Kopf fester an Samuel presste.
Samuel schüttelte den Kopf. »Ja.«
Er sah sich um, drückte Isaiah an sich, dann schloss er die Augen. Der Fluss konnte warten.
DEUTERONOMIUM
Als Samuel erwachte, war sein Gesicht ins orangefarbene Licht der langsam aufgehenden Sonne getaucht. Der Hahn krähte, doch er hatte ihn schon so oft gehört, dass sein Schrei mit den Hintergrundgeräuschen verschmolz. Isaiah war bereits auf den Beinen. Samuel hatte ihn früher am Morgen gebeten, ihn schlafen, noch ein paar Momente der Ruhe genießen zu lassen. So was war hier Diebstahl, aber wie konnte man was stehlen, was einem gehörte?
Samuel lag da, ruhig wie der Morgen, der seinen Körper mit dem Licht des kommenden Tages einfärbte, wild entschlossen, sich nicht von der Stelle zu rühren, bis er unbedingt musste. Er konnte Isaiah nicht sehen, hörte jedoch durch das offene Scheunentor, dass er zum Hühnerstall ging. Samuel setzte sich auf, schaute sich in der Scheune um, bemerkte das verstreute Heu vom Vorabend. Die Dunkelheit hatte die Spuren ihres Tuns verborgen, die der Tag nun offenbarte. Niemand konnte wissen, dass Lust die Ursache war, aber auch Nachlässigkeit wurde bestraft. Seufzend erhob er sich, ging zu der Scheunenwand mit den Geräten und holte den Besen. Widerstrebend fegte er die Spuren ihres Glücks zu einem Haufen zusammen, gleich neben den gestapelten Heuballen.
Isaiah kam mit zwei Eimern in die Scheune zurück.
»Morgen«, sagte er mit einem Lächeln.
Samuel grinste ihn schief an, ohne den Gruß zu erwidern. Isaiah lächelte. Er stellte die Eimer ab, ging zu Samuel und strich über seinen Arm. Nahm seine Hand und drückte sie, bis Samuel zurückdrückte. Er sah zu, wie Samuels anfangs noch misstrauischer Blick ihn ganz in sich aufnahm. Sah sich in diesen Augen von einem dunklen Braun, wie er es sonst nur aus Träumen kannte, voller Wärme aufgenommen. Und er lud Samuel ein, in seine Augen hineinzublicken, damit auch er die Wärme darin erkannte.
Samuel ließ seine Hand los. »Tja, wo wir schon auf sind, können wir auch …« Isaiah deutete vage in Richtung der Plantage, nahm erneut Samuels Hand und küsste sie.
»Nich wenns hell ist«, sagte Samuel mit gerunzelter Stirn.
Isaiah schüttelte den Kopf. »Wenn du schon ganz unten bist, kannste nicht tiefer fallen.«
Samuel seufzte, gab Isaiah den Besen und ging nach draußen, wo sich ein diesiger Himmel auf den noch jungen Tag herabsenkte.
»Mir is nich danach.«
»Nach was?«, fragte Isaiah, der ihm folgte.
»All dem hier.« Samuel machte eine ausholende Armbewegung.
»Aber wir müssen«, erwiderte Isaiah.
Samuel schüttelte den Kopf. »Einen Scheiß müssen wir.«
»Willste die Peitsche riskieren?«
»Es braucht weniger als das für die Peitsche. Schon vergessen?«
Isaiah verlor die Fassung. »Ich halts nicht aus, wenn sie dir wehtun.«
»Hältst dus vielleicht auch nicht aus, mich frei zu sehen?«
»Sam!« Isaiah schüttelte den Kopf und ging zum Hühnerstall.
»Tut mir leid«, flüsterte Samuel.
Isaiah bekam diese letzten Worte nicht mit, und Samuel war froh darüber. Er ging zu den Schweinen, nahm einen Eimer, sah weiter zu Isaiah hinüber, als ihn Erinnerungen überfielen.
An jenem Tag – oder vielmehr, in jener Nacht, unter einem schwarzen Himmel voller Sternenstaub – waren sie noch zu jung gewesen, um ihr Leben zu begreifen. Sie hatten durch ein Astloch im Dach zum Himmel aufgesehen. Ein Wimpernschlag, mehr nicht. Erschöpfung von der Arbeit, die ihre jungen Körper kaum bewältigen konnten, hatte sie auf ihr Lager aus Heu geworfen. Zuvor, am Fluss hatten sich ihre Hände gestreift, sich länger berührt, als Samuel erwartet hatte. Ein verwirrter Blick, dann hatte Isaiah gelächelt, und Samuels Herz hatte nicht genau gewusst, ob es schlagen sollte oder nicht. Und so war er aufgestanden und zur Scheune gegangen. Isaiah folgte ihm.
In der Scheune war es dunkel. Ihnen war nicht danach, eine Fackel oder Lampe anzuzünden, und so kehrten sie etwas Heu zusammen und breiteten die Flickendecke darüber, die Be Auntie für sie genäht hatte. Dann legten sie sich auf den Rücken darauf. Samuel atmete aus, und Isaiah sagte: »Jassir.« Das Wort hatte für Samuel damals plötzlich einen ganz neuen Klang bekommen. Nicht unbedingt wie eine Liebkosung, aber zärtlich. Die Falten seiner Lenden waren feucht, und er versuchte, seine Blöße mit den Händen zu verbergen. Ein Reflex. Isaiah dagegen drehte sich auf die Seite, wandte sich Samuel zu, alle Körperteile offen, frei und schamlos prickelnd zur Schau gestellt. Sie sahen einander an, dann wurden sie dort, in der Dunkelheit, eins.
Es dauerte nur einen Augenblick, und beide hatten begriffen, wie kostbar Zeit ist. Was für eine Vorstellung, man hätte so viel Zeit, wie man wollte. Um Lieder zu singen. Oder um in einem glitzernden Fluss im hellen Sonnenlicht die Arme auszubreiten und den Menschen zu umarmen, den man liebte und dessen Atem mit dem eigenen verschmolz, ein, aus, derselbe Rhythmus, dasselbe Lächeln. Samuel wusste nicht, wie viel Lebenslust er in sich hatte, bis er Isaiahs spürte.
Erinnerungen kamen oft in Bruchstücken. Doch je nachdem, was sie ins Gedächtnis rufen wollten, überfielen sie einen manchmal auch in einem chaotischen Schwall. Samuel fütterte gerade die Schweine, als die Nadel des Schmerzes, der ihm schon den ganzen Morgen zu schaffen gemacht hatte, seine Brust durchbohrte und austrat. Es blutete kaum, doch Blut war Blut. Wer hätte gedacht, dass Blut sprechen konnte? Er hatte andere von Bluterinnerungen erzählen hören, aber das war doch nur ein Vergleich, oder? Keiner von ihnen hatte Stimmen erwähnt. Aber anscheinend hatte Isaiah sie letzte Nacht mit seiner Frage in die Scheune eingeladen, mit der er all die stillschweigenden Regeln, denen so viele ihrer Leute folgten, über den Haufen warf.
Samuel gab den Schweinen mehr Futter. Ignorierte die Nadel in seiner Brust, das Flüstern des Blutes, das tropfenförmig austrat.
Ihm wurde heiß, und in seinem Körper kribbelte es.
Hast du dich je gefragt, wo deine Mam ist?
Bis jetzt hatte er dem bohrenden Schmerz solcher Fragen ausweichen können, der sich leicht in dem überreichlichen Kummer an diesem Ort ignorieren ließ. Niemand fragte andere nach ihren Narben, fehlenden Gliedmaßen, dem Zittern oder den nächtlichen Ängsten, alle versteckten sie in abgelegenen Winkeln hinter Säcken, ertränkten sie, begruben sie. Und jetzt buddelte Isaiah irgendwelchen Mist aus, den ans Licht zu zerren er kein Recht hatte, und sagte Dinge, die er angeblich nicht meinte. Samuel hatte gedacht, sie hätten eine Abmachung: die Leichen dort ruhen zu lassen, wo sie verdammt noch mal ruhten.
Gestern Nacht war es zum Glück dunkel gewesen, sodass Isaiah nicht sehen konnte, wie Samuel sich aufrichtete und ankündigte, er wolle zum Fluss gehen. Er hatte dort untergehen und nie wieder an die Oberfläche kommen wollen. Stattdessen war er sitzen geblieben, alle Muskeln angespannt von der Anstrengung, nach etwas zu greifen, was nicht da war. Er blinzelte und blinzelte, doch seine Augen hörten nicht auf zu brennen.
Er seufzte. Selbst in der Dunkelheit hatte er Isaiahs erwartungsvolle Ruhe nach der Frage gespürt, die wie ein stetiger, unablässiger Sog an ihm zerrte, ihn beschwor, sich noch mehr zu öffnen. Aber hatte er nicht schon genug offenbart? Niemand kannte sein Innerstes – wie es in ihm aussah, sich anfühlte, schmeckte –, niemand außer Isaiah. Was sollte er ihm noch alles geben? Am liebsten hätte er auf irgendetwas eingedroschen. Sich eine Axt geschnappt und einen Baum in Stücke gehackt. Einem Huhn den Hals umgedreht.
Das Schweigen zwischen ihnen war quälend gewesen. Dann hatte Samuel scharf nach Luft geschnappt, als sich zu seinen Füßen der Schatten einer Frau in der Finsternis erhob. Dunkler als die Dunkelheit selbst hatte sie dagestanden: nackt, mit hängenden Brüsten und breitem Becken. Ihr Gesicht kam ihm irgendwie bekannt vor, obwohl er es nie zuvor gesehen hatte. Ein Schatten in der Dunkelheit? Das ergab keinen Sinn. Schatten waren Tageslichtbewohner. Und doch war sie da: schwarze Haut, die die Nacht selbst neidisch gemacht hätte, Augen wie Fragen. War das seine Mutter, heraufbeschworen von Isaiahs Paktbruch? Hieß das, dass auch er ein Schatten war? Plötzlich deutete sie mit dem Finger auf ihn, und erschrocken hatte er das Schweigen gebrochen.
Möglich. Kann man nie wissen, hatte er geantwortet.
Hatte sie Isaiah die Worte eingegeben?
Während die Schweine das Futter in sich reinschlangen, versuchte Samuel, die Nadel in seiner Brust und das Blut loszuwerden. Er hörte ein schwaches Geräusch und hielt inne. Schwer zu sagen, ob es nur das Rascheln der Gräser gewesen war oder ein Schrei. Bei den Bäumen entdeckte er etwas, das aussah wie der Schatten. War er im Morgenlicht zurückgekommen, um sich in Erinnerung zu rufen? Würde er, aufgestört von Isaiahs Frage, von nun an überall dort erscheinen, wo er sich aufhielt? Denn wie man hörte, taten Mütter solche Dinge – wachten über ihre Kinder, bis die Kinder keine Kinder mehr waren, selbst Leben in die Welt setzten und zuschauten, wie es aufblühte oder verdorrte.
»’Zay! Komm und guck dir das an.« Samuel deutete auf den Wald.
Isaiah kam zu Samuel. »Willste dich nicht dafür entschuldigen, was du eben gesagt hast?«
»Hab ich schon. Hast mich bloß nicht gehört. Aber schau mal. Da drüben. Da bewegt sich was.«
»Die Bäume?« Isaiah war abgelenkt, wollte das Thema nicht wechseln.
»Nein, nein. Da hinten. Ich weiß nich, was … is das ein Schatten?«
Isaiah kniff die Augen zusammen, sah etwas flimmern.
»Schwer zu …«
»Siehst dus?«
»Ja. Keine Ahnung, was das is.«
»Gehn wir rüber.«
»Und kriegen die Peitsche, weil wir zu nah an der Grenze sind?«
»Pah«, sagte Samuel, rührte sich jedoch nicht vom Fleck.
Während sie zu den Bäumen hinüberspähten, wurde das, was schwarz gewesen war, weiß, und James, der Aufseher, tauchte auf, zusammen mit drei anderen Toubab, die für ihn arbeiteten.
»Glaubst du, die haben jemand erwischt?«, fragte Samuel, seltsam erleichtert.
»Angeblich kann mans an ihren Ohren sehen«, entgegnete Isaiah und ließ James und seine Männer nicht aus den Augen. »Daran, wie die Ohrläppchen runterhängen. Aber von hier aus kann ich nix erkennen.«
»Vielleicht patrouillieren sie nur. Is doch bald Zeit, die Leute aufs Feld zu rufen, oder?«
»M-hm.«
Beide blieben stehen und sahen zu, wie die Männer sich durch Gestrüpp und hohes Gras einen Weg zur Plantage bahnten, die sich bis zum Horizont erstreckte.
Auf Empty begann sich Leben zu regen; Leute kamen aus ihren Hütten, um sich dem Tag zu stellen. Samuel und Isaiah warteten ab, wer, wenn überhaupt, ihre Anwesenheit zur Kenntnis nehmen würde. Neuerdings waren ihnen aus irgendeinem Grund nur noch Maggie und ein paar andere gewogen.
Als das Signalhorn ertönte, zuckte Isaiah zusammen. »Daran werd ich mich nie gewöhnen«, sagte er.
Samuel drehte sich zu ihm. »Wenn du endlich gescheit wirst, musst dus auch nicht.«
Isaiah schnalzte mit der Zunge.
»Sag bloß, du bist glücklich hier, ’Zay?«
»Manchmal«, sagte Isaiah und schaute Samuel in die Augen. »Weißt du noch, damals im Wasser?«
Samuel ertappte sich dabei, dass er unwillkürlich lächelte.
»Zum Glücklichsein brauchts nicht nur Tun, sondern auch Denken«, erwiderte Isaiah dann auf Samuels Frage.
»Schätze, dann sollten wir mit dem Denken anfangen.«
Wieder erklang das Signal. Samuel schaute zum Feld hinüber. Seine Augen wurden schmal. Er spürte Isaiahs Hand auf seinem Rücken. Isaiah ließ sie dort liegen, ruhig, beständig, trotz der Hitze angenehm. Ein Moment, der fast zu schnell verging und doch nicht schnell genug, als würde Isaiah ihn stärken, ihm Halt geben, etwas, worauf er sich stützen konnte, wenn seine Beine müde wurden.
Samuel sagte: »Nich wenns hell ist.«
Trotzdem ließ Isaiah seine Hand noch eine Weile dort liegen. Er summte, so wie er es manchmal mitten in der Nacht tat, wenn er Samuel über die Haare strich, damit der besser schlief.
Samuels Gesichtsausdruck sagte: Schluss jetzt! Aber eine helle, klare Stimme in seinem Kopf sagte: Isaiah tut gut. Wie Balsam.
MAGGIE
Sie wachte auf.
Gähnte.
Ein Grab. Ein verdammtes Grab ist das, flüsterte Maggie, als es Zeit war, in die Küche zu gehen, an die sie gefesselt war – ganz ohne Kette. Und doch hing sie an ihrem Knöchel und klirrte bei jedem Schritt.
Sie fluchte leise. Maggie hatte sich angewöhnt, leise vor sich hin zu grummeln, sodass die Leute ihre Beleidigungen nicht mitbekamen. Eine Geheimsprache, die tief in der Kehle saß.
Es war noch dunkel, aber sie lag schon einen Augenblick zu lang auf ihrem Bett aus Heu, was sie womöglich büßen musste. Alle Halifaxes hatten ihre ganz persönliche Art, Unzufriedenheit auszudrücken, einige grausamer als andere. Sie konnte ein Lied davon singen.
Sie stand auf und verdrehte beim Anblick der Hunde zu ihren Füßen die Augen. Sie schlief bei ihnen auf der Veranda hinter dem Haus. Nicht ihre Entscheidung. Wenigstens war es eine geschlossene Veranda, mit Blick auf den Garten von Ruth Halifax. Jenseits davon lag eine Wiese mit Wildblumen in allen Farben; doch nur die blauen waren so vollkommen, dass es einem ans Herz gehen konnte. Reihen von Bäumen markierten das Ende der Wiese, jenseits davon ging sandiger Boden in das Ufer des Yazoo River über. In dem schlammigen Wasser wuschen sich die Leute, wenn sie durften – unter dem wachsamen Blick eines Mannes, dessen Namen sie aus gutem Grund nicht länger in den Mund nahm. Am anderen Ufer des Flusses, das weiter entfernt aussah, als es war, standen die Bäume in der ersten Reihe so dicht, dass sie nicht erkennen konnte, was dahinter lag, sosehr sie auch die Augen zusammenkniff.
Eigentlich hätte sie die Tatsache unerträglich finden müssen, dass man sie zwang, hier auf der Veranda zu schlafen, in einem behelfsmäßigen Bett aus Heu, das sie von Samuel und Isaiah hatte – oder, wie sie sie bei sich nannte, die Zwei Beiden. Aber der Geruch der Wiese beruhigte sie, und wenn sie schon bei Paul und seiner Familie im verdammten Großen Haus wohnen musste, dann war dies der beste Ort, denn er war am weitesten von ihnen weg.
Die Hunde hatte Paul selbst ausgewählt. Sechs Tiere, die jede Seele auf der Plantage kannten, für den Fall, dass mal eine auf Abwege geriet. Sie hatte schon erlebt, wie die Bestien Menschen, die glaubten, fliegen zu können, wenn nötig bis hoch in den Himmel verfolgten und sie von dort runterholten. Die Hunde: Schlappohren, schwermütiges Bellen, traurige Triefaugen, das ganze Drum und Dran. Man hätte Mitleid mit ihnen haben können, aber sie hatte miterlebt, wie sie die Leute am Hintern zurück aufs Baumwollfeld schleiften – oder, in einem Fall, zum Hackklotz.
Sie winselten, was sie verabscheute. Warum sie hier eingesperrt wurden, würde sie nie begreifen. Tiere gehörten nach draußen.
»Los, haut ab«, sagte sie zu ihnen und öffnete die Tür zum Garten. »Jagt Hasen und lasst mich in Ruhe.«
Alle sechs rannten nach draußen. Sie atmete tief ein; vielleicht konnte sie genug vom Duft der Wiese in sich aufnehmen, dass es für den ganzen Tag reichte. Leise schloss sie die Tür, damit sie nicht zuschlug. Dann humpelte sie durch die andere Tür in die Küche. Ein Raum doppelt so groß wie die Hütten, in denen ihre Leute auf Empty lebten. Trotzdem kam er ihr beengt vor, als würde etwas Unsichtbares sie von allen Seiten bedrängen.
»Durchatmen, Mädchen«, sagte sie laut zu sich und zog ihr lahmes Bein hinter sich her zum Küchentresen, der sich unter einer Reihe von Fenstern an der Ostseite erstreckte, die Ausblick auf die Scheune boten.
Sie nahm zwei Schüsseln und einen Sack Mehl aus dem Schrank unter dem Tresen und holte einen Krug Wasser und ein Sieb aus dem Regal. Sie verknetete die Zutaten zu einem Teig für weiche Brötchen: ein schwerer Klumpen, der mithilfe von Hitze, Zeit und ihren wunden Fingerknöcheln wieder einmal zu einer Mahlzeit verarbeitet wurde, die den Appetit der Halifaxes nicht stillte.
Sie ging nach draußen zu dem Holzstapel unter einem der Fenster, um ein paar Scheite für den Ofen zu holen. Tagsüber konnte sie von dort aus über die Weide vor dem Haus, den langen Pfad und jenseits des Tors die staubige Straße sehen, die zum Marktplatz von Vicksburg führte.
Sie hatte den Platz bisher nur einmal gesehen, das war, als man sie aus Georgia verschleppt und nach Mississippi gebracht hatte. Ihr ehemaliger Herr hatte ihr Fußketten angelegt und sie auf einen Wagen zwischen andere verängstigte Menschen gesetzt. Die Fahrt hatte Wochen gedauert. Einmal aus den holzwirtschaftlich genutzten Wäldern heraus, wurde die Straße breiter und führte an Gebäuden vorbei, wie sie sie noch nie gesehen hatte. Man stellte sie auf eine Plattform vor eine große Menschenmenge. Neben ihr stand ein schmutziger Toubab, der nach Bier roch und Zahlen rief. Die Menge starrte sie an, aber niemand hob die Hand – niemand außer Paul; sie hörte ihn zu seinem Begleiter sagen, dass sie eine gute Küchenmagd und Gesellschafterin für Ruth abgeben würde.
Mit den Holzscheiten ging Maggie zum Ofen neben einer der beiden Türen. Diese führte auf die Veranda, die gen Westen lag und wo sie schlief, die andere ins Esszimmer im Süden; dahinter lagen die Eingangshalle, die Wohnstube und der Salon, wo Ruth Besuch empfing, wenn sie dazu in der Lage war. Vom Salon aus hatte man Ausblick auf die Plantage. Ruth saß oft stundenlang am Fenster und schaute hinaus, ein so feines Lächeln im Gesicht, dass Maggie nicht sicher war, ob es tatsächlich ein Lächeln war.
An der Rückseite des Hauses befand sich Pauls Arbeitszimmer, das mehr Bücher enthielt, als Maggie je an einem Ort gesehen hatte. Die kurzen Blicke, die sie darauf erhaschte, weckten den Wunsch in ihr, eins der Bücher aufzuschlagen und die Worte auszusprechen, ganz gleich welche, solange sie sie selbst aussprechen durfte.
Im zweiten Stock lagen an den vier Ecken des Hauses jeweils vier große Schlafzimmer. Paul und Ruth schliefen in den beiden östlichen Räumen mit einem Balkon, von dem sie einen Großteil ihres Besitzes überblicken konnten. An der Rückseite des Hauses, im nordwestlichen Raum, schlief Timothy, ihr einziges überlebendes Kind, wenn er nicht gerade in den Nordstaaten studierte. Ruth bestand darauf, dass seine Bettwäsche auch in seiner Abwesenheit wöchentlich gewechselt und sein Bett jeden Abend aufgedeckt wurde. Der vierte Raum diente als Gästezimmer.
Scharfsichtige Menschen nannten die Halifax-Plantage bei dem Namen, der diesem Ort angemessen war: Empty. Von hier gab es kein Entkommen. Umgeben von dichter, wuchernder Wildnis – Rotahorn, Hainbuchen, Schneeglöckchenbäume und Kiefern, so breit, hoch und verwachsen, wie man es sich nur vorstellen konnte, trügerische Gewässer, in denen uralte Zähne geduldig darauf warteten, sich in Fleisch zu bohren – war es der perfekte Ort, um ganze Völker gefangen zu halten.
In Mississippi war es heiß und schwül. Maggie schwitzte schon jetzt so stark, dass der Schal um ihren Kopf durchnässt war, als sie das Kochgeschirr zusammensuchte. Sie würde sich umziehen müssen, bevor die Halifaxes zum Frühstück kamen. Ihr Erscheinungsbild war ihnen wichtig, diesen Leuten, die sich vor dem Essen nicht einmal die Hände wuschen oder sich nicht säuberten, wenn sie vom Plumpsklo kamen.
Mit mehlbestäubten Händen strich Maggie sich über die Flanken, glücklich darüber, dass ihr Körper – nicht nur durch ihre Kurven, sondern auch durch die Haut, die in der sengenden Sonne nie verbrannte oder rot wurde – sie von den Menschenfängern unterschied. Sie tat sich selbst Gutes, wann immer sie konnte. Das Einzige, was sie bedauerte, war ihr Hinken (und nicht den Umstand an sich, sondern die Ursache). Die Welt hatte sich Mühe gegeben, ihr andere Gefühle einzuimpfen. Hatte versucht, sie verbittert zu machen. Ihre Gedanken gegen sich selbst zu richten. Sie dazu zu bringen, das, was sie im Spiegel sah, als abstoßend zu empfinden. Doch den Gefallen tat sie ihnen nicht. Allen Grausamkeiten zum Trotz liebte sie ihre Haut. In ihren Augen war sie von einem Schwarz, nach dem Toubab-Männer sich verzehrten und das den eigenen Männern Respekt einflößte. Sie wusste darum und leuchtete im Dunkel.
Wenn sie über ihren Körper strich, weckte das noch ein verbotenes Gefühl in ihr: Selbstvertrauen. Nicht dass es mit bloßem Auge sichtbar gewesen wäre. Es war eine stille Rebellion, doch sie genoss gerade die Intimität daran. Davon fand man hier herzlich wenig – Intimität, Freude, was auch immer. Es gab nur die vier elenden Ecken der Küche, in denen das Unglück hing wie an Haken und in denen der Groll aus jedem Winkel quoll – aus Dielen, Türritzen und aufeinandergepressten Lippen.
Sie warf Holzscheite in den Ofen, dann holte sie eine Pfanne aus dem Schrank. Zurück am Tresen nahm sie den Teig aus der Schüssel. Behutsam formte sie ihn zu Brötchen. Legte sie ordentlich in die Pfanne und schob sie in den Ofen. Das hieß allerdings nicht, dass sie sich ausruhen konnte. Wenn man derart erfinderischen Leuten diente, gab es immer sofort das Nächste zu tun.
Ihr Einfallsreichtum war verblüffend. Einmal hatte Paul sie zu sich gerufen. Als sie in sein Zimmer kam, stand er am Fenster, gesichtslos in der grellen Sonne.
»Komm her«, sagte er, und seine Ruhe war mit Heimtücke gespickt.
Er befahl ihr, seine Männlichkeit zu halten, während er in eine Bettpfanne urinierte. Wenn man die anderen Möglichkeiten bedachte, hätte es schlimmer sein können. Doch dann wies er sie an, sie auf ihre Brust zu richten, und sie hatte das Zimmer mit gelben Flecken auf dem Kleid verlassen, die Fliegen anzogen. Alles in allem konnte sie sich immer noch glücklich schätzen, trotzdem: wie verwirrend.
Maggie versuchte sich an etwas zu erinnern, was Cora Ma’Dear – ihre Großmutter in Georgia, die ihr beigebracht hatte, wer sie war – einmal zu ihr gesagt hatte. Sie war damals noch ein kleines Mädchen gewesen und ihre gemeinsame Zeit zu kurz. Aber einige Dinge hatten sich ihr unauslöschlich eingeprägt – sie mochten verschwimmen, aber sie verschwanden nicht. Sie versuchte sich an das alte Wort von jenseits des Meers zu erinnern, das Cora Ma’Dear für Toubab benutzt hatte. Oyibo! Das war es. Dafür gab es in dieser Sprache keine Entsprechung. Das, was ihm am nächsten kam, war »Unfall«. Und das traf den Nagel auf den Kopf: Diese Leute waren ein Unfall.
Ihre Brutalität machte Maggie nicht viel aus, denn sie erwartete nichts anderes von ihnen. Menschen wurden ihrer Natur selten untreu, und obwohl es sie schmerzte, es zuzugeben, fand sie Trost im Vertrauten. Waren sie dagegen freundlich, bekam sie es mit der Angst zu tun. Denn ihre Freundlichkeit war, wie jede Falle, unberechenbar. Wies man sie zurück, riskierte man Konsequenzen. Aber die Bestrafung nahm dann wenigstens eine wiedererkennbare Form an, und sie wurde nicht zum Narren gehalten.
Als sie vor Jahren nach Empty gekommen war, hatte Ruth – sie waren beide ungefähr im gleichen Alter – sie herzlich aufgenommen. Beide waren, trotz des seit Kurzem fließenden Bluts, noch halbe Kinder.
»Hör auf zu weinen«, hatte Ruth damals fröhlich zu ihr gesagt, die dünnen Lippen zu einem Lächeln verzogen, das schiefe Zähne entblößte.
Ruth bugsierte sie ins Haus, das größte, das Maggie je gesehen hatte, nahm sie sogar mit nach oben in ihr Zimmer, wo sie ein Kleid aus der Kommode zog. Maggie war so dreist gewesen, es zu bewundern. Hatte sich von seinem Muster aus orangenfarbenen Rosenblüten verführen lassen, die so winzig waren, dass sie fast aussahen wie Punkte. Sie hatte noch nie etwas so Hübsches besessen. Wer wäre da nicht aufgeregt gewesen? Ruth war damals schwanger gewesen – mit einem der Kinder, die nicht überlebt hatten – und hatte ihre veränderte Körperform als Grund genannt, warum sie etwas so Wunderschönes verschenken wollte.
»Es soll im Winter kommen. Schrecklich, im Winter ein Kind zu kriegen. Findest du nicht auch?«
Maggie hatte nichts erwidert, weil jede Antwort Unheil bedeuten konnte.
»Na ja, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass es keine Lungenentzündung bekommt, nicht wahr?«, hatte Ruth gesagt, um die Stille zu füllen.
Das war eine sichere Frage. Maggie nickte.
»Ah, du wirst so hübsch in dem Kleid aussehen! Deine Haut glänzt richtig. Ich fand schon immer, dass Weiß euch Niggern besser steht als unsereinem.«
Damals war Maggie noch jung und ahnungslos gewesen. Sie hatte nicht gewusst, wie gefährlich es war, etwas Derartiges anzunehmen. Das Kleid konnte ihr jeden Moment unter Anschuldigungen wieder weggenommen werden. Und als es hieß, Maggie habe es gestohlen, nachdem Ruth ihr nichts als Freundlichkeit entgegengebracht hatte, unternahm Maggie nicht einmal den Versuch, es zu leugnen, denn was hätte es gebracht? Sie nahm die Schläge gleichmütig entgegen, obwohl sie Zeugen dafür hatte, dass es ein Geschenk gewesen war.
Oh, wie hatte Ruth geweint, als sie von ihrer Bestrafung erfuhr – als wäre ihre Aufrichtigkeit dadurch über jeden Zweifel erhaben. Ihre Tränen wirkten echt. Sie erzählte irgendwelchen Unsinn über ein schwesterliches Band, obwohl sie nie gefragt hatte, ob Maggie eine solche Beziehung überhaupt wünschte. Aber anscheinend verstand es sich von selbst, dass, wenn Ruth Wasser ließ, Maggie beide Hände unter den Strahl halten und trinken wollte. Und so weinte Ruth, und Maggie lernte, dass die Tränen einer Toubab-Frau mächtiger waren als jeder Zauber; sie konnten Stein erweichen und Menschen aller Hautfarben hilflos, unbesonnen und nachgiebig machen. Was nützte es da zu fragen: Warum hast du dann nicht die Wahrheit gesagt?
Der Winter kam, und Ruth brachte ein Mädchen zur Welt, das sie Adeline nannte. Sie trug den blassen, quengelnden Säugling in die Küche und sagte zu Maggie: »Hier. Ich helfe dir, dein Kleid aufzuknöpfen.«
Maggie hatte schon gesehen, wie andere Frauen das über sich ergehen lassen mussten, und hatte diesen Tag gefürchtet. Es kostete sie größte Selbstüberwindung, die Milchkuh für dieses Kind zu spielen. Es hatte trübe Augen und Wimpern, die ebenso hell waren wie seine Haut, fast, als hätte es keine. Maggie verabscheute das Gefühl der suchenden Lippen an ihrer Brust. Sie zwang sich zu einem Lächeln, statt den zerbrechlichen Körper auf den Boden zu schmettern. Was für ein Mensch wollte seine eigenen Kinder nicht stillen? Wer verweigerte seinen Nachkommen den Segen der eigenen Milch? Selbst Tiere waren klüger.
Von da an waren alle Kinder, einschließlich ihrer eigenen, Maggie ein Ärgernis. Sie verurteilte jeden, der die Kühnheit hatte, Leben in die Welt zu setzen: die Männer, die so dreist waren, es einzupflanzen; die Frauen, die nicht mit allen Mitteln versuchten, es wieder loszuwerden. Sie alle betrachtete Maggie mit Misstrauen. Denn auf Empty ein Kind zu bekommen, war ein gezielter Akt der Grausamkeit, und sie konnte sich selbst nicht vergeben, es selbst drei- von sechsmal nicht verhindert zu haben. Und wo waren das erste und zweite jetzt? Eindeutig Grausamkeit.
Die Bälger, wie sie sie nannte, hatten nicht einmal den Anstand zu wissen, was sie waren; für viele Erwachsene galt zwar das Gleiche, aber aus Absicht: Unwissenheit war kein Segen, aber Demütigungen waren leichter zu ertragen, wenn man glaubte, sie zu verdienen. Die Bälger rannten auf der Plantage herum, in die Ställe hinein und wieder hinaus, versteckten sich auf der Plantage, geschäftig wie Fliegen auf einem Misthaufen. Ihre unruhig zuckenden, knolligen Köpfe ahnten nichts von der ganz persönlichen Hölle, die sie erwartete. Sie waren dumm, hilflos, nicht liebenswert. Maggies tiefe Abneigung wurde nur von dem Wissen um das Leid gemildert, das sie irgendwann erdulden mussten.
Toubab-Kinder dagegen wuchsen zu dem heran, was ihre Eltern aus ihnen machten. Maggie konnte nichts dagegen tun. Zu welch freundlichen Listen sie auch immer griff, sie wurden zu den gleichen elenden, gierigen Kreaturen, die zu sein, sie bestimmt waren – eine der Plagen ihres humorlosen Gottes. Für sie brachte Maggie nur Mitleid auf, und dieses Gefühl steigerte ihren Abscheu noch.
Sie war schon auf die Idee gekommen, ihre Brustwarzen mit Nachtschattenblüten einzureiben, bevor man sie zum Stillen zwang. Die violette Farbe fiel auf ihrer dunklen Haut kaum auf. Und es funktionierte. Adeline starb aus scheinbar unerklärlichen Gründen. Mit Schaum vor dem Mund. Niemand wurde misstrauisch, weil Ruth schon eine Fehl- und kurz zuvor eine Totgeburt gehabt hatte.
Das vierte Kind jedoch, Timothy, hatte einen fast ebenso starken Überlebenswillen wie Maggie. Er war jetzt erwachsen. Gut aussehend, für einen von denen. Freundlicher, als sie sich hätte vorstellen können, wenn man bedachte, was er war. Was macht er jetzt gerade wohl?, fragte sie sich. Wahrscheinlich malte er. Er hatte Talent dafür. Ruth hatte Maggie aufgetragen, das Haus vor seiner Rückkehr von oben bis unten zu putzen, obwohl es bis dahin noch Wochen dauern würde.
Auch die Erwachsenen verschonte sie nicht. Sie wusste, dass ihre bescheidenen Versuche für sie gefährlicher waren als für ihre Opfer. Aber ein winziges Stück Macht war immer noch Macht. Und so, wenn sie gerade nicht überwacht wurde – was selten war, aber durchaus vorkam – und glaubte, einen Funken ihres Vertrauens gewonnen zu haben, mischte sie alle möglichen Dinge ins Essen. Langsam, geduldig, ein paar Tropfen Schlangengift in den gesüßten Tee. Eine winzige Menge mit dem Absatz zermalmtes Glas in die Maisgrütze. Nie Kot oder Urin, das war zu persönlich. Nicht ein Haar von ihrem Kopf, deshalb war es so wichtig, sich einen Schal um die Haare zu wickeln. Sie würde ihnen nicht das Vergnügen, die Genugtuung gönnen, ihnen freiwillig etwas von sich zu geben. Außerdem war es gefährlich; das würde ihnen nur noch mehr Macht über sie verleihen. Und wie bei jedem guten Zauber besiegelte sie alles mit einer gesummten Melodie, die man mit einer Hymne an irgendeinen weit entfernten Trickbetrüger im Himmel verwechseln konnte. Wenn sie sie schon nicht töten konnte, dann wenigstens dafür sorgen, dass es ihnen schlecht ging. Eine Magenverstimmung, hin und wieder blutiger Stuhl waren doch erfreuliche, ermutigende Ergebnisse.
Doch sie erinnerte sich immer daran, dass sie keinen Verdacht erregen durfte. Heute hatte sie nichts in die Brötchen gemischt. Denn sie hatte kürzlich im Traum eine Warnung erhalten. Sonst träumte sie nur von Dunkelheit. Angeblich schlief sie wie eine Tote, wofür sie mehr als einmal von Paul bestraft worden war. Als im Traum ihre Mutter zu ihr gekommen war, flüsternd, in Weiß gekleidet und mit einem Schleier über dem Gesicht, hatte Maggie es als Vorzeichen einer drohenden Gefahr erkannt und wusste, dass sie ganz besonders vorsichtig sein musste. Für den Augenblick also nichts als Brot.
Die Hunde waren zurück, wuselten winselnd vor der Hintertür herum, angelockt vom Geruch des Schweinefleisches, das sie gerade in der Pfanne briet. Sie trat auf die Veranda hinaus in den noch dunklen Morgen. Der Himmel begann sich am unteren Rand hell zu verfärben, aber die Sonne war nirgends zu sehen. Sie schnalzte mit der Zunge, vielleicht konnte sie das Rudel so zum Schweigen bringen. Die Hunde beruhigten sich kurz, dann winselten sie weiter. Sie ging nach draußen, hob einen Stock auf und warf ihn so weit wie möglich ins Gebüsch. Die Hunde rannten hinterher.
»Gott sei Dank«, sagt sie.
Sie spähte in die Dunkelheit, in der die Hunde verschwunden waren. Was auch immer sich im Wald und jenseits davon verbarg, es konnte dort nur besser sein als hier, dachte sie, schlimmer war es bestimmt nicht. Als sie noch jünger war, hatte sie manchmal darüber nachgegrübelt, was hinter den Bäumen lag. Noch ein Fluss vielleicht. Oder eine Stadt mit Leuten, die so aussahen wie sie. Vielleicht auch ein riesiges Loch, in dem irgendwelche Bestien hausten. Oder ein Massengrab, in das man die Leute warf, die nicht mehr nützlich waren.
Oder vielleicht hatten die Toubab recht, und dahinter lag nur das Ende der Welt, und die, die sich dorthin wagten, waren dazu verdammt, vom Nichts verschlungen zu werden. Und warum auch nicht, das Nichts war so gut oder schlecht wie alles andere. Reglos stand sie da und starrte in die Dunkelheit. Sie hätte es zwar nie zugegeben, am wenigsten vor sich selbst, aber sie war angeschlagen. Die Plantage hieß nicht umsonst Empty, die Jahre hier hatten sie ausgehöhlt. Von der Freundin zur Lumpenpuppe, zur Milchkuh, zur Köchin, alles ohne ihre Einwilligung. Das würde jeden aufreiben. Ja, sie war angeschlagen. Aber nicht kaputt. Noch hatte sie die Chance, die Verursacher ihres Leids dafür büßen zu lassen. Vielleicht würde ihr das Heilung bringen.
Essie, die Maggie manchmal im Haus half, war sicher auch schon wach. Bestimmt kümmerte sie sich gerade um die plärrende Bürde, deren Geburt sie fast umgebracht hätte.
»Ich weiß nich, was ich noch machen soll, Mag. Der guckt mich immer mit diesen glasigen Augen an, macht mir richtig Angst«, hatte Essie einmal zu ihr gesagt. Maggie hatte sie angesehen: Essies Haare waren zerzaust, ihr Kleid zerknittert, ihr Gesicht aschfahl und voller Tränenspuren. Sie hatte Essie nur einmal zuvor so gesehen. Beide Male war es ihr auf die Nerven gegangen.
»Kannste nix mehr gegen tun, Mädchen. Passiert is passiert. Is dein Kind. Wenn dir seine Augen Angst machen, mach deine zu. Oder gib ihn Be Auntie, die liebt die Farbe mehr als ihre eigene«, hatte Maggie schärfer als beabsichtigt geantwortet. Sie schwieg kurz und strich Essie über die Schulter.
»Und vielleicht«, hatte Maggie sanft hinzugefügt, »kann ich ja mal vorbeikommen und helfen.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Und Amos kriegen wir auch dazu, mit anzupacken, mir egal, was er sagt – grad jetzt nach eurem Besensprung.«
Maggie war meist eher gleichgültig, was Amos zu sagen hatte. Sie erinnerte sich, wie er vor einiger Zeit mit Paul Halifax im Arbeitszimmer verschwunden war, und als er herauskam, war er nicht mehr wiederzuerkennen; für einige beeindruckender als zuvor, doch für Maggie waren das Funkeln in seinen Augen und das Zungenschnalzen Blendwerk. Aber er hatte Stolz. Und die Leute mochten Stolz und verwechselten ihn gern mit Berufung.
»Guten Morgen«, sagte Amos oft mit einem Lächeln zu ihr, das zu gesetzt war, um ehrlich zu sein. Maggie nickte ihm zu, verdrehte jedoch die Augen, sobald er an ihr vorbeigegangen war. Aber sie begriff, was Essie in ihm gesehen hatte, als Paul ihn zu ihr geschickt hatte. Es war schöner, gefragt, statt einfach genommen zu werden, umarmt, statt festgehalten zu werden. Aber Schlange war Schlange, und ihr Biss, ob giftig oder nicht, schmerzhaft.
Manchmal, wenn sie Amos beobachtete – die Art wie er herumstolzierte, die Nase in die Luft reckte, als würde ihm der Dünkel im Nacken sitzen –, musste sie lachen. Sie wusste, was er vorhatte, wen er zu imitieren versuchte, und sie wusste auch, warum. Sie verachtete ihn nicht dafür, hatte allerdings auch nicht viele herzliche Gefühle für ihn. Sein Gesicht war freundlich, von Leid gezeichnet, das verband ihn mit ihren Leuten und diesem Ort. Er war schwarz wie jungfräuliche Erde, aber seine Treue galt anscheinend anderen, was sich jederzeit rächen konnte.
Kopfschüttelnd stützte Maggie die Hände in die Hüfte.
»Einfach nur albern«, sagte sie zu niemandem im Besonderen.
Sie wandte sich um, ging zurück in die Küche, sah, dass der Himmel sich allmählich aufhellte, und konnte die Umrisse der Scheune in der Dunkelheit ausmachen. Dort verbrachten Samuel und Isaiah ihre Zeit mit Arbeit, Atmen, Schlafen und anderen Dingen. Arme Jungs, die Zwei Beiden. Sie hatten früh gelernt, dass die Peitsche nur so grausam war wie die Hand, die sie hielt. Manchmal machten sie es sich schwerer als nötig, weil sie so verdammt stur sein konnten. Doch nie war Sturheit so hinreißend gewesen.
Anfangs hatte sie sich nicht viel aus ihnen gemacht. Wie alle Kinder war der eine nicht vom anderen zu unterscheiden. Alle verschmolzen zu einer Masse aus unwissenden, bedauernswerten Körpern, lachten mit zu hoher Stimme und ohne jede Zurückhaltung, was sie zu einer einladenden Zielscheibe machte. Es gab nicht einen Grashalm an diesem Ort, der sich nicht unter der Bürde des Leids bog, aber die Zwei Beiden benahmen sich, als könne man sich offen widersetzen. Als die Haare um ihr Geschlecht zu sprießen begannen, hatten die Zwei Beiden einen genialen Weg gefunden (vielleicht ganz zufällig), sich von den anderen abzusondern: indem sie sie selbst waren. Und das hatte ein seit Langem verborgenes Gefühl in ihr geweckt.