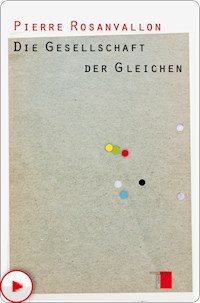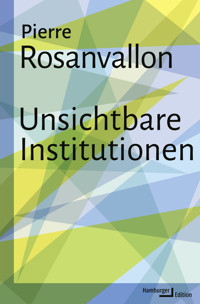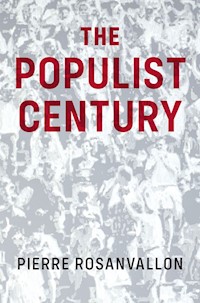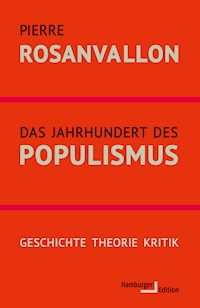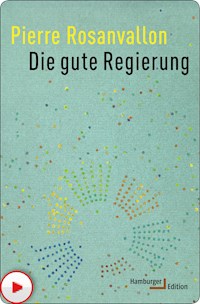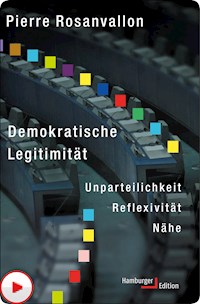23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Staat als Garant von Sicherheit: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger westlicher Demokratien teilen dieses Verständnis nicht mehr. Was ist der Grund dafür? Woher kommt die Wut vieler Menschen, die sich im Netz oder auf der Straße formiert? Im Zentrum von Pierre Rosanvallons neuem Buch stehen die Prüfungen des Lebens, persönliche Erfahrungen mit Geringschätzung, Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ungewissheit. Er richtet den Blick dabei auf so unterschiedliche Bewegungen wie Black Lives Matter, #MeToo oder die »Gelbwesten« und befasst sich mit den Folgen der Verunsicherung durch den Klimawandel und die Covid-19-Pandemie. Rosanvallons präzise Gegenwartsbeschreibung mündet in ein Plädoyer für eine »neue Regierungskunst«, eine Politik des Respekts, der Würde und der Aufmerksamkeit für die erlebten Realitäten. Das sei die einzige Alternative zu den »Gefahren, die mit dem Populismus auf der einen Seite und dem Technoliberalismus und der Politik der Abschottung auf der anderen Seite verbunden sind«. Dieses Buch eröffnet eine neue Etappe in der Arbeit des renommierten Demokratieforschers, die sich der subjektiven Dimension der Gesellschaft, einer Neudefinition der sozialen Frage und den Bedingungen für eine Konsolidierung des demokratischen Lebens widmet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Pierre
Rosanvallon
Die Prüfungen des Lebens
Aus dem Französischen von Ursel Schäfer
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2022 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-470-1
eISBN 978-3-86854-471-8
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© der deutschen Ausgabe 2022 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-361-2
© der Originalausgabe 2021 by Éditions du Seuil
Titel der Originalausgabe: »Les épreuves de la vie. Comprendre autrement les Français«
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Einführung
Auf dem Prüfstand
In Prüfungen denken
Methodische Fragen
Ausblick
I Die Prüfung der Missachtung
Missachtung von oben
Die Zeit des Arbeiterstolzes
Missachtung »von unten«
Vom Ressentiment zum Anspruch auf Würde
II Die Prüfung der Ungerechtigkeit
Statistische Befunde und praktische Gleichgültigkeit
Ungleichheit und Ungerechtigkeit im Zeitalter des Singularitätsindividualismus
Die beiden Regime der Ungerechtigkeit
Erfahrungsgemeinschaften und Empörungsgemeinschaften
III Die Prüfung der Diskriminierung
Das Messen eines Phänomens
Diskriminierung als Pathologie der Gleichheit
Der Trubel um Diskriminierung
Ein Imperativ der Anerkennung
IV Die Prüfungen der Unsicherheit
Die ersten Denker*innen, die sich mit der Reduzierung von Unsicherheit befasst haben
Die neue soziale Frage
Die Bedrohungen der Menschheit
Schluss
Die Wege zur Emanzipation
Die drei Wege, wie Emotionen Eingang in die Politik finden
Andere Formen der Erkenntnis und der Repräsentation
Hinweis zur Methode: Der Begriff Prüfung in den Sozialwissenschaften
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Einführung
Auf dem Prüfstand
Das wahre Leben der Menschen in Frankreich steckt nicht in den großen Theorien oder in statistischen Durchschnittswerten. So wurden die wichtigsten gesellschaftlichen Bewegungen der letzten Jahre nicht durch Studien über die großen Strukturen der Gesellschaft oder die territorialen Spaltungen erhellt, die vor einiger Zeit Aufmerksamkeit fanden und auf den Bestsellerlisten standen. Auch Meinungsumfragen haben das wahre Leben der Menschen in Frankreich nicht enthüllt. Natürlich dokumentierten sie gut die Neuordnung der politischen Spaltungslinien mit dem Aufstieg der populistischen Bewegungen und der Entstehung eines Klimas des allgemeinen Misstrauens. Aber die Blackbox der Erwartungen, der Wut und der Ängste, die dieser Entwicklung zugrunde lag, haben sie nicht entschlüsselt. Der vorliegende Essay schlägt Instrumente vor, um diese Blackbox zu öffnen und ihren Inhalt zu entziffern. Er erfasst das Land auf eine stärker subjektive Weise, indem er davon ausgeht, wie die Menschen selbst ihre persönliche Situation und den Zustand der Gesellschaft wahrnehmen. Dabei stützt sich dieser Essay auf eine Analyse der Prüfungen, mit denen sie sich im Allgemeinen konfrontiert sehen.
In Prüfungen denken
Der Begriff Prüfung hat zwei Bedeutungen. Zum einen verweist er auf die Erfahrung eines Leids, einer existenziellen Schwierigkeit, auf die Konfrontation mit einem Hindernis, das einen Menschen zutiefst erschüttert. Außerdem bezeichnet er einen Weg, die Welt auf unmittelbar spürbare Weise zu erfassen, sie zu verstehen und zu kritisieren und dementsprechend zu handeln. Um diesen Ansatz zu konkretisieren, können wir drei Typen unterscheiden:
– Prüfungen für die persönliche Individualität und Integrität. Derartige Prüfungen entmenschlichen Frauen wie Männer, sie erreichen das tiefinnere Ich und können psychisch und physisch lebensbedrohend sein. Es geht um Mobbing, sexuelle Gewalt, die Ausübung von Macht über eine andere Person, um Manipulation oder auch darum, dass jemand unter Druck gesetzt wird bis zum Burnout. Das sind im Wesentlichen Pathologien individueller Beziehungen, die sich in zerstörerischen Kontakten entfalten. Aber sie haben auch eine systemische Dimension, wenn sie sich zum Beispiel mit einer langen Geschichte der männlichen Dominanz oder mit bestimmten Formen der Arbeitsorganisation verbinden. Die Sensibilität für solche Prüfungen ist in einer Gesellschaft, die den Rechten von Einzelnen immer mehr Beachtung schenkt, beständig gewachsen, wie wir heute sehen können. Die entsprechende Weiterentwicklung des Strafrechts hat derartige Tatbestände systematischer kriminalisiert und die entsprechenden Strafen verschärft, bis dahin, dass Inzest nicht mehr verjähren soll.
– Prüfungen für die sozialen Bindungen. Sie haben zwar auch individuelle Auswirkungen, aber verweisen auf Hierarchien oder auf Formen von Herrschaft mit einer kollektiven Dimension. Hier können wir insbesondere die drei Prüfungen der Missachtung, der Ungerechtigkeit und der Diskriminierung unterscheiden. In allen drei Fällen handelt es sich um Pathologien der Gleichheit in dem Sinn, dass diese Prüfungen die Hindernisse unterstreichen, die dagegen errichtet werden, dass eine Gesellschaft von Gleichen entstehen kann. Es handelt sich um Situationen, die als unerträglich empfunden werden in einer Welt, in der eine elementare demokratische Forderung lautet, der Einzigartigkeit und dem intrinsischen Wert eines jeden Individuums Aufmerksamkeit zu schenken.
– Prüfungen der Unsicherheit. Sie haben zwei Gesichter. Zum einen hängen sie damit zusammen, dass der Begriff des Risikos nicht mehr zur Beschreibung gesellschaftlicher Probleme und ihrer versicherungsmäßigen Behandlung taugt. Immer mehr prekäre Lebenslagen oder Armutssituationen resultieren aus so etwas wie »Lebenspannen«, verursacht durch zufällige Ereignisse, die nicht in die Kategorien fallen, bei denen die traditionellen Mechanismen des Wohlfahrtsstaats greifen. Und deshalb wächst das Gefühl der Unsicherheit in einer Zeit, in der ökonomische Umwälzungen sowieso schon die Zukunft immer weniger vorhersehbar werden lassen. Überdies lasten auf allen Existenzen neue Bedrohungen der Menschheit als Folge von Klimaveränderungen und Pandemien, aber auch von geopolitischen Unsicherheiten.
Die unterschiedlichen Typen von Prüfungen sind der Kern dessen, was den Menschen Sorgen bereitet. Die Entwicklung der Kaufkraft und die wachsende Ungleichheit erscheinen natürlich als die zentralen Probleme. Aber daneben gibt es ein diffuses Gefühl, dass es sich dabei nicht um Probleme eines Systems handelt, das man kritisieren kann, sondern dass man nicht weiß, wie sich dieses System verändern lässt. Das erklärt die gegenwärtige Atmosphäre von Politikverdrossenheit: Die Menschen glauben nicht mehr daran, dass eine Revolution eine radikal neue Ordnung bringen könnte, und so herrscht ein Gefühl der Ohnmacht vor. Die Menschen in Frankreich sind aber nicht passiv. Im Gegenteil, sie haben noch nie so viel demonstriert, so viele Forderungen erhoben, sich so viel ausgetauscht. Aber ihr Augenmerk richtet sich verstärkt auf die Konfrontation mit diesen Prüfungen, deren Wirkungen unmittelbar und direkt spürbar sind.
Das ist offenkundig, wenn man sich anschaut, wie die kollektive Mobilisierung in den letzten Jahren aussah und welche Themen öffentliche Aufmerksamkeit erregten. Die #MeToo-Bewegung war insofern der Archetypus breiter Reaktionen auf Angriffe gegen die individuelle Integrität (in dem Fall von Frauen). Dieses Thema behandeln auch Bestseller wie Die große Familie von Camille Kouchner und Die Einwilligung von Vanessa Springora, ganz zu schweigen von dem Echo, das die Offenlegung von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche auslöste. Die aufsehenerregenden Kundgebungen der Gelbwesten auf den öffentlichen Straßen und Kreisverkehren wiederum können nur verstanden werden vor dem Hintergrund der Verachtung für »die da oben« und dem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden (wahrgenommen als Gleichgültigkeit der technokratischen Regeln angesichts der Realität ihrer Lebenssituationen), die ihre Protestaktionen angetrieben haben. Die Schockwelle, die die Bewegung Black Lives Matter in Frankreich ausgelöst hat, und die wachsende Kritik, dass Personenkontrollen von der Hautfarbe abhingen, oder auch die Diskussionen über das koloniale Erbe sind ebenfalls nur nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass Formen der Diskriminierung generell viel mehr Aufmerksamkeit finden. Betrachtet man noch die Proteste gegen die geplante Rentenreform, wird deutlich, dass der Widerstand derjenigen, die von bestimmten Sonderregelungen profitierten, nur der erste Funke war, dass aber eine generelle Angst vor einer unsicheren Zukunft den Flächenbrand entfachte. Die Klimaproteste der jungen Menschen seit Herbst 2019 gehören ebenfalls zur allgemeinen Sorge angesichts einer bedrohlichen Zukunft. All diese Bewegungen stellen Reaktionen auf die unterschiedlichen Kategorien von Prüfungen dar, die wir genannt haben. Insofern unterscheiden sie sich diametral von den großen sozialen Bewegungen der Vergangenheit wie etwa dem langen, symbolträchtigen Streik im Herbst 1995, der auf gesellschaftliche Forderungen beschränkt blieb und insofern die Reihe traditioneller gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen fortsetzte. Frappierend ist im Gegensatz dazu, dass bei den verschiedenen erwähnten Bewegungen1 die Gewerkschaften weitgehend unsichtbar blieben, als hätte sich das Feld des »Sozialen« mit ihnen verschoben.
Der Blick auf diese Verschiebung ist Ausgangspunkt des vorliegenden Essays. Neben der Verlagerung des Objekts, das die Kategorie der Prüfung gebracht hat, die sich über das Klasseninteresse gelegt und es oft sogar ersetzt hat und nun die Konfliktlinien beschreibt, um die sich die kollektiven Auseinandersetzungen heute drehen, scheint auch der Klassenbegriff selbst an Treffsicherheit verloren zu haben. Das zeigt sich auch daran, dass immer häufiger von »unteren Klassen« (classes populaires) die Rede ist statt von »der Arbeiterklasse«. Die Wahl des Plurals ist selbst ein Zeichen der Ratlosigkeit angesichts einer als immer komplexer wahrgenommenen sozialen Realität. Darin mischen sich statistische Befunde2 und eine soziologische Unschärfe. So sprechen die Verfasser*innen zahlreicher aktueller Veröffentlichungen zu dem Thema3 angesichts der starken Spannungen, die erkennbar sind, von einer »fragmentierten« oder »heterogenen« sozialen Welt, von einer »zerstückelten großen Körperschaft […], bei der die Organisation der Teile stets fraglich ist«4. Tatsächlich lauert hinter dem Begriff der »unteren Klassen« so etwas wie eine unauflösliche intellektuelle und politische Verunsicherung: die Schwierigkeit, genau zu benennen, wer künftig die gesellschaftliche Emanzipation vorantreiben wird. Insofern war zu Recht die Rede von »identitätsmäßiger und politischer Entwaffnung«5. Aber selbst wenn sich der Klassenkampf in seiner ursprünglichen Form aufgelöst haben mag, sind doch die Kämpfe in der neuen Gestalt der Prüfungen bestehen geblieben. Und genau wie in der marxistischen Theorie die Kämpfe die Klassen hervorbrachten, können wir heute sagen, dass die Prüfungen die gesellschaftliche Landkarte neu zeichnen.
Dieser Essay hat das Ziel, zu untersuchen, wie sich die Menschen den Prüfungen des Lebens stellen. Dabei steht am Anfang der Wunsch, die tiefen Triebfedern dieser Prüfungen zu erfassen. Insofern verengt er zugleich den Fokus, weil er sich auf die Prüfungen konzentriert, die mit den sozialen Bindungen und mit der Unsicherheit zu tun haben. Tatsächlich können wir davon ausgehen, dass die Prüfungen für die persönliche Integrität in der Vergangenheit bereits weitgehend identifiziert, medial abgehandelt, dokumentiert und konzeptualisiert wurden, auch wenn die Kämpfe, sie zu überwinden, noch längst nicht ausgefochten sind.
Methodische Fragen
In einer großen klassischen Schrift zur Methodik der Sozialwissenschaften, Kritik der soziologischen Denkweise, plädierte der amerikanische Soziologe Charles Wright Mills dafür, zwischen »persönlichen Milieuschwierigkeiten« und »allgemeinen Sachverhalten einer Sozialstruktur«6 zu unterscheiden, oder kurz zwischen »persönlichen Problemen« und »öffentlichen Sachverhalten«. In dem Zusammenhang führte er aus, dass beide unterschiedlich und gleichzeitig miteinander verflochten seien. Diese Sichtweise prägt auch die vorliegende Untersuchung. Sie zielt primär darauf ab, die Wichtigkeit dieser Prüfungen hervorzuheben, welche Reaktionen in Form von Emotionen auslösen, weil sie Auswirkungen auf die betroffenen Personen haben.7 Diese Emotionen bestimmen und prägen wiederum die Beziehungen zu anderen Personen und Institutionen. Aus dieser Sicht kommt es darauf an, zu begreifen, wie bedeutsam in unserer Gesellschaft Groll, Empörung, Wut, Verbitterung, Angst und Misstrauen sind. Wenn wir unseren Blick darauf richten, verstehen wir, welche Forderungen, Erwartungen und welche Ungeduld Männer und Frauen heute hegen. Tatsächlich bleiben diese Gefühle ganz und gar nicht im Inneren der Menschen eingeschlossen; weil sie auf vielfältige Weise geteilt werden, erlangen sie auch eine kollektive Dimension. In diesem Sinn hat der Historiker der britischen Arbeiterklasse, Edward Palmer Thompson, den Begriff der »moralischen Ökonomie« (moral economy) geprägt, um zu betonen, wie wichtig die Affekte und die Rechtfertigungen von Handlungsweisen waren, die Revolten auslösten und die unmittelbarste Ausdrucksform eines Kollektivs darstellten. An diese Konzeptualisierung wurde im Übrigen oft und zu Recht im Zusammenhang mit dem Handeln der Gelbwesten erinnert.
Auf gemeinsame Gefühle oder Erfahrungen gegründete Kollektive, die in diesem Rahmen entstehen, treten beispielsweise als »Gemeinschaften von Leserinnen und Lesern« eines Buchs zutage, als »Gemeinschaft der Follower*innen« in sozialen Netzwerken, als Gruppen, die sich punktuell zu einer Aktion oder Demonstration zusammenfinden, und in allen anderen Formen von Nähe, die bewirken, dass Menschen sich im Einklang mit anderen oder im selben Boot mit ihnen fühlen. All das bringt ein Kollektiv auf andere Weise hervor als durch Identität und Zugehörigkeit, die sich früher auf solche Formen der dauerhaften Organisation stützten, für die die Gewerkschaften der soziologische Archetypus und die institutionalisierte Gestalt waren. In der Folge werden die Objekte, die konstitutiv für die Gemeinschaft sind, neu definiert. Das geht weit über den Begriff des Interesses hinaus, für den das Klasseninteresse in einer von Produktions- und Distributionsbeziehungen bestimmten Welt der exemplarische Ausdruck war. Diese Begriffe sind zwar weiterhin wichtig, aber sie sind nicht mehr von zentraler Bedeutung, um die Herrschaftsverhältnisse in der heutigen Welt zu beschreiben.
Die Prüfungen des Lebens, die wir in den folgenden Kapiteln untersuchen, können ausgehend von den direkten zerstörerischen Wirkungen für die betroffenen Personen jeweils für sich genommen betrachtet werden. Aber man kann sie nicht vollständig ermessen, wenn man nicht auch das System betrachtet, das sie formen, sowie die Emotionen, die sie auslösen, und die Erwartungen auf Veränderung, die sie wecken. Die Prüfungen sind nichts anderes als totale soziale Fakten, die die Realität und die Vorstellung von der Realität unauflöslich miteinander verschmelzen. Das Psychologische, das Politische und das Soziale sind eng miteinander verschränkt. Die gemeinsame Betrachtung dieser Dimensionen führt zu einem dynamischeren und tieferen Verständnis dessen, was in der Welt passiert. Die folgende Tabelle stellt eine Kurzfassung des Analyserasters dar, das letztendlich diesem Aufsatz zugrunde liegt.
Die Typen von Prüfungen
Die dadurch ausgelösten Emotionen
Die sich daraus ergebenden Erwartungen
Die Prüfung der Missachtung
Demütigung Groll Zorn
Respekt Würde
Die Prüfung der Ungerechtigkeit
Empörung
Die Mächtigen sollen der erlebten Realität Beachtung schenken
Die Prüfun der Diskriminierung
Verbitterung Wut
Anerkennung Echte Chancengleichheit
Die Prüfungen der Unsicherheit
Angst Misstrauen
Sicherheit Lesbarkeit
Wenn wir die soziale Welt aus dem Blickwinkel der Prüfungen betrachten, fällt ein neuer Internationalismus auf. Die Mobilisierung für Respekt und Würde gegen Missachtung und Demütigung ist beispielsweise auf allen Kontinenten zu beobachten. So lautete die Parole bei den ersten Demonstrationen gegen das Regime in Syrien, die 2011 an den Tagen der großen Gebete stattfanden, »Freitage der Würde«, »Freitage des Stolzes« oder auch »Freitage der Ehrenmänner«.8 Ob in der arabischen Welt, in Afrika, Asien oder Europa, überall treibt die Arroganz der Mächtigen, die Korruption der Regierungen und die Missachtung von Rechten Männer und Frauen auf die Straßen. #MeToo und Black Lives Matter sind ebenfalls um die Welt gegangen, während die Bedrohungen der Menschheit alle Bewohner*innen des Planeten einander näher bringen. Die Prüfungen sind somit bereits »das Menschliche«!
Ausblick
Während die Ökonomie der Produktions- und Distributionsbeziehungen sowie die Soziologie der determinierenden sozialen Kräfte ihre Gültigkeit behalten, um die Gesellschaft zu erkennen, brauchen wir neue Werkzeuge, um sie zu verstehen, auch ihre inneren Triebkräfte und die Möglichkeiten ihrer Angehörigen, einzugreifen und den Lauf zu verändern. In diese Richtung zielt die Theorie der Prüfungen, die hier entworfen wird. Diese Neuorientierung, die auf der Neubewertung der subjektiven Dimension der sozialen Welt basiert, ist von entscheidender Bedeutung, damit die Bürger*innen die Kontrolle über ihr Leben zurückerlangen und ihr gegenwärtiges Ohnmachtsgefühl überwinden können. Aber sie ist auch politisch von entscheidender Bedeutung. Sie ist von Bedeutung für alle Herrschenden, denn wenn sie sich nur auf Statistiken und auf »objektive« Analysen eines Gesellschaftssystems verlassen, werden sie nicht in der Lage sein, die Realität zu verändern und ihre Fehler einzusehen. Und sie wird für alle jene von Bedeutung sein, die herrschen wollen, denn sie können nur an die Macht gelangen, wenn sie die Dynamik der Prüfungen verstehen und die Bereitschaft zeigen, sich auf die Gefühlslage des Landes einzulassen, die einen neuen Erwartungshorizont aufscheinen lässt.
Dieser Essay ist nur die erste Skizze, wie eine Neukonzeptualisierung aussehen könnte. Aber entsprechend der Natur des Vorhabens weist er auch die Richtung, in die ein politisches Projekt gehen könnte. Er eröffnet einen Weg für fortschrittliches Handeln auf erneuerten Grundlagen. Tatsächlich erweitert er das Feld, die Ziele und die Instrumente einer emanzipatorischen Politik und definiert sie damit zugleich neu.
1 Mit der bemerkenswerten Ausnahme der Bewegung gegen die Rentenreform, die im Wesentlichen noch dem klassischen Repertoire des sozialen Handelns entsprochen hat, auch wenn sie manchmal mit der Betonung der allgemeinen Unsicherheit darüber hinausgegangen ist.
2 80 Prozent der französischen Bevölkerung geben ein Monatseinkommen in einer Spanne zwischen 1247 Euro und 3654 Euro an. Man kann darum die Unterscheidung von unteren und mittleren Schichten in diesem Bereich ansetzen.
3 Siehe die Zusammenstellung von Siblot u. a., Sociologie des classes populaires contemporaines.
4 Béroud u. a., En quête des classes populaires, S. 77.
5 Duvoux / Lomba (Hg.), Où va la France populaire?, S. 8.
6 Mills, Kritik der soziologischen Denkweise, S. 45–51.
7 Siehe am Schluss die methodischen Ausführungen über den Begriff der Prüfung in den Sozialwissenschaften. Sie müssen berücksichtigt werden, um die konzeptuellen Grundlagen dieses Werk vollständig zu erfassen.
8 Siehe das Kapitel »Les noms des vendredis. Égypte, Syrie, Yémen«, in: Dakhli (Hg.), L’esprit de la révolte, S. 133–136.
I
Die Prüfung der Missachtung
Eine Person zu verachten bedeutet, sie geringzuschätzen, sie der Aufmerksamkeit und des Interesses nicht wert zu befinden. Missachtung war ein sehr typisches Merkmal aristokratischer Gesellschaften mit einer strikten Hierarchie der Rangstufen. Die revolutionären Kräfte des Jahres 1789 verkündeten, dass die Gesellschaft auf nichts anderem gründen könne als auf dem Naturrecht und der gesellschaftlichen Einheit, und schafften per Dekret die alte Welt der getrennten Stände ab. Sie definierten die Nation als »eine Körperschaft, die unter einem gemeinsamen Gesetz lebt«. Die revolutionären Sitten brachten das unmittelbar zum Ausdruck, indem das Duzen allgemein üblich wurde und für alle die Anrede »Bürger« und »Bürgerin« gelten sollte. Die Nation war damit zu einer Gemeinschaft der Stolzen geworden. Das Gewicht der Realität bewirkte im Weiteren einen Rückschritt. Die riesigen Unterschiede zwischen den Berufen und die Verteilung des Besitzes führten dazu, dass wieder soziale Hierarchien entstanden, und die Schranken zwischen den Klassen verbanden sich mit neuen Formen, der Missachtung Ausdruck zu verleihen. Daran scheiterte das Projekt, eine Gesellschaft von Gleichen zu schaffen.
Die Rückkehr der Missachtung zeigte sich in unterschiedlichen Formen.1 Zuerst und vor allem ganz klassisch als »Missachtung von oben«, die sich nun nicht mehr in den alten Formen einer institutionalisierten sozialen Distanz ausdrücken konnte. Aber sie zeigte sich auch in der Entstehung von »Missachtungskaskaden«, die es unterlegenen Personen erlaubten, ihre niedrigere Position dadurch zu kompensieren, dass sie wiederum Menschen oder Gruppen verachteten, die vermeintlich noch unter ihnen standen. Auf diese Weise spielten die Vorherrschaft eines Geschlechts, die Ablehnung von Fremden oder auch die Stigmatisierung bestimmter rassistisch dargestellter Gruppen eine bedeutende historische Rolle beim Funktionieren der demokratischen Gesellschaften. All diese Formen der »Missachtung von unten« dienten häufig als »Sicherheitsventile«, um Klassenkonflikte zu kanalisieren und teilweise umzulenken.
Missachtung von oben
In Frankreich wurde allein schon der Begriff einer Gesellschaft von Gleichen, wie ihn die drei modernen Revolutionen (die Amerikanische, die Französische und die Haitianische) propagierten, durch die Einführung des Zensuswahlrechts infrage gestellt. Ab der Restauration spielte die Kritik an diesem Bruch eine zentrale politische und soziale Rolle. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es große Demonstrationen und Kampagnen für Petitionen gegen das Zensuswahlrecht2 (anzumerken ist auch, dass sich der Begriff Proletariat zunächst hauptsächlich darauf bezog, dass bestimmte Gruppen kein Wahlrecht hatten). Aber die Mobilisierung fand vor allem in den Städten statt. In der bäuerlichen Welt lebte die Ehrerbietung gegenüber den Honoratioren und dem alten Adel weitgehend fort.3 Die Bediensteten, die zweitgrößte Gruppe der arbeitenden Bevölkerung, waren ebenfalls weiter in der besonderen Nähe zu ihren Herren gefangen. In beiden Fällen kann man nicht von Missachtung einer Klasse gegenüber einer anderen sprechen. In der Wahrnehmung der Missachtung schwang immer das Gefühl mit, dass die Gleichheit damit verhöhnt wurde. Beide Bevölkerungsgruppen hatten den gesellschaftlichen Abstand zu den Besitzenden und den Herren mehr oder weniger verinnerlicht, er besaß eine funktionelle Dimension. Insofern hatte der Bedienstete des 19. Jahrhundert nichts mit dem Butler gemein, wie ihn Joseph Losey in seinem Film Der Diener (1963) porträtiert hat.4 Ganz anders sahen die Beziehungen der höheren Klassen zur Welt der Arbeiter und der kleinen städtischen Gewerbetreibenden aus.
In diesem Fall kann man nicht von Missachtung sprechen, sondern eher von Angst. Es war die Angst vor der großen Zahl, vor einer gesichtslosen und bedrohlichen Masse, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestaut hatte: Es galt die Parole: »Arbeitende Klasse, gefährliche Klasse«.5 Man hatte es mit einem »Maschinenvolk« zu tun, das durch die Fabrikarbeit diszipliniert werden sollte,6 einem »rebellischen Volk«, das man fürchtete, einer aufrührerischen Macht, die man zu Beginn der 1830er Jahre in Lyon und Paris erlebt hatte.7 Die herrschenden Klassen fühlten sich mit einem neuen radikalen Gegenüber, gleichgesetzt mit der Gestalt des »Barbaren«, konfrontiert. Ein berühmter Beitrag im Journal des débats über den Arbeiteraufstand in Lyon im November 1831 drückte diese Angst exemplarisch aus. Darin heißt es:
Der Aufstand von Lyon hat ein schwerwiegendes Geheimnis enthüllt, nämlich das des inneren Kampfs, der in der Gesellschaft zwischen der besitzenden Klasse und der Klasse, die nichts besitzt, stattfindet. Unsere von Handel und Industrie geprägte Gesellschaft hat eine Wunde: Diese Wunde sind ihre Arbeiter. Keine Fabriken ohne Arbeiter, und mit einer stetig wachsenden und stets notleidenden arbeitenden Bevölkerung gibt es keine Ruhe für die Gesellschaft […]. Jeder Fabrikant lebt in seiner Fabrik wie die Plantagenbesitzer in den Kolonien inmitten ihrer Sklaven, einer gegen hundert; und der Aufstand von Lyon ist so etwas wie der Aufstand von Santo Domingo […]. Die Barbaren, die die Gesellschaft bedrohen, befinden sich nicht im Kaukasus und nicht in den Steppen der Tartarei: Sie befinden sich in den Vororten unserer Fabrikstädte.8
Verachtung für eine Klasse im eigentlichen Sinn wird erst mit dem Aufkommen des allgemeinen Wahlrechts (der Männer) manifest, als die Forderung nach Gleichheit, die mit einer starken symbolischen Unterstützung daherkam, eine Art von instinktivem Rückzug bei den herrschenden Klassen hervorgerufen hatte, die in der neuen Welt der politischen Gleichheit unbedingt den Abstand zu den unteren Klassen wahren wollten. An die Stelle der alten Ängste war somit eine quasi physische Missachtung durch Abstand getreten. In den Augen des Großgrundbesitzers gehörte der »Bauerntrampel« einer anderen menschlichen Spezies an als er selbst, ebenso der Arbeiter in seiner winzigen Behausung, dessen bescheidene Lebensumstände der Bürger für normal hielt. Manchmal ging die Wahrnehmung der Kluft sogar noch weiter. In Der Weg nach Wigan Pier sprach George Orwell vom »Geheimnis der Klassenunterschiede« und sagte, er verspüre bisweilen eine Art körperlichen Widerwillen gegenüber den unteren Klassen. »Die unteren Klassen stinken«, schrieb er in den 1930er Jahren.9 Eine solche Bemerkung wurde unaussprechlich, aber etwas davon blieb hängen. Ganz besonders in einem Land wie England, wo die Klassenunterschiede ausgeprägter sind als in Frankreich.10 Die Missachtung durch Abstand wurde auf subtile Weise erst überlagert und dann abgelöst von Missachtung durch Abgrenzung.
Missachtung durch Abgrenzung
Seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert ist für die Gesellschaft der Individuen das Streben nach Abgrenzung charakteristisch, etwa bei den Künstler*innen oder den gehobenen Klassen. Die Modalitäten und Mechanismen der Abgrenzung wurden in Romanen von Stendhal bis Proust penibel kartografiert. Freud gab eine psychoanalytische Erklärung und sprach vom »Narzissmus der kleinen Unterschiede«. Später erweiterte und »demokratisierte« sich diese Dynamik der Abgrenzung. Aber das geschah auf eine zwiespältige Weise. Einerseits erfolgte die Abgrenzung durch ein positives Streben nach Einzigartigkeit, andererseits entfaltete sie sich in Form einer Positionsrivalität und knüpfte damit (natürlich auf einem sehr viel bescheideneren Niveau) in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären an das alte System der höfischen Gesellschaft11 an. Ein Schulhof, um ein ganz banales Beispiel zu nehmen, ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Königshof, aber er weist durchaus einige Ähnlichkeiten auf. Aus diesem Grund lesen wir auch heute noch mit Interesse Die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon. Zur Fixierung auf Rangstufen, wie sie für den Hof Ludwigs XIV. typisch war, kam hinzu, dass unzählige Details der Kleidung, des Auftretens, der Kunst der Konversation, der Verwandtschaftsbeziehungen genauestens beobachtet wurden. Heute sehen wir Kopien davon, materiell zwar sehr viel weniger auffällige, aber die psychologischen Hintergründe und soziologischen Mechanismen sind sehr ähnlich. In Versailles konnte der geringste Verstoß gegen die Etikette oder gegen die höfischen Sitten durch den Ausdruck schärfster Missachtung sanktioniert werden, unter Umständen ging das so weit, dass es den sozialen Tod bedeutete. Der Film Ridicule – Von der Lächerlichkeit des Scheins (1996) von Patrice Leconte bringt die Triebkräfte und die Grausamkeit perfekt zum Ausdruck, während Francis Veber in Dinner für Spinner (1998) die Mechanismen entlarvt, indem er sie in die Gegenwart überträgt.
Eine solche Art der individualistischen Missachtung durch Abgrenzung ist heute nichts Besonderes, wenn wir uns die Entwicklungen des Individualismus der Einzigartigkeit ansehen, die wir systematisch im nächsten Kapitel untersuchen werden. Wichtig ist, den individuellen Dünkel nicht mit Klassendünkel zu verwechseln. Die letztgenannte Art der Distanzierung gehört zu einer allgemeinen Ökonomie der sozialen Unterschiede, die sie aufrechterhalten und rechtfertigen will. Sie hat die Form von Missachtung gegenüber körperlicher Arbeit und manchen subalternen Positionen angenommen und drückt sich auch darin aus, dass die Stadt auf das Land herabschaut. Aber am stärksten tritt diese Distanzierung in der kulturellen Ordnung zutage, und das deshalb, weil die Kultur die letzte Bastion des Widerstands gegen das Gefühl von Gleichheit darstellt. In der Kultur manifestiert und banalisiert sich die aristokratische Überzeugung, zu den happy few zu gehören, während man mitleidig auf den Plebs herabschaut. Dort vollzieht sich in gewisser Weise eine umgekehrte und verschlechterte Reproduktion des Überlegenheitsgefühls, das der Künstler gegenüber der Banalität der bürgerlichen Existenz empfindet.12
In seiner 1979 erschienenen Schrift Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft untersucht Pierre Bourdieu methodisch die Beziehungen zwischen Klassifizierungssystemen (die mit »Geschmack« zu tun haben) und sozialen Klassen. Mit seiner Mischung von soziologischer Theorie und zahlreichen Untersuchungen wurde das Buch ein epochemachendes Werk und fand sowohl wegen des Themas als auch wegen der Art, wie der Autor das Thema behandelte, ein großes Publikum. Zum Beispiel führt Bourdieu in diesem Buch den Begriff Klassenrassismus als Gegenbegriff zu Intelligenzrassismus ein, den er kurz zuvor geprägt hatte. Das Paradox dieses opus magnum ist, dass es zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als seine empirische Basis bereits veraltet war. Die dem Buch zugrunde liegenden Untersuchungen stammten überwiegend aus den 1960er Jahren, und ab den 1980er Jahre veränderte sich der ästhetische und musikalische Geschmack massiv. Zugleich verlor der mechanische Zusammenhang von kulturellem Konsum und gesellschaftlicher Klassenzugehörigkeit, über den bereits bei Erscheinen des Buchs diskutiert wurde, an Überzeugungskraft. In den 1960er Jahren zerfielen die Klassenstrukturen, und die kulturellen Vorlieben fächerten sich auf.13 Die Missachtung durch Abgrenzung bestand zwar fort, aber nicht mehr in so binärer Form, vielgestaltiger und verbreiteter, insbesondere mit der Gegenüberstellung von Intellektuellen und Bürgerlichen, kulturellem und ökonomischem Kapitel. Der Film Lust auf Anderes von Jean-Pierre Bacri und Agnès Jaoui (2000) illustriert das sehr schön.
Missachtung von oben, verstanden als eine eigene Gattung, findet ab den 1980er Jahren andere Formen des Ausdrucks, vielfältigere und vor allem direktere. Wir können zwei hauptsächliche Mechanismen unterscheiden: Missachtung durch Herablassung und Missachtung durch Gleichgültigkeit.14
Missachtung durch Herablassung
Missachtung durch Herablassung ist subtiler. Sie gibt sich den Anschein einer gewissen Fürsorglichkeit, aber einer Fürsorglichkeit, die das Gegenüber durch ihren paternalistischen Ton erniedrigt. Sie stellt einen Unterschied her, der sich heimlich unter eine behauptete Gleichheit mischt. Diese Art der Missachtung hat eine lange Geschichte. Ihre ersten Manifestationen finden wir in dem Bild vom »Volk als Kind«, das die republikanischen und revolutionären Eliten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts propagierten. Diese Sichtweise brachte zu Anfang einige dazu, vorschnell über das allgemeine Wahlrecht zu urteilen, weil das reale Volk offenbar ihren Erwartungen nicht entsprach. Glühende Revolutionäre wie Blanqui und Cabet rechtfertigten damit, warum sie sich dafür einsetzten, die ersten Wahlen nach dem allgemeinen Wahlrecht im Frühjahr 1848 zu verschieben. Cabet schrieb:
Das Volk weiß nichts, es muss wissen. Das ist keine Sache von einem Tag oder einem Monat […]. Das Licht muss in die letzten Weiler der Republik vordringen. Die Arbeiter müssen ihre von der Knechtschaft gebeugten Häupter erheben. Wenn die Wahlen zustande kommen, werden sie reaktionär sein […]. Lassen wir das Land zur Republik erwachen; zur Stunde ist es noch in der erstickenden Umhüllung durch die Monarchie gefangen.15
Dieses Urteil überschneidet sich in politischer Hinsicht mit den Vorbehalten der Konservativen wegen der Unreife des Volkes. Die Missachtung drückt sich später stärker verbrämt rund um das Thema der notwendigen »Erziehung zur Demokratie« aus, das im Zentrum der politischen Philosophie der Republik steht. Während es Ernest Renan zufolge bei der Demokratie darum geht, »den Diamanten aus den unreinen Massen herauszupressen«16, sagte George Sand über das allgemeine Wahlrecht, es sei »ein Riese noch ohne Verstand«17. »Er ist jung, der Kindkönig«, hatte sie anlässlich der Wahl von Louis-Napoléon Bonaparte geschrieben, »er besitzt die Fehler seines Alters, er ist waghalsig, schwärmerisch, ungeduldig. Er erträgt keine ungerechten und grausamen Zurechtweisungen. In seinem Zorn zerbricht er seine Fesseln und seine Spielzeuge. Naiv und gutgläubig vertraut er dem Erstbesten.«18
Über den Umweg der Volkserziehung manifestiert sich unterschwellig ein fortbestehendes aristokratisch-paternalistisches Gefühl. Dieses gedieh vor allem unter den Fittichen einer meritokratischen Ideologie. Sie formulierte die Idee eines objektiven und legitimen Adels, dessen Position auf Fähigkeiten beruhte, etwas, das die Liberalen des 19. Jahrhunderts erstmals als erstrebenswert bezeichnet hatten.19 Emmanuel Macron präsentiert die typische zeitgenössische Version und hat noch einen Schuss Arroganz hinzugefügt, beispielsweise als er die Beschäftigten in einem von der Schließung bedrohten Schlachthaus in der Bretagne als »ungebildet« bezeichnete, weshalb eine Umschulung schwierig sei. Oder als er von »Leuten, die nichts sind«, sprach und ihnen jene gegenüberstellte, »die Erfolg haben« (bei der Einweihung von Station F, einem Start-up-Campus in einem ehemaligen Eisenbahngebäude in Paris). Die Missachtung verbarg sich hinter einer vermeintlichen Tatsachenfeststellung. Deshalb fiel er auch aus allen Wolken, als er bemerkte, wie sehr seine Worte schockiert hatten.
Die Missachtung durch Herablassung ist nicht das Privileg der herrschenden Klassen. Sie durchzieht die gesamte gesellschaftliche Struktur und verbreitet sich umso weiter, je mehr sie sich zum Gebot der Gleichheit bekennt. Sie überschreitet die Klassenschranken im eigentlichen Sinn. Zum Beispiel kann es sein, dass die Schüler*innen eines allgemeinbildenden Gymnasiums auf ihre Altersgenoss*innen herabblicken, die sich auf ein berufliches Abitur vorbereiten, oder dass ein Facharbeiter oder Maschinenführer einen Handlanger auf dem Bau mit Missachtung betrachtet. Eine aktuelle Studie hat beleuchtet, wie massiv Schüler*innen des Collèges und der Hauptschule diese Form der Missachtung bei ihren Lehrer*innen wahrnehmen.20 Die Missachtung manifestiert sich oft unter dem Mantel von Fürsorge, aber einer Fürsorge, die das Gegenüber herabsetzt. Auch scheinbar warmherzige Worte können verletzen, wenn sie ein implizites Stereotyp enthalten. Bei dem Satz »Es ist großartig, was Sie machen«, schwingt mit, »für jemanden wie Sie«, und damit scheint durch, wie wenig Achtung der Sprecher oder die Sprecherin für die Person besitzt und dass er oder sie ganz selbstverständlich eine überlegene Position einnimmt. Diese Form der Missachtung durch Herablassung ist ähnlich wie die Manifestationen von Rassismus, die man als unmerklich bezeichnet und deren sich die Urheber*innen meistens gar nicht bewusst sind. Da sind die scheinbar harmlosen Sätze wie »Aus welchem Land kommen Sie?«, »Sie sprechen aber gut Französisch« oder »Bei Ihnen hört man gar keinen Akzent«, gerichtet beispielsweise an Französinnen und Franzosen von den Antillen oder solche afrikanischer Herkunft.21 In den Vereinigten Staaten spricht man im Zusammenhang mit solchem »gewöhnlichen« Rassismus von Mikroaggressionen22, die in ihrer Regelmäßigkeit als unerträglich empfunden werden.
Missachtung durch Gleichgültigkeit
Missachtung durch Gleichgültigkeit ist vielleicht die Form der Missachtung, die als am stärksten verletzend empfunden wird. Sie bedeutet, dass so getan wird, als zählten Menschen nicht, als existierten sie nicht, als seien sie einfach namenlose Rädchen, die in die dunklen Ecken der Gesellschaft verbannt werden. 1952 veröffentlichte Ralph Ellison seinen Roman Der unsichtbare Mann.23 Damit hinterließ er ausgehend von diesem Problem der amerikanischen Literatur ein Denkmal für die Situation von people of color, wie wir heute sagen würden. Neben der gesamten in klassischer Weise engagierten Literatur, die die Gewalt der Rassentrennung und die vielfältigen Manifestationen des Alltagsrassismus behandelt, hatte Ellison sich entschieden, dass der Held seines Romans »ein Mann, den man nicht sieht«, sein sollte. Physisch ist er durchaus wahrnehmbar, aber seine einzigartige Existenz wird geleugnet, indem man ihn in eine gesichtslose Masse einordnet. Er ist unsichtbar, »weil sich die Leute weigern, mich zu sehen«, aber auch, weil sie unfähig sind, ihn zu sehen; das ist »die Folge […] der Anlage ihrer inneren Augen«, schrieb der Autor. Der Roman will dieses Leben in die Gemeinschaft zurückholen, will ihm Konsistenz und Würde geben, es in seiner Wahrheit wiederherstellen, von den Schlacken der Stereotypen und Fantasievorstellungen befreien, die die Sicht der Weißen verstellen. Aber er will auch den people of color das Vertrauen in sich selbst, den Glauben an ihren eigenen Wert zurückgeben. Er will sie in gewisser Weise für ihre eigenen Augen sichtbar machen, indem er sie von den Projektionen der Weißen befreit und zugleich von der Versuchung, sich daran anzupassen. Er will ihnen, kurz gesagt, bei ihrer Suche nach Identität und Anerkennung Orientierungspunkte geben. Das war für Ellison das Mittel, um die von den Weißen praktizierte Missachtung durch Gleichgültigkeit, hinter der sich ihr Rassismus verbarg, zu überwinden. Dieser Roman war auch ein Mittel, um zu zeigen, dass zur Literatur unauflöslich die moralische und politische Funktion gehört, am Aufbau einer gemeinsamen Welt mitzuwirken. James Baldwin hat Ellison seine Referenz erwiesen, indem er einer Sammlung von Essays den Titel gab Nobody knows my name (Niemand kennt meinen Namen).24
Männer und Frauen auf den Status der Unsichtbarkeit zu reduzieren bedeutet, sie zu Individuen zu machen, deren Leben herabge-würdigt, negiert, verachtet werden. Die Unsichtbarkeit verstärkt die Härte der Lebensbedingungen, denn Existenzen im Schatten sind Existenzen, die nicht zählen, die keine Repräsentation haben in dem Sinn, dass sie in der öffentlichen Debatte nicht präsent sind. Die Missachtung durch Gleichgültigkeit ist schlichtweg die Leugnung der Existenz. Sie zeigt sich auch als Leugnung des gesellschaftlichen Nutzens. Der Historiker Bronislaw Geremek hat darauf hingewiesen, dass im Mittelalter Menschen verurteilt wurden, weil sie als »unnütz für die Welt« oder »unnütz für die öffentlichen Angelegenheiten« galten.25 Heute gibt es viele, die immer noch so angesehen und moralisch wie gesellschaftlich aus dem gemeinsamen Staatswesen ausgeschlossen werden. Aber sehr viel zahlreicher sind all jene, die sich tatsächlich in der Nicht-Welt der Unsichtbaren wiederfinden, weil ihr Beruf als subaltern gilt und / oder sie ihre tägliche Arbeit einsam ausüben oder im Schatten, als wäre sie der Anerkennung durch andere entzogen. Im Hinblick auf die Nicht-Beziehung zwischen diesen Menschen und der Mehrzahl ihrer Mitbürger*innen kann man darum auch von symbolischer Gewalt sprechen. Diese Ungerechtigkeit wurde bisher noch gar nicht beachtet. Die Corona-Pandemie hat uns erinnert, dass eine Gesellschaft ohne all diese Unsichtbaren nicht funktionieren kann, dass sie unverzichtbar sind, obwohl die Einstufung als »nicht systemrelevant« gleichzeitig für Unruhe gesorgt hat. Zuvor schon hatten die Gelbwesten mit ihrer leuchtenden Kleidung ihren Ärger darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie in die Unsichtbarkeit verwiesen wurden. Am Ende des Kapitels werden wir darauf zurückkommen.