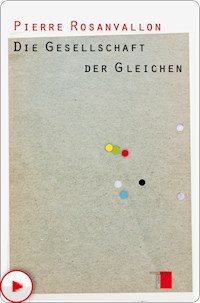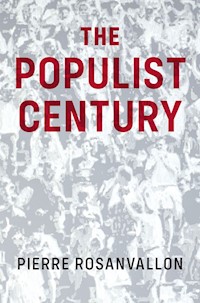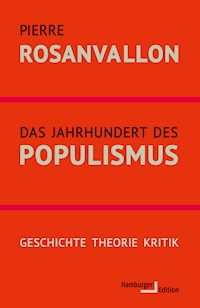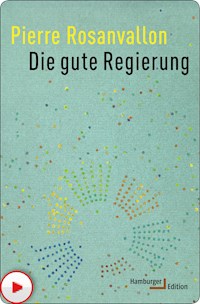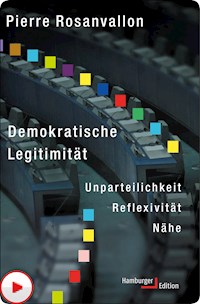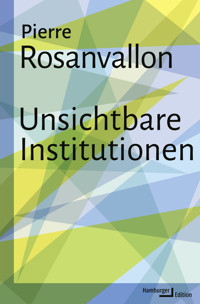
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nie zuvor schienen westliche Regierungen so unfähig, die Gesellschaft zu steuern und zu reformieren. Es ist von »unregierbaren Demokratien«, »Misstrauensgesellschaft« und »öffentlicher Ohnmacht« die Rede, Schlagworte, die den resignierten Fatalismus nähren, in dessen Schatten der Populismus gedeiht. Um die Grundlagen für eine Erneuerung zu schaffen, konzentriert sich der renommierte Demokratietheoretiker Pierre Rosanvallon auf die Konzepte Vertrauen, Autorität und Legitimität. Diese Konzepte, die auf das Innere der Gesellschaft verweisen, bezeichnet er als unsichtbare Institutionen. Es sind Institutionen, weil sie zur Integration, Kooperation und strukturellen Regulierung von Gesellschaften beitragen. Sie sind unsichtbar, weil sie weder durch Regeln definiert noch mit Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung ausgestattet sind. Sie werden vielmehr durch die Beziehungen zwischen Individuen oder zwischen Individuen und Organisationen konstituiert. Eine konstruktive Demokratie hängt vom inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft ab, die sich als beständig und stabil erweisen muss. Pierre Rosanvallon wirft mit diesem bahnbrechenden Buch ein neues Licht auf die Krisenzeiten, die wir durchleben, und zeichnet Möglichkeiten auf, wie es weitergehen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PierreRosanvallon
Unsichtbare Institutionen
Aus dem Französischen vonMichael Bischoff und Ulrike Bischoff
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-410-7
© der deutschen Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-397-1
© der Originalausgabe 2024 by Éditions du Seuil Titel
der Originalausgabe: »Les Institutions invisibles«
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Inhalt
Die unsichtbaren Institutionen erkennen und begreifen – Einleitung
Andere Ausprägungen der Gemeinsamkeit
Die Schaffung der gesellschaftlichen Zeit
Der Institutionenbegriff und seine Konzeptualisierungen
Ein Ausdruck der Lebendigkeit der sozialen Welt
Drei Arten, unsichtbare Institutionen zu begreifen
I Geschichte und Konzeptualisierung
1 Vertrauen – Erfahrungen und Theorien
Kredit und Vertrauen
Ein Entwicklungsfaktor des Handels
Erste theoretische Ansätze
2 Figuren und Funktionen der Autorität
Die Lehren der Römischen Republik
Die Erfindung des politischen Autoritätsbegriffs
Die Frage der intellektuellen Autorität
Die Autorität der Hochschullehrer im Mittelalter
Der Gesetzgeber bei Rousseau
Die drei Figuren der Autorität
3 Die kritische und moralische Triebfeder der Legitimität
Von der Philosophie der guten Regierung zum Recht auf Widerstand
Die Naturrechtstheorien
Die Geste de Gaulles
II Stützpfeiler und Grundlagen
1 Die instrumentelle Gemeinsamkeit
Normen und Maße
Geld
Gemeinsame Sprache
2 Die geteilten Selbstverständlichkeiten
Der Common Sense
Die Vernunft
Der deliberative Konsens
3 Die konstitutive Vorstellungswelt
Von der Staatsreligion in Rom zu den republikanischen Riten
Von der Zivilreligion in Amerika zum Demokratiekult
III Widerstände und Verblendungen
1 Das Projekt der Objektivierung der Welt und der Verweis des Vertrauens in die zweite Reihe
Die unsichtbare Hand und das Projekt einer Marktgesellschaft
Theorien und Praktiken der wissenschaftlichen Organisation
Das neue Zeitalter der Versicherung
Blockchain als ultimative Utopie
Die Kritik der Ökonomen und Juristinnen
Von der vagen Konzeptualisierung des sozialen Kapitals zur fragwürdigen Rückkehr zum Vertrauensbegriff
2 Die Demokratie und die Illusion des Aufgehens der Legitimität in der Legalität
Der antike Horizont der Einmütigkeit
Sinn und Probleme einer Rückkehr des Legitimitätsbegriffs
Die Lehren aus der Weimarer Republik
3 Das Verschwinden der auctoritas hinter der Souveränität
Die Erfindung der Unfehlbarkeit und der Souveränität
Die konservative Rückkehr des Autoritätsbegriffs
Erfolglose Analysen
Ein neues Autoritätsverständnis
4 Die Dekonstruktion der Gemeinsamkeit
Vernunft gegen Common Sense: das französische Beispiel von der Aufklärung bis Bourdieu
Das Zeitalter des Postfaktischen
Geist und Formen einer Rehabilitation – Schluss
Die funktionelle Reduktion des Misstrauens
Die Einsetzung von Autoritäten
Der Legitimität spürbares Leben verleihen
Bedingungen für die Neuformulierung geteilter Evidenzen
Bibliografie
Zum Autor
Die unsichtbaren Institutionen erkennen und begreifen – Einleitung
Noch nie waren Staatsapparate derart aufgebläht, und dennoch wirkten Staaten noch nie so paralysiert und unfähig, Gesellschaften zu leiten und zu reformieren. »Unregierbare Demokratien«, »staatliche Ohnmacht«, »Misstrauensgesellschaft«: Es wurden viele Begriffe geprägt, um diesen Zustand in Worte zu fassen. Aber jenseits der divergierenden Interpretationen und Sichtweisen, auf denen sie beruhen, dienten sie im Wesentlichen nur dazu, den gegenwärtigen Zustand resigniert zu beklagen und zu verfestigen. Sie schlossen sich den routinemäßigen Beschwörungen an, den politischen Willen umzusetzen und alle erdenklichen Normen einer Schlankheitskur zu unterziehen, Appellen, die sich nunmehr durch die Unschärfe des Allgemeinen jeglicher Erkenntnis entgegenstellen. Sicher gibt es keinen Zauberstab, um einen solchen Bann zu brechen, und es wird ihn wohl auch nie geben. Aber man darf zumindest hoffen, durch eine eingehendere Analyse unserer Gesellschaften Möglichkeiten zum Verständnis und damit zu effektivem Handeln zu gewinnen. In diesem Geiste schlage ich in diesem Buch vor, ein neues Universum zu erkunden: das der unsichtbaren Institutionen1 – und zwar in ihren drei Komponenten: Vertrauen, Autorität und Legitimität. Diese verschiedenen Elemente lassen sich insofern als Institutionen einstufen, als sie Faktoren der Integration, Kooperation und Regulierung sind, die die soziale Welt strukturieren. Aber es sind unsichtbare Institutionen, denn sie sind weder durch Statuten definiert, noch durch autorisierte Instanzen gelenkt oder mit Ordnungsmechanismen versehen. Der daher rein funktionale Charakter dieser drei unsichtbaren Institutionen findet seinen Ausdruck vor allem auf zwei Ebenen: im Beitrag zur Organisation der Gemeinsamkeit (le commun) und in der Schaffung gesellschaftlicher Zeit (temps social).
Andere Ausprägungen der Gemeinsamkeit
Seit Langem loten Soziologinnen2 die Ausprägungen sozialen Zusammenhalts aus und fordern dazu auf, die traditionelle Durkheim’sche Sicht auszuweiten. Émile Durkheim, der Gründervater der französischen Soziologie, stellte, wie bekannt, der Gemeinsamkeit der Kooperation, erwachsend aus einer funktionellen Arbeitsteilung, wie sie für stark differenzierte moderne Gesellschaften charakteristisch ist, die Gemeinsamkeit der Gleichartigkeit gegenüber, die kleinen traditionellen Gesellschaften eigen ist.3 Sein Zeitgenosse Gabriel Tarde legte dagegen in einer stark von der Psychologie gespeisten Sicht den Schwerpunkt vor allem auf die Macht der Nachahmungsdynamiken in der Schaffung einer gemeinsamen Welt.4 Noch bevor die Soziologie als Disziplin ihre ersten Schritte tat, hatten bedeutende Autoren im 18. und 19. Jahrhundert bereits vorgeschlagen, zahlreiche Ausprägungen des sozialen Zusammenhalts begrifflich zu fassen. So hatte Adam Smith in seiner Theorie den Markt als Form sozialen Austauschs völlig neuer Art eingestuft, während andere Schotten parallel den Schwerpunkt auf die Rolle der Empathie legten. Rousseau seinerseits hatte nicht nur über den Gesellschaftsvertrag nachgedacht, sondern zudem die traditionellen Verwendungen des Begriffs convenance, Schicklichkeit, Konventionalität (also die Konformität mit einer bestimmten Ordnung der Menschen und Dinge) auf äußerst originelle Weise untergraben und ihm eine dynamischere und stärker soziologische Bedeutung im Sinne eines Passungsverhältnisses verliehen. Er verstand darunter eine spezifische Art, sozialen Zusammenhalt zu schaffen (beispielsweise mochten zwei Individuen feststellen, dass sie zusammenpassten und sich dauerhaft zusammentun konnten).5Somit stand der Begriff convenance dem der Verwandtschaft nahe (der im ausgehenden 18. Jahrhundert in Mode war: So veröffentlichte Goethe 1809 Die Wahlverwandtschaften) und verwies auf eine bestimmte Art und Weise, das Zusammenleben in einer Gesellschaft zu gestalten.6 Im 19. Jahrhundert schlug Charles Fourier eine allgemeine Theorie der Anziehung als Konstitutionsweise einer harmonischen Gesellschaft vor, die den menschlichen Leidenschaften Rechnung trug.7 Andere führten die Modalitäten freiwilliger Kooperation aus, von Autoren wie Buchez (einem der ersten Theoretiker der Genossenschaftsbewegung in Frankreich) bis zu Kropotkin, dem Verfasser von Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt (1902). In jüngerer Zeit betonte man zudem den Begriff der »schwachen Bindungen«8 oder der sozialen Bindung9, um die Formen des Sozialen zu charakterisieren. Im Rahmen der Geschichte dieser sukzessiven Konzeptualisierung lassen sich die spezifischen Produktionsweisen von Gemeinsamkeit herausarbeiten, die mit den drei unsichtbaren Institutionen verknüpft sind. Das Vertrauen besitzt die besondere Eigenschaft, die Grundlage für gemeinsame Interaktion zu liefern, während aus der Autorität die gemeinsame Brechung des Kollektivs im Individuum und aus der Legitimität die gemeinsame Identifikation erwächst.
In einer engen, freundschaftlichen oder familiären Umgebung gilt Vertrauen als vorausgesetzt. Es ist gewissermaßen in diese unmittelbaren und fortdauernden Beziehungen zwischen Personen »eingebaut«, die sich gut genug kennen, um sich spontan aufeinander verlassen zu können. Es ist eine Gegebenheit und muss nicht eigens hergestellt werden: Vielmehr ist es mit der Tatsache der Nähe gleichzusetzen. Das »wahre« Vertrauen ist jenes, das sich zwischen Personen einstellt, zwischen denen von vorneherein eine größere Distanz herrscht. In diesem Fall besteht es in einer Art Ausweitung der Nähe auf kognitiver Ebene: Den anderen besser zu kennen schafft eine Annäherung. Das Vertrauen verringert die Distanz und erweitert zugleich die soziale Welt. Aus diesem Grund spielt es, wie wir sehen werden, eine wesentliche Rolle in Geschichte und Aufstieg des Fernhandels. Es stellt eine Gemeinsamkeit her, nämlich die der Interaktion auf verschiedenen Ebenen der gesellschaftlichen Aktivität. Man könnte auch von einer Gemeinsamkeit der Transparenz sprechen. Auf diese Weise verbindet es das Alte und das Neue und realisiert sogar deren wechselseitige Durchdringung: das Neue einer Welt, die aufgrund ihrer Dimensionen anonymer und unberechenbarer geworden ist, und das Alte einer Welt, in der die sozialen Beziehungen sich unmittelbar erschlossen.
Autorität, definiert als »Führung« im Gramsci’schen Sinne, eine richtungweisende moralische Kraft – im Unterschied zu einer Macht, die über Zwangsmittel verfügt –, schafft Gemeinsamkeit durch ihre Fähigkeit, von allen anerkannt zu werden. Sie steht über den Wechselfällen des politischen Alltags, über Meinungsverschiedenheiten und über sozialen Konflikten. Ihre Anerkennung besitzt eine konstitutive einigende Wirkung. Aber eine Autorität trägt auch dazu bei, dass jede Person leichter eine gewisse Sorge um das Gemeinwohl verinnerlicht. Dieses Anliegen wird nicht mehr als Zwang begriffen, dem man unterliegt, als Verpflichtung, die die Freiheit einschränkt, sondern bestärkt im Gegenteil das Individuum darin, sich als aktive Bürgerin, als für das Kollektiv wichtige Person zu engagieren. Sollte es zwischen diesen beiden Figuren zu einer Spannung kommen, so wird sie zumindest klar formuliert und lässt sich auf objektive Art in den Griff bekommen. Die Wichtigkeit dieses Perspektivwechsels wird auf Anhieb klar, wenn man sie beispielsweise mit Fragen in Beziehung setzt, die ökologischen Wandel betreffen.
In diesem Fall kann man insofern davon sprechen, dass Autorität Gemeinsamkeit schafft, als sie Formen der »Brechung des Kollektivs im Individuum« herbeizuführen vermag.10 Die Autorität lässt sich somit als »Präsenz der Gesellschaft im Individuum« definieren.11 Diese Aussage lässt sich auf zwei komplementäre Weisen verstehen. Zum einen führt die Autorität dazu, dass jede Person die positive Einstellung verinnerlicht, einem sinnvollen Kollektiv anzugehören, zum anderen besitzt sie die Fähigkeit, das Kollektiv zu verkörpern. Sie hat dann die Form einer »symbolischen Transfiguration gewisser Individuen, die die Verantwortung für die kollektiven Normen übernehmen und ihre Umsetzung zu ihrer persönlichen Aufgabe machen«.12 Die Autorität ist in diesem Fall mit der Figur einer Verantwortung gleichzusetzen, die übernommen wird, um dem Kollektiv Sinn und Gestalt zu verleihen. Und sie drückt sich zugleich in dem aus, was als »Wahrsprechen« wahrgenommen wird.13
Auch die Legitimität hat eine informelle Dimension. Im Unterschied zum Rechtscharakter eines Statuts oder einer Institution, der durch Texte definiert und umrissen ist und von dem man sich nicht freimachen kann, erwächst die Legitimität aus einer Eigenschaft, die eher dem Bereich der Moral zuzuordnen ist. Legalität und Legitimität sind also mit zwei verschiedenen Arten von Rahmenwerken und Regulierungen verknüpft: mit dem positiven Recht beziehungsweise mit dem Naturrecht. Vom Naturrecht darf man erwarten, dass es in Bezug auf eine bestimmte gemeinsame Sicht zum Leben der Individuen und zur Existenz des Kollektivs für alle gilt, aber weder über Richter noch über Polizeikräfte verfügt, die seine Einhaltung und Umsetzung überwachen. So vereinen sich Stärke und Schwäche im Begriff der Legitimität. Aber die Stärke kommt in dem Maße tatsächlich zum Tragen, wie sie von einer potenziell universellen Unterstützung profitiert, während die Legalität letztlich allein auf der Bestätigung durch das Mehrheitsprinzip beruht. Was als legitim anerkannt wird, findet dagegen allgemeine Zustimmung. Institutionen und Persönlichkeiten unterschiedlicher Art, die als legitim anerkannt sind, schaffen so eine Gemeinsamkeit der Identifikation oder eine Gemeinsamkeit des Konsenses, die einer dritten spezifischen Modalität der Konstitution des Sozialen durch die unsichtbaren Institutionen entspricht: einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Werten, die alle einbeziehen und eine autonome, gegenüber der etablierten Macht potenziell kritische Kraft darstellen.
Die Schaffung der gesellschaftlichen Zeit
Eine weitere wesentliche Funktion der unsichtbaren Institutionen ist die Konstruktion der Zeit. Zu den Merkmalen des Vertrauens gehört typischerweise, mit einem bestimmten Verhalten eines anderen in der Zukunft zu rechnen. Dadurch ermöglicht es, die dem sozialen Leben eigene Unsicherheit zu reduzieren und zugleich die damit verbundenen Befürchtungen zu mildern. So kann man beispielsweise darauf vertrauen, dass ein Unternehmen einen Liefertermin einhält, dass ein Freund einen ihm geborgten Geldbetrag zurückzahlt oder, prosaischer, dass man in einer Kurve kein entgegenkommendes Fahrzeug auf seiner Fahrspur auftauchen sieht. Wenn wir unser Alltagsleben genau beobachten, müssen wir feststellen, dass die Erwartungen an das Verhalten von Personen oder das Funktionieren von Organisationen unsere Existenz strukturieren. Sie wirken sich ständig und auf allen Ebenen aus, von den geringfügigsten bis zu den lebenswichtigen. Dieses Vertrauen hat nichts von einer Wette. Vielmehr stützt es sich auf Informations- und Einschätzungselemente in Bezug auf andere und auf die Kenntnis von Regeln, die den Rahmen des sozialen Lebens bilden. Somit hat es eine proaktive Dimension. Die Tatsache, Vertrauen in jemanden oder etwas zu setzen, bestimmt im Gegenzug mein Verhalten. So begnüge ich mich nicht damit, es als äußerst unwahrscheinlich einzuschätzen, dass ein Fahrzeug mir auf meiner Straßenseite entgegenkommt: Ich verhalte mich vielmehr so, als sei das tatsächlich nicht der Fall. Würde ich an allem zweifeln und allem misstrauen, wäre ich tatsächlich gelähmt und unfähig, zu handeln und mich in die Zukunft zu versetzen. Letztlich würde die gesamte Gesellschaft zusammenbrechen.14
Das Vertrauen ermöglicht somit die zeitliche Einbettung der sozialen Welt, und das auf mehrere Arten. Aus anthropologischer Sicht verleiht diese Projektionsfähigkeit dem Individuum seine existenzielle Tiefe (épaisseur), die aus ihm ein Wesen auf Zeit macht. Psychologisch hat Vertrauen auch eine emotionale Stabilisierungsfunktion. In einer immer komplexeren und anonymeren Gesellschaft trägt es dazu bei, das Gefühl der Instabilität und Unsicherheit zu reduzieren. Zugleich kanalisiert es das Wirken der Vorstellungskraft, eine der versteckten Kräfte, die das Zusammenleben von Menschen regulieren oder deregulieren.15 Es lässt sich sogar zurecht behaupten, dass das Vertrauen selbst eine »soziale Organisationsform« darstellt,16 während Marcel Mauss parallel annahm, dass die Erwartung »eine der Formen des kollektiven Denkens« sei.17 Spezieller und offenkundiger trägt das Vertrauen zur Wirtschaftsdynamik bei. Indem es die Unsicherheit reduziert, ist es dort ein wirkmächtiges Instrument, um menschliches Handeln in einen Zeitrahmen einzuordnen.
Der Begriff der Autorität, definiert als auctoritas im römischen Sinne des Wortes und klar unterschieden von der Macht, die auf der Vorstellung basiert, Befehle erteilen und Entscheidungen durchsetzen zu können, beruht ebenfalls auf einer solchen Fähigkeit, soziale Zeit zu konstruieren. Autorität setzt Maßstäbe, gibt die einzuschlagende Richtung an und verleiht dem menschlichen Handeln Sinn, indem sie ein Kollektivprojekt mit einer Geschichte verknüpft. »Die Zeit ist die Matrix der Autorität, wie der Raum die Matrix der Macht ist«, wurde zurecht konstatiert.18 Jenseits dieser Feststellung lässt sich sagen, dass die Autorität Zeitlichkeit schafft. Sie ermöglicht es, die Existenz einer Menschengruppe auf ein Schicksal auszuweiten. Sie ist eine Kraft, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft integriert, um daraus eine Identität abzuleiten. Dazu verbindet sie sich auf positive und keineswegs nostalgische Weise mit der Tradition. »Sofern Vergangenheit als Tradition überliefert ist, hat sie Autorität. Sofern Autorität sich geschichtlich darstellt, wird sie zur Tradition«, schrieb folglich Hannah Arendt.19 Sie ist eine Kraft oder eine Parole, die in den Augen aller Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu integrieren vermag, um Geschichtlichkeit zu schaffen. Der Verweis auf Legitimität ist Teil eines gleichartigen Unterfangens, indem er dazu auffordert, zwischen der kurzfristigen instrumentellen Legalität, die in der Demokratie den Wahlperioden entspricht, und dem langfristigen Festhalten an Werten zu unterscheiden. Eine Unterscheidung, die großenteils mit der zwischen Naturrecht und positivem Recht übereinstimmt, aber auch an die Besonderheit des Verfassungsrechts denken lässt. Die drei unsichtbaren Institutionen sind also durchaus daran beteiligt, eine Gesellschaft als eine für die Zeit konstruktive Erfahrung zu vermitteln.
Der Institutionenbegriff und seine Konzeptualisierungen
Es besteht wohl Einigkeit darin, Institutionen allgemein als Organisationsstrukturen menschlicher Interaktionen in verschiedenen Bereichen zu definieren. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts lieferte Montesquieu eine hilfreiche Präzisierung, als er in seinem Werk Vom Geist der Gesetze eine allgemeine Theorie zur Funktionsweise von Gesellschaften darlegte, in der er die regulatorische Funktion der Sitten und die präskriptive Rolle der Gesetze verknüpfte, also zwei bis dahin nur getrennt betrachtete Pflichtenregister.20 Auf der Basis dieses Rasters schlug er eine vergleichende Geschichte der Zivilisationen vor, die es sowohl ermöglichen würde, den Unterschied zwischen den antiken Republiken (in denen die Sitten seiner Ansicht nach eine zentrale Rolle spielten) und den modernen Monarchien (definiert durch die Herrschaft des Gesetzes) konzeptionell zu fassen als auch die Besonderheit der chinesischen Welt seiner Zeit im Vergleich zu Europa zu bestimmen (einer Welt, in der sich nach seiner Analyse Gesetze, Religion, Sitten und Gebräuche zu einem »allgemeinen Geist« [esprit général]21 vermengten und eine originelle Überlagerung von Häuslichem, Sozialem und Politischem bildeten). Aus dieser Konzeptualisierung leitete er zudem einen politischen Vorschlag ab: Er kritisierte den damaligen Zeitgeist, der sich über die Notwendigkeit ausließ, die als gefährdet erachteten Sitten wiederherzustellen, wohingegen er es für dringender hielt, die Gesetze zu stärken, da die gesellschaftliche Ordnung nach seiner Einschätzung mehr von der Bestrafung von Verbrechen abhing als von der Sakralisierung der Moral.
Während Montesquieu es der Entwicklung dieser Konzeption verdankte, als einer der Gründerväter der Gesellschaftswissenschaften zu gelten – was Durkheim in einer seiner ersten Schriften eindeutig anerkannte22 –, erfährt heutzutage seine erweiterte Verwendung des Institutionenbegriffs besondere Aufmerksamkeit. Tatsächlich fasste Montesquieu unter diesem Oberbegriff Gesetze und Sitten zusammen: Erstere waren »besondere und genau umschriebene Einrichtungen des Gesetzgebers; Sitten und Lebensstil waren Einrichtungen der Nation im Ganzen«.23 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ sich Marcel Mauss, der zunächst ein Wegbegleiter Durkheims war, bis er die französische Anthropologie begründete, von dieser Sicht Montesquieus inspirieren und entwarf eine allgemeine Theorie der Institutionen, wie man es nennen könnte. Er stellte fest, dass sich vielfältige Arten entwickelt hatten, Gesellschaft zu gestalten und das Gemeinschaftsleben zu organisieren, und schlug daher vor, das, was man unter dem Begriff der sozialen Tatbestände erfasst, auszuweiten und folglich die Definition, was eine Institution ist, über organisierte Strukturen von im Wesentlichen öffentlichem Charakter hinaus auszudehnen. »Es gibt keinen Grund, diesen Ausdruck [Institution] ausschließlich, wie es gewöhnlich geschieht, den grundlegenden sozialen Übereinkünften vorzubehalten. Wir verstehen unter diesem Wort also die Gebräuche und Moden, die Vorurteile und die abergläubischen Überzeugungen ebenso wie die politischen Verfassungen und zentralen rechtlichen Organisationen; denn alle diese Phänomene sind von gleicher Natur und nur graduell verschieden. Die Institution ist, kurz gesagt, innerhalb der sozialen Ordnung, was die Funktion in der biologischen Ordnung ist: Und wie die Wissenschaft vom Leben die Wissenschaft von den Lebensfunktionen ist, so ist die Wissenschaft von der Gesellschaft die Wissenschaft von den in diesem Sinne definierten Institutionen.«24 Neben der Erforschung gesellschaftlicher Gruppen sollte sich die Soziologie seiner Ansicht nach mit den Merkmalen dieser verschiedenen Kategorien von Institutionen im weitesten Sinne befassen.
Als Jurist formulierte Maurice Hauriou in den 1930er Jahren eine bemerkenswerte Theorie der Institution. Demnach konnte man von einer Institution sprechen, sobald drei Elemente in einer gesellschaftlichen Form vereint waren: eine »Beziehung zur allgemeinen Ordnung der Dinge«, eine dauerhaft stabile Existenz sowie die Fähigkeit, eine regulatorisch-organisatorische Funktion zu gewährleisten, indem ein Rahmen für Verhalten gesetzt wird. Parallel entwarf ein Wirtschaftswissenschaftler das Projekt einer institutionellen Ökonomie, die er in die Analyse wirtschaftlicher Phänomene einbeziehen wollte.25 In diese Richtung entwickelte sich eine äußerst aktive Strömung der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsgeschichte, wie die Verleihung einer Reihe von Nobelpreisen an deren renommierte Vertreter illustriert.26 Diese Ökonomen und Historikerinnen definieren Institutionen als Gesamtheit der Regeln, die soziale Interaktionen strukturieren.27 Regeln, die formell (Gesetze, Verfassungen, auf verschiedenen Ebenen des sozialen Lebens etablierte Normen) oder informell sind (Verhaltenskonventionen, Höflichkeitsformen, Werte und Traditionen). Kürzlich schlug ein viel beachteter Artikel vor, diese beiden Elemente besser zu unterscheiden und die informellen Institutionen dem weiter gefassten Begriff »Kultur« zuzuordnen.28 Von diesem semantischen Vorschlag abgesehen, ist den formellen Institutionen und den Variablen kultureller Art gemeinsam, dass es sich in beiden Fällen um in der Umgebung von Personen konstituierte Gegebenheiten handelt, die bereits bestehen, bevor diese handeln.
Von dieser Art sind die unsichtbaren Institutionen nicht. Sie sind resultierende, nicht konstituierende Institutionen. Tatsächlich werden sie durch die bestehenden sozialen Beziehungen konstruiert und bestimmt und sind daher keine »kulturellen« oder »informellen« Gegebenheiten, die einer bereits konstituierten Umgebung angehören. Der Unterschied in der Herangehensweise wird offenkundig, wenn man die Frage des Vertrauens betrachtet. Für Vertreterinnen der Institutionenökonomie sind die bestehenden Formen von Misstrauen und Vertrauen überlieferte kulturelle Variablen: Je nach ihrer Geschichte und ihren Merkmalen herrscht in manchen Ländern ein höheres Maß an Vertrauen als in anderen. Die Theorie der unsichtbaren Institutionen legt eine andere Sicht nahe. Zunächst unterstreicht sie, dass es kein generelles, singuläres Vertrauen gibt, sondern ein Ensemble sozialer Beziehungen, in denen dieses Verhältnis auf vielfältige Weise zum Tragen kommt. Als Nächstes erinnert sie daran, dass Vertrauen immer von unten kommt: Es besteht darin, einem anderen oder einer Institution eine Eigenschaft zuzuschreiben, und erwächst insofern aus einer jeweils spezifischen Beziehung. Es ist etwas, was konstruiert wird und nichts Gegebenes hat. Anhand dieses einen einzigen Beispiels wird erkennbar, was der Begriff der unsichtbaren Institutionen zu unserem Verständnis der Welt beizutragen vermag. Sie sagen uns etwas über das tatsächliche Leben von Gesellschaften und nicht nur über ihre Strukturen, ihre Kultur und die theoretischen Regeln ihrer Funktionsweise.
Ein Ausdruck der Lebendigkeit der sozialen Welt
Die Biologie lehrt uns, dass das Funktionieren von Organismen sich nicht auf die Addition und mechanische Artikulation der Organe beschränkt, die ihre Bestandteile bilden. Der Begriff des »Lebendigen« ist mit einer zugleich dynamischeren und für die wissenschaftliche Forschung interessanteren Sicht verknüpft. Die biologische Forschung legt daher den Schwerpunkt auf die Instabilität jeder lebendigen Struktur und zugleich auf die permanente, endlose Erneuerung ihrer Erscheinungsformen, die speziell die menschliche Welt kennzeichnen.29Wer Bergson und sein Werk Schöpferische Entwicklung liest,30 kann diese Feststellungen vertiefen und konzeptionell transponieren, indem er dessen Begriffe Dauer und élan vital (Lebensschwung) aufgreift, denn sie stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang zu den Begriffen, die zur Beschreibung der Funktionen unsichtbarer Institutionen verwendet wurden.
Leben ist die Eigenschaft dessen, was im Rahmen der Zeit geschieht. In Verbindung mit dem Begriff der Dauer setzt es eine gewisse Erinnerung an die Vergangenheit und ein spontanes Bewusstsein für die Zukunft voraus.31 Es ist zudem ein Kreislaufprinzip, das auf die Idee einer Gesamtheit zurückgeht, die Sinn ergibt und sich permanent konstruiert. Auf diese Weise schafft das Leben Kohärenz und Intensität, die einen Organismus im etymologischsten Sinne des Wortes animiert, also lebendig macht.32 Ein Kommentator Bergsons erklärte in diesem Sinne, dass Wesentliche seines Werkes bestehe in »seinem Versuch, einen unmittelbaren Kontakt zu den fluiden Aspekten der Realität herzustellen, die dem konzeptionellen Denken entgehen, weil sie eine analytische Zerlegung nicht überstehen«.33 Eben zu dieser Art von Realität gehören die unsichtbaren Institutionen. Sie sind Bestandteil der Lebensaufgabe, da sie, wie gesagt, die Funktion erfüllen, Gemeinsamkeit zu schaffen und gesellschaftliche Zeit zu konstruieren.34 Der Hinweis auf die Kategorie des Lebendigen ist auch negativ sinnvoll. Greift man den berühmten Aphorismus von Xavier Bichat auf, der das Leben als »Gesamtwirkung der Funktionen, die dem Tod widerstehen«, definiert,35 so muss man feststellen, dass die Gesellschaft ohne die unsichtbaren Institutionen eingehen und letztlich untergehen würde. Ohne Vertrauen würde der Handel zum Erliegen kommen; ohne Legitimität würden die politischen Regime zusammenbrechen oder sich auf erbarmungslosen Totalitarismus reduzieren; und ohne Autorität würde eine Form von Anarchie herrschen. Hierzu gibt es Erfahrungsberichte, für die wir zahlreiche Beispiele anführen werden.
Diese Sicht, was unsichtbare Institutionen sind und welche Rolle sie spielen, verkompliziert Montesquieus Schema. Tatsächlich erweitert es sich nicht nur, indem neben Gesetzen und Sitten eine »dritte Dimension« in die Analyse integriert wird.36 Die Eigenheit unsichtbarer Institutionen besteht vor allem darin, dass sie ein andersartiges Verständnis der sozialen Welt widerspiegeln. Sie entspringen einer Art von Realität – dem »Leben« von Gesellschaften –, die zugleich psychologischer, unmittelbarer interaktiv und instabiler ist, dabei aber zutiefst strukturierend wirkt. Sie sind Ausdruck der »Moral« von Gesellschaften mit den Vorstellungen von Zukunft, die sie sich schaffen, und dem Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sie manifestieren. Sie eröffnen Perspektiven oder schließen Horizonte; festigen Reiche oder bringen sie ins Wanken; entscheiden über den Ausgang von Schlachten; treiben Reformen voran oder blockieren sie. Zuweilen manifestieren sie sich in einer Nichtwählerquote, einem Börsenkurs oder einem Wechselkurs. Aber häufiger drücken sie sich in »Effekten ohne Ursache« aus, die es zu entschlüsseln gilt, um ihre Entstehung nachzuvollziehen. Das bedeutet, dass diese unsichtbaren Institutionen die wirkungsvollsten Mittel des Regierens sind, gleichzeitig aber auch im Fall ihres Versagens die dumpfeste Opposition zum Ausdruck bringen und unüberwindbaren Widerstand darstellen können. Daher ist das Soziale und das Politische unmöglich denkbar und machbar, ohne ihr Wesen und ihre Konstitutionsweisen zu verstehen.
Drei Arten, unsichtbare Institutionen zu begreifen
Dieses Buch verfolgt drei Arten, unsichtbare Institution zu erfassen: zunächst den historischen und konzeptionellen Ansatz, der einlädt, beispielsweise von den römischen Begriffen fides und auctoritas auszugehen, oder der auf die religiösen und politischen Konflikte des 16. Jahrhunderts verweist, die erstmals dazu führten, dass der Begriff der Legitimität im Abendland gegenüber dem der Legalität (der um die Mitte des 20. Jahrhunderts erneut an Aktualität gewann, um die Katastrophen jener Zeit zu erklären) als autonom betrachtet wurde. Bevor wir uns mit den ersten Arbeiten der Gesellschaftswissenschaften befassen, die Konzeptualisierungen dieser Begriffe vorschlagen, gilt es die philologischen Variationen und die Art und Weise zu betrachten, wie Vertreterinnen der Politik-, Wirtschafts- und Geistesgeschichte diese Begriffe aufgegriffen haben, um die großen Entwicklungen und Innovationen der von ihnen erforschten Epochen darzustellen.
Zweitens lassen sich die unsichtbaren Institutionen in ihrer Verknüpfung mit den verschiedenen Maßnahmenkategorien sehen, die geeignet sind, sie mit einem Rückgrat auszustatten. Man könnte von einem Nährboden sprechen, von instrumentellen Vorkehrungen, die in erster Linie eine gemeinsame Welt organisieren. Die Existenz gemeinsamer Normen und Maßnahmen bildet beispielsweise einen wesentlichen Stützpfeiler, um Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Eine gemeinsame Sprache und die gleiche Währung spielen ebenfalls eine Rolle: Die Lehren der Geschichte zu diesen diversen Punkten sind äußerst erhellend. Aber die Existenz gemeinsamer Selbstverständlichkeiten schafft ebenfalls Nähe. Daher der notwendige Verweis auf die Idee des Common Sense, der Vernunft oder auch des deliberativen Konsenses, die historisch drei wichtige Denk- und Handlungsweisen kennzeichneten, um Menschen in ihren Einstellungen einander näher zu bringen, Kooperation zu begünstigen und das demokratische Unterfangen zu legitimieren. In einem weiter gefassten Sinne geht es aber auch um die konstitutive Vorstellungswelt (um eine Formulierung Paul Veynes aufzugreifen), die eine mentale Landschaft skizziert, in der Sitten und Denkweisen zusammenfinden. Wir betrachten diese in den beiden laïzisierten Erscheinungsformen der »Staatsreligion« (religion civique) im römischen Sinne und der »Zivilreligion« (religion civile) in der amerikanischen Tradition.
Die Frage der unsichtbaren Institutionen lässt sich schließlich auch in Hinblick auf eine »negative Geschichte« betrachten: die der Kräfte, die ihrer Anerkennung und Entfaltung entgegenstehen. Häufig gelten sie als archaische Beziehungstypen, die in der modernen Welt nur noch eine marginale Rolle spielen sollten. So dachte man beispielsweise, dass die Beherrschung der Unsicherheit und Komplexität, die das Vertrauen bewirkte, dazu führen würde, dass es zunehmend durch neue Techniken der rationellen Organisation, der Vertragsgestaltung und der Versicherungen ersetzt würde (bis hin zu den jüngsten Verheißungen der Blockchain-Mechanismen). Ökonomen und Juristinnen forderten daher auf, einen als unscharf geltenden Begriff aufzugeben. Im Bereich des politischen Lebens war man parallel dazu der Ansicht, dass der Rückgriff auf ein Legitimitätsprinzip, das in Zeiten der Wirren und Mahnungen gerechtfertigt war, in stabilen demokratischen Regimen nicht mehr zweckmäßig sei und moralische Legitimität und formale Legalität nun zusammenfallen könnten (zahlreiche Kommentatoren sahen in der verbliebenen gaullistischen Verwendung dieses Begriffs ein Zeichen dafür, dass General de Gaulle der Erinnerung an seinen Appell vom 18. Juni 1940 verhaftet war). Parallel dazu hielt man auctoritas in einer vom Souveränitätsprinzip geleiteten Welt für gegenstandlos oder löste sie im lauwarmen Wasser der Managementtechniken auf. Man bezog sie nur noch auf nostalgische Figuren wie den pater familias oder die Lehrer der Antike. Folglich konnte man sich deren Wiederkehr nur auf diese reduzierte Art vorstellen.
Gleichzeitig waren Dekonstruktionsbewegungen der Gemeinsamkeit am Werk und untergruben die Fundamente diverser unsichtbarer Institutionen. In erster Linie handelte es sich um die Kluft, die zwischen Vernunft und Common Sense entstand; eine Spaltung, die in Frankreich mit dem Vorherrschen einer gewissen intellektuellen und technokratischen Arroganz besonders ausgeprägt ist. Aber mehr noch und vor allem war es der Beginn des »postfaktischen Zeitalters«, das seine schädigenden Wirkungen zeitigte, indem es die Feststellung objektiver Wahrheiten mit einer gewissen gesellschaftlichen Verachtung belegte und eine zerstörerische Kultur der Verleugnung schuf.
Diese diversen Kategorien widriger Kräfte spielen eine wesentliche Rolle im gegenwärtigen Niedergang unsichtbarer Institutionen – mit den daraus erwachsenden Folgen, die sich am beunruhigendsten in der Erschütterung der demokratischen Ordnung äußern, einer Erschütterung, von deren dumpfer Macht die große Welle des rechtsextremen Populismus zeugt. Diese Welle lässt sich weder durch besorgte Klagen noch durch wiederholte Beschwörungen, die sich parallel vervielfachen, eindämmen. Denn tatsächlich hat sie tiefere Ursachen.
Nur indem man diese widrigen Kräfte genau und scharfsinnig erforscht, kann man eine Bresche in die Mauer fatalistischer Resignation schlagen, die durch die stummen Eingeständnisse der Ohnmacht tagtäglich dicker wird. Im Schlusskapitel schlägt dieses Buch sowohl Elemente einer Methode als auch konkrete Wege vor, diesen Bann zu brechen.
1 Der Begriff »unsichtbare Institutionen« wurde erstmals von Kenneth Arrow in Bezug auf das Vertrauen verwendet; siehe ders., Wo Organisation endet, S. 23. Des Weiteren hat mich der französische Titel des Buches Pouvoir. Les génies invisibles de la cité inspiriert, in dem sich der italienische Essayist Guglielmo Ferrero mit der politischen Legitimität befasste (Erstveröffentlichung 1943 in den USA). Dieses Werk war ein wichtiger Bezugspunkt für das gaullistische Milieu der Nachkriegszeit.
2 Die Übersetzung bemüht sich um eine gendergerechte Sprache und wechselt daher wahllos zwischen den grammatikalischen Geschlechtern. Anm. d. Übers.
3 Daher unterscheidet er zwischen organischer und mechanischer Solidarität, die im Zentrum seines grundlegenden Werkes Über soziale Arbeitsteilung (1893) stehen.
4 Sein Hauptwerk, Die Gesetze der Nachahmung, stammt von 1890. René Girard knüpft an diese Intuition an, indem er das »kopierte Begehren« als wesentliche Triebfeder menschlicher Beziehungen sieht; siehe ders., Figuren des Begehrens.
5 Für ihn ist die Frage, was eine erfolgreiche Ehe ist, eine wesentliche politische Gegebenheit. Siehe hierzu das aufschlussreiche Buch von Florent Guénard, Rousseau et le travail de la convenance.
6 Rousseau verwendete ihn auch in seinem Frühwerk Institutions chimiques, das aus einer Auftragsarbeit hervorging und erst kürzlich wieder aufgelegt wurde; manche erkannten darin das Grundmaterial für den Gesellschaftsvertrag.
7 Siehe die Stichworte »Association«, »Attraction« und »Passions« in: Silberling, Dictionnaire de sociologie phalanstérienne.
8 Der Begriff, der auf den bahnbrechenden Artikel von Mark Granovetter »The Strength of Weak Ties« zurückgeht, regte zu zahlreichen Arbeiten an. Siehe z. B. Gefen/Laugier (Hg.), Le Pouvoir des liens faibles.
9 Paugam, L’Attachement social.
10 Dieser Ausdruck stammt von Alain Eraly; siehe Lebrun/Eraly, Autorité, coercition et domination, S. 101.
11 Siehe Genel, Autorité et émancipation, S. 32.
12 Bourricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, S. 368.
13 Siehe dazu meine Ausführungen zu »Die Motive des Wahrsprechens« in: Rosanvallon, Die gute Regierung, S. 305–309.
14 »Ohne jegliches Vertrauen aber könnte [der Mensch] morgens sein Bett nicht verlassen«, schrieb Niklas Luhmann in einem der Standardwerke zu diesem Thema: Luhmann, Vertrauen, S. 1. Ausführungen zu seinem Herangehen an diese Frage siehe ab S. 39 des vorliegenden Buches.
15 Diese soziale Funktion der Vorstellungskraft zu berücksichtigen stand im Zentrum von Adam Smith’ Werk Theorie der ethischen Gefühle. Zu einer erhellenden Interpretation dieses Werkes siehe Griswold, Adam Smith and the Virtues of Enlightenment.
16 Die Formulierung findet sich wiederholt bei Lucien Karpik, z. B. in seinem Artikel »L’Économie de la qualité«.
17 Mauss/Simiand, »Debatte über die Funktionen des Geldes«, S. 121. Er fährt fort: »Wir sind unter uns, in Gesellschaft, um untereinander dieses oder jenes Ergebnis zu erwarten; das ist die wesentliche Form der Gemeinschaft. […]. ›Ich erwarte‹ ist die Definition jeder kollektiven Handlung schlechthin.« Ebd.
18 Revault d’Allonnes, Le Pouvoir des commencements, S. 13.
19 Arendt, Menschen in finsteren Zeiten, S. 244.
20 Dies ist einer der meistkommentierten Aspekte seines Werkes, siehe Larrère, »Droit et moeurs chez Montesquieu«.
21 Zum esprit général bei Montesquieu siehe Spector, »Montesquieu, parcours d’une œuvre«.
22 Durkheim, Der Beitrag Montesquieus zur Begründung der Soziologie (1892). Siehe auch Karsenti, »Politique de la science sociale«. Es sei daran erinnert, dass Durkheim die Soziologie definierte als »die Wissenschaft von den Institutionen, ihrer Entstehung und Wirkungsart«; Durkheim, Die Regeln der soziologischen Methode, Vorwort zur zweiten Auflage, S. 100.
23 Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, S. 302.
24 Mauss/Fauconnet, »Soziologie«, Abs. 22. Diese Konzeption der Institution entwickelte Mauss in seiner »Einführung in die Analyse einiger religiöser Phänomene« weiter.
25 Commons, Institutional Economics, 1934. Kürzlich erschien dieses Buch in einer französischen Übersetzung mit Anmerkungen und Biografie: L’Économie institutionnelle. Zur Rezeption siehe Guéry (Hg.), Lectures de John R. Commons.
26 Ein Artikel von Douglas North, »Institutions« (1991) lenkte die Arbeiten erneut in diese Richtung. Er erhielt ebenso den Nobelpreis wie Robert Fogel, Elinor Ostrom und Oliver Williamson. Zu einem Überblick über diese Strömung, der man auch die »ökonomische Analyse des Rechts« zurechnen kann, siehe das Sonderheft der Zeitschrift Tracés (17/3, 2009) sowie Chavance, L’Économie institutionnelle.
27 Hier ist der erhebliche Einfluss des Buches von Greif, Institutions and the Path to the Modern Economy, zu unterstreichen. Darin definiert er Institutionen als »ein System von Regeln, Überzeugungen, Normen und Organisationen, die zusammen eine Regelhaftigkeit des (sozialen) Verhaltens hervorbringen« (S.30).
28 Siehe Alesina/Giuliano, »Culture and Institutions«. Die beiden Autoren fordern dazu auf, einen eigenen Zweig der cultural economics zu entwickeln.
29 Siehe Prochiantz, Qu’est-ce que le Vivant?
30 Nachdem Bergsons Œuvre zunächst durch Gilles Deleuze (siehe Le Bergsonisme, 1966) rehabilitiert wurde, hat es jüngst eine globale Neubewertung erfahren, beginnend mit der kritischen Neuauflage seiner Werke unter der Leitung vor allem von Frédéric Worms, dessen Arbeiten übrigens ebenfalls dazu beigetragen haben, dass Bergson wieder gelesen wurde. Für unsere Zwecke siehe besonders Bergson, Schöpferische Entwicklung.
31 Für Bergson ist die Dauer nicht das von der Uhr gemessene mechanische Verrinnen der Zeit, sondern das subjektive Zeitbewusstsein als Erfahrung, die einer entstehenden Geschichte entspricht. »Es ist unser eigenes Ich, das sich abspielt«, schrieb er; Bergson, L’Idée de temps, S. 43.
32 Aus diesem Grund ist dieser Begriff eher angebracht als der wesentlich statischere des »Zements«, der einem in den Sinn kommen könnte; siehe Elster, The Cement of Society.
33 Landes, »Bergson et Deleuze sur L’Évolution créatrice«, S. 163.
34 »Wie das Universum in seiner Gesamtheit […] ist der Organismus, der lebt, ein Ding, das dauert. Lückenlos dehnt sich seine Vergangenheit hinein in sein Jetzt und bleibt in ihm gegenwärtig und wirkend.« Bergson, Schöpferische Entwicklung, S.21–22. Dauer hat für ihn nichts Passives. Sie bedeutet sich zu entwickeln, sich neu zu erfinden, sich zu erweitern und zu stärken. Dauer bedeutet »ununterbrochenes Hervortreiben von absolut Neuem«, schrieb er an anderer Stelle (S. 17).
35 Bichat, Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod, S. 1; mit dieser Definition beginnt sein Werk.
36 Es ist festzuhalten, dass diejenigen, die von einer Dualität von Institutionen/Kultur ausgehen, eine Verarmung dieses Begriffs hinnehmen, indem sie ihn unschärfer machen.
I Geschichte und Konzeptualisierung
1 Vertrauen – Erfahrungen und Theorien
Vertrauen erwächst in erster Linie aus der menschlichen Erfahrung einer gewissen dauerhaften Bindung zwischen zwei Personen. So illustrieren Freundschaft und Liebe exemplarisch eine Beziehung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Beteiligten eine dauerhafte Hypothese über das zukünftige Verhalten des anderen aufstellen können: Man weiß, was man von einer Freundin oder einem Geliebten »erwarten kann«. Homer zeigte in der Odyssee auf seine Weise die regulatorische und erzieherische Funktion solcher Beziehungen. Als Kirke sah, dass Odysseus ihre List vereitelt hatte und sie nichts gegen ihn ausrichten konnte, ließ er sie sagen: »Dann wohlan, steck ein dein Schwert und laß uns zusammen auf meinem Lager ruh’n, damit wir beide vereinigt uns der Umarmung erfreun und werden vertraut miteinander.«1 Vertrauen ermöglicht es, Unsicherheit zu reduzieren und eine auf Dauer angelegte ruhige, für beide Seiten positive Beziehung zu führen. In den monotheistischen Religionen beruht der Glaube des Menschen an seinen Gott und Schöpfer auf der Annahme, dass dieser in der Lage ist, permanent wohlwollend über das Leben auf der Erde zu wachen. »Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort«, heißt es beispielsweise in einem Psalm der Bibel.2 Diese beiden Modalitäten des Vertrauens – das »direkte«, interindividuelle Vertrauen und der religiöse Glaube an seine Idealität – umreißen seine Grenzen. Historisch besaß der Begriff jedoch eine umfassendere Bedeutung. In der römischen Welt erwuchs fides, Vertrauen, aus einer bestimmten globalen Sicht der sozialen Ordnung. Später bildete es zudem die Grundlage für eine wirtschaftliche Kategorie wie den Kredit.
Kredit und Vertrauen
Das Wort fides hat im Lateinischen eine ganz spezielle Bedeutung. Es bezieht sich nicht auf den oben erwähnten religiösen Glauben, sondern bezeichnet ein grundlegendes Moralprinzip des sozialen Lebens: die Einhaltung eingegangener Verpflichtungen, besonders der Eide. Fides galt in Rom als Gottheit, und ihr Kult verehrte in ihr den heiligen Charakter des gegebenen Wortes (aus diesem Grund konnte man die Römer als »Volk der Fides« bezeichnen).3 Diesen Respekt symbolisierte die rechte Hand, die zum Eid erhoben oder einem anderen zum Handschlag gereicht wurde. Fides/Vertrauen hatte also in Rom den Charakter einer Verpflichtung. Allerdings handelte es sich nicht um eine reziproke Verpflichtung unter Gleichen wie bei einem Vertrag, sondern um die Verpflichtung eines Höhergestellten gegenüber seinen Untergebenen oder um die Pflichten, die man gegenüber seinen »Klienten« (im römischen Sinne des Wortes also den Abhängigen und Schützlingen eines Patrons) zu erfüllen gedachte. Fides ist hier also etwas, was man einem anderen erweist oder verspricht, und weit von dem heutigen bilateralen Begriff entfernt, »jemandem sein Vertrauen zu schenken« oder »Vertrauen zu jemandem zu haben«.4 In diesem Rahmen setzte sich der römische Begriff fides wie selbstverständlich fort in den des Kredits im Sinne der Glaubwürdigkeit. Jemand, der sich gegenüber einem anderen verpflichtet, hat zugleich bei ihm Kredit, besitzt also Glaubwürdigkeit. Zunehmend verselbstständigte sich der Begriff Kredit, behielt zwar eine gesellschaftliche Dimension, wurde aber spezifischer auf den Wirtschaftsbereich angewendet und verband sich mit dem, was den modernen Vertrauensbegriff ausmacht.5
»Einen gewissen Kredit genießen«: Dieser Ausdruck, der sich zunächst auf das Vertrauen bezog, das eine Person allgemein einflößt, verengte sich mit der Entwicklung des Handels um die Wende zum 16. Jahrhundert auf das Vertrauen eines Gläubigers in die Zahlungsfähigkeit eines Darlehensnehmers.6 In den indoeuropäischen Sprachen bezeichnet kred, aus dem das lateinische credere und dann das creditum (das auf Treu und Glauben Anvertraute) hervorgingen, die Gegenwart einer Kraft, die es erlaubt, jemandem etwas zu überlassen »mit der Gewißheit, die anvertraute Sache zurückzubekommen«.7 Der Akt, einen Kredit zu gewähren, erfordert also ein Vertrauensverhältnis – Vertrauen, das durch diverse Formen von Garantien abgesichert werden kann, in jedem Fall aber eine Art von Kalkül und Zukunftsprojektion voraussetzt.8 »Die unmittelbare Grundlage des Kredits ist die Überzeugung des Darlehensgebers von der Gewissheit der Rückzahlung«, fasst Diderots Enzyklopädie zusammen.9
Eine solche Einbettung des Kredits in das Soziale erklärt, dass er zunächst an nahe Beziehungen gebunden war. Und das umso mehr, als er in seiner Entwicklung einen archaischen Charakter beibehielt, der damit zusammenhing, dass die Verwendung von Geld lange durch eine materielle Gegebenheit begrenzt war: durch den relativ geringen Betrag der in Gold- oder Silbermünzen verfügbaren Zahlungsmittel.10 Dieser Umstand hatte zur Folge, dass Händler von Lebensmitteln, die am häufigsten konsumiert wurden, monatliche beziehungsweise jährliche Zahlungen von Kunden akzeptierten, die meist Nachbarn waren. So wurde in Versailles der Lebensmittelhändler im 18. Jahrhundert im Allgemeinen jährlich bezahlt und der Metzger halbjährlich.11 In England herrschte in allen Bereichen die Praxis der Christmas bills (Weihnachtrechnungen) vor.12 So strukturierte der Kredit im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts die Sozialbeziehungen im nahen Umfeld. Die Wirtschaft war über eine allgemeine wechselseitige Abhängigkeit vollständig in das soziale Leben eingebettet. Die Historikerin Laurence Fontaine beschrieb dies mit dem Bild des »Spinnennetzes«. Das war vor allem auf dem Land gut erkennbar. Die Verschuldung der Bauern bei ihren Gutsherren schrieb lediglich ihre unmittelbare Abhängigkeit in anderer Form fort. Das war weithin in ganz Europa zu beobachten. So ließe sich allein aufgrund ihrer Rechnungsbücher eine Soziologie großer Landgüter erstellen. Und der Schuldenerlass, der zuweilen nach einem Todesfall gewährt wurde, war lediglich Ausdruck einer Herrschaft, in der nichts vom Recht, und alles von der Gnade abhing. Allgemeiner betrachtet, lag den Volkswirtschaften im 18. Jahrhundert noch ein ganzes System wechselseitiger Schulden zwischen Privatpersonen, Fabrikanten und Kaufleuten zugrunde, deren Saldo nur in teils großen Intervallen mit Bargeld beglichen wurde.13 So veranstalteten Kaufleute in einer Stadt wie Lyon alle drei Monate »Zahlungsmessen«, auf denen unter der Leitung eines Konsuls die in Wechseln ausgewiesenen Geldsummen saldiert und beglichen wurden.14
Vertrauen war also die grundlegende Voraussetzung für Austausch und Handel im Gemeinschaftsleben. Daher rührte umgekehrt die Aufmerksamkeit für Zahlungsverzug und dessen letztliche Bestrafung. Schon sehr bald übersetzte sich dies in die Einführung spezifischer Rechtsvorschriften, in denen die Nichteinhaltung von Verpflichtungen als eine Form der Abspaltung von der Gemeinschaft und des Bruchs der sozialen Bindung galt. Die für nicht zurückgezahlte Schulden verhängten Gefängnisstrafen standen seit Beginn der Moderne in Europa im Zentrum der Tätigkeit von Gerichten, die in England in dieser Hinsicht besonders streng vorgingen.15 Man mag sich erinnern, dass Charles Dickens mit zwölf Jahren beklagte, dass sein Vater ins Gefängnis kam, bis er seine Schulden zurückgezahlt hatte. In Frankreich wurden ab dem 16. Jahrhundert spezielle konsularische Gerichte für Konkursfälle geschaffen. In ganz Europa entstand nach und nach eine ähnliche Gerichtsbarkeit. Finanziellen Verpflichtungen nicht nachzukommen gehörte zu einem Verhalten, das als Störung des sozialen Zusammenhalts wahrgenommen wurde.
Der Schuldner, der das Vertrauen seiner Gläubiger missbrauchte, indem er sich für zahlungsunfähig erklärte, galt lange Zeit als Geächteter. In Genf entzog ein Gesetz im 18. Jahrhundert Bürgern, die Konkurs angemeldet hatten oder zahlungsunfähig waren, ihre Bürgerrechte. Sogar ihre Kinder wurden aus der Bürgerschaft ausgeschlossen, wenn sie die Schulden ihres Vaters nicht beglichen.16 Montesquieu lobte diese Regelung,17und Diderots Encyclopédie bezeichnete es in dem Genf gewidmeten Artikel als »ein schönes Gesetz«. Zu Beginn der Französischen Revolution ließ Mirabeau im Herbst 1789 im selben Geist und unter Beifall über einen Gesetzestext abstimmen, der Konkursschuldnern, Bankrotteuren und zahlungsunfähigen Schuldnern ebenfalls ihre politischen Rechte entzog und sie von Wahlämtern ausschloss.18 Er stufte es als »grundlegendes Gesetz« ein und verknüpfte es mit der »Notwendigkeit, vor der wir stehen […], uns öffentliche Bande zu geben, das Vertrauen wiederherzustellen und die Wirtschaft zu beleben«.19
Ein Entwicklungsfaktor des Handels
Jenseits des »unmittelbaren« Vertrauens im nahen Umfeld, das mit den oben behandelten Kreditformen verknüpft ist, entstanden stärker strukturelle Mechanismen, Vertrauen herzustellen, die eine Weiterentwicklung des Handels ermöglichten. Übrigens sollte sich mit der Entwicklung des Fernhandels auch der Vertrauensbegriff präzisieren, da die Wirtschaft sich von unmittelbaren Sozialbeziehungen löste. Er bezog sich zwar immer noch auf »die Hypothese, die man über das zukünftige Verhalten aufstellen kann«, aber deren Grundlage war nicht mehr die räumliche Nähe von Käufern und Verkäufern. Die Bildung kleiner Kaufmannsgruppen mit starker interner Identität wurde zum Vektor der Wirtschaftsentwicklung. Damit entstand eine Vertrautheit auf einer neuen Basis. Wie Fernand Braudel in seinem Hauptwerk Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts nachdrücklich unterstrich, »handelte es sich bei den Großkaufleuten, Herren der Handelsketten und -netze, vielfach um Angehörige von Minderheiten, d. h. entweder um Bürger eines fremden Staates […] oder um Angehörige anderer Religionen«.20 Diese Feststellung konnte sich als Selbstverständlichkeit durchsetzen, da es so viele Monografien von Historikerinnen und Anthropologen gab, die chinesische Händler in Südwestasien, im 17. Jahrhundert geflüchtete Hugenotten in Holland und England, Italiener in Frankreich unter Philipp dem Schönen, Kopten im muslimischen Ägypten, Hindus in Goa, Libanesen in Lateinamerika oder allgemeiner Parsen, Armenier, Jainas usw. beschrieben, ganz zu schweigen von der immensen Fülle der Literatur über die Rolle der Juden in der Wirtschaft und im Finanzbereich in der ganzen Welt. Eine Autorin schlug kürzlich vor, diese verschiedenen Fälle unter dem Oberbegriff der »ethnisch homogenen Mittelsmänner-Gruppen« zu fassen,21da sie annahm, dass ihnen allen das gleiche Modell der Wirtschaftsentwicklung gemeinsam war. Der Erfolg dieser »durchsetzungskräftigen Minderheiten« beruhte auf der Tatsache, dass »jede Minderheit naturgemäß ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und damit eine Tendenz zu gegenseitiger Hilfeleistung und zur Selbstverteidigung entwickelt« und »ein gleichsam vorgegebenes, fest geknüpftes Netz« bildet, wie bereits Braudel erklärte.22 Diese Analyse muss jedoch hinterfragt und präzisiert werden.
Selbstverständlich beschäftigte dieses Phänomen die Pioniere der Gesellschaftswissenschaften. Sie waren lange dafür, diese Erfolge durch die Situation oder durch spezifische Merkmale dieser Minderheiten zu erklären. So unterstrich Max Weber in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, dass die kleinen Puritanergruppen ihre Wirtschaftstätigkeit mit der religiösen Konzeption verknüpften, die sie sich von ihrer irdischen Berufung machten; ein Minderheitenglaube, der sie veranlasste, sich gegenseitig zu vertrauen. Dieser fleißigen, solidarischen »puritanischen Natur« stellte er die der konfuzianischen Chinesen gegenüber, die seiner Ansicht nach durch das »typische Misstrauen« gekennzeichnet war, das unter ihnen herrschte.23 Manche sahen im Gegenteil im Arbeitseifer der Chinesen den Grund für ihren wirtschaftlichen Erfolg.24 Besonders exemplarisch ist in dieser Hinsicht die Behandlung von Juden, da die Erfolge von Kaufleuten und Finanziers aus dieser Gruppe Gegenstand so vieler widersprüchlicher Analysen und Interpretationen waren, die zugleich ebenso beträchtliche Ängste hervorbrachten. Das begann im ausgehenden 17. Jahrhundert. Bereits in Der vollkommene Kauff- und Handelsmann,25 dem meist genutzten praktischen Handbuch jener Zeit, ist zu lesen, dass sie den Wechsel, dessen Verwendung für einen Aufschwung des Handels sorgte, erfanden, weil ihre Religion es ihnen erlaubte, Goj,26 also Nichtjuden, zu betrügen, während sie sich gegenseitig unterstützen mussten. Werner Sombart, neben Weber und Simmel einer der bedeutenden Vertreter der deutschen Soziologie, unterstrich seinerseits die »objektive Eignung« der Juden für den Kapitalismus.27 Noch in jüngerer Zeit sprach ein Hochschullehrer von ihrem intrinsisch »merkurianischen« Charakter.28
Die Juden, die Chinesen, die Puritaner, die Armenier, die Jaina: Diese Bezeichnungen treffen als allgemeine Beschreibungen zu, soweit sie sich auf ethnische, religiöse oder geografische Kriterien beziehen. Aber sie lassen sich eigentlich nicht auf den Begriff der Minderheit anwenden, der immer eine relative Beziehungsdimension besitzt. So kann man im 17. Jahrhundert von französischen Exilhugenotten in Deutschland oder Antwerpen sprechen oder im ausgehenden 19. Jahrhundert von indischen Kaufleuten auf Madagaskar. Der Minderheitenbegriff muss immer in Zusammenhang mit einer Epoche, einer Bevölkerung, einem Ort oder bestimmten Tätigkeiten spezifiziert werden. Das führt wiederum zu seiner Präzisierung, indem man seine funktionelle Beschaffenheit berücksichtigt. Wenn man die Dinge genau betrachtet, ist festzustellen, dass dieser Begriff zu unscharf ist, um die tatsächlich im Wirtschaftsleben tätigen Gruppen zu charakterisieren. Wenn beispielsweise allgemein bekannt ist, dass die heute in Antwerpen tätigen Diamantenhändler nahezu ausnahmslos jüdisch sind, ist es notwendig, hervorzuheben, dass sie zwei durchaus unterschiedliche Gruppen bilden.29 Einerseits gibt es chassidische »ultra-orthodoxe« Juden, die den Importmarkt für Diamanten dominieren, anderseits die »nicht praktizierenden« Juden, die den Export geschliffener Steine fest in der Hand haben. Wenn gelegentlich die Tendenz besteht, allgemein von chinesischen Kaufleuten in Südostasien zu sprechen, so veranlassen empirische Studien dazu, sich die Dinge genauer anzusehen. Sie zeigen, dass es sich bei den effektiven chinesischen Netzwerken tatsächlich oft um bangsa handelt, also um Personengruppen derselben geografischen Herkunft, die streng endogam leben und denselben Dialekt sprechen.30
Es ließen sich noch viele solcher Beispiele anführen, die belegen, dass der Begriff der Minderheit allzu unscharf ist, um Erfolgsfaktoren oder wirtschaftliche Organisationsweisen zu charakterisieren. Brauchbarer ist der vom Historiker Charles Tilly vorgeschlagene Begriff »Vertrauensnetzwerk«, da er zugleich umfassender und funktioneller ist.31 Zum einen ist er umfassender, weil er es ermöglicht, vielfältige Formen der Soziabilität in die Analyse einzubeziehen. So wurde beispielsweise die historische Rolle hervorgehoben, die eine Zugehörigkeit zu verschiedenen »Klubs« wie den Freimaurern für die Konstitution des Zusammenhalts unter Kaufleuten spielte. Im 18. Jahrhundert förderte die Mitgliedschaft zahlreicher Kaufleute bei den Freimaurern in Hafenstädten wie Bordeaux oder Marseille eine »Kreditdisziplin«. Die Mitgliedschaft mancher in britischen Logen erleichterte wiederum den Außenhandel.32 Interkulturelle Studien zum Fernhandel haben ebenfalls ergeben, dass der Netzwerkbegriff eine sehr große Bandbreite wirtschaftlicher Realitäten zu erfassen vermochte.33 Exemplarisch belegt dies eine neuere Monografie über ein Unternehmen sephardischer Händler aus Livorno,34 das sich auf den Handel mit der Levante spezialisiert hatte.35 Die Autorin sichtete dreitausend Briefe, die das Unternehmen innerhalb von vierzig Jahren mit seinen Korrespondenten und Kommissionären in Europa und Indien austauschte, und wies nach, dass seine Beziehungen weit über die sephardischen Kreise hinausreichten. So machte es Geschäfte mit Hindus aus Goa und Madras wie auch mit katholischen Kaufleuten aus Lissabon und Marseille. Sein Netzwerk wurde durch diese Korrespondenzen strukturiert, in denen es eine Fülle von Informationen über Marktdaten (Preisschwankungen, Produktqualität) sowie über Marktteilnehmer (Zustand der Konkurrenz, Ereignisse, die spezifische Unternehmen betrafen) austauschte. Durch die in diesem regelmäßigen Briefwechsel erfolgte Interaktion mit ihren Kommissionären, deren Erfolg mit dem ihrer Mandanten verbunden war, knüpften diese Livorner ein Vertrauensnetz. Bezeichnenderweise bezeichneten sie jeden ihrer Kommissionäre als persona de confianza y diligente (fleißige und vertrauenswürdige Person). Diese Art informellen Netzwerks war sicher weniger strukturiert als das der sephardischen Gemeinden jeder Stadt, aber es ermöglichte zugleich, den Tätigkeitsbereich eines Unternehmens erheblich auszuweiten.
Umgekehrt spielten sehr kleine Netze zuweilen eine wesentliche Rolle, um stark begrenzte Aktivitäten zu strukturieren. Freundschaftliche Verbundenheit durch den Stolz auf die gleiche Herkunft trug ebenso zu solchen Vertrauensnetzwerken bei, die den Zugang zu Kredit und die Ausübung eines Berufs erleichterten. Ein anschauliches Beispiel sind die Pariser Brauereien, die noch heute zu achtzig Prozent von Inhabern geführt werden, die aus dem Departement Aveyron, überwiegend aus der Gemeinde Espalion stammen.36Wenn der Begriff der ethnischen oder religiösen Minderheit also zu präzisieren und mit Vorsicht anzuwenden ist, so ist er jedenfalls nur eine Modalität unter anderen für die Konstitution von Vertrauensnetzwerken, eine Modalität, deren Bedeutung in dem Maße abnahm, wie Volkswirtschaften sich öffneten und komplexer wurden. Diese Betrachtungsweise führt dazu, den Schwerpunkt auf die praktischen Funktionen dieser Vertrauensnetze zu legen, was bedeutet, den Vertrauensbegriff in seiner spezifischen Materialität zu sehen.
Ganz gleich, welche Form Vertrauensnetzwerke im nahen Umfeld auch annehmen, ist ihr charakteristisches Merkmal in erster Linie, dass sie eine gewisse Kontrolle über die Moral ihrer Mitglieder ausüben. Es geht darum, »die schwarzen Schafe auszusortieren«, wie die gängige Formulierung lautet. Die bereits erwähnte Studie über den sephardischen Handel in Livorno unterstreicht typischerweise, dass die jüdische Gemeinde der Stadt ohne Zögern Mitglieder ausschloss, die dem Ruf des Händlerkollektivs, das sie in den Augen der Außenwelt bildeten, schaden würden.37 In einer diesbezüglichen Studie zu Hausierern im Alpenraum wird ebenfalls erwähnt, dass es einem unredlichen Hausierer sogar unmöglich war, in das Dorf zurückzukehren, in dem die Handwerker lebten, die ihn belieferten.38 Auf diese regulatorische Funktion machen die meisten Monografien aufmerksam, die sich mit Handel treibenden Minderheiten befassen. In diesem Fall lässt sich von einem Vertrauen in die Gemeinschaft sprechen, einem Ersatz für das Vertrauen in den vertrauten Familien- und Bekanntenkreis. Es ist in die Sozialbindungen eingebettet, die durch eine Art von konstitutivem Zusammenhalt definiert sind (im Fall einer als »historisch« erlebten Minderheit erwächst er aus einem sozialen und kulturellen Erbe, im Fall einer als »natürlich« empfundenen Minderheit aus verwandtschaftlichen Banden). Der Gruppenzusammenhalt (eines Netzwerks) unterscheidet sich nur durch eine größere Heterogenität. Vertrauen ist hier eine intrinsische Eigenschaft der Bezugsgruppe. Daher wird auch durchgängig auf den Begriff der Vertrautheit verwiesen. Sie wird von den Gruppenmitgliedern als solche anerkannt, da sie vorausgesetzt und zugleich durch einen Satz an Pflichten und Sanktionen geregelt wird.
Diese für die verschiedenen Formen der engen oder erweiterten Vertrautheit kennzeichnenden Eigenschaften erklären, dass die größten Betrügereien der Geschichte häufig erst durch die Nähe, sprich Vertrautheit der Täter mit ihren Opfern möglich wurden. Diese Tatsache unterstreicht eine alte Studie aufgrund von Dossiers der Securities and Exchange Commission in den USA.39 In jüngerer Zeit lieferte der Mega-Betrug von Bernard Madoff eine spektakuläre Illustration.40 Seine Opfer, pigeons genannt, denen er enorme Summen aus der Tasche gezogen hatte, waren keine anonymen Personen: Fast alle waren »Freunde« oder zumindest Bekannte, mit denen er in New York, West Palm Beach oder in den Hamptons Umgang hatte. Seine »Klienten« hatte er persönlich oder nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda rekrutiert, ohne dass er ein wirklich gut gehendes Geschäft hätte betreiben müssen. Viele waren zudem Mitglieder der jüdischen Gemeinde, der auch er angehörte. Es herrschte ein Vertrauen des »Unter-sich-Seins«, der Nähe, das angeblich das stärkste ist. Das ist nur scheinbar ein Paradox. »Je größer das Vertrauen, umso größer sind die potenziellen Gewinne des Betrugs«, stellte ein Ökonom fest, der diese Frage theoretisch erörterte.41 Das ist durchaus logisch: Allein schon die Tatsache, dass in einer Gruppe Vertrauen herrscht, erhöht die Möglichkeiten zu opportunistischem Verhalten einer böswilligen Person in ihrer Mitte. Das ist wie bei der Spionage: Die effizientesten Spione sind immer die unverdächtigsten Personen, weil sie am besten in das Milieu integriert sind, das sie beobachten sollen.
Wenn das Vertrauen Wertschätzung genießt, weil es die Kooperation unmittelbar erleichtert und die Zukunft weniger unsicher macht, so tragen Erfahrungen mit Misstrauen mitsamt ihren schädlichen Folgen ebenfalls viel dazu bei, ihm Wert zu verleihen. Tatsächlich waren Wirtschafts- und Finanzkrisen häufig Vertrauenskrisen, gekennzeichnet durch die Unfähigkeit, sich weiterhin eine positive Zukunft vorzustellen.42 In dieser Hinsicht ist das Beispiel Hyperinflation in Deutschland in den 1920er Jahren typisch, die bekanntermaßen eine Rolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus gespielt hat.
Diese Hyperinflation, die in spektakulären Zahlen ihren Ausdruck fand, ist ein bekanntes Phänomen. Vervielfachten sich die Preise zwischen 1918 und 1921 in Deutschland, so explodierten sie buchstäblich 1922 und 1923.43 Als man dieser schwindelerregenden Krise Ende 1923 mit einer radikalen Währungsreform entgegenwirkte, war die neu eingeführte Rentenmark eine Milliarde Reichsmark wert! Allein schon diese Zahl, die einen Eindruck vom Ausmaß des Problems vermittelt, übersteigt beinahe das Vorstellungsvermögen, da ihre enorme Größe sie völlig unwirklich erscheinen lässt. Daher kann man dieses Phänomen nicht als simple »Finanzkrise« einstufen. Die monetäre Unordnung spiegelte in diesem Fall tatsächlich einen veritablen Zustand gesellschaftlichen Verfalls wider. Auf diesem Niveau griff die radikale Vertrauenskrise, die in der Flucht vor dem Geld zum Ausdruck kam, die Gesellschaftsstruktur selbst an. In dem Bereich, der anthropologische, ökonomische und politische Kategorien abdeckt, illustrierte die Hyperinflation in Deutschland zu Beginn der 1920er Jahre einen jener Grenzzustände, die begreiflich machen, dass Geld »der Ausdruck der Gesellschaft als Ganzes« sein kann.44 In diesem Fall ist die Geldfrage untrennbar mit der Konstitution des gesellschaftlichen Zusammenhalts verknüpft, dessen Qualität es ausdrückt (Marcel Mauss stellte fest, Geld müsse als »eine der Formen des kollektiven Denkens« und sogar als »wesentliche Form der Gemeinschaft« begriffen werden).45 Es hat also einen unmittelbar politischen Inhalt. Gemessen an diesem Maßstab war die Hyperinflation Ausdruck einer Art Bruch des Gesellschaftsvertrags, eine Rückkehr zum Naturzustand und zum Kampf aller gegen alle. Bereits Konrad Adenauer, der damalige Oberbürgermeister von Köln, hatte dramatisch erklärt: »Wenn keine Zahlungsmittel mehr da sind, dann schlagen sich die Leute gegenseitig tot.«46 Kein sozialer Zusammenhalt mehr, weil es kein allgemeines Äquivalent mehr gibt, ganz einfach.