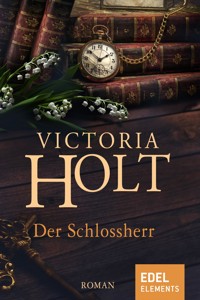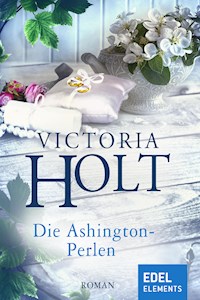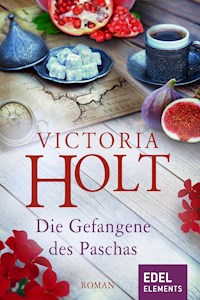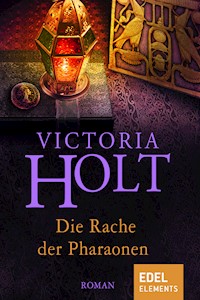
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tybalt Travers, ein leidenschaftlicher Archäologe, will die Ausgrabungsarbeiten seines toten Vaters vollenden. Er bricht mit seiner jungen Frau und einigen Helfern nach Ägypten auf. In den dunklen Grabhöhlen der Pyramiden sind seltsame Dinge geschehen, die er mit wissenschaftlichen Mitteln erklären will. Doch gegen die Rache der Pharaonen und ihren tödlichen Fluch scheint auch sein genialer Verstand machtlos. Hilflos muss er mitansehen, wie sich die Geister der Pharaonen seiner Frau bemächtigen ... Victoria Holt, die Meistererzählerin des Unheimlichen, verbindet in diesem aufregenden Roman ein Höchstmaß an Spannung mit einer romantischen Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Victoria Holt
Die Rache der Pharaonen
Roman
Ins Deutsche übertragen von Eva Schönfeld
Edel eBooks
Inhalt
1 Der Fluch
2 Der Bronzeschild
3 Monate der Knechtschaft
4 Tybalts Frau
5 Im Chepro-Palast
6 Ramadan
7 Die Nilfeier
8 Ein Sturz vom Gerüst
9 Warnungen
10 Finale im Grab
11 Die große Entdeckung
Impressum
1 Der Fluch
Der plötzliche, geheimnisumwitterte Tod von Sir Edward Travers in den achtziger Jahren löste nicht nur in seiner engeren Heimat, sondern im ganzen Land Verblüffung und zum Teil abenteuerliche Vermutungen aus.
Die Schlagzeilen der Tagespresse lauteten etwa so:
TOD DES BERÜHMTEN ARCHÄOLOGEN SIR EDWARD TRAVERS
IST ER DEM FLUCH DER PHARAONEN ZUM OPFER GEFALLEN?
Und in unserem Lokalblättchen stand:
Der Tod unseres verehrten Sir Edward, der kürzlich aufs neue zu einer Ausgrabungsexpedition ins Land der Pharaonen aufgebrochen war, wirft abermals die Frage auf, ob nicht etwas Wahres an dem alten Glauben ist, jeder, der die Totenruhe der altägyptischen Könige störe, setze sich ihrer Feindschaft und Rache aus? – Wie dem auch sei, Sir Edwards plötzlicher Tod führte zum vorzeitigen Abbruch dieses Forschungsunternehmens.
Sir Ralph Bodrean, unser Gutsherr und Sir Edwards vertrautester Freund, hatte die Expedition finanziell unterstützt. Daß er bei Erhalt der Todesnachricht einen Schlaganfall erlitt, trug natürlich zur Gerüchtebildung bei. Es war zwar schon sein zweiter, und er erholte sich auch diesmal, aber seine Gesundheit war zweifellos angegriffen, und die Abergläubischen sahen in dieser Tatsache eine weitere Folge des mysteriösen Fluches.
Das Begräbnis des toten Forschers fand auf dem heimischen Friedhof statt. Sein einziger Sohn Tybalt, der als Nachwuchs-Archäologe ebenfalls schon einige Aufmerksamkeit erregte, folgte dem Sarg als erster der Leidtragenden. Ihm folgten zahlreiche Vertreter der Wissenschaft, des Adels und – selbstverständlich – der Presse. Ich glaube kaum, daß unsere kleine, aus dem zwölften Jahrhundert stammende Dorfkirche je zuvor eine so illustre Trauergemeinde gesehen hat.
Ich war damals die sogenannte Gesellschaftsdame Lady Bodreans, der Frau des ebengenannten apoplektischen Sir Ralph. Die Stellung entsprach meiner Natur in keiner Weise; nur die Armut hatte mich genötigt, sie anzunehmen.
Während der Trauerfeierlichkeiten, wohin ich Lady Bodrean begleitete, konnte ich meine Augen nicht von Tybalt Travers losreißen. Seit unserer ersten Begegnung hatte ich hingebend, töricht und hoffnungslos für ihn geschwärmt, denn daß ich bei einem so vornehmen und gelehrten jungen Herrn keine Chance haben konnte, blieb mir voll bewußt. Für mich war er der Inbegriff aller männlichen Tugenden. Er war gottlob kein geleckter Schönling, sondern nur groß, sehnig und mittelbrünett von Haut- und Haarfarbe; er hatte eine durchgeistigte Gelehrtenstirn, verdächtig sinnliche Lippen, eine vorspringende, arrogant wirkende Nase und tiefliegende, verschleiert dreinblickende graue Augen. Man wußte nie so recht, was hinter seinem überlegenen und distanzierten Gebaren stecken mochte. Gerade deshalb sagte ich mir oft: Es dauert sicher ein Leben lang, bis man ihn versteht – aber welch aufregende und lohnende Forschungsaufgabe wäre das!
Nach der Beerdigung kehrten Lady Bodrean und ich unverzüglich nach Keverall Court, dem alten Familienstammsitz, zurück. Sie klagte und nörgelte noch ausdauernder als gewöhnlich, und ihre Laune besserte sich nicht, als sie erfuhr, daß inzwischen mehrere Zeitungsberichterstatter dagewesen seien, um sich nach Sir Ralphs Befinden zu erkundigen.
»Die reinsten Aasgeier!« schimpfte sie. »Natürlich können sie es kaum erwarten, daß auch er stirbt … Das würde so schön in ihre idiotischen Fluch-Stories passen!«
Ein oder zwei Tage später führte ich Lady Bodreans Hunde spazieren, wie es zu meinen täglichen Pflichten gehörte. Und ebenso gewohnheitsmäßig lenkte ich meine Schritte zur Villa Gizeh, dem Wohnsitz der Familie Travers. Ich stand, wie so oft, vor dem schmiedeeisernen Tor und blickte sehnsüchtig nach dem Haus. Darauf, daß Tybalt selbst herauskommen würde, war ich keineswegs gefaßt – aber zur Flucht war es zu spät; er hatte mich schon gesehen und kam auf mich zu.
»Guten Tag, Judith. Was machen Sie denn hier?«
Ich erfand rasch einen plausibel klingenden Grund.
»Lady Bodrean wollte gern wissen, wie es Ihnen geht.«
»Danke, gut. Aber kommen Sie doch herein.«
Sein unerwartetes Lächeln war beglückend. Lächerlich! Wie hatte ich, die sonst so vernünftige und stolze Judith Osmond, in eine derart alberne und aussichtslose Verliebtheit verfallen können?
Er führte mich zwischen ziemlich verwildertem Gebüsch den Gartenweg hinauf und öffnete die schwere Haustür, an der ein exotischer Metallklopfer in Form einer grinsenden Dämonenfratze angebracht war. Hatte Sir Edward beabsichtigt, damit ungebetene Besucher abzuschrecken?
Drinnen schluckten dicke Orientteppiche jeden Schall. Unsere Schritte wurden lautlos. Tybalt geleitete mich in einen vorwiegend in Dunkelblau und Gold gehaltenen Salon, der ebenfalls durch schwere Vorhänge und Teppiche wie gepolstert war. Sir Edward hatte jeglichen Lärm verabscheut. Dafür sprangen einem überall Beweise seiner Forschertätigkeit ins Auge – in diesem Zimmer waren es die rarsten fernöstlichen Fundstücke. Nur der Konzertflügel brachte einen Hauch unseres viktorianischen Englands hinein.
Tybalt bot mir einen Sessel an und setzte sich mir gegenüber.
»Wir bereiten eine neue Expedition an die Stelle vor, die mein Vater vorzeitig im Stich lassen mußte«, erzählte er mir nach wenigen Einleitungsfloskeln.
»Oh … halten Sie das für klug?«
»Aber Judith! Glauben Sie etwa an die Gerüchte um den Tod meines Vaters?«
»N-nein, natürlich nicht.«
»Es stimmt schon, daß er kerngesund war oder schien – und trotzdem hat es ihn erwischt. Das kommt vor. Ich glaube, er war gerade einer ganz großen Entdeckung auf der Spur.«
»Man hat doch eine Obduktion vorgenommen?«
»Ja, aber erst hier in England. Die Todesursache ließ sich nicht mehr mit Sicherheit ermitteln – Grund genug für alle möglichen Spekulationen. Und dazu noch Sir Ralphs Schlaganfall …«
»Sie meinen, da ist schon ein gewisser Zusammenhang?« fragte ich.
»Ein ganz alltäglicher. Sir Ralph war natürlich erschüttert über den Tod seines alten Freundes. Dazu kommt sein zu hoher Blutdruck; er hatte ja schon mal einen Anfall ohne jeden mysteriösen Anlaß, und die Ärzte haben ihm seit Jahren empfohlen, ein bißchen mehr auf seine Gesundheit zu achten. Dennoch treibt es mich jetzt mehr denn je nach Ägypten. Ich muß wissen, was mein Vater beinahe entdeckt hätte und … ob dieses Vorhaben wirklich etwas mit seinem Tode zu tun hat.«
»Nehmen Sie sich in acht!« fuhr es mir heraus.
»Ich glaube, damit einen Wunsch meines Vaters zu erfüllen«, erwiderte Tybalt lächelnd.
Ich nahm wieder Haltung an. »Wann reisen Sie ab?«
»Die Vorbereitungen dauern wahrscheinlich noch ein Vierteljahr, und dann …«
In diesem Moment unterbrach uns das Hereinkommen einer Dame, die Tabitha Grey hieß und mich wie alles in der Villa Gizeh brennend interessierte. Sie war schön, aber auf eine so unaufdringliche Weise, daß man es erst nach mehrmaligem Sehen merkte. Ihr Charme war seltsam mit stiller Resignation gemischt. Mir war nie ganz klar geworden, welche Stellung sie eigentlich hier einnahm; wahrscheinlich die einer sehr privilegierten Hausdame.
»Judith läßt herzliche Grüße von Lady Bodrean ausrichten«, erklärte Tybalt, bevor ich zu Worte kam.
»Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten?« fragte Tabitha.
Ich lehnte dankend ab: Meine Ausgangszeit sei ohnehin schon überschritten. Tabitha lächelte verständnisinnig. Jedermann wußte, daß Lady Bodrean keine sehr angenehme Brotgeberin war.
Tybalt begleitete mich zurück. Diese nie erwartete Höflichkeit warf mich fast um, und obwohl er nur von der bevorstehenden Expedition sprach, schwebte ich wie auf Wolken, besonders als er in ganz ernsthaftem Ton sagte:
»Ich wünschte, Sie könnten mitkommen.«
Es war wie ein Wunder, wie ein Traum, von dem ich damals noch nicht wußte, daß er sich tatsächlich erfüllen würde. Wie hatte dieses Märchen nur angefangen? Ich überlegte krampfhaft … Wahrscheinlich schon an meinem vierzehnten Geburtstag, als ich in einem frischausgehobenen Grab ein Bruchstück aus der Bronzezeit fand.
2 Der Bronzeschild
Mein vierzehnter Geburtstag war eines der denkwürdigsten Daten meines Lebens, nicht nur wegen meines ersten archäologischen Fundes, sondern weil ich erstmals etwas über meine eigene Herkunft erfuhr.
Doch ich will der Reihe nach erzählen. Der Schild kam zuerst. Es war ein früher, heißer Julinachmittag, und das Pfarrhaus schien menschenleer, weil weder meine »Tanten« Dorcas und Alison (unser Verwandtschaftsgrad war nicht ganz klar) noch ihr Vater, Reverend James Osmond, noch die beiden Hausmädchen zu sehen oder zu hören waren. Ich nahm an, daß die Mädchen sich in der mittäglichen Freizeit zwecks vertraulicher Herzensergießungen in ihre Dachkammer zurückgezogen hatten, Dorcas im Garten arbeitete, Alison nähte oder stickte, und daß der ehrwürdige Reverend im Studierzimmer über seiner nächsten Predigt eingeduselt war.
Ich irrte mich, zumindest in bezug auf Dorcas und Alison, die aufgeregt in einem ihrer Schlafzimmer zusammensaßen und beratschlagten, wie sie’s »dem Kinde sagen« sollten. Mit vierzehn Jahren, meinten sie, dürfe ich nicht länger im dunkeln gelassen werden …
Inzwischen war ich schon auf dem Friedhof und sah zu, wie Pegger, unser alter Totengräber, ein Grab aushob. Der Friedhof hatte von jeher eine magische Anziehungskraft auf mich ausgeübt. Manchmal, wenn ich mitten in der Nacht aufwachte, hockte ich mich aufs Fensterbrett und schaute mit wohligem Gruseln auf die Grabsteine hinunter. Bei Nebel konnte ich mir einbilden, sie regten sich, und gleich würde ich hier oder da ein emporsteigendes Totengerippe erblicken. Aber auch bei hellem Mondschein oder Stockdunkelheit und Regen arbeitete meine Phantasie; ich kam immer auf meine Kosten.
Pegger hielt im Graben inne, um sich mit seinem großen roten Taschentuch den Schweiß von der Stirn zu wischen und mich, wie es seine Art war, sehr streng anzusehen.
»Für Ihr Alter, Miß Judith«, sagte er, »haben Sie viel Sinn für die letzten Dinge. Darin gleichen wir uns wohl. Wenn ich hier in der Grube stehe und die Erde hochschaufle, denke ich stets an denjenigen, der hinein soll – ich kenne ja alle mein Leben lang.«
Pegger sprach mit Grabesstimme, was natürlich mit seinem Beruf zusammenhing. Er hatte das Amt des Totengräbers von seinem Vater und Großvater geerbt und wirkte mit der silberweißen Mähne und dem langen Bart schon rein äußerlich wie eine Prophetenfigur aus dem Alten Testament.
»Dies wird die letzte Ruhestätte von Josiah Polgrey«, fuhr er fort. »Siebzig Jahre währte sein Leben, und nun tritt er vor das Angesicht seines Schöpfers.« Pegger schüttelte bekümmert den Kopf. Offenbar schätzte er Josiahs Chancen in der Ewigkeit nicht sehr hoch ein.
»Gott urteilt vielleicht nicht so streng wie Sie, Mr. Pegger«, meinte ich.
»Hüten Sie Ihre Zunge, Miß Judith!« mahnte er. »Das grenzt ja an Gotteslästerung!«
»Ach was. Der buchführende Engel weiß, wie ich’s gemeint habe.« Und da Mr. Pegger die Augen gen Himmel verdrehte, fügte ich besänftigend hinzu: »Haben Sie überhaupt schon zu Mittag gegessen? Es muß doch ungefähr halb drei sein!«
Ich hatte das unberührte rote Baumwollbündel auf dem Nachbargrab bemerkt, das, wie ich aus Erfahrung wußte, den kalten Imbiß enthielt, den Mrs. Pegger ihrem Mann an arbeitsreichen Tagen mitzugeben pflegte.
Er folgte meinem Blick, stieg aus der Grube, setzte sich auf den Nebenhügel und knüpfte das Bündel auf.
»Wie viele Gräber mögen Sie wohl schon in Ihrem Leben gegraben haben?« fragte ich.
»Ich habe das Zählen aufgegeben, Miß Judith.«
»Und nach Ihnen wird Ihr Sohn Totengräber sein, nicht wahr?«
»Wenn es Gott gefällt«, erwiderte Pegger indigniert, »werde ich selbst noch ein paar Gräber schaufeln, ehe ich den Spaten an meinen Ältesten weiterreiche.«
»Sicher gehört auch viel Augenmaß dazu«, sinnierte ich. »Für die kleine Mrs. Edney müßten Sie wahrscheinlich keine so große Grube ausheben wie zum Beispiel für … na ja, sagen wir Sir Ralph Bodrean.«
Auf diese raffiniert-beiläufige Art brachte ich die Rede endlich auf Sir Ralph, von dem ich nie genug hören konnte. Und da die Sünden der Mitmenschen Mr. Peggers Lieblingsthema waren, hoffte ich einige mir noch unbekannte Details zu erfahren. Sir Ralph war in jeder Hinsicht überlebensgroß, auch als »Sünder«.
Ich hatte unseren Gutsherrn von frühester Kindheit an ehrfurchtsvoll angestaunt. Wenn er mit seinen Vollblutpferden auf der Dorfstraße an mir vorbeifuhr oder -ritt, klopfte mir das Herz. Ich knickste, wie Dorcas es mir beigebracht hatte, und meistens hob er die schweren Lider, sah mich einen Moment mit halbem Lächeln an und grüßte herablassend zurück. Irgendwer hatte den alten lateinischen Spruch auf ihn übertragen; »Hütet eure Töchter, wenn Caesar in Sicht ist!« Nun, und der Caesar unserer Gegend hieß Sir Ralph Bodrean. Ihm gehörte fast das ganze Dorf mitsamt den ausgedehnten Ländereien weit und breit. Seine Pächter betrachteten ihn als guten Herrn und sahen vor lauter Respekt gern durch die Finger, wenn ihre Töchter sich mit ihm über Sitte und Anstand hinwegsetzten. Diese Großherzigkeit sicherte ihnen Arbeit und Brot, und die zahlreichen illegitimen Sprößlinge wurden besser versorgt als die meisten ehelich geborenen Bauern- und Tagelöhnerkinder unserer Zeit.
In den Augen des frommen Totengräbers war Sir Ralph natürlich der Inbegriff des Lasters. Da er in Anbetracht meiner Jugend nicht von fleischlichen Sünden zu reden wagte, begnügte er sich mit einer Aufzählung der läßlicheren, die jedoch nach Mr. Peggers Meinung in ihrer Gesamtheit auch schon genügten, diesen Sünder zum ewigen Höllenfeuer zu verdammen. Zum Beispiel die vielen Gesellschaften! Die Jagden! Seine allgemeine Prunk- und Verschwendungssucht! Seine reichen, eleganten und oft lautstarken Freunde, die aus Plymouth und sogar aus London kamen und die schlichten Altvätersitten auf dem Lande zu verderben drohten!
Was mich betraf, so sah ich diese glänzenden Zugvögel stets gern, und besonders glücklich schätzte ich mich, täglich – außer samstags und sonntags – ins Herrenhaus zu dürfen, um am Unterricht der einzigen ehelichen Tochter Sir Ralphs, Theodosia, und seines Neffen Hadrian teilzunehmen. Dies war eine sehr große Vergünstigung für die Enkelin Reverend Osmonds, die sonst kaum zu einer soliden Schulbildung gekommen wäre. Die kleinen Bodreans hatten eine Gouvernante, und für einige Fächer war Oliver Shrimpton, unser junger Pfarramtsgehilfe, zuständig.
Doch an diesem Julinachmittag behielt ich die Freude über meine bevorzugte Stellung für mich, um Mr. Peggers interessanten Redefluß nicht zu dämmen. Er beklagte Sir Ralphs Unsitte, »seine Nase in Dinge zu stecken, die Gott der Herr wohlweislich verborgen hält«.
»Was meinen Sie denn damit, Mr. Pegger?«
»Wissen Sie nicht, Miß Judith, daß er hier auf Carters Wiese Ausgrabungen vornehmen will? Ich nenne das Gottes Erde aufwühlen, nach heidnischem Zeug buddeln, er und seine feinen Freunde aus der Großstadt … Kein gottesfürchtiger Mensch brächte das über sich!«
»Aber Mr. Pegger, es handelt sich um eine sehr ehrbare Wissenschaft: Archäologie, Altertumsforschung.«
»Ganz gleich, wie sie’s nennen. Wäre es Gottes Wille, diese Dinge ans Tageslicht zu bringen, so hätte er sie nicht mit Erde zugedeckt.«
»Ich glaube nicht, daß Gott persönlich sie zugedeckt hat.«
»Wer sonst?«
»Die Zeit«, erwiderte ich naseweis.
Mr. Pegger seufzte, stieg in das halbfertige Grab zurück und grub weiter.
»Stellen Sie sich doch vor«, spann ich meinen Faden fort, »wir fänden hier Überreste einer römischen Siedlung! Das würde uns weltberühmt machen!«
»Wir brauchen keine Weltberühmtheit, Miß Judith. Uns ziemt allein …«
»Gottesfurcht«, nahm ich ihm das Wort aus dem Munde. »Nehmen Sie’s mir nicht übel, aber ich finde Sir Ralphs Vorhaben großartig. Es ist ja kein plötzlicher Spleen. Er hat sich immer für Altertumsforschung interessiert, und berühmte Wissenschaftler zählen zu seinen Freunden. Vielleicht heißt seine Tochter deswegen Theodosia und sein Neffe Hadrian.«
»Heidnische Namen!« donnerte Mr. Pegger aus der Grube.
»Sachte, sachte … Wissen Sie nicht, daß Theodosia ›Gottesgeschenk‹ bedeutet? Und Hadrian … So hieß, glaube ich, ein römischer Kaiser.«
»Ordentliche Christenmenschen taufen ihre Kinder nicht so«, beharrte er.
»Na, ich heiße wenigstens Judith. Die steht schon in der Bibel. Aber Dorcas, Alison, Lavinia … Was mag Lavinia bedeuten?«
»Ach, Miß Lavinia«, murmelte Pegger. »Wie traurig, daß sie so jung und in Sünden sterben mußte.«
»So schrecklich sündhaft kann sie nicht gewesen sein. Alison und Dorcas sprechen stets sehr liebevoll von ihr.«
Auf dem Treppenabsatz des Pfarrhauses hing ein Bildnis der jüngsten Pfarrerstochter, das meine Phantasie von klein auf ebenso beschäftigt hatte wie der Friedhof. Ich malte mir gern aus, daß Lavinia zuweilen um Mitternacht herumspukte und wir am nächsten Morgen den Rahmen leer finden würden, weil sie versäumt hatte, rechtzeitig mit dem Schlage eins wieder hineinzukommen.
»Wir sind allzumal Sünder«, behauptete Mr. Pegger störrisch, »besonders die Weiber.«
»Na, hören Sie mal! Lavinia bestimmt nicht.«
Er lehnte sich einen Moment auf den Spatengriff und kratzte in seiner weißen Prophetenmähne. »Sie war die Hübscheste von den Dreien.«
Wenn mir Lavinias Porträt nicht bekannt gewesen wäre, hätte das nicht viel besagt, denn Dorcas und Alison waren zwar sympathisch und bieder, aber durchaus keine Schönheiten. Außerdem zogen sie sich so spießig an, wie man es von Pfarrerstöchtern erwartete – oder wie es auf dem Lande einzig vernünftig und praktisch war. Lavinia hingegen trug auf dem Bild ein Samtkleid und einen Federhut. Aber vielleicht war das nur für die Porträtsitzungen ausgeliehen.
»Schlimm, daß sie gerade an jenem Tag mit der Eisenbahn fahren mußte«, sagte ich aus meinen Gedanken heraus.
»So geht es, Miß Judith. Keiner denkt daran, daß er im nächsten Moment vor Gottes Richterstuhl stehen kann. Tuet Buße, auf daß ihr nicht in euren Sünden dahinfahrt …«
»Herrje, Mr. Pegger, hören Sie doch endlich mit Ihren Sünden auf. Lavinias Vater und ihre älteren Schwestern haben sie innig geliebt. Das spricht doch wohl für sie.«
Merkwürdigerweise ließ Mr. Pegger das Thema fallen. Er wischte sich die Stirn, murmelte etwas über die Hitze und stieg aus dem Grab, denn er war fertig. Ich beugte mich über die gähnende schwarze Höhle, und plötzlich ergriff ich den Spaten und sprang hinunter.
»Was soll denn das?« stieß Mr. Pegger erschrocken hervor.
»Nichts weiter … Ich möchte nur mal wissen, wie man sich in Ihrem Beruf vorkommt.« Ich grub schon hastig. »Wie modrig das riecht!«
»Kommen Sie heraus! Sie machen sich doch nur schmutzig!«
»Bin ich schon. Puh, wie man in die lockere Erde einsinkt … Wenn die Seitenwände nun zusammenrutschen? Haben Sie nie Angst, lebendig verschüttet zu werden?«
»Mein Leben ist in Gottes Hand. Kommen Sie heraus.«
Ich beachtete ihn nicht, denn soeben war der Spaten auf etwas Hartes gestoßen. Ich ging in die Knie, wühlte mit den Händen nach und beförderte schließlich ein arg patiniertes, seltsam geformtes Stück Metall zutage. »Sehen Sie mal, Mr. Pegger«, schrie ich aufgeregt. »Was mag das sein?«
Er bückte sich zu mir hinunter. »Irgendein alter Sargbeschlag«, knurrte er. »Jetzt kommen Sie aber raus, Miß Judith.« Er streckte mir die Hand hin, und diesmal ließ ich mir willig hinaufhelfen, freilich nicht ohne meinen Fund.
»Aber schauen Sie doch genau hin, Mr. Pegger. Sind da nicht irgendwelche Gravierungen drauf – oder wie das heißt?«
»Werfen Sie’s lieber weg. Sie könnten sich an den dreckigen Zacken verletzen«, riet Mr. Pegger.
Ich dachte nicht daran. Ich nahm es mit nach Hause und reinigte es vorsichtig. Das Bruchstück schien aus Bronze zu sein, war leicht gewölbt und zeigte tatsächlich einige tief eingeritzte Zeichen oder Ornamente. Dennoch war ich nicht ganz bei der Sache, denn das Gespräch mit dem Totengräber hatte meine Gedanken auch sehr stark auf Lavinia zurückgeführt, die jüngste Tochter des Reverend Osmond, die bei einem Zugunglück auf der Strecke Plymouth-London ums Leben gekommen war.
»Sie war auf der Stelle tot«, hatte Dorcas mir oft versichert, wenn wir die Blumen auf ihrem Grab in Ordnung brachten, »und das ist noch ein Segen … Besser tot als ein Krüppel fürs Leben wie manche der anderen Opfer damals. Sie war gerade erst einundzwanzig geworden. Eine Tragödie.«
»Was suchte sie denn in London, Dorcas?« hatte ich gefragt, als ich zum erstenmal davon hörte.
»Eine Stellung.«
»Als was?«
»Oh … als Gouvernante oder so etwas Ähnliches.«
»Nanu, weißt du’s denn nicht genau?«
»Ich nehme es an … Sie wohnte damals bei einer entfernten Verwandten.«
»Bei welcher?«
»Himmel, Kind, deine ewigen Fragen! Ich sag’ dir ja, eine entfernte Verwandte. Wir kannten sie kaum und hören nichts von ihr. Lavinia hatte sie wegen … wegen ihrer Stellungssuche um Rat gebeten, und so ergab es sich, daß sie später ausgerechnet in Plymouth in den Unglückszug stieg. Die Nachricht von ihrem Tod hat uns fast das Herz gebrochen.«
»Ach so, darum habt ihr mich ins Haus genommen. Als Ersatz für Lavinia.«
»Liebling, niemand ist ›Ersatz‹ für jemand anderen und schon gar nicht für Lavinia. Du bist du selbst, und wir haben dich um deinetwillen lieb.«
»Aber nicht so wie Lavinia. Ich ähnele ihr kein bißchen, oder?«
»Nein, kein bißchen.«
»Sie war bestimmt immer artig und sanft, nie vorlaut, frech oder rechthaberisch und so weiter … Alles, was ich bin.«
»Übertreibe nicht, Judith. Nein, sie war nicht wie du, aber auch sie konnte bei aller Sanftmut manchmal recht … eigensinnig sein.«
»Nun gut, jedenfalls habt ihr mich nur ins Haus genommen, weil sie tot war. Und ich war ein Waisenkind und irgendwie mit euch verwandt.«
»Ja … in gewisser Weise.«
»Komisch, ihr scheint nur ›entfernte Verwandte‹ zu haben, so um sechzehn Ecken herum. Wer waren denn meine nächsten Verwandten? Meine Eltern zum Beispiel?«
»Das wirst du schon alles zu seiner Zeit erfahren«, hatte Dorcas mit einer gewissen Hast geantwortet. »Warte doch, bis du größer bist. Wir wissen ja selbst nicht so genau Bescheid.«
An dieses Gespräch dachte ich, während ich in meinem Zimmer am Waschtisch stand und das gefundene Bronzestück putzte. Ich trocknete es gerade, als es an die Tür klopfte.
»Herein!« rief ich erstaunt, weil innerhalb der Familie selten geklopft wurde. Dennoch waren es Dorcas und Alison, die auf der Schwelle erschienen, und zwar mit so feierlichen Gesichtern, daß mir angst und bange wurde. Ich vergaß meinen Fund und fragte beklommen: »Ist etwas passiert?«
»Wir haben dich nach Hause kommen hören«, sagte Alison.
»Oje, war ich wieder so ein Trampel?«
Sie tauschten einen lächelnden Blick. »Nein, nein«, sagte Dorcas dann, »wir haben auf dich gewartet und deshalb die Ohren gespitzt.«
Hierauf entstand eine Pause. Ich spürte, daß etwas Ungewöhnliches in der Luft lag. »Ihr habt doch was«, drängte ich endlich. »Nun sagt’s schon!«
»Ruhig, Kind … nichts Besonderes. Nichts Schlimmes. Wir überlegen schon seit einiger Zeit, wie wir dich aufklären sollen, und da der vierzehnte Geburtstag gewissermaßen ein Meilenstein ist …«
Ich hätte beinahe gelacht. »Macht’s nicht so spannend«, sagte ich.
Alison holte tief Luft, und Dorcas nickte ihr ermutigend zu. »Also, Judith, die Sache ist die … Du bist bei uns aufgewachsen, und wir haben dich immer bei der Meinung gelassen, du seiest eine entfernte Verwandte.«
»Über sechzehn Ecken«, ergänzte ich.
»Aber das stimmt nicht.«
Ich zuckte zusammen und blickte von einer zur andern.
»Wer bin ich denn dann?«
»Unser liebes Pflegetöchterchen.«
»Ja, das weiß ich, aber wer sind oder waren meine Eltern.«
Alison räusperte sich. »Du warst bei dem Eisenbahnunglück dabei … im selben Zug wie Lavinia.«
»Was? Ihr sagtet immer, damals sind so viele Menschen ums Leben gekommen. Waren meine Eltern dabei?«
»Ähem … ja, wahrscheinlich.«
»Himmel, wißt ihr denn nicht, wie das alles ablief und wer sie waren?« schrie ich ungeduldig.
»Schsch, Liebling, reg dich nicht auf! Nein, leider war die Identität deiner Eltern trotz aller Nachforschungen nicht festzustellen. Sie … waren sehr entstellt und hatten keine Papiere bei sich. Du, das Baby, warst wie durch ein Wunder unverletzt geblieben; und um in unserer Trauer um Lavinia irgend etwas zu tun, haben wir dich adoptiert.«
»Was wäre aus mir geworden, wenn ihr das nicht getan hättet?«
»Oh, dann hätte sich bestimmt ein anderer gefunden.«
Ich bekam feuchte Augen, als ich an all ihre Güte und all meine Ungezogenheit dachte. Herrgott, wie hatten sie sich aufgeopfert, und wie hatte ich sie fast vierzehn Jahre lang geplagt!
Impulsiv stürzte ich auf sie zu und versuchte beide gleichzeitig in die Arme zu schließen.
»Judith, Judith, nicht so stürmisch!« lächelte Dorcas, obwohl ihre Augen naß waren. Freilich hatte sie sowieso ein bißchen »dicht am Wasser gebaut«, wie es bei uns hieß.
Alison sagte gefaßter: »Du warst uns ein Trost, Kleine. Wir brauchten etwas zum Liebhaben, nachdem Lavinia nicht mehr war.«
»Danke für die Aufklärung«, sagte ich. »Kein Grund zum Heulen. Vielleicht bin ich eine verschollene Prinzessin oder die Erbin eines Großgrundbesitzers, und meine Familie hat sich seit über dreizehn Jahren halb kaputt gesucht …«
Alison und Dorcas zwangen sich wieder zum Lächeln. »Wie schon gesagt, leider war nichts Genaues festzustellen. Viele der Katastrophenopfer damals waren bis zur Unkenntlichkeit … verletzt. Papa konnte unsere arme Lavinia zwar noch identifizieren, aber er kam furchtbar erschüttert zurück.«
»Warum habt ihr mir immer erzählt, ich wäre mit euch verwandt?«
»Weil wir deine kindliche Unbefangenheit so lange wie möglich erhalten wollten. Vielleicht hattest du außer deinen Eltern gar keine Familie mehr. Jedenfalls ist nie eine Suchanzeige aufgegeben worden. Wir haben uns jahrelang darum gekümmert.«
»Wie aufregend! Dann bin ich womöglich ein königlicher Bastard oder ein Zigeunerkind« – Dorcas und Alison zuckten zusammen – »oder eine Spanierin. Sehe ich mit dem schwarzen Haar und den braunen Augen nicht ziemlich spanisch aus? Na ja, ich gebe zu, hier in Cornwall ist das nichts Apartes. Seit die Spanier mit ihrer Armada bei uns notlandeten, herrscht eine beträchtliche Rassenmischung.«
»Judith, du phantasierst zuviel«, begann Dorcas.
»Ich bin froh, daß sie es so sachlich aufnimmt«, unterbrach Alison.
»Ja, wie sollte ich’s denn sonst aufnehmen? Ich hab’ oft genug nach meinen Eltern gefragt. Nun weiß ich endlich, daß sie mich nicht böswillig verlassen oder ausgesetzt haben, sondern daß sie die Bedauernswerten sind. Ich werde nie mehr einen Groll gegen Unbekannt hegen.«
»Da wir deinen Namen nicht wußten, hat Vater dich Judith getauft.«
»Danke, ich bin mit meinem Namen zufrieden. Und Dank für die nette Geburtstagsüberraschung. Ich finde alles wunderbar romantisch. Aber nun guckt euch mal an, was ich heute gefunden habe. Sieht aus wie ein Museumsstück, nicht?«
»Was ist es?«
»Keine Ahnung. Diese eingekerbten Linien sind vielleicht Runen. Was meinst du, Dorcas?«
»Wo und wie hast du das gefunden?«
»In dem frischen Grab, das Mr. Pegger gerade für Josiah Polgrey ausgehoben hat. Ich hab’ ein bißchen mitgebuddelt und bin dabei auf dieses Ding gestoßen. Mal sehen, was es wert ist. Auf jeden Fall ist es ein Geburtstagsgeschenk von Josiah Polgrey und irgendeinem Toten, der vielleicht vor Tausenden von Jahren hier gelebt hat.«
»Kind, was für Ideen!« Alison drehte mein kostbares Fundstück nachdenklich hin und her. »Ja, ich glaube, ich habe so was schon in Museen gesehen. Sir Ralph würde dir auf Anhieb sagen können, ob es von Bedeutung ist.«
»Ihr glaubt also auch, daß es etwas bedeutet?«
Wieder tauschten meine beiden Nenntanten Blicke. Dann sagte Alison langsam:
»Möglich. Nimm es auf alle Fälle mit nach Keverall Court, Judith, und frage, ob Sir Ralph es sehen möchte. Er interessiert sich ja für solche alten Sachen.« Ich strahlte.
Da Sir Ralph sowieso Ausgrabungen auf Carters Wiese plante, war es bestimmt ein großes Plus für mich, daß ich als allererste etwas gefunden hatte.
»Ich gehe gleich hin!« rief ich begeistert.
»Ja, aber wasche dich vorher, zieh dich um und kämme dich.«
Ich lachte, und mein Herz quoll vor Liebe über. Dorcas und Alison waren so rührend gut – und so herrlich normal!
Außerdem war es immer noch mein Geburtstag; ich hatte eben erfahren, daß ich ein geheimnisvolles Findelkind war und daher Gott weiß was sein konnte, und zu alledem hatte ich wahrscheinlich einen ganz ungewöhnlichen Fund aus der Bronzezeit gemacht. Aber ihre größte Sorge war, daß ich ordentlich gewaschen, gekleidet und gekämmt vor das Angesicht des Herrn trat!
Ich ging durch einen der Torbögen in den Hof, schnupperte in Richtung des Pferdestalls und tippte auf den altertümlichen Prellstein, was bekanntlich Glück bringt. Die schwere, eisenbeschlagene Tür zur Halle des Herrenhauses knarrte beim Öffnen. Wie still es heute war! Ich schaute auf die Ritterrüstungen und Waffen zu beiden Seiten der breiten, geschwungenen Treppe und auf das schöne alte Zinngeschirr, das, solange ich mich erinnern konnte, den musealen Refektoriumstisch schmückte. Heute stand auch eine große Vase mit frischen Blumen darauf.
Wo mochten Hadrian und Theodosia wohl gerade sein? Ich malte mir aus, wie ich ihnen morgen von meinem Fund erzählen würde, der in meinen Augen schon zu etwas Unerhörtem und Einzigartigem angewachsen war. Die berühmtesten Archäologen der Welt würden sich vor mir verbeugen, die Ehrendoktorate würden mir förmlich nachgeworfen, und … und …
Hinter mir wurde ein Stuhl gerückt. Ich hatte den Diener Derwent, der den Eingang zu bewachen hatte, aus seinem wohligen Dösen aufgeschreckt.
»Ach, Sie sind’s nur, Judith«, murmelte er erleichtert.
»Bitte melden Sie mich Sir Ralph. Es handelt sich um eine Angelegenheit von äußerster Tragweite«, erklärte ich hochtrabend.
Derwent hob halb amüsiert die Brauen. »Geben Sie nicht so an, Miß. Ich kenne Ihre Tricks.«
»Es ist kein Trick. Ich habe etwas Einmaliges gefunden. Meine Tanten meinten, ich müsse es sofort Sir Ralph zeigen, und weh dem, der es ihm vorenthält!«
»Sir Ralph und Lady Bodrean sitzen gerade beim Tee.«
»Egal – sagen Sie ihm wenigstens, daß ich hier bin und warum!«
Immerhin war Sir Ralphs Steckenpferd allgemein so bekannt und geachtet, daß ich binnen fünf Minuten wirklich in die Bibliothek geführt wurde, wo er mich inmitten seiner exotischen Souvenirs erwartete. Ich legte einfach mein Bronzestück vor ihm auf den Tisch und merkte gleich, daß es den gewünschten Eindruck auf ihn machte.
»Mich laust der Affe«, sagte er. »Wo hast du denn das her?«
Ich erzählte ihm von meinem Friedhofserlebnis. Seine buschigen Brauen ruckten in die Höhe. »Was hast du denn auf dem Friedhof zu schaffen?«
»Ich wollte mal wissen, wie man sich als Totengräber fühlt.«
Sir Ralph konnte auf zweierlei Arten lachen: Die eine war ein brüllendes Röhren, die andere ein kaum hörbares Glucksen tief unten in der Kehle, und die zeigte meist an, daß er sich wirklich amüsierte. Heute gluckste er. »Bronzezeit«, sagte er sachlich, als er sich endlich ausgegluckst hatte.
»Ja, das dachte ich mir auch schon. Interessant, ja?«
»Sicher. Bist ein braves Kind. Falls du noch was findest, bring es nur immer gleich zu mir.« Damit wies er mit dem Kinn zur Tür, aber ich war nicht gesonnen, mich so kurz abfertigen zu lassen.
»Sie wünschen mein Fundstück zu behalten, Sir, wenn ich Sie recht verstanden habe?« fragte ich.
Er verengte die Augen und mahlte kurz mit den Kiefern.
»Was heißt ›mein‹ Fundstück!« blaffte er mich an. »Es ist nicht deins.«
»Wieso? Ich habe es doch gefunden.«
»Finden heißt nicht Behalten. Zumindest nicht bei Gegenständen dieser Art, mein Kind. Die gehören nämlich der Nation.«
»Komisch!«
»Du wirst im Lauf der nächsten Jahre noch vieles komisch finden.«
»Es ist also wirklich von archäologischem Wert?«
»Was weißt du von Archäologie?«
»Oh, allerhand. Da wird in großem Stil gebuddelt, und man findet herrliche Sachen: römische Bäder und Mosaiken und kaputte Statuen und so weiter.«
»Das klingt ja fast, als würdest du gern mal ›in großem Stil‹ mitmachen?«
»Und ob! Ich würde mich dazu eignen. Ich würde sicher Sachen finden, von denen die anderen bisher nicht mal etwas geahnt haben.«
Jetzt lachte er sein röhrendes Gelächter. »An Selbstbewußtsein fehlt es dir jedenfalls nicht! Aber wenn du dir unter Archäologie vorstellst, daß man nur fortlaufend römische Villen und trojanische Schätze entdeckt, bist du auf dem Holzweg. In den meisten Fällen geht ein ungeheurer Kraft-, Geld- und Zeitaufwand drauf, und alles, was man findet, ist ein kleiner Dreck – wie dein Bronzeschildstückchen. Von der Sorte haben wir mehr als genug. Und die meisten Fachkollegen finden ihr Leben lang nichts Besseres.«
»Ich würde große Entdeckungen machen«, behauptete ich zuversichtlich.
Er legte mir die Hand auf die Schulter und drängte mich sanft zur Tür. Aber da ich ihn kannte und bewunderte, war ich ob dieser milden Art des Abschiebens nicht weiter beleidigt. Schließlich hatte er zugegeben, daß mein Fund das Bruchstück eines Schildes aus der Bronzezeit war, und ich war stolz darauf, meinen ersten Beitrag zur internationalen Wissenschaft geleistet zu haben.
Nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei meinen adligen Mitschülern Hadrian und Theodosia hatte ich merklich an Prestige gewonnen, wie ich vor Beginn des nächsten Unterrichts in Keverall Court erfreut feststellte. Ich hatte die beiden, besonders Theodosia, immer ein bißchen minderbegabt gefunden, obwohl sie etwas älter waren als ich. Seit ich aus den engen Pfarrhausverhältnissen auf Hadrian und Theodosia losgelassen war, hatte ich im Handumdrehen die Führung im Schulzimmer an mich gerissen, und die beiden Sanften, Blonden, Blauäugigen hörten widerspruchslos auf mein Kommando.
Sir Ralph hatte seiner Tochter und seinem Neffen offenbar von meiner »Ausgrabung« erzählt und mich gelobt, weil ich so gescheit gewesen war, sie ihm zu bringen. Das stärkte mein Ansehen ungemein, und ich nützte die Situation nach Kräften aus. Im Laufe meiner dramatischen Erzählungen wurde das kümmerliche Bronzestück zu reinem Gold, das ein prähistorischer König extra für mich im Boden vergraben hatte.
Nachmittags stiftete ich Theodosia und Hadrian an, sich Spaten zu besorgen und unter meiner Leitung auf Carters Wiese zu graben, um den Forschern die dort vermuteten Schätze vor der Nase wegzuschnappen. Wir wurden entdeckt und tüchtig ausgescholten; aber Sir Ralph hielt es nach diesem Beweis unseres Eifers für richtig, uns in die Grundbegriffe der Archäologie einführen zu lassen. Miß Graham, die vielgeprüfte Gouvernante, mußte sich deshalb durch Stöße von Fachliteratur hindurcharbeiten und uns das Wichtigste in leicht faßlicher Form beibringen. Hierbei war ich weitaus begeisterter bei der Sache als die anderen, und Sir Ralph, der sich Bericht erstatten ließ, schien sich allmählich wirklich für mich zu interessieren.
Um diese Zeit zog sein Freund Sir Edward Travers nebst Familie in den ehemaligen Witwensitz des Bodrean-Gutes. Das Gerücht von vielversprechenden Ausgrabungsstätten hatte ihn angezogen, zumal er schon lange ein ruhiges Landhaus in der Nähe seines Freundes suchte. Er gab gelegentlich Gastvorlesungen in Oxford, befand sich aber meistens auf Forschungsreisen. Seine Zeitungsberichte und Bücher waren in Fachkreisen wohlbekannt.
In unserem stillen Dörfchen herrschte nicht geringe Aufregung, als die Kunde von dem neuen glanzvollen Zuwachs ruchbar wurde. Am meisten freute sich natürlich Sir Ralph, wie mir Tochter und Neffe erzählten, besonders im Hinblick auf seine Ausgrabungspläne.
Das neue Heim der Familie Travers wurde in »Villa Gizeh« umbenannt, nach den ägyptischen Pyramiden, wie Dorcas vermutete. Anhand des Konversationslexikons stellten wir fest, daß sie recht hatte.
Nun war das düstere alte Haus mit dem verwilderten Garten also wieder bewohnt, was mich um das Vergnügen brachte, Theodosia mit Spukgeschichten zu ängstigen. Allerdings gab ich mich nicht so ohne weiteres geschlagen. »Wenn ein Haus mal verhext ist«, raunte ich mit gekonntem Schaudern, »bleibt es für immer und ewig verhext. Ihr werdet ja merken, daß es da nicht mit rechten Dingen zugeht!«
Und wirklich verbreiteten sich bald sonderbare Gerüchte: Das Haus sei voll von so merkwürdigen Mitbringseln aus aller Welt, daß es der Dienerschaft vor dem Betreten einiger Zimmer gruselte. Wäre Sir Edward nicht ein so berühmter Gelehrter gewesen, dessen Glanz auf sie zurückstrahlte, so hätten die meisten nach wenigen Wochen gekündigt.
Sir Edward war Witwer. Sein Sohn Tybalt war schon erwachsen und studierte; seine Tochter Sabina hingegen war ungefähr gleichaltrig mit Theodosia, Hadrian und mir und nahm deshalb bald an unserem Hausunterricht teil.
Tybalt war mir zuwider, lange bevor ich ihn persönlich kennenlernte – nur weil seine Schwester so hemmungslos für ihn schwärmte. Ihren Reden zufolge war er allwissend, allmächtig, herrlich von außen und innen, kurzum gottähnlich. Sabina redete fast ununterbrochen, ohne sich um die Reaktion ihrer Zuhörer zu kümmern, falls man ihr überhaupt zuhörte. Gegen ironische Randbemerkungen war sie immun. Ich sagte Hadrian unter vier Augen, das käme von dem unnatürlichen Leben in dem alten Spukhaus mit einem stets zerstreuten Gelehrten-Vater und teils verängstigten, teils angsteinflößenden Dienstboten. Zwei davon waren nämlich Ägypter namens Mustapha und Absalam. Sie trugen lange weiße Burnusse und glitten auf ihren Sandalen so lautlos durchs Haus, daß sie beständig gerade da auftauchten, wo man nicht auf sie gefaßt war, und das brave einheimische Personal erschreckten. Waren sie nun Spitzel oder nicht?
Im übrigen war Sabina hübsch; das mußte ihr der Neid lassen. Sie hatte ein kleines, herzförmiges Gesicht, seidige blonde Locken und große graue Augen mit langen Wimpern. Theodosia, die selbst wenig Reize aufwies, bewunderte sie selbstlos. Die Freundschaft der beiden Mädchen bewirkte, daß Hadrian und ich sich notgedrungen enger zusammenschlossen als zuvor. Manchmal trauerte ich der Zeit nach, als die Familie Travers noch nichat dagewesen war und wir ein so vertrautes kleines Trio gebildet hatten – das heißt im Klartext: Ich sah meine Hauptrolle bedroht. Dorcas hatte mich immer ermahnt, die andern nicht so herumzukommandieren und zu verlangen, daß jedermann meine Ansichten teilte. Schließlich kamen Hadrian und Theodosia aus einem großen Hause und ich nur aus einer armseligen Pfarre. Daß ich am Unterricht der vornehmen Kinder teilnehmen durfte, war eine große Gunst, aber ich benahm mich, als sei ich die Tochter des Hauses und die andern die Almosenempfänger. Ich hatte Dorcas oft zu erklären versucht, das käme nur von Hadrians Energielosigkeit, und Theodosia sei ohnehin zu dumm, um je eine eigene Meinung zu haben.
Doch nun war Sabina auf der Bildfläche erschienen – nicht nur hübsch, sondern stets freundlich und gutgelaunt, nie ausfallend und somit ein ziemliches Gegenstück zu mir. Ihre blonden Locken fielen von Natur immer auf die gepflegteste Weise, während ich meine dichte schwarze Mähne kaum bändigen konnte, ganz egal, wie ich sie zu binden oder zu stecken versuchte. Ihre grauen Augen funkelten, wenn sie Spaßiges erzählte, und leuchteten, wenn sie von dem angebeteten Bruder Tybalt sprach. Sie war eine Art Fee, deren Gegenwart die Atmosphäre unseres Schulzimmers vollkommen veränderte.
Von ihr erfuhren wir natürlich auch genau, wie es in der Villa Gizeh zuging. Ihr Vater vergrub sich oft tagelang in seinem Studierzimmer und ließ sich nur von den katzenpfötigen ägyptischen Dienern Mustapha und Absalam bedienen. Dann speiste Sabina allein mit der Hausdame Tabitha Grey, die nebenbei ihre Klavierlehrerin war. Sabina nannte sie »Tabby«. Ehe ich sie kannte, stellte ich mir unter ihr ein mausgraues mittelalterliches Wesen vor. Als ich sie dann zum erstenmal sah – eine aparte, interessante jüngere Dame –, war ich sehr verblüfft.
Ich sagte Sabina, wenn sie Personen so schlecht beschreiben könnte, würde es mich gar nicht wundern, wenn sich ihr vergötterter großer Bruder als mickriger, kurzsichtiger Student entpuppte, der für nichts als verstaubte Papyri und Mumien Sinn hätte und vor allem Lebendigen kläglich versagte.
Sabina lachte nur. »Warte, bis du ihn siehst.«
Wir alle (offen gestanden, auch ich) konnten kaum erwarten, daß er zu den Semesterferien von Oxford nach Hause kam. Aber kurz vor dem ersehnten Termin berichtete Sabina mit Tränen in den Augen, er käme nun doch nicht. In Northumberland waren Ausgrabungen begonnen worden, an denen er während der ganzen Ferien teilnehmen wollte. Und ihr Vater, Sir Edward, hatte die Absicht, zu ihm zu stoßen.
Glücklicherweise kam während der Semesterferien ein Stellvertreter, Tybalts Studiengenosse Evan Callum. Um sich ein bißchen Geld zu verdienen, hatte er es übernommen, uns in die Anfangsgründe der Archäologie einzuführen.
Er machte seine Sache so gut, daß ich bald nicht mehr an Tybalt dachte und mich mit Feuereifer auf den neuen Lehrstoff warf, während die anderen nur mäßig interessiert waren. Manchmal spazierte ich nachmittags mit Evan Callum zu Carters Wiese, und er erläuterte mir die praktischen Seiten des dortigen Vorhabens. Einmal trafen wir dabei zufällig Sir Ralph Bodrean.
»Na, immer noch neugierig auf Altertümer?« erkundigte er sich jovial.
Ich sagte, mehr denn je.
»Hast du inzwischen noch was gefunden?«
»Leider nein, aber ich hab’ ja auch nicht viel Gelegenheit.«
Er knuffte mich spaßhaft in die Rippen. »Bilde dir bloß nicht ein, daß man dauernd was findet, auch wenn man Gelegenheit hat. Du kannst mit deinem Erstling schon ganz zufrieden sein.« Sein innerliches Glucksen deutete an, daß er sich freute, mich weiter so eifrig bei der Sache zu sehen.
Etwas später zeigte mir einer der Arbeiter, die für die Ausgrabungen angeheuert waren, wie man zerbrochene Tongefäße provisorisch zusammensetzte (»Erste Hilfe« nannte er es), bis sie fachgerecht restauriert werden konnten und eventuell von einem Museum angekauft wurden.
Zunächst war ich etwas ernüchtert von dem vielen Kleinkram, der beachtet werden mußte und sich mit meinen hochfliegenden Träumen nicht vertrug, aber dann sah ich die Notwendigkeit ein und begeisterte mich für alles, auch das scheinbar Nebensächliche.
Außerdem übernahm jetzt Tabitha Grey unsere Musikstunden, die bisher von der armen, überforderten Miß Graham mehr schlecht als recht mit abgehalten worden waren, so daß wir jetzt auf mehreren Gebieten eine ungewöhnlich gründliche und umfassende Bildung genossen. Dorcas und Alison waren entzückt und betonten unermüdlich, daß wohl kein anderes armes Mädchen hierzulande je so ein Glück gehabt hätte und daß ich guten Gebrauch davon machen sollte.
Das tat ich schon aus eigenem Antrieb, außer in Miß Grahams Handarbeitsstunden. Häkeldeckchen und Kreuzstichmuster machten mich geradezu rebellisch – solch eine sinnlose Zeitvergeudung! Aber von den Stunden bei Evan Callum konnte ich nie genug haben. Tagtäglich lag ich ihm in den Ohren, was ich noch tun könnte, um später auf möglichst große und weite Expeditionen mitgenommen zu werden, und er meinte lachend, für eine Frau sei das heutzutage schwierig, es sei denn, sie heirate beizeiten einen Archäologen. Sonst dämpfte er meinen Enthusiasmus nicht, denn es machte ihm selbst Spaß, eine so gelehrige Schülerin zu haben.
Die alten Ägypter hatten es mir besonders angetan, weil sie laut Evan noch unheimlich viele Rätsel aufgaben. »Im Tal der Könige sind noch ungeahnte Schätze verborgen, Judith«, pflegte er zu sagen, und selbstverständlich träumte ich davon, daß ich sie entdecken und die Hochachtung solcher Koryphäen wie Sir Edward Travers erringen würde.
Ich muß gestehen, daß er mich bisher enttäuscht hatte. Wenn man ihn überhaupt einmal traf, war er in Gedanken so weit weg, daß er uns junges Gemüse völlig übersah. Seine Augen waren stets mit seltsamem Ausdruck in weite Fernen gerichtet – wahrscheinlich in die Tiefen der Vergangenheit.
»Sein gräßlicher Sohn Tybalt ist sicher genauso«, sagte ich zu Hadrian.
Tybald war für mich inzwischen ein Inbegriff pedantischen, verknöcherten Strebertums geworden, gerade weil Sabina so von ihm schwärmte. Hadrian und ich zogen sie oft ziemlich taktlos damit auf, aber sie war so gutartig, daß sie nur lachte und sagte:
»Denkt, was ihr wollt. Was kümmert es Tybalt? Er ist über dummes Geschwätz doch haushoch erhaben!«
Trotz allem zog mich die Villa Gizeh magisch an, und ich freute mich auf die neueingeführten Klavierstunden bei Tabitha Grey, obwohl ich beklagenswert unmusikalisch war. Aber meine Phantasie geriet in Wallung, sooft ich das »verwunschene« alte Haus betrat. »Es hat was Bedrohliches«, sagte ich zu Hadrian, der mir wie üblich zustimmte.
Düster war die Villa auf jeden Fall. Zum Teil waren die wildwuchernden Büsche und Bäume, die sie umgaben, daran schuld, aber auch drinnen war alles mit dicken Vorhängen und prunkvoll gemusterten Wandteppichen verhängt. Jeder Laut war so gedämpft, daß man selten jemanden kommen oder gehen hörte. Infolgedessen hatte ich in diesem Hause dauernd das Gefühl, heimlich beobachtet zu werden. Außerdem wohnte eine hexenartige alte Frau unter dem Dach, offenbar in einer für sie reservierten, abgeschlossenen Wohnung. Nachdem ich sie einmal am Fenster gesehen hatte, fragte ich Sabina nach ihr.
»Das ist Nanny Tester. Sie war schon Mutters Kinderfrau und dann Tybalts und meine.«
»Was macht sie da oben?«
»Nichts. Sie wohnt eben dort.«
»Aber ihr braucht doch keine Kinderfrau mehr!«
»Denkst du vielleicht, wir werfen alte Dienstboten hinaus, nachdem sie uns jahrzehntelang treu ergeben waren?« erwiderte Sabina, ausnahmsweise etwas indigniert.
»Ich halte sie für eine Hexe.«
»Halte sie für was du willst, Judith Osmond. Für uns ist und bleibt sie die gute alte Nanny Tester.«
»Sie hat bestimmt den Bösen Blick. Immer klebt sie am Fenster, wenn wir kommen, und weicht nur zurück, wenn wir hinaufblicken und damit zeigen, daß wir ihr ewiges Spionieren bemerkt haben.«
»Was brauchst du dich um unsere Nanny zu kümmern?« meinte Sabina achselzuckend, und darauf wußte ich ausnahmsweise keine Antwort.
Das große Musikzimmer war noch das hellste und normalste im ganzen Haus, obwohl auch dort reichlich chinesische Vasen, Drachen und Figuren verteilt waren – fette, schläfrig lächelnde Buddhas in einer Sitzhaltung, die ich erfolglos nachzuahmen versuchte, zerbrechliche Damen mit undurchdringlichen und Mandarine mit grausamen Gesichtern. Und wenn ich unter »Tabbys« Anleitung meine Tonleitern und Etüden klimperte, fand ich sie nicht minder rätselhaft als die gemalten oder geschnitzten chinesischen Damen ringsumher.
Sooft sich die Gelegenheit bot, stahl ich mich vor oder nach dem Unterricht auch in die anderen Zimmer, wobei ich den armen Hadrian zum Mittun zwang. Er fand dieses Herumstöbern mit Recht unverschämt, aber er wagte nicht, sich zu sträuben, weil ich ihn sonst der Feigheit bezichtigt hätte.
Von Evan Callum wußten wir, daß Sir Edward nicht nur an altchinesischen, sondern auch an altägyptischen Entdeckungen maßgeblich beteiligt war, und die Geschichte der Pharaonenzeit faszinierte mich am allermeisten. Evan zeigte uns sehr gute Abbildungen und erklärte die dargestellten Szenen und Götterkulte. Ich lauschte hingerissen, wenn von Amon Ra, Isis, Osiris und Horus die Rede war, und begriff vollkommen, warum sie manchmal Falken-, Ibis- oder Schakalköpfe trugen: nämlich zum Zeichen ihrer über alles Menschliche hinausgehenden Macht.
Der Horusfalke zum Beispiel war ein Symbol des durchdringenden, untrüglichen Blickes … Das mußte doch jedem einleuchten.
Aber noch mehr beschäftigten mich die eigentümlichen Begräbnisriten der alten Ägypter, die ihre Könige und Großen einbalsamierten, so daß die sterbliche Hülle Jahrtausende überdauerte, während die Seele mit allem gewohnten Prunk für das Leben im Jenseits versehen wurde, sogar mit Sklaven, die sich mit ihren toten Herren oder Herrinnen einmauern lassen mußten, um ihnen auch in der Ewigkeit weiterzudienen.
»Diese Sitte, den Vornehmen oft die erlesensten Kostbarkeiten ins Grab mitzugeben, hat natürlich von jeher die Räuber angelockt«, erklärte Evan. »Manche Grabkammern sind schon vor Jahrhunderten ausgeplündert worden, ungeachtet der Legende vom Fluch der Pharaonen, der jeden treffen soll, der frevelhaft ihren Frieden stört.«
Ich war von alledem so fasziniert, daß ich am liebsten viele andere Stunden geschwänzt hätte, um sie mit Evan zu verbringen und ihn nach weiteren Einzelheiten über die alten Ägypter auszufragen. Als Sabina beiläufig erwähnte, sie hätte schon einmal eine echte Mumie gesehen, wurde ich fast neidisch.
»Wo?« fragte ich.
»Vater hat sie in einer Art Sarg mitgebracht, und …«
»Es heißt ›Sarkophag‹«, verbesserte Evan.
»Aha, danke. Der Sarkophag steht noch in einer Kammer bei uns in der Villa, aber die Mumie ist jetzt im Britischen Museum, glaube ich. Sie sah gräßlich aus«, fügte Sabina schaudernd hinzu. »Ich bin froh, daß sie weg ist.«
»Wie schade!« rief ich. »So etwas Interessantes – stell dir doch nur vor, jemanden im Haus zu haben, der vor Jahrtausenden so lebendig war wie wir!«
Im Laufe der nächsten Tage beschloß ich, mir wenigstens den Sarkophag zeigen zu lassen, ob es Sabina nun paßte oder nicht, und als Theodosia das nächste Mal Einzelunterricht bei Tabby hatte (sie war uns im Klavierspiel weit voraus), nötigte ich Sabina, Hadrian und mich zu der bewußten Kammer zu führen. Ich wußte schon vom Hörensagen, daß die Dienstboten aus abergläubischer Furcht stets einen weiten Bogen darum schlugen.
Die Kammer enthielt nur deckenhohe Bücherregale und den Sarkophag, der in eine Ecke gerückt war. Er ähnelte einem steinernen Wassertrog, aber um seinen oberen Rand zogen sich mehrere Reihen von eingeritzten Hieroglyphen.
Ich ging in die Hocke, um sie von nahem zu sehen.
»Mein Vater ist noch mit der Entzifferung beschäftigt«, erklärte Sabina. »Wenn er fertig ist, kommt auch der Sarkophag ins Britische Museum.«
»Ich wünschte, die Mumie wäre noch drin«, seufzte ich, indem ich einige Hieroglyphen vorsichtig mit dem Finger nachzog.
»Ach was, so sehenswert sind Mumien wirklich nicht. Du kannst dich in jedem größeren Museum davon überzeugen. Nichts weiter als stocksteife Figuren, die von oben bis unten in einem dicken Wickelverband Stecken.«
Ich richtete mich aus der Hocke auf und ließ meinen Blick über die dichtgedrängten Bücherrücken streifen. Viele der Titel waren in Sprachen oder Schriftzeichen gedruckt, die ich nicht kannte.
»Dieser Raum hat wirklich eine seltsame Atmosphäre«, sagte ich. »Kein Wunder, daß die Dienstboten sich graulen. Merkt ihr es nicht auch?«
»Ach Unsinn, du willst uns ja nur wieder einschüchtern«, antwortete Hadrian. »Es ist nur ein bißchen düster – das macht der Baum vor dem Fenster.«
»Aber ich höre auch was: so ein geisterhaftes Stöhnen …«
»Das ist der Wind im Kamin«, sagte Sabina abwehrend. »Nun kommt wieder raus; wir dürfen uns hier nicht erwischen lassen.«
Sie und Hadrian waren sichtlich erleichtert, als sich die Tür hinter uns schloß, aber mir ging das kurze Erlebnis nicht mehr aus dem Sinn. In den nächsten Tagen borgte ich mir von Evan alles Erreichbare über Mumien und Begräbnisriten. Da ich wie immer, wenn ich von einer Idee besessen war, von nichts anderem reden konnte, fiel ich meiner Umgebung beträchtlich auf die Nerven.