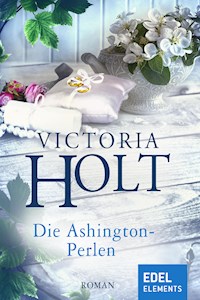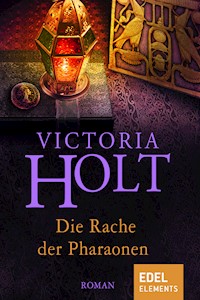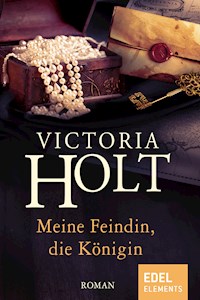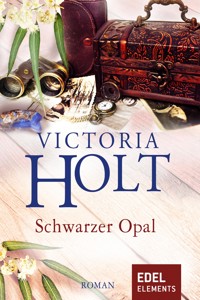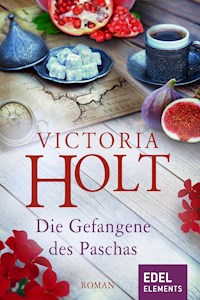
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Rosetta Cranleigh gerät auf einer Schiffsreise vor der Küste Afrikas in einen schweren Sturm. Nur sie und zwei Männer können sich in ein Boot retten. Bald jedoch geraten die drei Überlebenden ins Netz von Menschenhändlern und werden nach Konstantinopel verschleppt. Wo Rosetta schließlich im Serail des Paschas landet ... Victoria Holt, die Meistererzählerin des Unheimlichen, verbindet in diesem aufregenden Roman ein Höchstmaß an Spannung mit einer romantischen Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Die Gefangene des Paschas
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Das Haus in Bloomsbury
Sturm auf See
Die Gefangene des Paschas
Trecorn Manor
Die Gouvernante
Das Seemannsgrab
Entdeckungen
In London
Begegnung im Wäldchen
Heimkehr
Das Haus in Bloomsbury
Mit siebzehn Jahren hatte ich das wohl ungewöhnlichste Erlebnis, das einer jungen Frau zustoßen kann. Es verschaffte mir Einblick in eine Welt, die allem widersprach, was ich meiner Erziehung gemäß hätte erwarten können. Von da an hat sich mein Leben grundlegend geändert.
Ich hatte stets den Eindruck, meine Eltern müßten mich in einem Augenblick der Geistesabwesenheit gezeugt haben. Ich konnte mir ihr Erstaunen, ihre Verblüffung, ja Bestürzung vorstellen, als die Anzeichen meiner bevorstehenden Ankunft offenbar wurden. Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich noch ganz klein und der Aufsicht meines Kindermädchens vorübergehend entschlüpft war, meinem Vater auf der Treppe begegnete. Wir sahen uns so selten, daß wir uns bei diesem Anlaß wie Fremde gegenüberstanden. Er hatte seine Brille auf die Stirn geschoben und zog sie nun herunter, um dieses fremde Wesen, das sich da in seine Welt verirrt hatte, näher in Augenschein zu nehmen, so als suche er sich zu entsinnen, was das sei. Dann trat meine Mutter in Erscheinung; sie erkannte mich offenbar sogleich, denn sie sagte: »Ach, das Kind. Wo ist das Kindermädchen?«
Ich wurde schleunigst auf zwei vertraute Arme gehoben und fortgeschafft; und als wir außer Hörweite waren, vernahm ich Gemurmel: »Unnatürliche Bande. Mach dir nichts draus. Du hast deine gute alte Nanny, die hat dich lieb.«
Das wußte ich, und ich war zufrieden; denn neben meiner guten alten Nanny hatte ich den Butler Mr. Dolland, die Köchin Mrs. Harlow, das Stubenmädchen Dot und das Dienstmädchen Meg, dazu Emily, die Hausmagd. Und später Felicity Wills.
In unserem Haus gab es zwei getrennte Bereiche, und ich wußte, zu welchem ich gehörte. Es war ein großes Haus an einem Platz im Londoner Bezirk Bloomsbury. Es war zu unserem Wohnsitz erkoren worden, weil es in der Nähe des Britischen Museums lag, über das man im Erdgeschoß immer mit solcher Ehrfurcht sprach, daß ich, als ich zum erstenmal für alt genug befunden wurde, durch seine geheiligten Pforten zu treten, eine himmlische Stimme zu vernehmen erwartete, die mir befahl, meine Schuhe auszuziehen; denn dort, wo ich stünde, sei heiliger Boden.
Mein Vater, Professor Cranleigh, leitete die ägyptische Abteilung dieses Museums. Er war eine Kapazität auf dem Gebiet Altägypten und besonders der Hieroglyphen. Und meine Mutter lebte durchaus nicht in seinem Schatten. Sie nahm teil an seiner Arbeit, begleitete ihn auf seinen häufigen Vortragsreisen und war Verfasserin eines beachtlichen Buches mit dem Titel Die Bedeutung des Steins von Rosette, das Seite an Seite mit dem halben Dutzend Büchern meines Vaters in einem Raum neben seinem Arbeitszimmer, der Bibliothek, einen Ehrenplatz einnahm.
Sie hatten mich Rosetta genannt, und das war eine große Ehre. Es verknüpfte mich mit ihrer Arbeit, was mir das Gefühl gab, daß sie zu irgendeiner Zeit etwas für mich empfunden haben mußten. Das erste, was ich sehen wollte, als Felicity Wills mich ins Museum mitnahm, war dieser alte Stein. Ich betrachtete ihn staunend und hörte hingerissen zu, als sie mir erzählte, daß die seltsamen Zeichen den Schlüssel zur Entzifferung der Schriften der alten Ägypter darstellten. Ich konnte den Blick nicht von der Basalttafel wenden, die für meine Eltern von solcher Wichtigkeit war, aber was ihr in meinen Augen wirkliche Bedeutung verlieh, war der Umstand, daß sie fast denselben Namen trug wie ich.
Als ich etwa fünf Jahre alt war, befanden meine Eltern, ich müsse eine Schulbildung erhalten. Die Aussicht auf eine Gouvernante rief in unserem Bereich des Hauses eine gewisse Beklommenheit hervor.
»Gouvernanten«, verkündete Mrs. Harlow, als wir alle am Küchentisch saßen, »sind komische Geschöpfe. Weder Fisch noch Fleisch.«
»Nein«, warf ich ein, »das sind richtige Damen.«
»Kann schon sein«, fuhr Mrs. Harlow fort, »zu fein für uns, nicht fein genug für die.« Sie zeigte an die Decke, um anzudeuten, daß sie die oberen Regionen des Hauses meinte. »Hier unten spielen sie sich mächtig auf, und oben tun sie lammfromm. Tja, komische Geschöpfe, diese Gouvernanten.«
»Ich habe gehört«, sagte Mr. Dolland, »sie soll die Nichte von irgendeinem Professor sein.«
Mr. Dolland schnappte sämtliche Neuigkeiten auf. Er war »pfiffig wie ‚ne Wagenladung Affen«, wie Mrs. Harlow sich ausdrückte. Dot hatte ihre eigenen Quellen, die sich ihr auftaten, wenn sie bei Tisch bediente. »Das ist dieser Professor Wills«, sagte sie. »Sie waren zusammen auf der Universität, aber dann hat er was anderes gemacht, Naturwissenschaften oder so was. Der hat ‚ne Nichte, und sie suchen eine Stellung für sie. Sieht ganz so aus, als kriegten wir Professor Wills’ Nichte ins Haus.«
»Ob die schlau ist?« fragte ich bang.
»Oberschlau, wenn du mich fragst«, sagte Mrs. Harlow.
»Daß die mir ja nicht im Kinderzimmer dreinredet, das lass’ ich mir nicht bieten«, verkündete Nanny Pollock.
»Dafür ist sie sich bestimmt zu fein. Die läßt sich ihr Essen aufs Zimmer bringen. Das heißt, du mußt immer mit ’nem Tablett die Treppe rauf, Dot. Oder du, Meg. Ich kann euch sagen, wir kriegen ’ne richtige Madam ins Haus.«
»Ich will nicht, daß die herkommt«, erklärte ich. »Lernen kann ich auch bei euch.«
Darauf mußten sie lachen.
»Sag, was du willst, Schätzchen«, meinte Mrs. Harlow, »wir ham nicht das, was man Bildung nennt. Außer vielleicht Mr. Dolland.«
Alle blickten Mr. Dolland liebevoll an. Er wahrte nicht nur die Würde unseres Bereiches, er unterhielt uns auch und ließ sich ab und an überreden, eine kleine »Nummer« zum besten zu geben. Er war ein vielseitiger Mann, was nicht verwunderlich war, war er doch einst Schauspieler gewesen. Ich hatte ihn gesehen, wie er sich anschickte, nach oben zu gehen, der formvollendet gekleidete, würdevolle Butler; ein andermal sah ich ihn, wie er mit seiner grünen Moltonschürze um seine recht füllige Mitte Silber putzte und ein Lied anstimmte. Dann saß ich da und lauschte, und die andern schlichen herbei, um sich an dieser Kostprobe von Mr. Dollands mannigfachen Talenten zu erfreuen. »Ach wißt ihr«, erklärte er bescheiden, »Singen ist nicht mein Fach. Operettenbühnen waren nichts für mich. Ich hab’s immer mehr mit dem richtigen Theater gehabt. Ich hatte es im Blut, vom Augenblick meiner Geburt an.«
An diesem großen Küchentisch sitzen, das gehört zu meinen glücklichsten Erinnerungen an jene Zeit. Ich besinne mich auf die Abende – es muß Winter gewesen sein, denn es war dunkel, und Mrs. Harlow zündete die Paraffinlampe an und stellte sie mitten auf den Tisch. Im Küchenkamin knisterte ein Feuer, und während meine Eltern auswärts auf einer Vortragsreise waren, umfing uns ein wunderbares Gefühl von Frieden und Geborgenheit.
Mr. Dolland erzählte von seiner Jugendzeit, als er auf dem Wege war, ein großer Schauspieler zu werden. Es war nicht so gekommen, wie er geplant hatte – sonst hätten wir ihn ja nicht bei uns gehabt –, worüber wir froh sein mußten, obwohl es für Mr. Dolland bedauerlich war. Er hatte etliche Statistenrollen gespielt, und einmal war er als Geist in Hamlet aufgetreten; er hatte tatsächlich derselben Truppe angehört wie Henry Irving. Er verfolgte den Werdegang des großen Schauspielers, und einige Jahre zuvor hatte er sein Idol als vielbeklatschten Mathias in Die Glocken bewundert.
Ab und zu beglückte er uns mit Szenen aus dem Stück. Wir verfielen in tiefes Schweigen. Ich saß neben Nanny Pollock und griff nach ihrer Hand, um mich zu vergewissern, daß sie bei mir war. Am wirkungsvollsten war es, wenn der Wind heulte und wir den Regen an die Fenster prasseln hörten.
»Es war eine Nacht wie diese, als der polnische Jude ermordet wurde ...«, deklamierte Mr. Dolland mit hohltönender Stimme; er berichtete, wie Mathias den Tod des Juden herbeigeführt hatte und seitdem vom Klang der Glocken verfolgt wurde. Wir saßen schaudernd, und hinterher lag ich im Bett und blickte ängstlich auf die Schatten im Zimmer, gespannt, ob sie sich in den Mörder verwandeln würden.
Mr. Dolland war im Hause sehr geachtet. Das wäre er ohnehin gewesen, doch mit seinem Talent zu unterhalten bewirkte er, daß wir ihn liebten, und wenn ihm auch die Welt des Theaters die Anerkennung verweigert hatte, das Haus in Bloomsbury lag ihm zu Füßen.
Es waren glückliche Erinnerungen. Diese Menschen waren meine Familie, bei ihnen fühlte ich mich geborgen.
Ins Eßzimmer wagte ich mich damals nur unter Dots schützenden Fittichen, wenn sie den Tisch deckte. Ich reichte ihr das Besteck an, das sie auf dem Tisch verteilte. Ich sah ihr bewundernd zu, wie sie die Servietten mit flinker Hand zu phantasievollen Formen faltete und plazierte.
»Sieht es nicht fabelhaft aus?« meinte sie, ihr Werk begutachtend. »Nicht, daß es denen auffiele. Die quatschen nur dauernd, sie reden und reden, und du hast keinen blassen Schimmer, wovon. Manche reden sich richtig in Rage. Man könnte meinen, die schweben in höheren Regionen, es geht bloß um Sachen, die vor langer Zeit passiert sind, um Orte und Menschen, von denen du nie gehört hast. Und sie kommen dabei richtig in Fahrt.«
Ich begleitete Meg durchs Haus. Wir machten gemeinsam die Betten. Wenn sie sie abzog, schlüpfte ich aus meinen Schuhen und sprang auf die Federplumeaus, weil ich es herrlich fand, wie meine Füße darin versanken. Und dann half ich ihr beim Beziehen der Betten.
»Auf links drehn und den Zipfel greifen,
auf rechts dann übers Kissen streifen«,
sangen wir. »Hier«, sagte Meg, »steck’s noch ‚n bißchen fester. Du willst doch nicht, daß ihre Füße rausgucken, oder? Die würden ja dann so kalt wie der Stein, nach dem du getauft bist.«
O ja, ich hatte es gut und fühlte mich keineswegs durch den Mangel an elterlicher Zuwendung benachteiligt. Ich war meinem Namenspatron und all diesen ägyptischen Königen und Königinnen vielmehr dankbar, weil sie meine Eltern so sehr beanspruchten, daß sie für mich keine Zeit mehr erübrigen konnten. Ich verbrachte glückliche Tage mit Bettenmachen, Tischdecken, ich schaute Mrs. Harlow beim Fleischschaben und Puddingrühren zu, wobei mir gelegentlich ein Leckerbissen in den Mund geschoben wurde, und lauschte den dramatischen Szenen aus Mr. Dollands verpfuschter Vergangenheit. Und immer waren Nanny Pollocks liebevolle Arme da, wenn ich Trost brauchte. Es war eine glückliche Kindheit, und auf die Zuwendung meiner Eltern konnte ich gut verzichten.
Dann kam der Tag, an dem Felicity Wills, die Nichte von Professor Wills, als meine Erzieherin ins Haus kommen sollte, um sich um die Grundlagen meiner Bildung zu kümmern, bis weitere Pläne für meine Zukunft gemacht würden.
Ich hörte die Droschke vorfahren. Wir standen am Fenster des Kinderzimmers – Nanny Pollock, Mrs. Harlow, Dot, Meg, Emily und ich.
Ich sah sie aussteigen und den Kutscher ihr Gepäck bis an die Haustür bringen. Sie war jung und wirkte unbeholfen und nicht im mindesten furchteinflößend.
»So ein junges Ding«, bemerkte Nanny.
»Wartet’s nur ab«, meinte Mrs. Harlow betont pessimistisch. »Wie ich immer sage, nach dem Aussehen allein kann man nicht gehen.«
Endlich erfolgte die erwartete Vorladung in den Salon. Nanny hatte mir ein sauberes Kleid angezogen und mir die Haare gekämmt.
»Denk dran, deutlich zu antworten«, sagte sie. »Und hab keine Angst. Dir wird nichts geschehen, und Nanny hat dich lieb.«
Ich gab ihr einen innigen Kuß und ging in den Salon, wo meine Eltern und Felicity Wills mich erwarteten. »Ah, Rosetta«, sagte meine Mutter, die mich wohl nur deswegen erkannte, weil sie mit mir gerechnet hatte. »Das ist deine Gouvernante, Miß Felicity Wills. Unsere Tochter Rosetta, Miß Wills.«
Sie trat auf mich zu, und ich glaube, schon von diesem Augenblick an habe ich sie geliebt. Sie war so zierlich, so hübsch, wie ein Bild, das ich irgendwo gesehen hatte. Sie ergriff meine Hände und lächelte mich an. Ich erwiderte ihr Lächeln.
»Ich fürchte, Sie müssen auf jungfräulichem Boden beginnen, Miß Wills«, sagte meine Mutter. »Rosetta hat noch nie Unterricht gehabt.«
»Ich bin überzeugt, sie hat schon eine Menge gelernt«, meinte Miß Wills.
Meine Mutter hob die Schultern.
»Rosetta kann Ihnen das Schulzimmer zeigen«, sagte mein Vater.
»Eine ausgezeichnete Idee«, wandte sich Miß Wills, immer noch lächelnd, an mich.
Das Schlimmste war vorüber. Gemeinsam verließen wir das Wohnzimmer. »Es ist ganz oben«, sagte ich.
»Ja, Schulzimmer sind oft oben im Haus. Damit wir ungestört sind, nehme ich an. Ich hoffe, daß wir gut miteinander auskommen. Dann bin ich also deine erste Erzieherin.« Ich nickte. »Ich will dir was verraten«, fuhr sie fort. »Du bist meine erste Schülerin. Also sind wir beide Anfängerinnen.«
Das knüpfte sogleich ein Band zwischen uns. Mir war viel fröhlicher zumute als am Morgen beim Aufwachen, wo ich als erstes an ihre Ankunft gedacht hatte. Ich hatte mir eine grimmige alte Dame vorgestellt, und hier war ein hübsches junges Mädchen. Sie konnte nicht älter als siebzehn sein, und sie hatte bereits gestanden, daß sie noch nie unterrichtet hatte.
Es war eine freudige Überraschung. Ich wußte, es würde alles gut werden.
Das Leben hatte eine neue Wendung genommen. Zu meiner großen Freude entdeckte ich, daß ich nicht so unwissend war, wie ich befürchtet hatte.
Irgendwie hatte ich mir mit Mr. Dollands Hilfe das Lesen beigebracht. Ich hatte die Bilder in der Bibel betrachtet und die Geschichten geliebt, die er mit dramatischer Betonung erzählte. Ich war von den Bildern fasziniert: Rachel am Brunnen, Adam und Eva, wie sie bei der Vertreibung aus dem Paradies über die Schulter zu dem Engel mit dem Flammenschwert zurückblicken, Johannes der Täufer, der im Wasser steht und predigt. Und ich hatte natürlich Mr. Dollands Wiedergabe der Rede Heinrichs V. vor Harfleur gelauscht und konnte sie aufsagen, genau wie einen Teil von »Sein oder Nichtsein«. Mr. Dolland sah sich gern als Hamlet.
Miß Wills war sehr zufrieden mit mir, und wir waren von Anfang an Freundinnen.
Für meine Freunde in der Küche galt es allerdings zunächst eine gewisse Abneigung zu überwinden. Aber Felicity – ich duzte sie bald, wenn wir allein waren –, war so herzlich und keineswegs hochnäsig, wie Mrs. Harlow befürchtet hatte, daß die Schranke zwischen der Küche und denen, die sich Mrs. Harlow zufolge »was Besseres dünken«, bald überwunden war. Bald schon wurden ihr die Mahlzeiten nicht mehr auf dem Zimmer serviert, sondern Felicity setzte sich zu uns an den Küchentisch.
Solche Zustände wären in einem ordentlichen Haushalt natürlich nicht geduldet worden, aber einer der Vorteile, Eltern zu haben, die in einer abgehobenen Gelehrtensphäre fern einer irdischen Hausordnung lebten, war die Freiheit, die wir genossen. Und wie wir sie genossen! Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, die manche Leute vielleicht als vernachlässigt bezeichnen würden, kann ich nur frohlocken, denn sie gehörte zum Wunderbarsten und Liebevollsten, das einem Kind zuteil werden kann. Während man sie erlebt, merkt man natürlich nicht, wie gut man es hat. Erst wenn sie vorüber ist, kommt die Erkenntnis.
Mit Felicity machte das Lernen Spaß. Jeden Vormittag unterrichtete sie mich. Sie stellte alles so interessant dar und ließ es so aussehen, als entdeckten wir die Dinge gemeinsam. Nie gab sie vor, alles zu wissen. Wenn ich eine Frage stellte, sagte sie freimütig: »Das muß ich nachschlagen.« Sie erzählte mir von sich. Ihr Vater war vor einigen Jahren gestorben, und sie waren sehr arm. Sie hatte zwei jüngere Schwestern. Zum Glück hatte ihr Onkel, Professor Wills, der Bruder ihres Vaters, die Familie unterstützt und Felicity diese Stellung verschafft. Sie gestand, daß sie gefürchtet hatte, zu einem überklugen Kind zu kommen, das mehr wüßte als sie selbst.
Wir lachten darüber. »Nun ja«, sagte sie, »die Tochter von Professor Cranleigh. Er ist eine Kapazität und in akademischen Kreisen sehr geachtet.«
Ich wußte nicht recht, was akademische Kreise waren, aber ich glühte vor Stolz. Immerhin war er mein Vater, und es war angenehm, zu wissen, daß er hoch angesehen war. »Er und deine Mutter sind sehr gefragt«, erklärte sie. Das war eine weitere gute Nachricht; würden sie uns doch auch fürderhin nicht im Wege sein.
»Ich hatte gedacht, es gäbe eine strenge Beaufsichtigung und Vorschriften und so weiter. Insofern hat sich alles viel besser angelassen, als ich erwartet hatte.«
»Ich dachte, du wärst fürchterlich ... weder Fisch noch Fleisch.«
Das fanden wir sehr lustig, und wir lachten. Wir lachten sehr viel. Und ich lernte schnell. Im Geschichtsunterricht ging es um Menschen – darunter sehr eigenartige –, nicht bloß um Namen und eine Reihe von Daten. Erdkunde war wie eine aufregende Reise um die Welt. Wir hatten einen großen Globus, den wir rundherum drehten; wir suchten uns Orte aus und stellten uns vor, wir befänden uns dort.
Sicher hätten meine Eltern diese Lernmethode nicht gutgeheißen, aber sie erwies sich als vorzüglich. Nie hätten sie eine Erzieherin eingestellt, die wie Felicity aussah und zugab, nicht über die notwendigen Voraussetzungen zu verfügen und noch nie unterrichtet zu haben, wäre sie nicht die Nichte von Professor Wills gewesen. Somit hatten wir allen Grund dankbar zu sein, und wir waren uns dessen bewußt.
Auf unseren Spaziergängen entdeckten wir, was für eine interessante Gegend Bloomsbury war, und wir machten ein Spiel daraus, zu erkunden, wie es wurde, wie es heute war. Es war aufregend, zu erfahren, daß es vor einem Jahrhundert ein einsames Dorf namens Lomesbury gewesen war und zwischen der St. Pancras Kirche und dem Britischen Museum Felder und freies Land lagen. Wir fanden das Haus, das der Maler Sir Godfrey Kneller bewohnt hatte. Und es gab die Elendsquartiere, in die wir uns nicht hineinwagen konnten – ein Straßengewirr, wo die ganz Armen Seite an Seite mit den kriminellen Elementen lebten, die sich dort in Sicherheit wiegen konnten, da niemand das Viertel zu betreten wagte.
Mr. Dolland, der in Bloomsbury geboren und aufgewachsen war, erzählte gern von den alten Zeiten, und wie zu erwarten stand, wußte er eine Menge darüber. Bei den Mahlzeiten gab es allerlei interessante Gespräche über dieses Thema. An den Winterabenden saßen wir am Tisch, das Licht der Lampe beschien die Reste von Mrs. Harlows Pasteten oder Puddings und die leeren Gemüseschüsseln, während Mr. Dolland von seiner Jugendzeit in Bloomsbury berichtete.
Er war in der Gray’s-Inn-Straße geboren und hatte als Junge seine Umgebung erkundet, über die er viel zu erzählen wußte.
Ich erinnere mich so gut an Einzelheiten aus jener Zeit. Mr. Dolland konnte sehr anschaulich schildern, und wie alle Schauspieler liebte er es, seine Zuhörer in Bann zu schlagen. Nirgendwo hätte er ein aufmerksameres Publikum finden können, wenn es auch kleiner war, als er es sich vielleicht gewünscht hätte.
»Schließt die Augen«, sagte er, »und stellt es euch vor. Mit den Häusern sieht alles ganz anders aus. Stellt euch diese Gegend vor, als wär’s auf dem Land. Ich selbst habe mich auf dem Land nie wohl gefühlt.«
»Da sind Sie wie ich, Mr. Dolland«, sagte Mrs. Harlow. »Sie haben gern ein bißchen Leben um sich.«
»Geht es uns nicht allen so?« fragte Dot.
»Ich weiß nicht«, warf Nanny Pollock ein. »Manche schwören aufs Land.«
»Ich bin auf dem Land geboren und aufgewachsen«, piepste Emily.
»Mir gefällt es hier«, sagte ich, »mit uns allen zusammen.«
Nanny nickte beifällig über diese Bemerkung.
Ich sah, daß Mr. Dolland in der Stimmung war, uns etwas zum besten zu geben, und ich überlegte, ob ich um »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde« oder um Die Glocken bitten sollte.
»Ah«, sagte Mr. Dolland, »hier hat sich eine Menge verändert. Wenn ihr nur um Jahre zurücksehen könntet.«
»Schade, daß wir uns aufs Hörensagen verlassen müssen«, sagte Felicity. »Ich finde es spannend, Leute von früher erzählen zu hören.«
»Leider«, sagte Mr. Dolland, »kann ich so weit nicht zurückgehen, aber ich weiß Geschichten von meiner Großmutter. Sie hat hier gelebt, bevor all die Häuser gebaut wurden. Sie pflegte von einem Bauernhof zu erzählen, der dort stand, wo jetzt der höchste Punkt der Russell Street ist. Sie konnte sich noch an die Misses Capper erinnern, die da gewohnt haben.«
Ich lehnte mich freudig zurück in der Erwartung, eine Geschichte über die Misses Capper zu hören. Als Mr. Dolland dies sah, lächelte er mir zu und sagte: »Du möchtest wohl hören, was sie mir von ihnen erzählt hat, Rosetta?«
Ich nickte, und er begann: »Sie waren zwei alte Jungfern, die Damen Capper. Die eine hatte Pech in der Liebe, die andere hatte nie Gelegenheit dazu. Das machte sie verbittert gegenüber allen Männern. Sie waren wohlhabend, die beiden. Ihr Vater hatte ihnen den Hof hinterlassen. Sie haben ihn allein bewirtschaftet. Einen Mann wollten sie nicht dahaben. Sie sind mit ein, zwei Melkerinnen ausgekommen. Alles wegen dieser Abneigung gegen das andere Geschlecht.«
»Weil die eine Pech in der Liebe hatte«, sagte Emily.
»Und die andere nie Gelegenheit dazu hatte«, ergänzte ich.
»Psst«, mahnte Nanny. »Laßt Mr. Dolland weitererzählen.«
»Ein seltsames Gespann waren sie, die beiden. Sind auf alten grauen Stuten ausgeritten. Sie konnten das männliche Geschlecht nicht leiden, aber angezogen haben sie sich, als gehörten sie selbst dazu, mit Zylinderhüten und Reithosen. Wie zwei alte Hexen sahen sie aus. In der ganzen Gegend waren sie als die verrückten Cappers bekannt.«
Ich fand das sehr spaßig und lachte herzhaft, womit ich mir nur ein weiteres vorwurfsvolles Kopfschütteln von Nanny einhandelte. Ich hätte es besser wissen müssen. Man durfte Mr. Dolland nicht unterbrechen, wenn er in vollem Schwung war.
»Nicht, daß sie etwas richtig Niederträchtiges getan hätten. Aber es machte ihnen Spaß, hier und da Schabernack zu treiben. Die Buben ließen dort gern ihre Drachen steigen – war ja alles freies Feld. Eine von den Damen Capper ist mit einer Schere herumgeritten. Sie ist den Buben mit den Drachen hinterhergaloppiert und hat die Schnüre durchgeschnitten, und die Buben standen da, die Schnüre in der Hand, und sahen ihre Drachen ins Jenseits fliegen.«
»Ach, die armen kleinen Buben. So eine Gemeinheit«, sagte Felicity.
»So waren die Damen Capper eben. In der Nähe floß ein Bach, in dem die Buben zu baden pflegten. Nichts taten sie an einem heißen Sommertag lieber als ins Wasser zu tauchen. Ihre Kleider ließen sie hinter einem Busch liegen. Die andere Miß Capper hat sie beobachtet. Sie ist hingeflitzt und hat ihnen die Kleider weggenommen.«
»So eine gemeine Alte«, sagte Dot.
»Sie sagte, die Buben seien in ihr Grundstück eingedrungen, und Eindringlinge müßten bestraft werden.«
»Eine kleine Verbotstafel hätte doch sicher genügt?« meinte Felicity.
»Das war nicht die Art der Damen Capper. Es wurde viel geklatscht über die beiden. Ich wünschte, ich hätte sie erleben können. Die hätte ich gern gesehen.«
»Sie hätten es sich nicht gefallen lassen, daß die Ihren Drachen abschnitten und ins Jenseits schickten, Mr. Dolland«, sagte ich.
»Die waren ganz schön gerissen, die zwei. Und dann waren da natürlich die vierzig Schritte.«
Wir lehnten uns zurück, um die Geschichte von den vierzig Schritten zu hören.
»Ist das eine Gespenstergeschichte?« fragte ich gespannt.
»So etwas Ähnliches.«
»Vielleicht hören wir sie lieber morgen früh«, sagte Nanny mit einem Blick auf mich. »Die Kleine regt sich über Gespenstergeschichten immer so auf. Ich möchte nicht, daß sie die halbe Nacht wach liegt und sich einbildet, Dinge zu hören.«
»Ach, Mr. Dolland«, bettelte ich. »Bitte erzählen Sie’s uns jetzt. Ich kann es nicht erwarten. Ich möchte die vierzig Schritte hören.« Felicity lächelte mich an. »Wird schon nicht so schlimm sein«, sagte sie, genauso gespannt wie ich, und nachdem er uns Appetit gemacht hatte, sah Mr. Dolland ein, daß er fortfahren mußte.
Nanny wirkte etwas verstimmt. Sie war Felicity nicht so gewogen wie wir übrigen. Sie wußte wohl von meiner Zuneigung und fürchtete, es würde meine Anhänglichkeit an sie selbst schmälern. Sie hätte sich keine Gedanken zu machen brauchen. Ich war durchaus fähig, alle beide zu lieben.
Mr. Dolland räusperte sich und setzte die Miene auf, die er wohl zur Schau getragen haben mußte, wenn er in den Kulissen auf seinen Auftritt wartete. Er begann theatralisch: »Es waren einmal zwei Brüder. Das war vor langer Zeit, als König Karl auf dem Thron saß. Dann starb der König, und sein Sohn, der Herzog von Monmouth, hielt sich für einen besseren König als Karls Bruder James, und es gab einen Kampf zwischen ihnen. Der eine der beiden Brüder war für Monmouth und der andere für James, somit kämpften sie als Feinde auf verschiedenen Seiten. Wichtiger aber war für sie ihre Verehrung für eine gewisse junge Dame. Ja, die beiden Brüder liebten dieselbe Frau, und das gedieh so weit, daß sie übereinkamen, die Entscheidung durch einen Zweikampf herbeizuführen. Diese junge Dame war die Schöne von Bloomsbury und hatte eine hohe Meinung von sich, wie bei solchen jungen Damen üblich. Sie war stolz, weil sie um sie kämpfen wollten. Sie sollten mit Degen kämpfen, wie es dazumal der Brauch war. Dergleichen nannte man ein Duell. Nahe dem Capper-Hof lag ein Stück Brachland, das immer in schlechtem Ruf gestanden hatte. Es war der Schlupfwinkel von Wegelagerern, und niemand, der seine fünf Sinne beisammenhatte, ging nach dem Dunkelwerden dorthin. Das schien ein guter Platz für ein Duell.« Mr. Dolland nahm das große Tranchiermesser vom Tisch und schwang es geschickt, wobei er auf und ab schritt und mit einem unsichtbaren Gegner focht. Er hielt das Messer gekonnt, und es sah so echt aus, daß ich die zwei Männer beinahe kämpfen sehen konnte. Er hielt einen Augenblick inne, wies auf den Küchenherd und sagte: »Dort auf einer Böschung saß die Ursache des Übels. Jede Minute genießend, sah sie jeden der zwei Brüder bereit, den anderen ihretwegen zu töten.« Der Küchenherd wurde zu einer Böschung. Ich sah das Mädchen vor mir, sie ähnelte Felicity ein wenig, nur daß Felicity zu gütig war, um zu wünschen, daß jemand ihretwegen stürbe. Es war alles so lebendig, wie immer, wenn Mr. Dolland eine »Nummer« zum besten gab. Er vollführte einen dramatischen Stoß und fuhr mit hohltönender Stimme fort: »Just als der eine Bruder den anderen am Hals traf und eine Ader durchtrennte, stach der andere seinen Bruder durchs Herz. So starben beide Brüder auf Long Fields, wie es damals hieß. Später wurde der Name in Southampton Fields geändert.«
»Nein, so was«, sagte Mrs. Harlow. »Was die Menschen nicht alles aus Liebe tun.«
»Und welcher ist ihr erschienen?« fragte ich.
»Du mit deinen Gespenstern«, sagte Nanny mißbilligend. »Für die Kleine muß immer ein Gespenst dabeisein.«
»Hört weiter«, sagte Mr. Dolland. »Wie sie so hin und her gingen« – er führte noch einen Degenkampf vor, um seine Worte zu untermalen –, »machten sie vierzig Schritte auf der blutbefleckten Erde, und wo die Brüder hingetreten waren, ist nie wieder etwas gewachsen. Die Menschen pflegten hinzugehen und die Fußabdrücke zu betrachten. Meine Großmutter sagte, sie seien deutlich zu erkennen gewesen, und die Erde war rot, wie mit Blut befleckt. Niemand ist nach dem Dunkelwerden dort hingegangen.«
»Da ist schon vorher keiner hingegangen«, erinnerte ich ihn.
»Aber die Wegelagerer waren jetzt nicht mehr da, und trotzdem ging niemand hin.«
»Hat man etwas gesehen?« fragte Dot.
»Nein, es war nur so ein unheimliches Gefühl, daß etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Es hieß, wenn es regnete und die Erde durchweicht war, könne man die Fußabdrücke noch sehen, und sie seien rot gefärbt. Man pflanzte etwas an, aber nichts wollte gedeihen. Die Fußabdrücke sind geblieben.«
»Was ist aus dem Mädchen geworden, um das sie gekämpft haben?« fragte Felicity.
»Ihre Spur hat sich verloren.«
»Hoffentlich sind sie ihr erschienen«, sagte ich.
»Sie hätten nicht solche Narren sein sollen«, meinte Nanny. »Ich habe keine Nachsicht mit Narren. Habe ich nie gehabt und werde ich nie haben.«
»Ich finde es ziemlich traurig, daß beide gestorben sind«, bemerkte ich. »Es wäre besser, einer wäre am Leben geblieben, um zu bereuen. Und das Mädchen war die ganze Mühe ohnehin nicht wert.«
»Du mußt dich mit dem abfinden, was ist«, sagte Felicity. »Du kannst das Leben nicht ändern, um ein gutes Ende herbeizuführen.«
Mr. Dolland fuhr fort: »Jemand hat ein Theaterstück darüber geschrieben. Das Feld der vierzig Schritte.«
»Haben Sie da mitgespielt, Mr. Dolland?« fragte Dot.
»Nein, das war etwas vor meiner Zeit. Ich hatte davon gehört, und das hat mein Interesse für die Geschichte der Brüder geweckt. Jemand namens Mayhew schrieb es mit seinem Bruder. Ein hübsches Zusammentreffen, Brüder schreiben über Brüder. Es wurde im Theater an der Tottenham Street aufgeführt. Es ist eine ganze Weile gelaufen.«
»Nicht auszudenken, daß das alles hier in der Nähe geschah«, sagte Emily.
»Man weiß eben nie, was irgendwem von uns irgendwann zustoßen kann«, bemerkte Felicity ernst.
So verging die Zeit. Die Wochen wurden zu Monaten und die Monate zu Jahren. Es waren glückliche, ungetrübte Tage, und wenig vermochte unsere heitere Ruhe zu stören. Mein zwölfter Geburtstag nahte. Felicity dürfte damals vierundzwanzig gewesen sein. Mr. Dolland ergraute an den Schläfen, was ihn sehr vornehm aussehen ließ und seinen Nummern eine gewisse Größe verlieh. Nanny klagte häufiger über Rheumatismus, und Dot verließ uns, um zu heiraten. Wir vermißten sie, doch Meg nahm ihren Platz ein und Emily den von Meg, und es wurde für unnötig befunden, eine neue Hausmagd einzustellen. Zu gegebener Zeit kam Dot mit einem niedlichen, pummeligen Baby nieder, das sie stolz zu uns brachte, um es bewundern zu lassen.
Diese Tage bargen viele glückliche Erinnerungen, doch ich hätte mir darüber im klaren sein müssen, daß sie nicht ewig währen konnten.
Ich entwuchs der Kindheit, und Felicity war eine schöne junge Frau geworden.
Veränderungen schleichen sich äußerst heimtückisch an. Felicity war gelegentlich zu den Abendessen gebeten worden, die meine Eltern zu geben pflegten. Natürlich nur, erklärte sie mir, weil sie noch eine Dame brauchten, damit sich beide Geschlechter zahlenmäßig die Waage hielten; und als Professor Wills’ Nichte war sie als Gast annehmbar, obwohl sie nur die Erzieherin war. Diese Veranstaltungen machten ihr keinen Spaß. Ich erinnere mich an das einzige kleine Abendkleid, das sie besaß. Es war aus schwarzer Spitze, und sie sah sehr hübsch darin aus, aber in ihrem Kleiderschrank hing es als bedrückende Erinnerung an diese Abendessen, die einzigen Gelegenheiten, zu denen sie es trug. Sie war immer froh, wenn meine Eltern verreisten, weil es dann keine Abendeinladungen geben konnte. Man konnte nie sicher sein, wann sie zur Teilnahme aufgefordert wurde, denn die Einladung an sie war gewöhnlich ein Entschluß in letzter Minute. Sie war, wie sie sagte, ein ihr höchst widerstrebender Notbehelf.
Als ich älter wurde, bekam ich meine Eltern etwas häufiger zu Gesicht. Ab und zu trank ich Tee mit ihnen. Ich glaube, sie waren in meiner Gegenwart noch verlegener als ich in ihrer. Unfreundlich waren sie nie. Sie stellten eine Menge Fragen über meinen Unterricht, und da ich über die Gabe verfügte, Fakten zu sammeln, und Liebe zur Literatur besaß, konnte ich ihnen ein einigermaßen klares Bild von mir geben. Waren sie von meinen Fortschritten auch nicht besonders begeistert, so waren sie doch nicht so ungehalten, wie sie hätten sein können.
Dann setzten die ersten Anzeichen der Veränderung ein, wenngleich ich sie damals nicht erkannte.
Eine Abendeinladung stand bevor, und Felicity wurde zur Teilnahme befohlen. »Mein Kleid sieht schon so abgenutzt und fade aus, wie es Schwarz mit der Zeit eben wird«, sagte sie zu mir.
»Es steht dir sehr gut, Felicity«, versicherte ich ihr.
»Ich komme mir so fremd vor, eine richtige Außenseiterin. Alle wissen, ich bin die Erzieherin, bloß dazugebeten, damit die Zahl stimmt.«
»Aber du bist hübscher als alle, und interessanter bist du auch.« Das brachte sie zum Lachen. »Diese gelehrten alten Professoren halten mich für eine leichtsinnige, hohlköpfige Schwachsinnige.«
»Die sind selber hohlköpfige Schwachsinnige«, sagte ich.
Ich war bei ihr, als sie sich ankleidete. Sie hatte ihr schönes Haar hochgesteckt, und ihre Nervosität verlieh ihren Wangen einen Hauch von Rosa, was ihr gut zu Gesicht stand.
»Du siehst reizend aus«, sagte ich ihr. »Alle werden dich beneiden.« Das brachte sie abermals zum Lachen, und es freute mich, sie etwas aufgeheitert zu haben. Mir kam der schreckliche Gedanke, daß ich bald an diesen langweiligen Essen würde teilnehmen müssen.
Um elf Uhr abends kam sie in mein Zimmer. Noch nie hatte ich sie so schön gesehen. Ich setzte mich im Bett auf. Sie lachte. »Oh, Rosetta, ich muß dir was erzählen.«
»Psst«, sagte ich. »Wenn Nanny Pollock dich hört, wird sie sagen, du solltest meinen Schlaf nicht stören.« Wir kicherten, und sie setzte sich auf meine Bettkante. »Es war so spaßig.«
»Was?« rief ich aus. »Ein Essen mit den alten Professoren und spaßig?«
»Nicht alle waren alt. Da war einer ...«
»Ja?«
»Er war sehr interessant. Nach dem Essen ...«
»Ich weiß«, unterbrach ich. »Die Damen lassen die Herren allein, damit sie sich beim Portwein über Sachen unterhalten können, die zu gewichtig oder zu anstößig für weibliche Ohren sind.« Wieder lachten wir. »Erzähl mir mehr über diesen nicht so alten Professor«, sagte ich. »Ich wußte gar nicht, daß es so was gibt. Ich dachte, die werden alle alt geboren.«
»Man lernt nie aus.«
Jetzt fiel mir auf, daß sie regelrecht strahlte. »Nie hätte ich gedacht, daß dir so ein Abendessen Spaß machen würde«, sagte ich. »Du machst mir Hoffnung. Mir ist nämlich der Gedanke gekommen, daß eines Tages von mir erwartet wird, daran teilzunehmen.«
»Es kommt immer darauf an, wer da ist«, sagte sie und lächelte in sich hinein.
»Du hast mir noch nichts von dem jungen Mann erzählt.«
»Er war so um die Dreißig, würde ich sagen.«
»Oh, das ist aber nicht sehr jung.«
»Für einen Professor schon.«
»Was ist sein Fach?«
»Ägypten.«
»Das scheint sehr beliebt zu sein.«
»Deine Eltern verkehren vornehmlich in diesen Kreisen.«
»Hast du ihm erzählt, daß ich nach dem Stein von Rosette benannt bin?«
»Allerdings.«
»Hoffentlich war er entsprechend beeindruckt.«
Wir setzten unser leichtfertiges Geplauder fort, und der bloße Umstand, daß Felicity einmal Spaß an einer Abendeinladung gehabt hatte, brachte mich nicht auf den Gedanken, dies könne der Beginn einer Veränderung sein.
Schon am nächsten Tag machte ich die Bekanntschaft von James Grafton. Felicity und ich waren gerade auf unserem Morgenspaziergang; seit wir die Geschichte von den vierzig Schritten gehört und die Stätte ausfindig gemacht hatten, gingen wir oft dorthin. Es gab tatsächlich einen Flecken Erde, wo das Gras spärlich wuchs, und es sah dort wirklich so verlassen aus, daß man sich bemüßigt fühlte, der Geschichte Glauben zu schenken. In der Nähe war eine Bank. Dort ließ ich mich gern nieder. Mr. Dollands Schilderung des Vorfalls war so lebhaft gewesen, daß ich die Brüder bei ihrem tödlichen Kampf vor mir sah.
Die Macht der Gewohnheit ließ uns die Richtung zu der Bank einschlagen und uns niedersetzen. Nicht lange, und ein Mann kam auf uns zu. Er lüftete seinen Hut und machte eine Verbeugung. Er stand da und lächelte uns an, und Felicity errötete geziemend. »Na so etwas«, sagte er, »Sie sind es wirklich, Miß Wills.«
Sie lachte. »Oh, guten Morgen, Mr. Graf ton. Dies ist Miß Rosetta Cranleigh.«
Er verbeugte sich vor mir. »Guten Morgen. Darf ich mich einen Augenblick setzen?«
»Bitte«, sagte Felicity.
Ich wußte instinktiv, daß dies der junge Mann war, den sie am Abend zuvor beim Essen kennengelernt hatte, und daß diese Begegnung verabredet war. Wir unterhielten uns eine Weile über das Wetter. »Dies ist wohl ein Lieblingsplatz von Ihnen«, meinte er, und ich hatte das Gefühl, daß er sich angestrengt bemühte, mich in die Unterhaltung einzubeziehen.
»Wir kommen oft hierher«, erklärte ich.
»Die Geschichte von den vierzig Schritten hat uns neugierig gemacht«, sagte Felicity.
»Kennen Sie sie?« fragte ich. Er verneinte, und ich erzählte sie ihm.
»Wenn ich hier sitze, kann ich mir alles genau vorstellen«, sagte ich.
»Rosetta ist eine Romantikerin«, informierte ihn Felicity.
»Die meisten von uns sind im Grunde Romantiker«, erwiderte er und lächelte mich warmherzig an. Er erklärte uns, er sei auf dem Weg zum Museum. Es seien etliche Papyrusrollen aufgetaucht, und Professor Cranleigh gestatte ihm, sie sich anzusehen. »Es ist sehr aufregend, wenn etwas ans Licht kommt, das womöglich unseren Wissensstand erweitert«, fuhr er fort. »Professor Cranleigh hat uns gestern abend von einigen wunderbaren Entdeckungen berichtet, die man in jüngster Zeit gemacht hat.«
Er erzählte weiter von diesen Entdeckungen, und Felicity hörte hingerissen zu. Mir wurde plötzlich klar, daß etwas Bedeutendes im Gange war. Felicity entglitt mir. Es schien lächerlich, so etwas zu denken. Sie war liebevoll und fürsorglich wie stets, aber sie wirkte ein wenig geistesabwesend, so als dächte sie, während sie mit mir sprach, an jemand anderen. Aber ich kam nicht gleich bei dieser ersten Begegnung mit dem sympathischen Professor Grafton auf die Idee, daß Felicity verliebt war.
Wir trafen ihn danach mehrmals, und ich wußte, daß keine dieser Begegnungen Zufall war. Er kam ein-, zweimal zum Essen in unser Haus, und jedesmal saß Felicity mit am Tisch. Ich hatte den Eindruck, daß meine Eltern in das Geheimnis eingeweiht waren.
Felicity kaufte sich ein neues kleines Abendkleid. Wir gingen zusammen in das Geschäft. Es war nicht ganz das, was sie gern gehabt hätte, aber das beste, das sie sich leisten konnte. Da sie seit ihrer Begegnung mit James Grafton noch hübscher geworden war, sah sie reizend darin aus. Das Kleid war blau – so blau wie ihre Augen, und sie strahlte.
Mr. Dolland und Mrs. Harlow merkten bald, was vorging. »Wie schön für sie«, meinte Mrs. Harlow. »Gouvernanten haben ein hartes Los. Sie sind so anhänglich, und wenn sie nicht mehr erwünscht sind, geht es zum nächsten Kind, und immer so weiter, bis sie zu alt sind. Und was wird dann aus ihnen? Sie ist ein hübsches junges Ding, und es wird Zeit, daß sie einen Mann findet, der für sie sorgt.«
Ich muß gestehen, ich war bestürzt. Wenn Felicity Mr. Grafton heiratete, würde sie nicht mehr bei mir sein. Ich versuchte, mir ein Leben ohne sie vorzustellen.
Sie bekundete großes Interesse für das alte Ägypten, und wir gingen oft ins Britische Museum. Ich verspürte nicht mehr die bange Ehrfurcht wie in meiner Kindheit; ich war sehr gefesselt und, angespornt von Felicity, vom ägyptischen Saal fast so gebannt wie sie. Besonders die Mumien hatten es mir angetan ... es war ziemlich morbid. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mit ihnen allein im Raum wäre, würden sie zum Leben erwachen.
Manchmal gesellte sich dort James Grafton zu uns. Dann streifte ich umher und ließ ihn mit Felicity flüstern, während ich die Gesichter von Osiris und Isis betrachtete, wie es jene, die sie für göttlich hielten, vor vielen Jahren getan haben mochten.
Eines Tages kam mein Vater in den Saal und entdeckte uns. Nach einem Augenblick der Verwirrung dämmerte es ihm, daß seine eigene Tochter sich hier in seinem Allerheiligsten befand. Ich stand vor dem mumienförmigen Sarg von König Menkara – einem der ältesten in der Sammlung –, als mein Vater zu mir trat. Seine Augen leuchteten plötzlich freudig auf. »Nanu, Rosetta. Es freut mich, dich hier zu sehen.«
»Ich bin mit Miß Wills gekommen«, sagte ich.
Er drehte sich langsam zu Felicity und James um. »Ich verstehe.« Er hatte einen Gesichtsausdruck, der bei anderen vielleicht spitzbübisch zu nennen gewesen wäre, aber bei ihm war es nur nachsichtiges Verständnis. »Wie ich sehe, fühlst du dich zu Mumien hingezogen.«
»Ja«, erwiderte ich. »Es ist unglaublich, daß die Überreste dieser Menschen nach all den Jahren noch da sind.«
»Ich freue mich über dein Interesse. Komm mit mir.« Ich folgte ihm zu Felicity und James. »Ich gehe mit Rosetta in mein Zimmer«, sagte er. »Vielleicht treffen wir uns dort in, sagen wir, einer Stunde?«
»Oh, danke, Sir«, sagte James.
Ich wußte, was mein Vater tat. Er ermöglichte ihnen, eine Zeitlang allein zu sein. Es war ein amüsanter Gedanke, daß mein Vater Amor spielte.
Er führte mich in sein Zimmer, das ich noch nie gesehen hatte. Die Wände waren vom Fußboden bis zur Decke mit Büchern vollgestellt, und mehrere Glasvitrinen enthielten alle möglichen Gegenstände, unter anderem mit Hieroglyphen bedeckte Steine und mehrere gemeißelte Bildnisse. »Nun siehst du zum erstenmal, wo ich arbeite«, sagte er.
»Ja, Vater.«
»Es freut mich, daß du ein bißchen Interesse zeigst. Wir leisten hier wunderbare Arbeit. Wärst du ein Junge gewesen, so hätte ich gewünscht, daß du mir nachfolgst.«
Ich hatte das Gefühl, mich für mein Geschlecht entschuldigen und es verteidigen zu müssen. »Wie meine Mutter ...« begann ich.
»Sie ist eine außergewöhnliche Frau.«
Natürlich. Da konnte ich kaum mithalten. Außergewöhnlich war ich nicht. Ich hatte meine glückliche Kindheit mit Menschen im Erdgeschoß verbracht, die mich unterhielten, mich liebten und mit meinem Los zufrieden sein ließen.
Da die Verlegenheit, die unsere Begegnungen stets hervorriefen, sich auch jetzt einzustellen schien, erging er sich in einer Beschreibung von Einbalsamierungsmethoden, der ich aufmerksam lauschte, wobei ich die ganze Zeit darüber staunte, daß ich im Britischen Museum war und mit meinem Vater sprach.
Schließlich gesellten sich Felicity und James zu uns. Es war ein ungewöhnlicher Morgen, und jetzt wurde mir bewußt, daß eine Veränderung im Gange war.
Bald darauf verlobte sich Felicity mit James Grafton. Ich war aufgeregt und bange zugleich. Es war schön, Felicity so glücklich zu sehen und zu wissen, daß ihre Existenz gesichert war, worüber ich mir nie Gedanken gemacht hatte, bis Mrs. Harlow darauf hinwies. Aber es blieb freilich die Frage, was aus mir werden sollte. Meine Eltern schenkten mir nun mehr Aufmerksamkeit, was an sich schon beunruhigend war. Mein Vater hatte mich im Britischen Museum entdeckt und mein Interesse an den Exponaten im ägyptischen Saal bemerkt. Anschließend hatten wir uns ein wenig in seinem Zimmer dort unterhalten. Ich war nicht ganz so dumm, wie sie bislang angenommen hatten. Ich besaß einen Verstand, der zwar all die Jahre geschlummert hatte, aber möglicherweise würde ich mich mausern und eine der Ihren werden.
Felicity wollte im März des nächsten Jahres heiraten. Ich hatte meinen dreizehnten Geburtstag hinter mir. Felicity sollte bis eine Woche vor der Hochzeit bei uns bleiben, danach würde sie ins Haus von Professor Wills ziehen, der ihr die Stellung bei uns verschafft hatte, und nach der Heirat würde sie sich mit James in Oxford niederlassen, wo er an der Universität arbeitete. Die große Frage war, wie sollte es mit meiner Ausbildung weitergehen?
Ein Geldgeschenk ihres Onkels versetzte Felicity in die Lage, ihre spärliche Garderobe zu ergänzen, ein Unternehmen, an dem ich mich mit großer Begeisterung beteiligte, wenngleich ich der schwerwiegenden Frage wegen meiner Zukunft und der Aussicht auf die Leere, die Felicitys Fortgang unweigerlich hinterlassen würde, nie ganz ausweichen konnte. Ich versuchte mir vorzustellen, wie es ohne sie sein würde. Sie war ein Teil meines Lebens geworden und stand mir näher als alle übrigen. Würde eine neue Gouvernante von der eher traditionellen Art ins Haus kommen, die sich mit Mrs. Harlow und den anderen nicht verstand? Es gab nur eine Felicity auf der Welt, und es war ein Glück für mich gewesen, sie all die Jahre bei mir zu haben. Aber es liegt wenig Trost darin, sich an vergangenes Glück zu erinnern, das einem demnächst entrissen wird, so daß man in eine ungewisse Zukunft blickt.
Etwa drei Wochen vor der Hochzeit riefen meine Eltern mich zu sich. Seit ich meinem Vater im Britischen Museum begegnet war, hatte sich unsere Beziehung leicht verändert. Sie kümmerten sich mehr um mich, und obwohl ich mir immer gesagt hatte, ich sei glücklich ohne ihre Zuwendung, freute es mich jetzt doch ein wenig, daß sie mich mit ihrer Aufmerksamkeit bedachten.
»Rosetta«, sagte meine Mutter, »dein Vater und ich halten die Zeit für gekommen, daß du ein Internat besuchst.«
Das kam natürlich nicht unerwartet. Felicity hatte mit mir darüber gesprochen. »Es ist ziemlich wahrscheinlich«, hatte sie gesagt, »und bestimmt das beste. Gouvernanten sind gut und schön, aber im Internat lernst du Gleichaltrige kennen, und das wirst du genießen.« Ich konnte mir nicht vorstellen, daß ich irgend etwas so genießen würde wie das Zusammensein mit ihr, und dies sagte ich ihr. Sie nahm mich fest in ihre Arme. »In den Ferien kannst du uns besuchen kommen.«
Daran erinnerte ich mich jetzt, und deswegen war ich vorbereitet. »Gresham ist eine sehr gute Schule«, sagte mein Vater. »Sie wurde uns wärmstens empfohlen. Ich denke, sie ist durchaus angemessen.«
»Du wirst im September hingehen«, fuhr meine Mutter fort. »Dann fängt das neue Schuljahr an. Es gilt gewisse Vorbereitungen zu treffen. Und da ist freilich noch Nanny Pollock.« Nanny Pollock! Sie sollte ich also auch verlieren. Eine große Traurigkeit überkam mich. Ich dachte an die liebevollen Arme, die geflüsterten Koseworte, den Trost, der mir zuteil wurde. »Wir werden ihr ein gutes Zeugnis ausstellen«, sagte meine Mutter. »Sie war exzellent«, ergänzte mein Vater.
Veränderungen. Veränderungen allüberall. Und die einzige, die glücklicheren Verhältnissen entgegenging, war Felicity. Alles habe stets sein Gutes, pflegte Mr. Dolland zu sagen. Aber wie ich die Veränderung haßte!
Die Wochen vergingen allzu rasch. Jeden Morgen erwachte ich mit einem beklemmenden Gefühl in der Magengrube. Die Zukunft rückte bedrohlich näher, unbekannt und beängstigend. Ich hatte zu lange in ungestörter Heiterkeit gelebt.
Nanny Pollock war sehr traurig. »So kommt es immer«, sagte sie. »Die Küken bleiben nicht ewig klein. Da sorgst du für sie wie für deine eigenen, und dann kommt der Tag. Sie sind erwachsen geworden. Sie sind nicht mehr deine Babys.«
»Ach Nanny, Nanny. Ich werde dich nie vergessen.«
»Ich dich auch nicht, Herzchen. Ich hatte meine Lieblinge, aber wie die da oben nun mal sind, da warst du mehr als mein kleines Baby, falls du verstehst, was ich meine.«
»Ja, Nanny.«
»Nicht, daß sie grausam wären oder hartherzig, nein, bestimmt nicht. Sie sind bloß irgendwie geistesabwesend, so vertieft in diese komischen Schriften und ihre Bedeutung und diese Könige und Königinnen all die Jahre in ihren Särgen. Ungesund und unnatürlich ist das, ich hab’ nie viel davon gehalten. Kleine Babys sind wichtiger als ‚n Haufen tote Könige und Königinnen und all die Zeichen, die sie gekritzelt haben, weil sie nicht ordentlich schreiben konnten.« Das amüsierte mich, und sie freute sich, mich lächeln zu sehen. Sie wurde ein wenig heiterer. »Ich komm’ schon zurecht«, sagte sie. »Ich hab’ eine Kusine in Somerset. Sie hält ihre eigenen Hühner. Ich mag gerne ein richtig frisches Frühstücksei, am selben Morgen gelegt. Vielleicht geh’ ich zu ihr. Mir ist nicht danach, noch mal eine andere ... aber vielleicht tu’ ich’s doch. Jedenfalls muß ich mir darüber keine Sorgen machen. Deine Mutter sagt, es hat keine Eile. Ich kann hierbleiben, bis ich was finde, das mir zusagt.«
Felicity heiratete in Oxford, wo Professor Wills sie zum Traualtar führte. Ich fuhr mit meinen Eltern zur Hochzeit. Wir tranken auf das Wohl der Neuvermählten, und ich sah Felicity in ihrem erdbeerfarbenen Reisekostüm, das ich mit ihr ausgesucht hatte. Sie sah strahlend aus, und ich sagte mir, ich müsse mich für sie freuen, auch wenn ich mir selbst leid tat.
Als ich nach London zurückkehrte, wollten sie alles über die Hochzeit hören. »Sie muß eine reizende Braut gewesen sein«, sagte Mrs. Harlow. »Hoffentlich ist sie glücklich. Gott segne sie. Sie hat es verdient. Bei diesen Professoren kann man nie wissen. Das sind komische Geschöpfe.«
»Wie Gouvernanten, wie Sie immer gesagt haben«, erinnerte ich sie.
»Nun ja, ich glaube, sie war keine richtige Gouvernante. Sie war was Besonderes.«
Mr. Dolland schlug vor, wir sollten alle auf das Wohl und das Glück des glücklichen Paares trinken. Gesagt, getan. Die Unterhaltung verlief trübsinnig. Nanny Pollock hatte sich fast entschieden, eine Zeitlang zu ihrer Kusine nach Somerset zu ziehen. Sie hatte etwas zuviel Wein getrunken und wurde rührselig. »Gouvernanten, Kindermädchen ... es ist ihr Los. Sie sollten es besser wissen. Sie sollten nicht an den Kindern anderer Leute hängen.«
»Aber wir werden uns nicht verlieren, Nanny«, versicherte ich ihr.
»Nein. Du kommst mich besuchen, nicht wahr?«
»Natürlich.«
»Aber es wird nicht dasselbe sein wie jetzt. Du wirst eine erwachsene junge Dame sein. Die Schule, die verändert einen.«
»Sie ist dazu da, daß sie einen bildet.«
»Es wird nicht dasselbe sein«, beharrte Nanny Pollock und schüttelte betrübt den Kopf.
»Ich weiß, wie Nanny zumute ist«, sagte Mr. Dolland. »Felicity ist fort. Damit hat es angefangen. So ist es immer, wenn sich etwas ändert. Hier ein bißchen, da ein bißchen, und man merkt, daß alles anders wird.«
»Und eh man sich’s versieht«, fügte Mrs. Harlow hinzu, »ist alles wie umgewandelt.«
»Man kann eben im Leben nicht stehenbleiben«, meinte Mr. Dolland philosophisch.
»Ich will nicht, daß sich was ändert«, rief ich. »Ich will, daß wir alle so weiterleben wie bisher. Ich wollte nicht, daß Felicity heiratet. Ich wollte, daß alles bleibt, wie es immer war.«
Mr. Dolland räusperte sich und deklamierte feierlich:
»The Moving Finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.«
Mr. Dolland lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Alles schwieg. Mit seiner üblichen dramatischen Betonung hatte er uns klargemacht, daß dies das Leben war und daß wir alle hinnehmen müssen, was wir nicht ändern können.
Sturm auf See
Als die Zeit gekommen war, fuhr ich ins Internat. Ich war eine Weile unglücklich, gewöhnte mich aber rasch ein. Das Gemeinschaftsleben gefiel mir. Da ich mich schon immer für andere Menschen interessiert hatte, schloß ich bald Freundschaften und beteiligte mich an Schulveranstaltungen.
Felicity hatte mich hinreichend unterrichtet, und ich war weder übermäßig gescheit noch dumm. Ich war guter Durchschnitt, was vielleicht das beste ist, denn es erleichtert einem das Leben. Niemand beneidete mich um meine Kenntnisse, und niemand verachtete mich, weil es mir daran gemangelt hätte. Ich mischte mich bald unter die anderen und wurde ein ganz normales Schulmädchen. Die Tage vergingen rasch. Schulfreuden, -dramen und -triumphe wurden ein Teil meines Lebens. Dennoch dachte ich oft wehmütig an die Mahlzeiten in der Küche zurück, vor allem an Mr. Dollands »Nummern«. Wir hatten in der Schule Theaterkurse und führten in der Turnhalle Stücke auf. Ich spielte den Bassanio in Der Kaufmann von Venedig und heimste einen bescheidenen Erfolg ein, der sicher dem Umstand zu verdanken war, daß ich viel bei Mr. Dolland abgeschaut hatte.
Dann kamen die Ferien. Nanny Pollock hatte sich endgültig entschieden, nach Somerset zu ziehen, und ich verbrachte eine Woche bei ihr und ihrer Kusine. Nanny hatte sich an das Landleben gewöhnt, und ein Jahr, nachdem sie Bloomsbury verlassen hatte, brachte der Tod einer entfernten Verwandten wieder völlige Zufriedenheit in ihr Leben. Die Verstorbene, eine junge Frau, hinterließ ein zweijähriges Kind, und die Verwandten waren ratlos, wer sich des Waisenkinds annehmen solle. Das war eine gottgesegnete Gelegenheit für Nanny Pollock; ein Kind, das sie umsorgen und zu ihrem eigenen machen konnte und das ihr nicht entrissen werden würde wie die Kinder anderer Leute.
Zu Hause wurde nun von mir erwartet, daß ich die Mahlzeiten mit meinen Eltern einnahm, und wenn sich auch mein Verhältnis zu ihnen erheblich verändert hatte, so dachte ich doch sehnsüchtig an die Mahlzeiten in der Küche zurück. Aber wenn meine Eltern außerhalb Londons Forschungen betrieben oder Vorträge hielten, konnte ich den alten Brauch Wiederaufleben lassen.
Natürlich vermißten wir Felicity und Nanny Pollock, aber Mr. Dolland war wie immer glänzend in Form, und Mrs. Harlows Bemerkungen hatten die Würze der alten Zeiten bewahrt. Und ich besuchte natürlich Felicity, die sich jedesmal freute, mich zu sehen. Sie war sehr glücklich. Sie hatte ein Baby namens James und widmete sich voller Begeisterung der Aufgabe, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein. Eine gute Gastgeberin war sie auch. Für einen Mann in James’ Position war es unumgänglich, ab und zu Gäste zu haben, daher hatte sie es lernen müssen. Da ich nun fast erwachsen war, konnte ich an ihren Abendgesellschaften teilnehmen und stellte fest, daß ich sie genoß.
Bei einem solchen Anlaß machte ich die Bekanntschaft von Lucas Lorimer. Felicity hatte mir schon von ihm erzählt. »Übrigens«, sagte sie, »Lucas Lorimer kommt heute abend. Er wird dir gefallen. Die meisten Leute mögen ihn. Er ist charmant, sieht recht gut aus und versteht es, jedem das Gefühl zu geben, ungeheuer interessant zu sein. Du weißt, was ich meine. Laß dich nicht täuschen. So ist er zu allen. Er ist eine ziemlich rastlose Natur, nehme ich an. Er war eine Zeitlang beim Militär, hat aber seinen Abschied genommen. Sein älterer Bruder Carleton hat kürzlich das Gut in Cornwall geerbt. Es ist recht ansehnlich, glaube ich. Der Vater ist erst vor ein paar Monaten gestorben, und Lucas weiß nicht recht, was nun werden soll. Auf dem Gut gibt es viel zu tun, aber er ist ein Charakter, der das Heft lieber selbst in der Hand hätte. Er ist im Moment ein bißchen unsicher, was er anfangen soll. Vor ein paar Jahren fand er im Garten von Trecorn Manor – so heißt das Gut in Cornwall – ein Amulett, eine Art Relikt. Der Fund verursachte einige Aufregung. Es war etwas Ägyptisches, und man steht vor einem Rätsel, wie es dahin gekommen ist. Dein Vater ist damit befaßt.«
»Ich nehme an, es ist mit Hieroglyphen bedeckt.«
»Daran müssen sie seine Herkunft erkannt haben.« Sie lachte. »Lucas hat seinerzeit ein Buch darüber geschrieben. Sein Interesse war geweckt, und er hat ein wenig nachgeforscht. Er fand heraus, daß es ein Orden für militärische Verdienste war, und das führte ihn zu alten ägyptischen Bräuchen. Er stieß auf welche, von denen man noch nie gehört hatte. Ein, zwei Leute wie dein Vater haben sich für das Buch interessiert. Nun, du wirst ihn ja kennenlernen, dann kannst du dir selbst ein Urteil bilden.«
Ich lernte ihn an jenem Abend kennen. Er war groß, schlank und geschmeidig; seine Lebhaftigkeit sprang einem sofort ins Auge. »Das ist Rosetta Cranleigh«, stellte Felicity mich vor.
»Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen.« Er nahm meine Hände und sah mich an. Felicity hatte recht. Er gab einem das Gefühl, wichtig zu sein, und man hatte das Empfinden, daß seine Worte keine bloße Förmlichkeit seien. Ich war geneigt, ihm trotz Felicitys Warnung zu glauben.
Felicity fuhr fort: »Professor Cranleighs Tochter und eine ehemalige Schülerin von mir. Tatsächlich die einzige, die ich je hatte.«
»Das ist alles so aufregend«, sagte er. »Ich kenne Ihren Vater. Ein ausgezeichneter Mann.«
Felicity überließ uns unserem Geplauder. Die meiste Zeit führte er das Wort. Er erzählte mir, wie hilfreich mein Vater gewesen und wie dankbar er sei, daß der bedeutende Gelehrte ihm so viel Zeit gewidmet habe. Dann bat er mich, von mir zu erzählen. Ich bekannte, daß ich noch zur Schule ging, daß ich die Ferien hier verbrachte und noch ein gutes Jahr vor mir hatte.
»Und was machen Sie dann?«
Ich hob die Schultern.
»Sie werden über kurz oder lang verheiratet sein, dessen bin ich sicher«, sagte er, womit er andeutete, meine Reize seien dergestalt, daß die heiratsfähigen Männer in Wettstreit treten würden, um mich zu erringen.
»Man weiß nie, was kommt.«
»Wie wahr«, bemerkte er, als habe meine banale Äußerung meine Weisheit bewiesen. Felicity hatte recht. Er war bestrebt zu gefallen. Es war ziemlich offensichtlich, nachdem man gewarnt worden war, und dennoch angenehm, wie ich mir gestehen mußte.
Bei Tisch saß ich neben ihm. Man konnte sich ganz zwanglos mit ihm unterhalten. Er erzählte mir von dem Fund im Garten und daß dieser gewissermaßen sein Leben verändert habe. »Meine Familie war stets dem Militär verbunden, und ich hatte mit der Tradition gebrochen. Mein Onkel war Oberst und Regimentskommandeur. Er hielt sich selten in England auf, stets erfüllte er an irgendeinem entlegenen Posten des Empires seine Pflicht. Ich merkte, daß das kein Leben für mich war, und nahm meinen Abschied.«
»Es muß sehr aufregend gewesen sein, dieses Relikt zu finden.«
»O ja. Während meiner Militärzeit war ich eine Weile in Ägypten. Das machte den Fund besonders interessant. Ich sah es einfach da liegen. Die Erde war feucht, und ein Gärtner war gerade damit beschäftigt, etwas zu pflanzen. Der Fund war mit Hieroglyphen bedeckt.«
»Sie hätten den Stein von Rosette gebraucht.«
Er lachte. »Oh, ganz so unlesbar war es nicht. Ihr Vater hat es entziffert.«
»Das freut mich. Ich heiße nach dem Stein.«
»Ich weiß. Felicity hat es mir erzählt. Sie sind sicher sehr stolz darauf.«
»Das war ich einst. Als ich zum erstenmal im Museum war, habe ich ihn voller Staunen betrachtet.«
Er lachte. »Namen sind bedeutsam. Sie werden es nie erraten, wie mein erster Vorname lautet.«
»Sagen Sie’s mir.«
»Hadrian. Stellen Sie sich vor, mit einem solchen Namen befrachtet zu sein. Die Leute würden einen andauernd fragen, wie man mit dem Grenzwall vorankomme. Hadrian Edward Lucas Lorimer. Hadrian kam aus dem genannten Grund nicht in Frage. Edward – es gibt so viele Edwards auf der Welt. Lucas ist nicht so gebräuchlich, also wurde ich Lucas gerufen. Aber ist Ihnen aufgefallen, was meine Initialen ergeben? Das ist sehr ungewöhnlich: HELL, Hölle.«
»Ich bin sicher, das ist höchst unangemessen«, sagte ich lachend.
»Oh, Sie kennen mich nicht. Haben Sie noch einen anderen Namen?«
»Nein. Bloß Rosetta Cranleigh.«
»R. C., Römisch-Catholisch.«
»Nicht annähernd so amüsant wie Ihrer.«
»Ihrer läßt auf große Frömmigkeit schließen, wogegen ich ein Satanssproß sein könnte. Das ist bedeutungsvoll, finden Sie nicht? Der Hinweis auf Menschen in entgegengesetzten Sphären? Ich bin sicher, es betrifft unsere kommende Freundschaft. Sie werden mich vom Pfad des Bösen abbringen und einen guten Einfluß auf mein Leben ausüben. Ich würde gerne denken, daß es diese Bedeutung hat.« Ich lachte, und wir schwiegen eine Weile, dann sagte er: »Sie interessieren sich bestimmt für die Geheimnisse Ägyptens. Als Tochter Ihrer Eltern müssen Sie sich einfach dafür interessieren.«
»Nun ja, mit Maßen. Im Internat hat man nicht viel Zeit, sich mit Dingen zu befassen, die nichts mit der Schule zu tun haben.«
»Ich wüßte gerne, was die Worte auf meinem Stein wirklich bedeuten.«
»Ich dachte, man hat sie Ihnen entziffert.«
»Das schon, gewissermaßen. Diese Dinge sind alle so rätselhaft. Die Bedeutung ist in Worte gekleidet, die nicht ganz klar sind.«
»Warum müssen die Menschen sich so unklar ausdrücken?«
»Um ein mysteriöses Element hineinzubringen, meinen Sie nicht? Das steigert das Interesse. Mit den Menschen ist es genauso. Wenn Sie etwas Untergründiges in ihrem Charakter entdecken, finden Sie sie interessanter.« Er lächelte mich an, und seine Augen sagten etwas, das ich nicht verstand. »Irgendwann werden Sie merken, daß ich recht habe«, sagte er.
»Sie meinen, wenn ich älter bin?«
»Ich glaube, es ärgert Sie, wenn man auf Ihre Jugend anspielt.«
»Ja. Ich vermute, es soll mich darauf hinweisen, daß ich vieles noch nicht zu begreifen vermag.«
»Sie sollten Ihre Jugend in vollen Zügen genießen. Die Dichter haben gesagt, sie vergeht viel zu schnell. ›Pflücke die Rose, eh sie verblühte‹ Er lächelte mich mit nahezu zärtlichem Wohlwollen an. Das machte mich etwas nachdenklich, und ich nahm an, daß es ihm auffiel.
Nach dem Essen ging ich mit den Damen hinaus, und als die Herren sich zu uns gesellten, sprach ich nicht wieder mit ihm. Später fragte mich Felicity, wie er mir gefallen habe. »Ihr habt euch offenbar sehr gut verstanden«, meinte sie.
»Ich glaube, er gehört zu denen, die sich mit jedermann gut verstehen ... oberflächlich.«
Sie zögerte eine Sekunde, bevor sie sagte: »Ja, du hast recht.«
Später kam es mir bedeutsam vor, daß mir von diesem Besuch die Begegnung mit Hadrian Edward Lucas Lorimer am deutlichsten in Erinnerung geblieben war.
Als ich in den Weihnachtsferien nach Hause kam, erschienen mir meine Eltern lebhafter als sonst, ja geradezu erregt. Ich konnte mir nur eines denken, was eine solche Wirkung auf sie ausübte: eine neue Erkenntnis. Ein Durchbruch im Verständnis ihrer Arbeit? Ein neuer Stein, der den von Rosette ersetzte?
Es war nichts dergleichen. Sie wünschten mich unverzüglich zu sprechen. »Es hat sich etwas sehr Interessantes ergeben«, sagte meine Mutter. Mein Vater lächelte mich nachsichtig an. »Und«, setzte er hinzu, »es betrifft dich.« Ich war verblüfft. »Laß es dir erklären«, sagte meine Mutter. »Wir sind auf eine hochinteressante Vortragsreise eingeladen. Sie führt uns nach Kapstadt und auf dem Rückweg nach Baltimore und New York.«
»So? Dann werdet ihr lange fort sein.«
»Deine Mutter schlug vor, die Arbeit mit Ferien zu verbinden«, sagte mein Vater.
»Er hat in letzter Zeit viel zu schwer gearbeitet. Natürlich wollen wir nicht ganz untätig sein. Er kann an seinem neuen Buch arbeiten ...«
»Natürlich«, murmelte ich.
»Wir planen, mit dem Schiff nach Kapstadt zu fahren ... eine lange Seereise. Wir werden uns dort ein paar Tage aufhalten, wenn dein Vater seinen Vortrag hält. Das Schiff fährt unterdessen weiter nach Durban, und wenn es nach Kapstadt zurückkehrt, gehen wir wieder an Bord. Es legt in Baltimore an, wo wir es abermals verlassen werden – für einen weiteren Vortrag –, danach fahren wir über Land nach New York, wo dein Vater seinen letzten Vortrag halten wird, und dann nehmen wir ein anderes Schiff nach Hause.«
»Das klingt aufregend.«
Es entstand eine kurze Pause. Mein Vater sah meine Mutter an und sagte: »Wir haben beschlossen, dich mitzunehmen.«
Ich war zu verblüfft, um gleich zu antworten. Dann stammelte ich:
»Ist das ... ist das wirklich euer Ernst?«
»Es wird dir guttun, etwas von der Welt zu sehen«, sagte mein Vater gütig.
»Wann, wann?« fragte ich.
»Wir brechen Ende April auf. Es gilt eine Menge Vorbereitungen zu treffen.«
»Da bin ich noch in der Schule.«