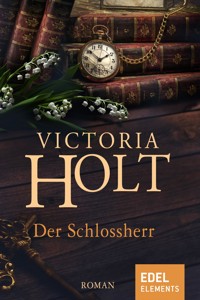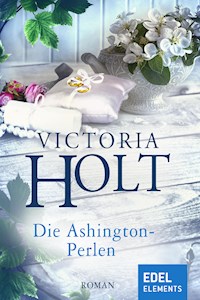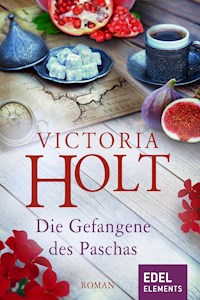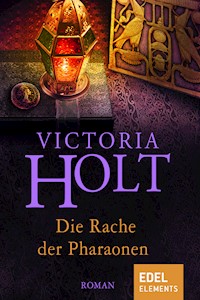4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 18jährige Minella Maddock fristet ihr Dasein als Lehrerin adeliger Töchter im England des 18. Jahrhunderts. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie eines Tages dem französischen Grafen Fontaine Delibes begegnet, der eine geradezu teuflische Faszination auf sie ausübt. Wird Minella dem "Teufel zu Pferde" verfallen? Virtuos mixt Victoria Holt die Zutaten für diesen großangelegten Spannungsroman im historischen Gewand: Romantik und Spannung, Liebe und Hass, Leben und Tod bilden die Pole dieses aufregenden Romans: die gefährliche Leidenschaft einer jungen Frau für einen Mann, der sie unwiderstehlich anzieht – und dem sie niemals vertrauen darf!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Der Teufel zu Pferde
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Gut Derringham
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zwischenstation in Petit Montlys
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Château Silvaine
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Die wartende Stadt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Château Grasseville
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Das Regime des Schreckens
Kapitel 1
Kapitel 2
Und nachher ...
Gut Derringham
1
Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die mich zum Château Silvaine führte. Mein Vater war Kapitän zur See gewesen und war mit seinem Schiff untergegangen, als ich fünf Jahre alt war, und meine Mutter, all ihr Leben an hinlänglichen Komfort gewöhnt, sah sich nun gezwungen, den Unterhalt für sich und ihre Tochter selbst zu verdienen. Eine Frau ohne einen Pfennig Geld, so pflegte meine Mutter zu sagen, müsse sich entweder mittels ihres Scheuertuches oder ihrer Nähnadel ernähren, es sei denn, sie verfüge über eine gewisse Bildung, die sich zu solchem Behufe verwenden ließe. Da meine Mutter zu dieser Kategorie von Frauen gehörte, standen ihr zwei Wege offen: Sie konnte entweder junge Menschen unterrichten oder den älteren als Gesellschafterin dienen. Sie wählte die erstere dieser Möglichkeiten. Sie war eine Frau von starkem Charakter und zum Erfolg entschlossen. Mit den äußerst geringen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, mietete sie ein kleines, auf dem Grundbesitz von Sir John Derringham gelegenes Häuschen in Sussex und gründete dort eine Schule für junge Mädchen. Wenn diese auch anfangs noch nicht recht florierte, so reichten die Einkünfte doch aus, uns während der Anfangsjahre mit allem, was zum Leben nötig war, zu versorgen. Als Schülerin meiner Mutter hatte ich eine ausgezeichnete Erziehung genossen – als Gegenleistung sollte ich sie, das stand von Anfang an fest, als Lehrerin unterstützen, und das hatte ich während der letzten drei Monate auch getan.
»Du dürftest hier dein gutes Auskommen finden, Minella«, pflegte meine Mutter zu sagen.
Sie hatte mich nach sich selbst Wilhelmina genannt. Der Name paßte zu ihr, aber ich war nie der Meinung, daß er mir ebensogut zu Gesicht stand. Als Baby hatte man mich Minella gerufen, und diesen Namen hatte ich beibehalten.
Ich glaube, den größten Vorteil an der Schule sah meine Mutter in der Tatsache, daß sie meine Zukunft sicherte. Ihre Hauptsorge war stets gewesen, daß wir keine Familie im Hintergrund hatten, die mir im Notfall hätte beistehen können. Meine Mutter und ich waren ganz auf uns selbst angewiesen. Die Derringham-Mädchen Sybil und Maria besuchten unsere Schule, und das führte dazu, daß auch andere Familien ihre Töchter zu uns schickten. Das ersparte ihnen eine Gouvernante im Haus, pflegten sie zu sagen. Wenn Logiergäste ihre Kinder mit nach Derringham brachten, so wurden auch sie vorübergehend in unsere Schule aufgenommen. Zusätzlich zu den drei Grundfächern lehrte meine Mutter auch Umgangsformen und gab Anstands-, Tanz- und Französischunterricht, was in der Tat sehr ungewöhnlich war.
Sir John, ein großzügiger und gütiger Mann, war eifrig bedacht, einer Frau wie meiner Mutter, die er bewunderte, behilflich zu sein. Er besaß ausgedehnte Ländereien, von einem schmalen, doch wunderschönen Flüßchen bewässert, in welchem sich Forellen tummelten. Viele reiche Leute – darunter gar einige vom Königshof – pflegten auf das Gut zu kommen, um zu fischen, Fasanen zu schießen, zu reiten oder zu jagen. Dies waren wichtige Zeiten für uns, da sich der Ruf von der Schule meiner Mutter in den Kreisen Sir Johns verbreitet hatte. Diejenigen Familien, die sich nicht von ihren Kindern trennen wollten, brachten sie mit, und da die Schule meiner Mutter von Sir John wärmstens empfohlen wurde, machten sie mit Vergnügen Gebrauch davon. Diese Kinder, die nur für kurze Zeit zu uns kamen, waren, wie meine Mutter in ihrer unumwundenen Art zu sagen pflegte, der Belag auf unserem Brot. Wir konnten zwar von den langfristigen Schülerinnen leben, doch wurden für kurzzeitigen Unterricht natürlich höhere Gebühren erhoben – und deshalb waren uns diese Kinder höchst willkommen. Ich war sicher, daß Sir John dies wußte und daß er deshalb ein solches Vergnügen darin empfand, sie zu uns zu schicken.
Dann kam ein Tag, der sich als bedeutend für mein weiteres Leben herausstellen sollte. Die Familie Fontaine Delibes kam aus Frankreich auf das Gut Derringham. Der Comte Fontaine Delibes war ein Mann, gegen den ich zunächst eine Abneigung hegte. Er wirkte nicht nur hochmütig und arrogant, sondern schien sich von allen anderen menschlichen Lebewesen zu distanzieren, indem er sich ihnen in jeder Hinsicht überlegen fühlte. Die Comtesse war anders geartet, doch sie bekam man kaum zu Gesicht. In ihrer Jugend mußte sie sehr schön gewesen sein – nicht daß sie jetzt alt gewesen wäre, aber in meiner Unreife hielt ich jeden für alt, der über dreißig war. Margot war zu dieser Zeit sechzehn Jahre alt, ich war achtzehn. Später hörte ich, daß Margot ein Jahr nach der Vermählung des Comte und der Comtesse, als diese selbst erst siebzehn Jahre alt war, geboren wurde. Über diese Ehe erfuhr ich eine ganze Menge von Margot, die natürlich auf den Rat des gütigen Sir John auf unsere Schule geschickt wurde.
Margot und ich fühlten uns von Anbeginn zueinander hingezogen. Das mag wohl auch an der Tatsache gelegen haben, daß ich einen natürlichen Hang zu Sprachen besaß und mit ihr Französisch plaudern konnte – ungezwungener selbst als mit meiner Mutter oder mit Sybil und Maria, deren sprachliche Fortschritte, wie meine Mutter sich ausdrückte, eher einer Schildkröte als einem Hasen glichen.
Aus unseren Unterhaltungen gewann ich den Eindruck, daß Margot nicht sicher war, ob sie ihren Vater liebte oder haßte. Sie gestand, daß sie sich vor ihm fürchtete. Er regierte sein Hauswesen in Frankreich sowie die angrenzenden Ländereien (welche er zu besitzen schien) wie ein Feudalherr aus dem Mittelalter. Jedermann erzitterte in Ehrfurcht vor ihm. Zeitweise konnte er wohl auch recht heiter und großzügig sein, sein hervorstechendster Charakterzug war jedoch seine Unberechenbarkeit. Margot erzählte mir, daß er an einem Tag einen Diener auspeitschen lassen konnte, um ihm tags darauf einen Beutel voller Geld zuzustecken. Diese beiden Begebenheiten aber hätten nichts miteinander zu tun. Der Comte empfand niemals Bedauern über eine Grausamkeit – oder jedenfalls nur selten –, und seine Äußerungen von Güte entsprangen keineswegs der Reue. »Nur einmal«, deutete Margot geheimnisvoll an, doch als ich sie vorsichtig auszuhorchen versuchte, wollte sie weiter nichts dazu sagen. Mit einem gewissen Stolz fügte sie jedoch hinzu, daß man ihren Vater (natürlich nur hinter seinem Rücken) als Le Diable bezeichnete.
Auf eine finstere, satanische Art sah er sehr gut aus. Seine Erscheinung entsprach durchaus dem, was ich über ihn gehört hatte. Ich erblickte ihn erstmals in der Nähe der Schule. Auf einem Rappen sitzend, ähnelte er wirklich einer Sagengestalt. Der Teufel zu Pferde, so nannte ich ihn sogleich, und mit diesem Namen bedachte ich ihn lange Zeit. Er war prachtvoll gekleidet. Die Franzosen waren natürlich von unübertroffener Eleganz, und obgleich Sir John der Welt eine tadellose Erscheinung bot, hielt er einem Vergleich mit »Graf Satan« nicht stand. Die Halskrause dieses Teufels bestand aus einem Geriesel erlesener Spitzen, ebenso die Rüschen an seinen Handgelenken. Sein Rock war von flaschengrüner Farbe, desgleichen sein Reiterhut. Er trug eine Perücke aus glattem weißem Haar, und zwischen den Spitzen um seinen Hals glitzerten diskret Diamanten auf. Er bemerkte mich nicht, so daß ich stehenbleiben und ihn anstarren konnte.
Natürlich war meine Mutter nie auf Gut Derringham zu Gast. Selbst dem vorurteilslosen Sir John wäre es nicht im Traum eingefallen, eine Schulmeisterin in sein Haus einzuladen, und obgleich er uns stets höflich und zuvorkommend behandelte (was seiner Natur entsprach), betrachtete man uns selbstverständlich nicht als sozial gleichgestellt.
Nichtsdestotrotz wurde meine Freundschaft mit Margot gefördert, weil diese Beziehung als vorteilhaft für ihr Englisch angesehen wurde, und als ihre Eltern nach Frankreich zurückkehrten, blieb Margot hier, um ihre Kenntnisse unserer Sprache zu vervollkommnen. Dies erfreute meine Mutter, durfte sie dadurch doch eine ihrer besser zahlenden Schülerinnen über einen längeren Zeitraum als üblich behalten. Margots Eltern – vor allem aber ihr Vater – statteten dem Gut hier und da einen kurzen Besuch ab, und es war bei einer solchen Gelegenheit, daß folgendes geschah:
Margot und ich waren ständig beisammen, und als Gegenleistung, obgleich dies durchaus nicht als üblich angesehen wurde, lud man mich eines Tages auf das Gut zum Tee ein, damit ich dort ein paar Stunden mit unseren Schülerinnen verbringe. Meine Mutter war hocherfreut. Als die Schule am Tag vor der Visite zu Ende war, wusch und bügelte sie das einzige Gewand, das nach ihrer Ansicht für diese Gelegenheit in Frage kam – eine blaue Leinenrobe, mit leidlich feiner Spitze umsäumt, die einst meiner Großmutter väterlicherseits gehört hatte. Während sie bügelte, schnurrte meine Mutter gleichsam vor Stolz in dem sicheren Gefühl, daß ihre Tochter ihren Platz unter den Mächtigen mit Leichtigkeit behaupten konnte. Wußte sie etwa nicht genau, was sich geziemte? War sie etwa nicht so gebildet, daß sie sich den Hochgestellten ebenbürtig erweisen konnte? Wußte sie nicht mehr für ihr Alter als irgend jemand unter ihnen? (Allerdings.) War sie nicht hübsch und gut gekleidet? (Ich fürchtete, dies entsprang ihrem Mutterstolz und entsprach keineswegs den Tatsachen.)
Gerüstet mit dem Vertrauen meiner Mutter und mit meiner Entschlossenheit, sie nicht zu blamieren, machte ich mich auf den Weg. Während ich durch den Tannenwald schritt, empfand ich keinerlei übermäßige Erregung. Ich war mit Sybil, Maria und Margot in der Schule so oft zusammen gewesen, daß ich an ihre Gesellschaft gewöhnt war. Nur der Schauplatz würde ein anderer sein. Doch als ich aus dem Wald hervortrat und hinter dem üppigen Rasen das Haus aufragen sah, konnte ich mich, da ich es nun bald betreten sollte, eines Gefühls der Vorfreude nicht erwehren. Graue Steinmauern, durch Pfosten unterteilte Fenster. Von dem ursprünglichen Gebäude hatten Cromwells Mannen nur die Außenmauern übriggelassen. Nach der Restauration hat man den Originalzustand mehr oder weniger wiederhergestellt. Daniel Derringham, der für die Sache des Königs gekämpft hatte, wurde dafür mit dem Barontitel und mit Ländereien entlohnt.
Ein steinerner Pfad führte quer über den Rasen, auf dem ein paar uralte Eiben wuchsen, welche die Puritaner überlebt haben mußten, da man ihnen ein Alter von zweihundert Jahren zuschrieb. In der Mitte einer der Rasenflächen befand sich eine Sonnenuhr, und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, das Gras zu überqueren, um sie mir anzuschauen. Eine sorgfältig eingemeißelte Inschrift, von der Zeit fast ausgelöscht, war sehr schwer zu entziffern.
»Genieße jede Stunde«, konnte ich lesen, doch der Rest der Schrift war von grünem Moos bedeckt. Ich rieb es mit meinem Finger ab und betrachtete dann bestürzt den grünen Fleck darauf. Meine Mutter würde mich dafür tadeln. Wie anders als makellos konnte ich auf Gut Derringham erscheinen!
»Das ist schwierig zu lesen, nicht wahr?«
Ich drehte mich erschrocken um. Hinter mir stand Joel Derringham. Ich war so in die Betrachtung der Sonnenuhr vertieft gewesen, daß ich sein Näherkommen auf dem weichen Gras nicht bemerkt hatte.
»Es ist soviel Moos über die Worte gewachsen«, entgegnete ich. Ich hatte zuvor kaum mit Joel Derringham gesprochen. Er war der einzige Sohn, etwa einundzwanzig Jahre alt. Er sah Sir John schon jetzt sehr ähnlich und würde genau wie er aussehen, wenn er in sein Alter käme. Er hatte das gleiche hellbraune Haar und die gleichen blaßblauen Augen, die nämliche Adlernase und den gütigen Mund. Wenn ich über Sir John und seinen Sohn nachdenke, kommt mir das Attribut »liebenswürdig« in den Sinn. Sie waren gütig und teilnahmsvoll, ohne Schwäche zu zeigen, und wenn ich es recht überlege, dann ist dies wohl das größte Kompliment, das ein menschliches Wesen einem anderen machen kann.
Joel lächelte mir zu. »Ich kann Ihnen sagen, was da steht:
›Genieße jede Stunde, Verweile nicht im Gestern. Koste aus jeden Tag, Es kann dein letzter sein.‹«
»Eine ziemlich traurige Mahnung«, sagte ich. »Aber ein vernünftiger Rat.«
»Ja, das mag wohl stimmen.« Mir schien, daß ich meine Anwesenheit erklären müßte. »Ich bin Wilhelmina Maddox«, fuhr ich daher fort, »und ich bin zum Tee eingeladen.«
»Ich weiß natürlich, wer Sie sind«, sagte er. »Erlauben Sie, daß ich Sie zu meinen Schwestern bringe.«
»Danke, gern.«
»Ich habe Sie in der Nähe der Schule gesehen«, fügte er hinzu, während wir über den Rasen schritten. »Mein Vater betont oft, welchen Wert die Schule für unsere Umgebung hat.«
»Es ist erfreulich, auch noch von Nutzen zu sein, während man sich seinen Lebensunterhalt verdient.«
»Oh, da stimme ich Ihnen zu, Fräulein ... hm ... Wilhelmina. Wenn Sie erlauben, der Name ist etwas zu steif für Sie.«
»Man nennt mich Minella.«
»Das klingt schon besser, Fräulein Minella, viel besser.«
Wir waren beim Haus angelangt. Die schwere Pforte stand angelehnt. Er stieß sie weit auf, und wir gingen in die Halle. Die hohen Fenster, der gepflasterte Boden, die wunderbar gewölbte Balkendecke – das alles entzückte mich. In der Mitte befand sich ein großer eichener Eßtisch mit Zinntellern und Pokalen. An den steinernen Wänden mit den herausgemeißelten Sitzbänken hingen Rüstungen. Die Stühle waren karolingisch, und ein riesengroßes Porträt von Charles IL beherrschte die Halle. Ich verweilte einige Sekunden, um die ernsten und sinnlichen Gesichtszüge zu betrachten, die ohne die belustigten Augen und den milden Schwung der Lippen vielleicht grob zu nennen gewesen wären.
»Der Wohltäter der Familie«, sagte Joel Derringham. »Ein wundervolles Porträt.«
»Eine persönliche Gabe des Monarchen, nachdem er bei uns zu Gast war.«
»Sie hängen gewiß sehr an Ihrem Heim.«
»Nun, das ist wohl wahr. Das kommt daher, daß die Familie all die Jahre hindurch hier gelebt hat. Wenn es während der Restauration auch fast gänzlich neu erbaut wurde, stammen doch Teile des Hauses noch aus der Zeit der Plantagenet.«
Neid gehört nicht zu meinen Untugenden, aber jetzt regte er sich doch in mir. Einem solchen Haus, einer solchen Familie anzugehören, das mußte einem doch ein mächtig stolzes Gefühl verleihen. Für Joel Derringham war das alles selbstverständlich. Ich bezweifle, daß er dieser Tatsache viele Gedanken widmete. Er hatte es wohl stets als gegeben akzeptiert, in diesem Haus geboren zu sein und es eines Tages auch zu erben. Er war schließlich der einzige Sohn und infolgedessen der unangefochtene Erbe. »Ich nehme an«, äußerte ich impulsiv, »das ist es, was man als ›mit einem Silberlöffel im Mund geboren‹ bezeichnet.« Er machte ein betroffenes Gesicht, und mir wurde klar, daß ich meinen Gedanken in einer Weise Ausdruck verlieh, welche meine Mutter gewiß nicht gebilligt hätte.
»Dies alles hier«, sagte ich, »gehört Ihnen ..., vom Tag Ihrer Geburt an ..., einfach, weil Sie hier geboren sind. Was haben Sie für ein Glück gehabt! Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer der Hütten auf Ihren Gütern geboren!«
»Aber mit anderen Eltern wäre ich doch nicht ich selbst«, hielt er mir entgegen.
»Angenommen, zwei Babys wären vertauscht worden, und eines aus der Hütte wäre als Joel Derringham aufgewachsen, Sie dagegen als das Hüttenkind. Würde jemand den Unterschied merken, wenn sie erwachsen wären?«
»Ich glaube, ich bin meinem Vater sehr ähnlich.«
»Aber nur, weil Sie hier groß geworden sind.«
»Ich sehe aus wie er.«
»Ja, das stimmt ...«
»Umgebung ..., Geburt ..., was mag das bewirken? Die Gelehrten setzen sich seit Jahren mit dieser Frage auseinander. Diese Frage kann man nicht in ein paar Augenblicken beantworten.«
»Ich fürchte, ich habe mich ziemlich ungehörig betragen. Ich habe laut gedacht.«
»Aber nicht doch. Es ist eine interessante Theorie.«
»Das Haus hat mich überwältigt.«
»Ich freue mich, daß es einen derartigen Eindruck auf Sie gemacht hat. Sie haben seine altehrwürdige Vergangenheit gespürt ..., die Geister meiner verstorbenen Ahnen.«
»Ich kann nur sagen, daß es mir leid tut.«
»Aber warum? Ihre Offenheit gefällt mir. Darf ich Sie jetzt hinaufbegleiten? Sie werden gewiß bereits erwartet.«
Von der Halle führte eine Treppe nach oben. Wir gingen hinauf und kamen zu einer mit Porträts behangenen Galerie. Dann erklommen wir eine Wendeltreppe bis zu einem Absatz, auf den mehrere Türen hinausgingen. Joel öffnete eine davon, und sogleich hörte ich Sybils Stimme. »Sie ist da. Komm herein, Minella. Wir warten schon.«
Der Raum war ein sogenanntes Solarium, so konstruiert, daß die Sonne voll hereinschien. An einem Ende befand sich eine Stickerei auf einem Rahmen, an der, wie ich herausfand, Lady Derringham arbeitete. Am anderen Ende des Raumes gab es ein Spinnrad. Ich fragte mich, ob es wohl von irgend jemandem benutzt wurde. In der Mitte stand ein großer Tisch, auf dem eine Handarbeit lag. Später erfuhr ich, daß die Mädchen in diesem Zimmer daran arbeiteten. Ein Cembalo und ein Spinett waren auch vorhanden, und ich konnte mir ausmalen, wie anders das Zimmer aussehen würde, wenn man es zum Tanzen ausräumte. Ich stellte mir die in den Leuchtern flackernden Kerzen und die Damen und Herren in ihren kostbaren Gewändern vor. Margot rief in ihrem akzentuierten Englisch: »Steh doch nicht so glotzäugig herum, Minelle!« Sie übertrug unsere Namen stets in ihre Muttersprache. »Hast du noch nie ein Sonnenzimmer gesehen?«
»Ich vermute«, meinte Maria, »daß Minella hier einen großen Unterschied im Vergleich zu ihrem Schulhaus feststellt.«
Maria meinte es gut, doch in ihrer Nettigkeit war oft ein Stachel herauszuspüren. Sie war die affektiertere der Derringham-Schwestern.
Joel sagte: »Ich lasse euch Mädchen jetzt wohl besser allein. Auf Wiedersehen, Fräulein Maddox.«
Als sich die Tür hinter ihm schloß, fragte Maria: »Wo hast du Joel getroffen?«
»Auf dem Weg zum Haus. Er hat mich hierher begleitet.«
»Joel meint stets, er müsse aller Welt helfen«, bemerkte Maria. »Er würde selbst einem Küchenmädchen den Korb tragen helfen, wenn er fände, daß er zu schwer für sie sei. Mama findet, das sei entwürdigend, und dieser Meinung bin ich auch. Joel sollte es wirklich besser wissen.«
»Und mit seiner aristokratischen Nase auf die Lehrerin herabblicken«, ergänzte ich spitz, »denn schließlich steht sie so tief unter ihm, daß es ein Wunder ist, daß er sie überhaupt bemerkt.«
Margot lachte kreischend auf. »Bravo, Minelle!« rief sie. »Und wenn Joel es besser wissen sollte, dann solltest du es auch, Marie. Kreuze deine Klinge nie ..., sagt man so?« Ich nickte. »Kreuze deine Klinge nie mit Minelle, denn sie wird dich immer schlagen, und ist sie auch die Tochter der Schulmeisterin, und du bist die des Gutsbesitzers ... was besagt das schon. Die Klügere ist sie.«
»O Margot«, rief ich aus, »du bist zu komisch.« Doch ich wußte, daß mein Tonfall ihr dafür dankte, daß sie mir zu Hilfe gekommen war.
»Da du jetzt hier bist, werde ich nach dem Tee läuten«, ließ sich Sybil vernehmen, die sich ihrer Pflichten als Gastgeberin erinnerte. »Er wird im Studierzimmer serviert.«
Während wir uns unterhielten, schaute ich mich um, nahm meine Umgebung in mich auf und dachte daran, wie angenehm meine Begegnung mit Joel Derringham gewesen und wieviel liebenswürdiger er war als seine Schwestern.
Der Tee wurde, wie Sybil gesagt hatte, im Studierzimmer serviert. Es gab dünngeschnittene Butterbrote, Kirschkuchen und kleine runde Kümmelbrötchen dazu. Ein Diener stand untätig herum, während Sybil den Tee einschenkte. Anfangs waren wir ein wenig förmlich, aber bald schon plapperten wir drauflos wie in der Schule; denn obwohl ich seit kurzem die Rolle der Lehrerin übernommen hatte, war ich doch vor nicht allzu langer Zeit eine Schülerin wie sie gewesen.
Margot verblüffte mich mit dem Vorschlag, Verstecken zu spielen, denn das war höchst kindisch. Sie hielt sich doch sonst soviel auf ihre Weltgewandtheit zugute.
»Immer schlägst du dieses alberne Spiel vor«, klagte Sybil, »und dann verschwindest du, und wir können dich nirgendwo finden.«
Margot zog die Schultern hoch. »Es amüsiert mich eben«, sagte sie.
Die Derringham-Mädchen schwiegen resigniert. Ich vermute, man hatte ihnen beigebracht, daß sie ihren Gast zu unterhalten hätten.
Margot wies auf den Fußboden. »Da unten haben wohl jetzt alle ihren Mittagsschlaf beendet und trinken im Malzimmer ihren Tee. Das Spiel macht mir Spaß. Obwohl es abends noch lustiger ist, wenn die Gespenster in der Dunkelheit erscheinen.«
»Es gibt keine Gespenster«, widersprach Maria entschieden. »O doch, Marie«, neckte Margot sie. »Hier spukt doch diese Dienstmagd herum, die sich erhängt hat, weil der Mundschenk sie verlassen hatte. Nur du siehst sie nicht. Wie sagt man bei euch? Sie weiß, wo sie ihren Platz hat.«
Maria murmelte errötend: »Margot schwätzt immer solchen Unsinn.«
»Laßt uns doch Verstecken spielen«, bettelte Margot.
»Das ist Minella gegenüber nicht fair«, protestierte Sybil. »Sie kennt das Haus doch noch gar nicht.«
»Oh, aber wir wollen doch nur hier oben spielen. Man würde es uns gewiß übelnehmen, wenn wir den Gästen unten in die Arme liefen. Ich werde mich jetzt verstecken.«
Die Vorfreude ließ Margots Augen funkeln, was mich erstaunte. Doch der Gedanke, das Haus zu erforschen, auch wenn man sich auf das oberste Geschoß beschränken mußte, erregte mich so sehr, daß ich meine Überraschung über Margots unerwartete Kindlichkeit beiseite schob. Eigentlich war Margot unberechenbar, und schließlich war sie wirklich noch nicht so alt.
Maria grollte. »So ein albernes Spiel. Ich frage mich, warum sie es so gerne mag. Ratespiele wären weit angenehmer. Ich möchte wissen, wohin sie läuft. Wir finden sie nie. Und immer muß sie diejenige sein, die sich verstecken darf.«
»Vielleicht gelingt es uns diesmal mit Minellas Hilfe, sie zu finden«, sagte Sybil.
Wir verließen das Studierzimmer und begaben uns zu einem Treppenabsatz. Maria öffnete eine Tür, Sybil öffnete eine andere. Ich schloß mich Sybil an. Der Raum, den wir betraten, war als Schlafzimmer eingerichtet. Hier schliefen Maria und Sybil. Zwei halbüberdachte Himmelbetten standen so weit wie möglich voneinander entfernt in separaten Ecken des Zimmers.
Ich trat auf den Treppenabsatz zurück, Maria war nirgends zu sehen, und es überkam mich ein unwiderstehlicher Drang, auf eigene Faust auf die Suche zu gehen. Ich ging in das Solarium zurück. Es kam mir jetzt anders vor, da ich allein dort war. So ist es immer mit großen Häusern: Sie veränderten sich mit der Gegenwart von Menschen, als wären sie selbst lebendig.
Wie sehr verlangte es mich, im Haus umherzuwandern und es zu erforschen! Wie gern hätte ich erfahren, was sich gerade darin abspielte und was sich in der Vergangenheit hier ereignet hatte.
Margot hätte das vielleicht verstanden. Die Derringham-Mädchen dagegen würden es nie verstehen. Sie würden wohl annehmen, die Tochter der Schulmeisterin sei von der Umgebung überwältigt worden.
An Margots kindischen Spielen war ich nicht interessiert. Es war klar, daß sie sich im Sonnenzimmer nicht befand. Ich entdeckte nichts, wo sie sich hätte verstecken können.
Ich hörte Marias Stimme auf dem Treppenabsatz, und flink durchquerte ich den Raum. Im Solarium war mir eine zweite Tür aufgefallen. Ich öffnete sie und stand vor einer Wendeltreppe. Ohne zu zögern, stieg ich hinab. Nach schier endlosen Windungen gelangte ich nach unten. Vor mir erstreckte sich ein breiter Korridor. Schwere Samtportieren hingen an den Fenstern. Ich blickte hinaus. Ich sah den Rasen mit der Sonnenuhr und wußte, daß ich mich im vorderen Flügel des Hauses befand.
An dem Korridor lagen mehrere Türen. Ganz behutsam öffnete ich eine von ihnen. Die Läden in dem Raum waren geschlossen, damit die Sonne nicht hereindrang, und es dauerte ein paar Sekunden, bis meine Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Dann erblickte ich eine schlafende Gestalt auf der Chaiselongue. Es war die Comtesse, Margots Mutter. Rasch und leise schloß ich die Tür. Wenn die Comtesse aufgewacht wäre und mich hier gesehen hätte! Ich wäre sofort in Ungnade gefallen. Meine Mutter wäre gekränkt und enttäuscht, und ich würde nie wieder nach Gut Derringham eingeladen. Aber das würde ich vielleicht ohnehin nicht. Dies war das erste und höchstwahrscheinlich auch das letzte Mal. Also mußte ich es voll ausnutzen. Meine Mutter sagte oft, daß ich um Rechtfertigungen nie verlegen war, wenn ich etwas Fragwürdiges zu tun wünschte. Was für eine Entschuldigung hatte ich aber dafür, daß ich im Haus umherwanderte, aus purer Neugier ..., denn mehr war es doch nicht? Joel Derringham hatte sich gefreut, daß mir das Haus gefiel. Ich war sicher, daß er nichts gegen meinen Forschungsdrang einzuwenden hatte. Sir John gewiß auch nicht. Und dies war vielleicht die einzige Möglichkeit.
Ich ging den Korridor entlang. Zu meiner Freude entdeckte ich eine Tür, die nur angelehnt war. Ich stieß sie ein wenig weiter auf und spähte in das Zimmer. Es glich demjenigen, in welchem die Comtesse auf ihrer Chaiselongue lag, mit Ausnahme eines Himmelbettes mit schweren Vorhängen. Wundervolle Gobelins zierten die Wände.
Ich konnte nicht widerstehen. Auf Zehenspitzen schlich ich hinein.
Mein Herz tat einen erschreckten Sprung, als ich hörte, daß sich die Tür hinter mir schloß. Noch nie im Leben hatte ich solche Angst verspürt. Jemand hatte die Tür hinter mir zugemacht. Ich befand mich in einer unerträglich peinlichen Lage. Meistens hatte ich in derlei Situationen schnell eine Ausrede parat, und gewöhnlich konnte ich mich aus allen Unannehmlichkeiten herauswinden, doch in diesem Augenblick war ich wirklich erschrocken. Wir hatten manchmal von übernatürlichen Dingen gesprochen, und nun kam es mir vor, daß ich solchen gegenüberstand.
Dann sprach eine Stimme hinter mir in akzentuiertem Englisch: »Guten Tag. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen.«
Ich drehte mich heftig um. »Graf Satan« stand mit verschränkten Armen gegen die Tür gelehnt. Seine Augen – sehr dunkel, beinahe schwarz – durchbohrten mich, sein Mund verzog sich zu einem Lächeln, das zu seiner ganzen Erscheinung paßte und das ich nur als diabolisch bezeichnen konnte.
Ich stammelte: »Ich bitte um Verzeihung, daß ich hier eingedrungen bin.«
»Suchen Sie jemanden?« fragte er. »Sicher nicht meine Gemahlin, denn Sie haben sie nach einem Blick in ihr Zimmer verschmäht. Vielleicht halten Sie aber nach mir Ausschau?«
Jetzt fiel mir auf, daß es zwischen den beiden Zimmern eine Verbindung gab. Er mußte sich in dem gleichen Raum befunden haben, in welchem ich die schlafende Comtesse erblickt hatte. Er war rasch in dieses Zimmer gegangen, um mir eine Falle zu stellen, sobald ich eingetreten war.
»Nein, nein«, sagte ich. »Es handelt sich um ein Spiel. Margot hat sich versteckt.«
Er nickte. »Nehmen Sie doch Platz!«
»Nein danke. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Ich wäre wohl besser oben geblieben.«
Mutigen Schrittes ging ich zur Tür, doch er gab sie nicht frei. Ich blieb stehen und blickte ihn hilflos und doch fasziniert an, neugierig, was er wohl tun würde. Da trat er vor und ergriff meinen Arm.
»Sie dürfen nicht so schnell fortgehen«, sagte er. »Da Sie mich nun einmal aufgesucht haben, müssen Sie schon ein Weilchen bleiben.«
Er musterte mich eindringlich, und sein forschender Blick machte mich verlegen.
»Ich glaube aber, ich muß gehen«, sagte ich ungezwungen, so gut ich es konnte. »Ich werde gewiß schon vermißt.«
»Aber Margot hat sich doch versteckt. Man wird sie so schnell nicht finden. Das große Haus bietet viele Möglichkeiten, sich zu verbergen.«
»Oh, man wird sie finden. Sie darf sich ja nur im oberen Stockwerk ...«
Ich brach betreten ab – ich hatte mich verraten.
Er lachte triumphierend auf. »Und was tun Sie dann hier unten, Mademoiselle?«
»Ich bin zum erstenmal in diesem Haus. Ich habe mich verlaufen.«
»Und Sie haben in diese Räume geschaut, um Ihre Orientierung wiederzufinden?«
Ich schwieg. Er schob mich zum Fenster und zog mich zu sich herunter. Ich war ganz nah bei ihm, nahm den schwachen Sandelholzduft des Leinens wahr und sah den großen Siegelring, den er am kleinen Finger seiner rechten Hand trug.
»Sie sollten sich mir vorstellen«, verlangte er.
»Ich bin Minella Maddox.«
»Minella Maddox«, wiederholte er. »Ich weiß, Sie sind die Tochter der Schulmeisterin.«
»Ja. Aber ich hoffe, Sie werden niemandem erzählen, daß ich hierherunter gekommen bin.«
Er nickte ernsthaft. »Sie haben also die Anordnungen mißachtet ...«
»Ich habe mich verirrt«, behauptete ich. »Ich möchte nicht, daß die anderen erfahren, daß ich so töricht war.«
»Sie bitten mich also um einen Gefallen?«
»Ich schlage lediglich vor, daß Sie diese lächerliche Angelegenheit nicht erwähnen.«
»Für mich ist sie nicht lächerlich, Mademoiselle.«
»Ich verstehe Sie nicht, Monsieur le Comte.«
»Sie kennen mich?«
»Jedermann in der Umgebung kennt Sie.«
»Ich wüßte gern, wie gut Sie mich kennen.«
»Ich weiß nur, wer Sie sind, daß Sie Margots Vater sind und daß Sie von Zeit zu Zeit aus Frankreich nach Derringham zu Besuch kommen.«
»Meine Tochter hat von mir erzählt, nicht wahr?«
»Hin und wieder.«
»Sie hat Ihnen wohl viel erzählt von meinen ..., wie sagt man?«
»Lastern, meinen Sie? Wenn Sie lieber Französisch sprechen möchten ...«
»Ich sehe, Sie haben sich bereits eine Meinung über mich gebildet. Ich bin ein Sünder, der Ihre Sprache nicht so gut spricht, wie Sie die meine sprechen.« Er redete sehr schnell auf französisch, in der Hoffnung, das war mir bewußt, daß ich ihn nicht verstehen würde, aber ich hatte einen ausgezeichneten Unterricht gehabt, und außerdem ließ meine Furcht allmählich nach. Zudem konnte ich trotz meiner schwierigen Lage, und obwohl er sicherlich nicht der Mann war, der mich ritterlich daraus befreien würde, eine gewisse Belustigung nicht unterdrücken. Auf französisch erwiderte ich, daß ich glaubte, er habe nach demselben Wort gesucht, das ich genannt hatte, und falls er etwas anderes meine, so möge er es mir auf französisch sagen – ich würde es gewiß verstehen.
»Ich sehe«, sagte er, immer noch sehr schnell sprechend, »daß Sie eine geistreiche junge Dame sind. Wir werden uns also verstehen. Sie suchen meine Tochter Marguerite, die Sie Margot nennen. Sie versteckt sich im oberen Geschoß des Hauses. Sie wissen das, und doch suchen Sie hier unten nach ihr. Ah, Mademoiselle, Sie haben gar nicht nach Marguerite gesucht, sondern es gelüstete Sie, Ihre Neugier zu befriedigen. Kommen Sie, gestehen Sie es!« Er runzelte die Stirn in einer Weise, die ganz sicher dazu angetan war, demjenigen, dem es galt, einen Schrecken einzujagen.
»Ich kann Leute nicht leiden, die mir die Unwahrheit sagen.«
»Nun ja«, lenkte ich ein, entschlossen, mich nicht einschüchtern zu lassen, »dies ist mein erster Besuch in einem derartigen Haus, und ich gebe eine gewisse Neugier durchaus zu.«
»Natürlich, das ist sehr natürlich. Sie haben sehr hübsches Haar, Mademoiselle. Ich würde fast sagen, es hat die Farbe von Korn im August, finden Sie nicht auch?«
»Es gefällt Ihnen, mir zu schmeicheln.«
Mit einer Hand ergriff er eine Strähne meines Haares, das, von meiner Mutter sorgsam gekräuselt, mit einem zu meinem Kleid passenden blauen Band zurückgebunden war.
Obwohl ich mich unbehaglich fühlte, hielt die Belustigung an. Da er an meinen Haaren zog, war ich gezwungen, noch näher an ihn heranzurücken: Ich konnte sein Gesicht ganz deutlich sehen, die Schatten unter den leuchtenden dunklen Augen, die dichten, wohlgeformten Brauen. Noch nie hatte ich einen Mann von solch markantem Äußeren gesehen.
»Und jetzt«, sagte ich, »muß ich gehen.«
»Sie sind hierhergekommen, wann es Ihnen beliebte«, erinnerte er mich, »und ich finde es nur höflich, daß Sie erst gehen, wenn es mir beliebt.«
»Da wir uns um Höflichkeit bemühen, werden Sie mich nicht gegen meinen Willen zurückhalten.«
»Es geht hier nur um die Höflichkeit, die Sie mir schulden. Ich stehe nicht in Ihrer Schuld, vergessen Sie das nicht! Sie sind der Eindringling! Oh, Mademoiselle, in mein Schlafgemach zu spähen! So neugierig zu sein! Schämen Sie sich!«
Seine Augen sprühten. Mir fiel ein, was Margot mir über seine Unberechenbarkeit erzählt hatte. Im Augenblick machte es ihm Spaß. Doch das konnte sich bald ändern.
Mit einem Ruck zog ich meine Haare aus seiner Hand und stand auf.
»Ich bitte für meine Neugier um Verzeihung«, sagte ich. »Es war höchst ungehörig von mir. Sie müssen tun, was Sie in dieser Angelegenheit für angemessen halten. Falls Sie Sir John davon unterrichten möchten ...«
»Ich danke Ihnen für die Erlaubnis«, sagte er. Er trat neben mich, und zu meinem Schrecken legte er seine Arme um mich und drückte mich an sich. Einen Finger unter meinem Kinn, hob er mein Gesicht. »Wenn wir eine Missetat begehen«, fuhr er fort, »müssen wir für unsere Sünden büßen. Dies ist die Buße, die ich verlange.« Damit nahm er mein Gesicht zwischen seine Hände und küßte mich auf die Lippen – nicht einmal, sondern viele Male.
Ich war entsetzt. Nie zuvor war ich auf eine solche Art geküßt worden.
Ich riß mich los und rannte davon.
In meinem Kopf spukte der Gedanke, daß er mich wie eine Dienstmagd behandelt hatte. Ich war empört. Dabei war ich selbst schuld daran.
Ich taumelte aus dem Zimmer, erreichte die Wendeltreppe, und als ich emporzusteigen begann, vernahm ich hinter mir eine Bewegung. Einen Augenblick lang dachte ich, der Comte verfolge mich, und ich war starr vor Schreck. Es war jedoch Margot, die mich fragte: »Was tust du hier unten, Minelle?«
Ich drehte mich um. Ihr Gesicht war gerötet, und ihre Augen flackerten.
»Wo bist du gewesen?« wollte ich wissen.
»Wo warst du?« Sie legte die Finger auf die Lippen. »Komm, laß uns nach oben gehen.«
Wir stiegen die Treppe hinauf. Oben angekommen, wandte sich Margot nach mir um und lachte. Zusammen betraten wir das Solarium.
Maria und Sybil waren bereits dort. »Minelle hat mich gefunden«, sagte Margot. »Wo?« verlangte Sybil zu wissen.
»Glaubt ihr, das verrate ich?« gab Margot zurück. »Vielleicht möchte ich mich dort noch einmal verstecken.«
So fing es an. Er war auf mich aufmerksam geworden, und ich sollte ihn sicherlich nicht so schnell vergessen. Den ganzen Rest des Nachmittags ging er mir nicht mehr aus dem Sinn. Während wir bei einem Ratespiel im Sonnenzimmer saßen, erwartete ich ständig, daß er hereinkäme und mich denunzierte. Aber es war wahrscheinlicher, so glaubte ich, daß er Sir John davon unterrichtet hatte. Mir war ganz unbehaglich bei dem Gedanken an die Art, wie er mich geküßt hatte. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Ich wußte, daß meine Mutter dauernd darum besorgt war, daß ich tugendhaft bleibe und eine gute Ehe eingehe. Sie wollte das Beste für mich. Ein Arzt wäre als Ehemann angemessen, hatte sie einmal gesagt, aber der einzige Arzt, den wir kannten, war fünfundfünfzig Jahre lang unverheiratet geblieben, und es war kaum wahrscheinlich, daß er sich jetzt eine Frau nehmen würde; und selbst wenn er sich dazu entschlösse, mir die Ehe anzutragen, so hätte ich es abgelehnt.
»Wir stehen mitten zwischen zwei Welten«, sagte meine Mutter. Damit meinte sie, daß die Dorfbewohner weit unter uns, die Bewohner des großen Hauses dagegen weit über uns standen. Dies war der Grund, weshalb sie so eifrig darauf bedacht war, mir eine florierende Schule zu hinterlassen. Doch ich muß gestehen, daß die Vorstellung, mein ganzes Leben mit der Unterrichtung der Abkömmlinge des Adels zu verbringen, welche in den nächsten Jahren auf Gut Derringham zu Besuch weilen würden, keinen sonderlichen Reiz für mich besaß.
Es war der Comte, der meine Gedanken in diese Richtung gelenkt hatte. In meinem Zorn wurde ich mir darüber klar, daß er es niemals gewagt hätte, eine junge Dame aus guter Familie auf diese Art zu küssen. Oder doch? Natürlich hätte er es gewagt. Er würde stets tun, was ihm beliebte. Er hätte zweifelsohne auch sehr unangenehm werden können. Er konnte Sir John erzählen, daß ich in sein Schlafgemach eingedrungen war. Statt dessen hatte er mich behandelt wie eine ..., ja, wie eigentlich? Wie konnte ich das wissen?
Ich wußte lediglich, daß meine Mutter, wenn sie es erführe, entsetzt sein würde.
Sie erwartete mich voller Neugier, als ich zurückkam.
»Du siehst so erhitzt aus«, schalt sie zärtlich, aber zugleich auch ein wenig vorwurfsvoll. Ihr wäre es lieber gewesen, ich hätte so gleichgültig ausgesehen, als gehörte es zu meinen täglichen Erlebnissen, den Tee auf Gut Derringham zu nehmen. »Hat es dir gefallen? Wie war es?«
Ich erzählte ihr, was es zum Tee gegeben hatte und wie die Mädchen gekleidet waren.
»Sybil war die Gastgeberin«, sagte ich, »und danach haben wir Spiele gemacht.«
»Was für Spiele?« wollte sie wissen.
»Ach, nur so ein kindisches Versteckspiel und Städte und Flüsse raten.«
Sie nickte. Dann runzelte sie die Stirn. Mein Kleid sah ausgesprochen schäbig aus.
»Am liebsten würde ich dir ein neues Kleid nähen lassen«, meinte sie. »Etwas wirklich Hübsches, vielleicht aus Samt.«
»Aber Mama, wann sollte ich das tragen?«
»Wer weiß? Vielleicht wirst du wieder eingeladen.«
»Das bezweifle ich. Einmal im Leben ist der Ehre genug.«
Es muß bitter geklungen haben, denn sie machte ein trauriges Gesicht. Es tat mir leid, und ich trat zu ihr und legte meinen Arm um sie. »Gräme dich nicht, Mama«, sagte ich. »Wir sind doch auch hier glücklich, nicht wahr? Und die Schule geht doch recht gut.« Dann fiel mir ein, was ich bis dahin vergessen hatte. »O Mama, ich habe unterwegs Joel Derringham getroffen.«
Ihre Augen leuchteten auf. Sie sagte: »Das hast du mir ja gar nicht erzählt.«
»Ich hatte es vergessen.«
»Vergessen ..., daß du Joel Derringham getroffen hast! Eines Tages wird er Sir John sein. Alles wird ihm gehören. Wie kam es dazu, daß du ihm begegnet bist?«
Ich schilderte es ihr und wiederholte Wort für Wort, was wir gesprochen hatten. »Er scheint liebenswert zu sein«, sagte sie. »Ja, das ist er allerdings – und er ist Sir John so ähnlich. Das ist wirklich amüsant. Man könnte sagen, das ist Sir John ... vor dreißig Jahren.«
»Er war gewiß sehr freundlich zu dir.«
»Er hätte nicht freundlicher sein können.«
Ich konnte sehen, wie sie in Gedanken Pläne schmiedete.
Zwei Tage später kam Sir John zum Schulhaus. Es war Sonntag, ein Tag also, an dem kein Unterricht stattfand. Meine Mutter und ich hatten zu Mittag gegessen und, wie wir es am Sonntag häufig zu tun pflegten, bis nahezu drei Uhr am Tisch gesessen, um den Lehrplan der kommenden Woche zu besprechen. Obwohl meine Mutter normalerweise eine ganz und gar prosaische Frau war, konnte sie romantisch träumen wie ein junges Mädchen, wenn ihr Herz an einer Sache hing. Ich wußte, daß sie sich in den Kopf gesetzt hatte, ich solle viele Einladungen auf das Gut erhalten, um dort jemanden kennenzulernen – jemanden von nicht unbedingt hohem Stand, der aber wenigstens in der Lage war, mir mehr zu bieten, als ich erhoffen konnte, wenn ich meine Tage im Schulhaus verbrachte. Vorher war sie entschlossen gewesen, mir die bestmögliche Ausbildung angedeihen zu lassen, um mir meine Zukunft als Lehrerin zu sichern. Jetzt aber waren ihre Gedanken von gewagteren Phantasien beflügelt, die, da sie eine an Erfolg gewöhnte Frau war, keine Grenzen kannten.
Durch das Fenster unseres kleinen Speisezimmers sah sie, wie Sir John sein Pferd an der Eisenstange festband, die eigens für diesen Zweck dort angebracht war. Mir wurde ganz kalt. Es ging mir sogleich durch den Kopf, daß der heimtückische Graf es für richtig erachtet hatte, sich über mein Benehmen zu beklagen. Ich hatte ihn einfach stehenlassen und ihm auf unmißverständliche Weise gezeigt, daß ich sein Verhalten mißbilligte. Dies nun mochte seine Rache sein.
»Oh, da kommt Sir John«, sagte meine Mutter. »Was mag er nur ...«
»Vielleicht eine neue Schülerin ...«, hörte ich mich sagen.
Er wurde in unsere Wohnstube geleitet, und ich stellte erleichtert fest, daß er lächelte, wohlwollend wie immer.
»Guten Tag, Mrs. Maddox ... und Minella. Lady Derringham hat eine Bitte an Sie. Uns fehlt ein Gast für die Soiree und das heutige Abendessen. Die Comtesse Fontaine Delibes ist an ihr Zimmer gefesselt, und ohne sie würden wir dreizehn an der Zahl sein. Sie kennen ja den Aberglauben, daß dreizehn eine Unglückszahl ist, und einige unter unseren Gästen könnten deswegen beunruhigt sein. Ich fragte mich, ob ich Sie wohl überreden könnte, Ihrer Tochter zu gestatten, uns Gesellschaft zu leisten.« Dies entsprach so sehr den Träumen, welche meine Mutter während der letzten zwei Tage beschworen hatte, daß sie die Einladung, ohne mit der Wimper zu zucken, akzeptierte, als sei sie die natürlichste Sache von der Welt.
»Aber selbstverständlich wird sie Ihnen Gesellschaft leisten«, antwortete sie.
»Aber Mama«, protestierte ich, »ich habe doch gar kein passendes Kleid dafür.«
Sir John lachte. »Auch daran hat Lady Derringham bereits gedacht, als wir die Angelegenheit besprachen. Eines von den Mädchen wird Ihnen etwas borgen – wenn es weiter nichts ist.« Er wandte sich zu mir. »Kommen Sie heute nachmittag zum Gutshaus. Dann können Sie das Kleid auswählen, und die Näherin kann die notwendigen Änderungen vornehmen. Es ist sehr gütig von Ihnen, Mrs. Maddox, uns Ihre Tochter zu überlassen.« Er lächelte mir zu. »Wir werden uns also später sehen.« Als er gegangen war, nahm meine Mutter mich in ihre Arme und liebkoste mich.
»Ich habe es herbeigewünscht«, rief sie aus. »Dein Vater pflegte stets zu sagen, ich bekäme alles, was ich mir in den Kopf setze. Weil ich so fest daran glaubte, würde ich es herbeiführen.«
»Ich finde es nicht sehr erhebend, mich mit fremden Federn zu schmücken.«
»Unsinn. Das weiß doch niemand.«
»Sybil und Maria wissen es, und Maria wird mich bei der ersten Gelegenheit daran erinnern, daß ich nur als Lückenbüßer dort bin.«
»Solange sie es niemand anderem sagt, kann es dir doch nichts ausmachen.«
»Mama, warum bist du eigentlich so aufgeregt?«
»Weil jetzt das eingetreten ist, was ich mir immer ersehnt habe.«
»Hast du der Comtesse die Krankheit gewünscht?«
»Vielleicht.«
»Damit deine Tochter auf den Ball gehen kann!«
»Das ist kein Ball!« rief sie betroffen aus. »Dafür müßtest du doch ein richtiges Ballkleid haben.«
»Ich habe mich nur metaphorisch ausgedrückt.«
»Wie recht ich doch hatte, dich so gründlich auszubilden. Deine musikalischen Kenntnisse werden denen der anderen Anwesenden ebenbürtig sein. Ich denke, wir sollten dein Haar auf dem Kopf auftürmen. Das bringt die Farbe voll zur Geltung.« Ich hörte eine zynische Stimme murmeln: »Wie Korn im August.«
»Dein Haar ist dein größter Vorzug, mein Liebes. Wir müssen das Beste daraus machen. Ich hoffe, das Kleid wird blau sein, weil das die Farbe deiner Augen betonen wird. Dieses Kornblumenblau kommt ziemlich selten vor ..., so intensiv wie bei dir, meine ich.«
»Du machst aus einer angehenden Schulmeisterin eine Prinzessin, Mama.«
»Warum sollte eine angehende Schulmeisterin nicht ebenso schön und anmutig sein wie irgendeine von den Damen im Lande?«
»Gewiß, vor allem, wenn sie deine Tochter ist.«
»Du mußt deine Zunge heute abend im Zaum halten, Minella. Du sprichst immer alles aus, was dir gerade in den Sinn kommt.«
»Ich werde ich selbst sein, und wenn es denen nicht behagt ...«
»Dann werden sie dich nicht wieder einladen.«
»Warum sollten sie auch? Findest du nicht, daß du dies alles viel zu wichtig nimmst? Sie haben mich eingeladen, weil ihnen ein Gast fehlt. Es ist nicht das erste Mal, daß jemand gebeten wird, der vierzehnte zu sein. Wenn sich der vierzehnte schließlich doch noch zu kommen entschiede, würde man mir wohl höflich zu verstehen geben, daß meine Anwesenheit nicht mehr erforderlich sei.«
In Wirklichkeit aber arbeitete mein Geist ebenso fieberhaft wie der meiner Mutter. Warum war die Einladung (so dachte ich nämlich darüber) so bald nach meinem Besuch auf dem Gutshof erfolgt? Wer hatte sie veranlaßt? Und war es nicht ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß ausgerechnet die Gemahlin des Comte indisponiert war? Hatte er möglicherweise vorgeschlagen, daß ich die Lücke ausfüllen sollte? Welch ausgefallener Gedanke! Warum? Weil er mich wiedersehen wollte? Immerhin hatte er von meinem schlechten Benehmen nichts erzählt. Ich erinnerte mich, was er über mein Haar gesagt hatte, als er leicht daran zupfte, und dann ... diese Küsse. Er war so unverschämt. Hatte er befohlen: »Schafft mir das Mädchen ins Gutshaus«? So pflegte ein Mann wie er sich unter seinesgleichen zu benehmen. Ich dachte an das sogenannte droit de seigneur, welches besagte, daß ein Mädchen, das kurz vor der Hochzeit stand und dessen Aussehen dem Gutsherrn gefiel, von diesem für eine Nacht in sein Bett geholt wurde – manchmal auch für mehr als eine Nacht, wenn sie sich als zufriedenstellend erwies –, und erst danach überließ man sie ihrem Bräutigam. Wenn der Herr großzügig war, fiel wohl auch ein Geschenk dabei ab. Ich konnte mir gut ausmalen, wie dieser Comte von einem solchen Recht Gebrauch machte.
Was hatte ich nur für Einfälle? Ich war keine Braut, und Sir John würde ein solches Gebaren auf seinem Besitz niemals dulden. Ich schämte mich meiner Gedanken. Die Unterhaltung mit dem Comte übte eine tiefere Wirkung auf mich aus, als ich zunächst angenommen hatte.
Meine Mutter sprach ständig von Joel Derringham. Ich mußte ihr wiederholen, was er zu mir gesagt hatte. Wieder war sie von ihren romantischen Träumen erfüllt. Oh, das war zu töricht. Sie redete sich ein, daß die Indisponiertheit eine Erfindung sei, daß Joel, der meine nähere Bekanntschaft zu machen wünschte, meine Einladung für diesen Abend bei seinen Eltern durchgesetzt habe. O Mama, dachte ich, liebe Mama, immer dann verlor sie den Kopf, wenn es um ihre Tochter ging. Nur dann, wenn sie mich auskömmlich versorgt sehe, könnte sie glücklich sterben. Aber sie schwelgte in den unsinnigsten Phantasien.
Margot kam zu mir ins Schulhaus. Sie war erregt.
»Wie schön!« rief sie aus. »Du wirst also heute abend kommen. Meine liebe Minelle, Marie hat ein Kleid für dich ausgesucht, aber mir gefällt es nicht. Du mußt eines von meinen tragen ..., von einer Pariser Couturière. Blau, wegen deiner Augen. Maries Kleid ist braun – abscheulich! Ich sage nein, nein, nein! Nicht für Minelle, denn wenn du auch keine wahre Schönheit bist – im Vergleich zu mir, meine ich –, so hast du doch deine Vorzüge. O ja, und ich werde darauf bestehen, daß du mein Kleid trägst.«
»O Margot«, sagte ich, »es ist also dein Wunsch, daß ich komme!«
»Aber natürlich. Es wird bestimmt ein Vergnügen. Maman wird den Abend in ihrem Zimmer verbringen. Sie hat heute nachmittag geweint. Daran war wieder mein Vater schuld. Oh, er ist boshaft, aber ich glaube, sie liebt ihn. Ich möchte nur wissen, warum?«
»Deine Mutter ist nicht wirklich krank, nicht wahr?«
Margot zog die Schultern hoch. »Es ist Melancholie. Das behauptet Le Diable jedenfalls. Vielleicht hat es Streit gegeben. Sie würde es nicht wagen, mit ihm zu zanken. Der Streit geht immer von ihm aus. Wenn sie weint, wird er noch wütender. Er haßt weinende Frauen.«
»Und weint sie oft?«
»Ich weiß es nicht. Ich denke, ja. Sie ist schließlich mit ihm verheiratet.«
»Margot, wie kannst du nur so gemein von deinem Vater sprechen!«
»Wenn du die Wahrheit nicht hören willst ...«
»Das möchte ich schon, aber ich weiß nicht, wie du wissen kannst, wo die Wahrheit liegt. Schließt sie sich immer ein? Auch bei euch zu Hause?«
»Ich glaube schon.«
»Aber du mußt es doch wissen.«
»Ich sehe sie nicht oft, weißt du. Nou-Nou behütet sie; und immer heißt es, sie darf nicht gestört werden. Aber warum reden wir eigentlich über die anderen. Ich bin so froh, daß du kommst, Minelle. Ich glaube, es wird dir Spaß machen. Der Teebesuch bei uns hat dir doch gefallen, nicht wahr?«
»Ja, das war lustig.«
»Was hast du auf der Stiege gemacht? Gestehe, daß du spioniert hast!«
»Und was hast du gemacht, Margot?«
Sie kniff die Augen zusammen und lachte. »Komm, sag es mir!« beharrte ich.
»Wenn ich es dir sage, erzählst du mir dann auch, was du gemacht hast? Aber nein, das ist kein fairer Handel. Du hast dir ja nur das Haus angeschaut.«
»Margot, wovon sprichst du eigentlich?«
»Ach laß nur.«
Ich war froh, daß das Thema fallengelassen wurde, aber meine den Comte und die Comtesse betreffende Neugier blieb bestehen. Sie fürchtete sich vor ihm. Das konnte ich verstehen. Sie schloß sich ein und flüchtete sich in ihre Krankheit. Das tat sie sicher nur, um ihm zu entkommen. Das alles war sehr mysteriös. Margot nahm mich mit in ihr Zimmer im Gutshaus. Es war hübsch möbliert und erinnerte mich an das Schlafgemach des Comte. Nur das Himmelbett war nicht ganz so prächtig verziert.
Die Vorhänge waren aus schwerem blauem Samt, und eine Wand war mit einem Gobelin in dem gleichen, im ganzen Raum vorherrschenden Farbton verziert.
Das Kleid, das ich tragen sollte, lag auf dem Bett ausgebreitet. »Ich bin ein wenig rundlicher als du«, sagte Margot. »Das erleichtert die Änderung. Du bist ein wenig größer. Aber schau, hier ist ein breiter Saum. Ich habe ihn gleich von der Näherin auftrennen lassen. Probiere es jetzt an, dann lasse ich sie kommen, um die Änderungen vorzunehmen. Ich werde sie gleich rufen lassen.«
»Margot«, sagte ich, »du bist eine wahre Freundin.«
»Aber ja«, stimmte sie zu. »Du interessierst mich eben. Sybil ..., Marie ... Pouf!« Sie blies das Wort zwischen den Lippen hervor. »Die sind so geistlos. Ich weiß schon, was sie sagen werden, bevor sie es aussprechen. Du bist anders, ganz anders. Und außerdem bist du die Tochter der Schulmeisterin.«
»Was hat das damit zu tun?«
Wieder lachte sie und wollte nichts weiter sagen. Ich zog das Kleid an. Es stand mir ausgesprochen gut. Margot läutete die Glocke, und die Näherin erschien mit Steck- und Nähnadeln. In weniger als einer Stunde war mein Kleid fertig.
Maria und Sybil kamen, um mich zu begutachten. Maria rümpfte die Nase.
»Nun?« fragte Margot. »Was paßt dir nicht?«
»Es ist nicht besonders kleidsam«, kritisierte Maria.
»Wieso nicht?« rief Margot aus.
»Das braune wäre besser gewesen.«
»Besser für dich, nicht wahr? Hast du Angst, daß sie schöner aussehen wird als du? So ist das also.«
»Welch eine Narretei!« widersprach Maria.
Margot schmunzelte. »Es stimmt aber.«
Daraufhin erwähnte Maria die Unkleidsamkeit des Gewandes nicht mehr. Margot bestand darauf, mein Haar zu frisieren. Dabei plapperte sie unentwegt. »Schau, Chérie, ist das nicht hübsch? O ja, es stimmt, du hast ein gewisses Flair. Du solltest nicht dazu verdammt sein, dein Leben damit zu verbringen, dumme Kinder zu unterrichten.« Sie beobachtete meine Reaktion. »Kornblondes Haar«, bemerkte sie. »Kornblumenblaue Augen und Lippen wie Mohn.«
Ich lachte. »Du machst ja ein ganzes Weizenfeld aus mir.«
»Ebenmäßige weiße Zähne«, fuhr sie fort. »Die Nase ein wenig ..., wie sagt man bei euch ..., aggressiv? Volle Lippen ..., sie können lächeln, sie können ernst sein. Ich weiß, Minelle, meine Freundin, was zu Attraktivität verhilft. Der Kontrast ist es. Die Augen sind sanft und fügsam. Aha, aber dann ..., sieh dir diese Nase an! Sieh dir den Mund an! O ja, man sagt, ich sehe gut aus ..., ich bin leidenschaftlich ..., aber warte ein wenig. Kein Unsinn, bitte!«
»Ja bitte«, gab ich zurück, »nichts mehr von diesem Unsinn. Und wenn ich eine Beschreibung meines Aussehens und meines Charakters wünsche, werde ich darum bitten.«
»Das würdest du nie tun, denn auch das gehört zu deinem Charakter, Minelle. Du denkst, du weißt immer ein wenig mehr als alle anderen, und du kannst alle Fragen soviel besser beantworten. O ja, du hast mich in der Schule immer überflügelt ..., uns alle ..., und das ist recht so und geziemt sich für die Tochter der Lehrerin; und jetzt unterrichtest du uns und erklärst uns, was wir richtig oder falsch machen. Aber laß dir von mir gesagt sein, meine kluge Minelle, du mußt noch viel lernen.«
Ich blickte in ihr dunkles, lachendes Gesicht mit den schönen, fast schwarzen, funkelnden Augen, die denen ihres Vater so ähnlich waren, den vollen Brauen, dem dichten, dunklen Haar. Sie war sehr anziehend, und sie hatte etwas Geheimnisvolles an sich. Ich dachte daran, wie wir uns auf der Wendeltreppe getroffen hatten. Wo mochte sie gewesen sein?
»Etwas, das du bereits gelernt hast?« fragte ich.
»Manche von uns werden mit diesem Wissen geboren«, sagte sie.
»Und du gehörst zu denen, welche diese Gabe besitzen?
»O ja.«
Auf der Galerie musizierte ein kleines Orchester.
Lady Derringham, eine anmutige Erscheinung in malvenfarbener Seide, drückte mir die Hand und murmelte: »Wie lieb von Ihnen, uns auszuhelfen, Minella.« Obschon die Bemerkung gutgemeint war, erinnerte sie mich doch augenblicklich daran, warum ich hier war.
Als der Comte erschien, kam mir der Verdacht, daß er für meine Anwesenheit verantwortlich sei! Er blickte sich im Musikzimmer um, bis seine Augen auf mir haften blieben. Dann machte er von der anderen Seite des Raumes herüber eine Verbeugung, und ich sah, wie er jedes Detail meiner Erscheinung auf eine Weise in sich aufnahm, die ich als beleidigend empfand. Hochmütig erwiderte ich seinen Blick, was ihn zu amüsieren schien.
Lady Derringham hatte es so arrangiert, daß ich mit ihren Töchtern und Margot zusammensaß – wie um den Gästen anzudeuten, daß wir trotz unserer Teilnahme an dieser Veranstaltung noch nicht formell in die Gesellschaft eingeführt waren. Wir waren keine Kinder mehr und durften deshalb bei der Soiree und dem anschließenden Mahl zugegen sein; doch sobald dies vorüber war, würde man uns entlassen.
Für mich war das ein ungeheuer aufregendes Ereignis. Ich liebte Musik, besonders die Werke von Mozart, die bei diesem Konzert vornehmlich gespielt wurden. Ich lauschte hingerissen und dachte, wie mir ein solch angenehmes Leben gefallen würde und wie viele meiner Schülerinnen es führten. Mir schien es ungercht, daß das Schicksal mich davon ausgeschlossen hatte, ohne mich jedoch so weit davon entfernt zu haben, daß ich nicht ab und zu einen Blick darauf werfen konnte und merkte, was mir entging.
Während der Konzertpause wandelten die Menschen auf der Galerie umher und begrüßten alte Freunde. Joel kam zu mir herüber.
»Ich freue mich, daß Sie gekommen sind, Fräulein Maddox«, sagte er.
»Glauben Sie wirklich, es wäre aufgefallen, wenn ich nicht gekommen wäre? Würden die Leute sich wahrhaftig gegenseitig zählen und sich wegen der unglücksbringenden Dreizehn von Verderbnis bedroht fühlen?«
»Das können wir nicht wissen, da eine solche Situation vermieden wurde ..., auf höchst angenehme Weise, wenn Sie diese Bemerkung erlauben. Ich hoffe, dies ist die erste von vielen Gelegenheiten, bei denen Sie unser Gast sein werden.«
»Sie können nicht erwarten, daß ein vierzehnter Gast im letzten Augenblick absagt, nur um mir eine Gefälligkeit zu erweisen.«
»Ich finde, Sie messen diesem Anlaß zu viel Bedeutung bei.«
»Das muß ich wohl, denn andernfalls wäre ich nicht hier.«
»Vergessen wir das und freuen wir uns, daß Sie da sind. Wie fanden Sie das Konzert?«
»Vorzüglich.«
»Sie mögen Musik?«
»Über alle Maßen.«
»Derartige Konzerte gibt es häufig bei uns. Sie müssen öfter kommen.«
»Sie sind sehr gütig.«
»Dieses hier findet zu Ehren des Comte statt. Er hegt eine besondere Vorliebe für Mozart.«
»Habe ich meinen Namen gehört?« fragte der Comte.
Er setzte sich auf den Stuhl neben mir, und ich spürte seinen intensiv musternden Blick auf mir.
»Ich erzählte Fräulein Maddox soeben, Comte, daß Sie Mozart lieben und daß dieses Konzert Ihnen zu Ehren gegeben wird. Ich darf Sie mit Fräulein Maddox bekannt machen.«
Der Comte stand auf und verbeugte sich. »Es ist mir ein Vergnügen, Sie hier zu treffen, Mademoiselle.« Er wandte sich an Joel. »Mademoiselle Maddox und ich sind uns bereits begegnet.« Ich fühlte, wie mir das Blut ins Gesicht schoß. Jetzt würde er mich bloßstellen. Er würde Joel erzählen, wie ich in sein Schlafgemach gespäht hatte, während man mich oben vermutete, und er würde darauf hinweisen, wie unklug es war, Leute meines Standes in höhere Kreise mitzubringen. Welch einen Augenblick hatte er dafür gewählt! Ich war sicher, daß dies für ihn bezeichnend war.
Er betrachtete mich mit einem sardonischen Blick und las dabei meine Gedanken.
»In der Tat?« fragte Joel überrascht.
»In der Nähe der Schule«, sagte der Comte. »Ich kam dort vorbei und sah Mademoiselle Maddox. Ich dachte mir, das ist die vortreffliche Lehrerin, welche meiner Tochter so viel Gutes angedeihen ließ. Ich freue mich, daß ich nun Gelegenheit habe, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen.«
Er lächelte mich an und natürlich bemerkte er mein Erröten, das ihm gewiß verriet, daß ich jener Küsse und meines würdelosen Abgangs gedachte.
»Mein Vater singt beständig Loblieder auf Frau Maddox' Schule«, sagte der gute Joel. »Sie hat uns die Anstellung einer Gouvernante erspart.«
»Gouvernanten können sehr schwierig sein«, meinte der Comte, während er sich neben mich setzte. »Sie sind nicht von unserem Stand, und doch gehören sie nicht zur Dienerschaft. Es ist verdrießlich, wenn Menschen im Zwischenreich schweben. Nicht für uns, sondern für sie selbst. Sie werden sich ihrer Stellung zu sehr bewußt. Man sollte die Klassenunterschiede ignorieren, finden Sie nicht auch, Joel? Und Sie, Fräulein Maddox? Als unserem verstorbenen König Louis XV. einmal von einem seiner Freunde, einem Herzog, vorgehalten wurde, daß seine Mätresse die Tochter eines Kochs sei, erwiderte er: ›Ach wirklich? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ihr steht nämlich alle so tief unter mir, daß ich den Unterschied zwischen einem Herzog und einem Koch nicht erkennen kann.‹«
Joel lachte, und ich konnte mich nicht enthalten, mit scharfer Zunge zu entgegnen; »Ist das auch bei Ihnen so, Monsieur le Comte? Könnten auch Sie den Unterschied zwischen einem Koch und einem Herzog nicht erkennen?«
»Ich bin zwar nicht so hochgestellt wie der König, aber ich stehe immerhin hoch genug, und ich könnte den Unterschied zwischen den Töchtern von Sir John und denen der Schulmeisterin nicht wahrnehmen.«
»Dann, so scheint es, bin ich nicht völlig unwillkommen.«
Seine Augen schienen sich glühend in die meinen zu bohren. »Mademoiselle, Sie sind höchst willkommen, das versichere ich Ihnen.«
Joel sah betreten aus. Er fand diese Unterhaltung sicherlich geschmacklos, aber ich merkte, daß der Comte, ebenso wie ich selbst, einen unwiderstehlichen Gefallen daran fand.
»Ich glaube«, sagte Joel, »die Pause ist fast vorüber, und wir sollten unsere Plätze wieder einnehmen.«
Die Mädchen kamen zurück. Margot sah amüsiert aus, Maria wirkte ein wenig verstimmt, und Sybil machte einen unbeteiligten Eindruck.
»Man wird auf dich aufmerksam, Minelle«, flüsterte Margot. »Gleich zwei der bestaussehenden Männer unter den Anwesenden haben einen Blick auf dich geworfen. Du bist eine Sirene.«
»Ich habe sie nicht zu mir gebeten.«
»Das tun Sirenen nie. Sie strahlen einfach ihre Faszination aus.« Während des zweiten Teils des Konzerts dachte ich über den Comte nach. Auf irgendeine Art fand er mich anziehend. Und ich wußte, auf welche. Er liebte Frauen, und obwohl ich noch nicht voll entwickelt war, reifte ich rasch heran. Daß seine Absichten unehrenhafter Natur waren, war nicht zu verkennen. Aber das Erschreckende war, daß ich, anstatt zu erzürnen, davon fasziniert war.
Unten im Speisesaal, wo kalte Gerichte für das Abendmahl angerichtet waren, kam ein Lakai – prächtig anzuschauen in der Derringhamschen Livrée – hinein, suchte die Augen Sir Johns und ging unauffällig zu ihm. Ich sah ihn ein paar Worte flüstern. Sir John nickte und ging zum Comte, welcher, wie ich nicht ohne eine leichte Kränkung bemerkte, mit Lady Eggleston plauderte, der flatterhaften jungen Gattin eines gichtgeplagten Gemahls, der das mittlere Alter schon lange überschritten hatte. Sie lächelte ein wenig geziert, und ich konnte mir den Verlauf ihrer Unterhaltung wohl vorstellen.
Sir John sprach mit dem Comte, und nach einer Weile verließen sie zusammen den Raum.
Joel trat an meine Seite.
»Kommen Sie zum Buffet«, sagte er. »Dort können Sie wählen, was Ihnen beliebt. Danach suchen wir uns einen kleinen Tisch.«
Ich war ihm dankbar. Es sprach so viel Güte aus ihm. Er glaubte, daß ich, die ich niemanden hier kannte, einen Beschützer brauchte.
Es gab Fische jeder Sorte und verschiedenes kaltes Fleisch. Ich nahm nur wenig davon. Ich verspürte nicht den geringsten Hunger.
Wir fanden einen kleinen, durch Pflanzen ein wenig abgeschirmten Tisch, und Joel sagte zu mir: »Ich darf wohl annehmen, daß Sie den Comte etwas ungewöhnlich fanden.«
»Nun ja ..., er ist kein Engländer.«
»Ich dachte, er hätte Sie ein wenig verstimmt.«
»Ich glaube, er ist ein Mann, der es gewöhnt ist, seine eigenen Wege zu gehen.«
»Zweifelsohne. Sie sahen ihn mit meinem Vater fortgehen. Einer seiner Diener ist mit einer Botschaft aus Frankreich gekommen, die anscheinend sehr wichtig ist.«
»Das muß sie wohl sein, wenn der Diener deswegen so weit gereist ist.«
»Aber sie kam nicht ganz unerwartet. Es ist Ihnen gewiß bekannt, daß die Lage in Frankreich schon seit geraumer Zeit sehr gespannt ist. Ich hoffe, es ist kein Unglück geschehen.«
»Die Situation dort ist allerdings betrüblich«, bemerkte ich.
»Man fragt sich, wie das enden wird.«
»Vor zwei Jahren besuchte ich mit meinem Vater den Comte, und schon damals war im ganzen Land eine gewisse Unruhe zu verspüren. Den Leuten dort fiel das allerdings nicht so stark auf wie mir. Wenn man in der nächsten Nähe von etwas lebt, wird man sich dessen oft weniger bewußt.«
»Ich habe von der Verschwendungssucht der Königin gehört.«
»Sie ist höchst unbeliebt. Die Franzosen mögen die Ausländer nicht, und sie ist weiß Gott eine Fremde.«
»Trotzdem ist sie eine charmante und schöne Frau, glaube ich jedenfalls.«
»O ja. Der Comte hat uns ihr vorgestellt. Ich erinnere mich, daß sie eine vorzügliche Tänzerin ist, und sie war wundervoll gekleidet. Ich glaube, der Comte ist doch ein wenig besorgter als er zugibt.«
»Diesen Eindruck macht er aber ganz und gar nicht ...; doch ich rede vielleicht unbesonnen. Ich kenne ihn ja kaum.«
»Er ist kein Mann, der seine Gefühle zur Schau stellt. Falls es Schwierigkeiten geben sollte, hätte er eine Menge zu verlieren. Neben anderen Besitztümern gehören ihm das Château Silvaine, etwa vierzig Meilen südlich von Paris gelegen, sowie das Hotel Delibes, ein Palast in der Hauptstadt. Er stammt aus einer sehr alten Familie, die mit den Capets verwandt ist, und geht bei Hofe ein und aus.«
»Ich verstehe. Ein sehr einflußreicher Herr.«
»Ja, das ist er in der Tat. Das kommt auch in seinem Auftreten zum Ausdruck, finden Sie nicht?«
»Es scheint ihm viel daran zu liegen, von jedermann beachtet zu werden. Ich bin sicher, es würde ihn sehr verdrießen, wenn man es daran fehlen ließe.«