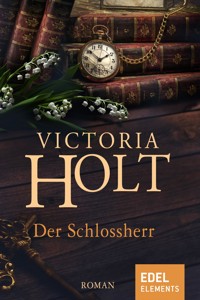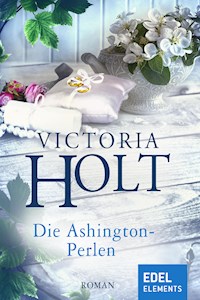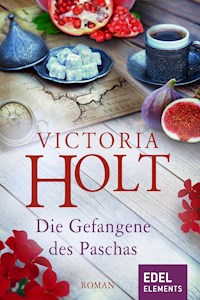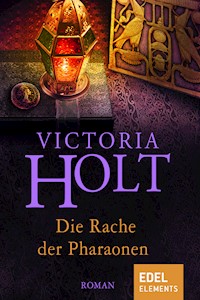4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Davina Glentyre gerät völlig unschuldig in den Verdacht, ihren Vater ermordet zu haben. Eine dornenvolle Wegstrecke liegt vor ihr, die sie bis zum Tag ihrer völligen Rehabilitierung zurücklegen muss... Victoria Holt, die Meistererzählerin des Unheimlichen, verbindet in diesem aufregenden Roman ein Höchstmaß an Spannung mit einer romantischen Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Die Schlangengrube
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Edinburgh
Der Diebstahl
Die Gouvernante
Jamie
Unter Anklage
Lakemere
Das Pfarrhaus
Ein Posten in der Fremde
Kimberley
Der Aufbruch
Der Schatz von Kimberley
Das Treppenhaus
Die Belagerung
Edinburgh
Der Unschuldsbeweis
Impressum
EDINBURGH
Der Diebstahl
Ich beobachtete ihre Ankunft vom Fenster aus. Nie hatte ich eine Frau gesehen, die einer Gouvernante weniger ähnelte. Als sie einen Augenblick vor dem Haus stehenblieb und heraufblickte, konnte ich ihr Gesicht deutlich erkennen. Unter einem schwarzen Hut, den eine grüne Feder zierte, quollen tizianrote Haare hervor. Sie hatte nichts von dem Flair edler Armut, das ihre Vorgängerin, Lilias Milne, und die meisten Damen ihrer Profession auszeichnete. Diese Frau hatte etwas Extravagantes. Sie wirkte eher, als sei sie gekommen, sich einer Theatertruppe anzuschließen statt in der Absicht, die Tochter eines der angesehensten Bürger von Edinburgh zu unterrichten.
Hamish Vosper, der Sohn des Kutschers, hatte sogar Anweisung erhalten, sie mit der Kutsche vom Bahnhof abzuholen. An Lilias Milnes Ankunft konnte ich mich nicht mehr erinnern, da sie so lang zurücklag, doch bin ich sicher, daß Lilias nicht in der Familienkutsche vorfuhr. Hamish half der Neuen aus dem Wagen, als sei sie unser Ehrengast; danach belud er sich mit ihrem umfangreichen Gepäck und geleitete sie zum Hauseingang.
Jetzt war für mich der Zeitpunkt gekommen, in die Halle hinunterzugehen. Mrs. Kirkwell, die Haushälterin, war schon dort. »Das ist die neue Gouvernante«, sagte sie zu mir.
Die Gouvernante stand in der Halle. Sie hatte sehr grüne Augen, deren Farbe durch die grüne Feder an ihrem Hut und den Seidenschal um ihren Hals noch betont wurde; das Auffälligste aber waren die dunklen Augenbrauen und Wimpern, die einen lebhaften Kontrast zum Rot der Haare bildeten. Sie hatte eine kurze, kecke Nase und eine lange Oberlippe, was ihr etwas Verspieltes, Kätzchenhaftes verlieh. Der Mund war rot und voll. Die leicht vorstehenden Zähne ließen auf Mutwillen schließen, auch auf Habgier; worauf diese Gier gerichtet sein mochte, konnte ich nicht sagen – ich war schließlich erst sechzehn.
Sie sah mich eindringlich an, und ich fühlte mich einer gründlichen Musterung unterzogen.
»Du mußt Davina sein«, sagte sie.
»Ja, die bin ich«, gab ich zur Antwort.
Die grünen Augen blickten nachdenklich. »Wir werden uns gut vertragen«, sagte sie in einem schüchternen Ton, der nicht recht zu diesem Blick passen mochte.
Ich merkte gleich, daß sie keine Schottin war. Mein Vater hatte sie nur kurz erwähnt. »Du bekommst eine neue Gouvernante«, hatte er erklärt. »Ich habe sie persönlich eingestellt und bin überzeugt, daß wir mit ihr zufrieden sein werden.«
Ich war entsetzt. Ich wollte keine neue Gouvernante. Ich war fast siebzehn und fand, nun müsse endlich Schluß sein mit Gouvernanten. Zudem war ich noch völlig verwirrt von dem, was mit Lilias Milne geschehen war. Sie war acht Jahre bei mir gewesen, und wir waren gute Freundinnen geworden. Ich meinte sie gut zu kennen und konnte nicht glauben, daß sie sich wirklich hatte zuschulden kommen lassen, was man ihr anlastete.
Mrs. Kirkwell sagte soeben: »Vielleicht möchtest du Miss ... hm ... zeigen, wo ...«
»Grey«, sagte die Gouvernante. »Zillah Grey.«
Zillah! Ein merkwürdiger Name für eine Gouvernante! Und warum hatte sie uns ihren Vornamen genannt? Warum sagte sie nicht einfach Miss Grey? Es hatte lange gedauert, bis ich erfuhr, daß Miss Milnes Vorname Lilias war.
Ich zeigte Miss Grey ihr Zimmer, und da stand sie neben mir und sah sich um. Sie begutachtete den Raum so eingehend, wie sie zuvor mich gemustert hatte.
»Sehr hübsch«, sagte sie und blickte mich mit leuchtenden Augen an. »Ich denke, ich werde hier sehr glücklich sein.«
Die dramatischen Ereignisse, die zur Ankunft von Miss Zillah Grey geführt hatten, waren ganz unversehens in unser friedliches Dasein geplatzt.
Alles begann an jenem Morgen, als ich meine Mutter tot in ihrem Schlafzimmer fand. Danach schlich sich eine unheimliche Macht ins Haus – anfangs wirkte sie unmerklich, hinterhältig, doch schließlich gipfelte sie in der Tragödie, die mein Leben zu zerstören drohte.
Ich war an jenem schicksalhaften Morgen wie an jedem anderen Tag aufgestanden und ging zum Frühstück hinunter. Auf der Treppe begegnete ich Kitty McLeod, unserem Zimmermädchen.
»Mrs. Glentyre antwortet nicht«, sagte sie. »Ich hab’ zwei- oder dreimal angeklopft. Ich mag nicht reingehen, wenn sie mich nicht dazu auffordert.«
»Ich komme mit«, sagte ich.
Wir gingen die Treppe zum Elternschlafzimmer hinauf, das meine Mutter seit dem letzten Jahr allein bewohnte. Sie kränkelte, und mein Vater, der oft bis spätabends in Geschäften unterwegs war, wollte sie nicht stören und bezog daher das Schlafzimmer nebenan. Bisweilen geschah es sogar, daß er abends überhaupt nicht nach Hause kommen konnte.
Ich klopfte an. Als keine Antwort kam, trat ich ein. Es war ein sehr hübsches Zimmer. Das große Doppelbett hatte polierte Messingknäufe und einen Vorhang mit Volants. Durch die hohen Fenster sah man die vornehmen, aus grauen Quadersteinen errichteten Häuser auf der gegenüberliegenden Seite der breiten Straße.
Ich trat ans Bett, und da lag meine Mutter, bleich und still, mit einem friedlichen Ausdruck im Gesicht.
Ich wußte sofort, daß sie tot war, und sagte zu Kitty, die neben mir stand: »Geh, hol Mr. Kirkwell.«
Mr. Kirkwell, der Butler, kam sogleich, begleitet von seiner Frau. »Wir schicken nach dem Doktor«, sagte er.
Als der Arzt kam, erklärte er uns, sie sei im Schlaf verschieden: »Ganz friedlich – und nicht unerwartet.«
Wir konnten nicht nach meinem Vater schicken, denn wir wußten nicht, wo er sich gerade aufhielt. Wir vermuteten ihn auf einer Geschäftsreise nach Glasgow, aber das war zu unbestimmt. Vater kam jedoch noch am selben Tag zurück. Als er die Neuigkeit vernahm, machte er ein so entsetztes Gesicht, wie ich es noch nie gesehen hatte. Seltsam, ich bildete mir ein, einen flüchtigen Ausdruck von Schuldgefühl darin zu entdecken. Machte er sich Vorwürfe, weil er nicht zu Hause war, als Mutter starb?
Dann setzten die Veränderungen ein. Ich vermißte meine Mutter schmerzlich. Ich hatte die sechzehn Jahre meines bisherigen Lebens in geordneten Bahnen verbracht und mir nie vorgestellt, daß es sich so drastisch ändern könnte. Ich machte die Erfahrung, daß wir Frieden, Geborgenheit und Glück für selbstverständlich halten und sie erst dann zu schätzen wissen, wenn wir sie verloren haben.
Die Erinnerungen sind zahlreich: ein geräumiges, behagliches Heim, wo warme Feuer entfacht wurden, sobald die kalten Herbstwinde spüren ließen, daß der Winter bald Einzug halten würde. Ich mußte die Kälte nicht fürchten. Für mich war es ein prickelnder Genuß, in warmen Gamaschen, einem Mantel, der an Hals und Ärmeln mit Pelz besetzt war, und mit Wollschal, Handschuhen und obendrein einem Pelzmuff geschützt, ins Freie zu gehen. Ich war mir stets bewußt, daß ich einer der angesehensten Familien in Edinburgh angehörte.
Mein Vater war Direktor einer Bank in der Princes Street, und ich war jedesmal von glühendem Stolz erfüllt, wenn ich an dem Gebäude vorüberging. Als kleines Mädchen dachte ich, alles Geld, das in die Bank gebracht wurde, gehöre ihm. Es war wunderbar, eine Glentyre, ein Mitglied dieser illustren Familie, zu sein. Mein Vater war David Ross Glentyre, und ich war Davina genannt worden, weil dieser Name David so nahekam wie nur möglich. Wäre ich als Junge auf die Welt gekommen, was meinen Eltern vermutlich lieber gewesen wäre, hätte ich David geheißen. Aber ein Knabe wurde nie geboren; meine Mutter war zu zart, um das Risiko einer nochmaligen Schwangerschaft auf sich zu nehmen.
Solche Erinnerungen barg für mich das Haus, das nun ein Haus der Trauer geworden war.
Bis ungefähr ein Jahr vor ihrem Tod waren meine Mutter und ich oft in der Kutsche zum Einkaufen oder zu Besuch bei Freunden gefahren. In allen großen Geschäften wurde meine Mutter ehrerbietig bedient. Männer in schwarzen Röcken kamen beflissen herbeigeeilt und rieben sich entzückt die Hände, weil sie ihnen die Ehre erwies, sie aufzusuchen. »Wann möchten Sie es zugeschickt haben, Mrs. Glentyre? Selbstverständlich, selbstverständlich, wir können es noch heute liefern. Und Miss Davina ist schon eine richtige junge Dame.« Das alles war sehr angenehm. Wir besuchten Freunde, lauter Leute, die so gut situiert waren wie wir und ähnliche Häuser bewohnten. Wir tranken Tee, aßen Haferküchlein, und ich lauschte brav den Erzählungen der Erwachsenen.
Wie liebte ich die Fahrt auf der Royal Mile von der Felsenburg zu dem herrlichsten aller Paläste, dem Holyrood Palace. Einmal war ich in dem Palast gewesen. Schaudernd stand ich in dem Raum, wo Rizzio zu Füßen Königin Marias ermordet wurde; ich träumte noch monatelang davon – alles war so wunderbar schauerlich.
Jeden Sonntag besuchte ich die Kirche mit Mutter und Vater, sofern er nicht auswärts war. War Vater verreist, gingen Mutter und ich allein, und nach dem Gottesdienst blieben wir vor der Kirche stehen, um mit Freunden ein Schwätzchen zu halten, bevor wir uns von Mr. Vosper, der mit dem Wagen wartete, durch die sonntäglich stillen Straßen zum Mittagsmahl nach Hause kutschieren ließen.
Die Sonntagsmahlzeiten wären ohne meine Mutter eine ernste Zeremonie gewesen. Aber sie lachte viel und ließ sich gerne respektlos über die Predigt aus; wenn sie über Leute redete, ahmte sie diese täuschend echt nach. Mr. Kirkwell hielt sich diskret die Hand vor den Mund, um ein Lächeln zu verdecken; Kitty schmunzelte, und selbst die Lippen meines Vaters zuckten leicht, während er Mutter mit mildem Vorwurf ansah. Sie aber lachte nur.
Mein Vater, ein ernsthafter, frommer Mann, legte großen Wert darauf, daß alle im Haus es ihm gleichtaten. Wenn er daheim war, hielt er jeden Morgen in der Bibliothek eine Andacht, an der alle teilnehmen mußten, sogar die Dienstboten – Mr. und Mrs. Kirkwell, Kitty, Bess und das Hausmädchen Jenny –, Mutter war ausgenommen; der Doktor hatte ihr Ruhe verordnet, daher stand sie nie vor zehn Uhr auf.
Und auch die Vospers mußten nicht kommen, da sie nicht im Haus wohnten. Sie hatten ihre Unterkunft über den Stallungen, wo die Pferde und die Kutsche untergestellt waren. Sie waren zu dritt, Mr. und Mrs. Vosper mit ihrem Sohn Hamish. Hamish war um die Zwanzig. Er ging seinem Vater zur Hand, und konnte der alte Vosper die Kutsche einmal nicht fahren, dann übernahm sein Sohn diese Aufgabe.
Aus Hamish wurde ich nicht ganz klug. Er hatte dunkle Haare und fast schwarze Augen. Mrs. Kirkwell meinte: »Der Bursche ist wirklich zu dreist. Er meint wohl, er sei was Besseres als wir übrigen.«
Ein Aufschneider war er gewiß. Groß gewachsen und breitschultrig, überragte er seinen Vater und Mr. Kirkwell, den Butler. Wenn er jemanden ansah, hatte er die Angewohnheit, eine Augenbraue und einen Mundwinkel gleichzeitig zu heben. Das verlieh ihm einen hochmütigen Gesichtsausdruck, so, als blicke er auf die anderen herab, als fühle er sich um vieles erfahrener. Mein Vater war ihm jedoch offensichtlich zugetan. Er sagte, Hamish verstehe sich gut auf den Umgang mit Pferden, und als Kutscher sei ihm der junge Vosper allemal lieber als der alte.
Gern hatte ich bei meiner Mutter gesessen und mit ihr geplaudert. Sie schwärmte ständig von den alten Zeiten. Ihre Augen leuchteten aufgeregt, wenn sie von den Streitigkeiten mit unserem Feind jenseits der Grenze erzählte. Sie sprach leidenschaftlich von dem großen William Wallace, der sich gegen den mächtigen Edward erhoben hatte, als dieser soviel Elend über unser Land brachte, daß er als »Hammer von Schottland« in die Geschichte einging.
»Der große Wallace wurde gefangengenommen.« Ihre Augen glühten vor Zorn und bitterem Scherz. »Sie haben ihn in Smithfield gehenkt und gevierteilt wie einen gewöhnlichen Verräter.« Sie sprach von dem guten Prinz Charlie und der Tragödie von Culloden, dem Triumph von Bannockburn und natürlich von der unglückseligen, ach so romantischen Maria, Königin von Schottland.
Das waren beglückende Stunden, und ich konnte den Gedanken kaum ertragen, daß sie unwiederbringlich dahin waren. Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr hatte ich die Mahlzeiten mit Miss Milne eingenommen, danach mit meinen Eltern. Da Lilias Milne und ich gute Freundinnen waren, hatte ich eine Menge über sie erfahren; von ihr wußte ich auch, zu welch unsicherem, oft demütigendem Dasein Gouvernanten gezwungen waren. Ich war froh, daß Lilias zu uns gekommen war. Auch sie selbst war froh darüber. »Deine Mutter ist jeder Zoll eine Dame«, sagte sie einmal. »Sie hat mich nie fühlen lassen, daß ich mehr oder weniger eine Bedienstete bin. Als ich damals hierherkam, stellte sie mir Fragen über meine Familie, und ich merkte, daß sie Verständnis hatte. Sie nimmt Anteil an anderen Menschen; sie sieht, wie sie leben, und kann sich an ihre Stelle versetzen. Sie bemüht sich stets, andere in keiner Weise zu verletzen. So etwas nenne ich eine Dame.«
»Oh, ich bin so froh, daß du hier bist, Lilias«, sagte ich. Wenn wir allein waren, duzte ich sie. Miss Milne nannte ich sie nur in Gegenwart anderer. Mrs. Kirkwell hätte mich zweifellos dafür getadelt, daß ich einen so vertraulichen Umgang mit der Gouvernante pflegte, und meinem Vater wäre es auch nicht recht gewesen. Meine Mutter hätte sicher nichts dagegen gehabt.
Lilias erzählte mir von ihrer Familie, die in England in der Grafschaft Devon lebte. »Wir sind sechs Geschwister«, sagte sie, »lauter Mädchen. Es wäre besser gewesen, wenn wir ein paar Jungen gehabt hätten, obwohl deren Erziehung natürlich teuer gekommen wäre. Wir waren sehr arm. Und in unserem großen Haus war es immer kalt und zugig. Ich liebe eure warmen Feuer hier. Ihr braucht sie natürlich noch mehr, weil es bei euch soviel kälter ist. Hier im Haus hab’ ich’s warm. Das behagt mir.«
»Erzähl mir vom Pfarrhaus.«
»Es ist groß und zugig. Die Kirche ist gleich nebenan. Sie ist uralt, und irgendwo hapert’s immer. Klopfkäfer, Holzwürmer, ein leckes Dach. Aber es ist eine schöne Kirche. Sie liegt mitten in Lakemere, das ist ein typisches englisches Dorf, mit der alten Kirche, den Katen und dem Gutshaus. Solche Dörfer habt ihr hier nicht. Du siehst den Unterschied, sobald du über die Grenze kommst. Ich liebe die englischen Dörfer.«
»Aber das zugige alte Pfarrhaus? Du mußt zugeben, in unserem Haus lebt man bequemer.«
»Gewiß, gewiß. Das weiß ich zu schätzen. Dann aber frage ich mich: Wie lange gibt es das noch für mich? Ich muß mich damit auseinandersetzen, Davina. Wie lange wirst du noch eine Gouvernante brauchen? Das frage ich mich schon geraume Zeit. Sie werden dich wohl ins Internat schicken, nehme ich an.«
»Vorerst nicht. Vielleicht heirate ich, und du wirst die Gouvernante meiner Kinder.«
»Bis dahin ist es noch eine Weile«, sagte sie traurig. Sie war zehn Jahre älter als ich, und ich war acht gewesen, als sie zu uns kam. Ich war ihre erste Schülerin.
Sie erzählte mir noch mehr von ihrem Leben daheim. »Wir Schwestern wußten von vornherein, daß wir unseren Lebensunterhalt selbst verdienen mußten, sofern wir nicht heirateten. Wir konnten nicht alle zu Hause bleiben. Die beiden ältesten, Grace und Emma, sind verheiratet, Grace mit einem Pfarrer und Emma mit einem Rechtsanwalt. Ich war die dritte, und nach mir kamen Alice, Mary und Jane. Mary ist Missionarin irgendwo in Afrika. Alice und Jane sind daheim geblieben, um das Haus zu führen, als unsere Mutter starb.«
Unsere Freundschaft vertiefte sich. Auch ich fürchtete, mein Vater würde eines Tages beschließen, daß ich keine Gouvernante mehr brauchte. Wann würde es soweit sein? Wenn ich siebzehn würde? Das war nicht mehr lange hin.
Einmal hätte Lilias fast geheiratet, erzählte sie mir voller Wehmut. Aber er hatte sich nie »erklärt«.
»Ich vermute, es waren nur Andeutungen«, sagte ich. »Wie kamst du denn darauf, daß er sich ›erklären‹ würde?«
»Er hatte mich gern. Er war der jüngere Sohn des Gutsherrn von Lakemere. Er wäre eine gute Partie für mich, die Pfarrerstochter, gewesen. Doch dann stürzte er beim Reiten und war schwer verkrüppelt. Er kann seine Beine nicht mehr gebrauchen.«
»Bist du denn nicht zu ihm gegangen? Hast du ihm nicht gesagt, du würdest auf immer für ihn sorgen?«
Sie schwieg ein Weilchen, während sie in die Vergangenheit zurückblickte. »Er hatte sich nicht erklärt. Niemand wußte, wie es um uns stand. Was konnte ich tun?«
»Ich wäre zu ihm gegangen. Ich hätte ihm die Erklärung abgenommen.«
Sie lächelte nachsichtig. »Das schickt sich nicht ... eine Frau muß warten, bis sie gefragt wird. Er würde mich nicht gefragt haben, in diesem Zustand. Es konnte nicht sein. Es war Fügung.«
»Von wem?«
»Von Gott. Vom Schicksal. Wie immer du es nennen willst.«
»Ich hätte es nicht zugelassen. Ich wäre zu ihm gegangen und hätte ihm gesagt, daß ich ihn heirate.«
»Du mußt noch viel lernen, Davina«, sagte sie.
Ich erwiderte: »Dann bring’s mir bei.«
»Manche Dinge kann man nur durch Erfahrung lernen.«
Ich dachte viel über Lilias nach. Zuweilen fragte ich mich, ob sie nicht weniger in den Mann als vielmehr in die Vorstellung vom Heiraten verliebt gewesen war. Als verheiratete Frau wäre sie nicht gezwungen gewesen, als Gouvernante zu arbeiten, immer im ungewissen, wann sie sich nach einem neuen Posten in einer fremden Familie würde umsehen müssen.
In den Wochen bevor meine Mutter starb, band Lilias’ Angst vor der Zukunft sie eng an mich – und nach dem Tod meiner Mutter kamen wir uns näher denn je.
Doch ich wurde allmählich erwachsen. Ich sah den Tatsachen ins Auge und wußte, daß Lilias nicht mehr lange bei uns sein würde.
Nanny Grant hatte uns erst kurz zuvor verlassen. Sie war zu einer Kusine aufs Land gezogen. Der Abschied hatte mich tief betrübt. Nanny war schon die Kinderfrau meiner Mutter gewesen, war bei ihr geblieben, bis sie heiratete, und später war sie meine Kinderfrau geworden. Wir standen uns sehr nahe. Sie war es, die mich tröstete, wenn ich Alpträume hatte, wenn ich hinfiel und mir weh tat. An diese Zeit werde ich immer zurückdenken. Wenn es schneite, ging sie mit mir in den Garten zwischen den Stallungen und dem Haus, und sie saß geduldig auf einer Bank, während ich einen Schneemann baute. Bis sie mich plötzlich aufhob und sagte: »Jetzt ist es genug. Möchtest du, daß deine alte Nanny sich in einen Schneemann verwandelt? Oh, wenn du dich jetzt sehen könntest ... deine Augen blitzen bei dieser Vorstellung. Du kleiner Schlingel!«
Ich erinnere mich an die Regentage, wenn wir am Fenster saßen und warteten, daß es aufklarte und wir hinausgehen konnten. Dann sangen wir zusammen:
Es regnet, Gott segnet, die Erde wird naß.
Mach mich nicht naß, mach mich nicht naß,
mach nur die bösen Kinder naß.
Und nun war Nanny Grant fortgegangen und hatte die wunderbaren Erinnerungen zurückgelassen – sie waren alle Teil eines wunderbaren Lebens, vor das sich an jenem tragischen Tag, als ich zu meinem Unglück meine Mutter tot fand, ein dunkler Vorhang schob.
»Für eine Tochter beträgt die Trauerzeit ein Jahr«, verkündete Mrs. Kirkwell. »Für uns dauert sie zwischen drei und sechs Monate. Sechs für Mr. Kirkwell und mich. Für die Hausmädchen dürften drei Monate genügen.«
Wie habe ich die schwarzen Kleider gehaßt! Wenn ich sie anzog, mußte ich jedesmal an meine Mutter denken, wie sie tot in ihrem Bett lag.
Nichts war mehr wie vorher. Manchmal hatte ich das Gefühl, wir würden warten, daß etwas geschehe, warten, daß wir aus unserer Trauer erlöst würden. Lilias wartete, daß mein Vater sie zu sich rief, um ihr zu sagen, ihre Dienste würden nicht mehr benötigt.
Mein Vater war öfter auswärts denn je. Ich war dankbar dafür. Mir graute vor den Mahlzeiten mit ihm, wenn wir beide immer auf den leeren Stuhl starrten und schwiegen.
Nicht daß mein Vater je gesellig gewesen wäre. Meiner Mutter jedoch war es gelungen, ihn ein wenig aus seiner Starrheit zu lösen. Ich dachte daran, wie seine Lippen zuckten, wenn er sich anstrengte, seine Belustigung zu verbergen. Er war ihr offenbar sehr zugetan, was ich eigenartig fand, da sie so verschieden waren. Sie scherte sich nicht um die Konventionen, an denen er so strikt festhielt. Ich erinnerte mich an den milden Vorwurf in seiner Stimme, wenn sie etwas sagte, was er gewagt fand. »Meine Liebe, meine Liebe«, murmelte er dann, aber er mußte unwillkürlich lächeln.
Einmal sagte meine Mutter: »Dein Vater ist ein Mann mit hehren Prinzipien, ein guter Mensch. Er gibt sich große Mühe, seinen hohen Wertmaßstäben gemäß zu leben. Manchmal halte ich es für bequemer, sie etwas niedriger anzusetzen, damit man sich nicht selbst enttäuschen muß.«
Ich verstand nicht ganz, was sie damit meinte, und bat sie, es mir zu erklären. Doch sie lachte nur und sagte: »Meine Gedanken gehen spazieren. Es ist nichts ...« Dann zuckte sie die Achseln und murmelte: »Armer David.«
Ich hätte gerne gewußt, warum sie meinen Vater bedauerte. Aber meine Mutter wollte zu diesem Thema nichts mehr sagen. Etwa drei Wochen nach ihrem Tod kam die Schwester meines Vaters, Tante Roberta, zu uns ins Haus. Sie war zur Zeit des Begräbnisses krank gewesen und hatte nicht daran teilnehmen können, doch jetzt fühlte sie sich wieder gesund und war voll Tatendrang.
Sie war ganz anders als mein Vater. Er war ein zurückhaltender Mensch, der Distanz zu uns wahrte. Nicht so Tante Roberta. Ihre hohe, befehlende Stimme war im ganzen Haus zu hören. Sie betrachtete uns alle mit äußerster Mißbilligung.
Sie war unverheiratet. Mrs. Kirkwell, die über ihre Anwesenheit verstimmt war, meinte, es wundere sie gar nicht, daß Miss Glentyre keinen Mann finden konnte, der mutig genug war, es mit ihr aufzunehmen.
Tante Roberta verkündete, sie sei zu uns gekommen, weil mein Vater nach dem Verlust seiner Gattin eine Frau brauche, die seinen Haushalt beaufsichtige. Da meine Mutter niemals etwas beaufsichtigt hatte und dennoch alles reibungslos lief, war diese Idee von Anfang an absurd. Alle im Haus erschauderten in schlimmen Vorahnungen, denn Tante Roberta ließ durchblicken, daß sie für immer bei uns zu bleiben gedenke. Und vom Augenblick ihrer Ankunft an begann sie, den Haushalt umzukrempeln. Unmut kam auf, und ich befürchtete, daß die Dienstboten sich bald nach neuen Stellungen umschauen würden. »Nur gut, daß Mr. Kirkwell so geduldig ist«, sagte Mrs. Kirkwell zu Lilias, die die Bemerkung an mich weitergab und hinzufügte: »Ich glaube wirklich, so gut sie es hier auch haben, dies könnte den Leuten zuviel werden.«
Ich wünschte innig, Tante Roberta würde wieder abreisen. Zum Glück war mein Vater nicht so geduldig wie Mr. Kirkwell. Eines Abends kam es beim Essen zu einer heftigen Auseinandersetzung. Es ging um mich.
»Du solltest daran denken, David, daß du eine Tochter hast«, begann Tante Roberta, während sie sich aus der Schüssel mit Pastinaken bediente, die Kitty ihr reichte.
»Das dürfte ich wohl kaum vergessen«, gab mein Vater scharf zurück.
»Sie wird rasch erwachsen.«
»Sicher nicht schneller als andere Mädchen in ihrem Alter.«
»Sie braucht eine leitende Hand.«
»Sie hat eine vorzügliche Gouvernante. Das dürfte vorerst genügen, denke ich.«
»Gouvernante!« schnaubte Tante Roberta. »Was verstehen die davon, wie man ein Mädchen auf die Einführung in die Gesellschaft vorbereitet?«
»Einführung in die Gesellschaft!« rief ich entgeistert.
»Du bist nicht gefragt, Davina.«
Es ärgerte mich, daß ich für sie offenbar noch in dem Alter war, wo man gesehen, aber nicht gehört werden darf, daß sie mich aber dennoch nicht mehr für zu jung befand, um in die Gesellschaft eingeführt zu werden.
»Die Rede war aber von mir«, gab ich heftig zurück. »Himmlischer Vater! Was soll aus dir noch werden?« »Roberta«, sagte mein Vater ruhig, »du bist hier sehr willkommen, aber ich kann nicht zulassen, daß du das Regiment in meinem Haus übernimmst. Der Haushalt ist stets vortrefflich geführt worden, und ich möchte nicht, daß sich daran etwas ändert.«
»Ich verstehe dich nicht, David«, sagte Tante Roberta. »Ich glaube, du vergißt ...«
»Du bist es, die vergißt, daß du nicht mehr die große Schwester bist. Daß du zwei Jahre älter bist als ich, mag eine gewisse Bedeutung gehabt haben, als du acht warst und ich sechs. Aber heutzutage brauche ich dich nicht, damit du dich um meinen Haushalt kümmerst.«
Tante Roberta war fassungslos. Sie zuckte mit resignierter Miene die Achseln und murmelte: »Die Undankbarkeit mancher Leute geht über mein Fassungsvermögen.«
Ich dachte, sie würde jetzt vielleicht abreisen, aber sie schien es trotz ihrer Unbeliebtheit für ihre Pflicht zu halten, uns davor zu bewahren, in die Katastrophe zu schlittern.
Dann ereignete sich etwas, das mich – uns alle – zutiefst erschütterte und Tante Roberta die Entscheidung abnahm.
Mein Vater wurde jetzt fast immer von Hamish kutschiert. Die Rangordnung in den Stallungen hatte sich umgekehrt. Nicht Hamish half aus, wenn sein Vater anderweitig beschäftigt war, sondern der Vater wurde gerufen, wenn Hamish nicht zur Hand war. Hamish war ein größerer Angeber denn je. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, in die Küche zu kommen, wo er sich an den Tisch setzte und die Mädchen angaffte – sogar mich, wenn ich zufällig anwesend war. Kitty, Bess und Jenny, das Hausmädchen, fanden seine Gegenwart sichtlich aufregend, und er ließ sich gönnerhaft herab, mit ihnen zu flirten.
Ich konnte nicht verstehen, was sie an ihm beeindruckte. Es bereitete ihm anscheinend großes Vergnügen, die behaarten Arme vorzuzeigen. Er hatte die Hemdsärmel stets bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt, so daß er seine Arme zärtlich streicheln konnte. Auf mich wirkte dieser Anblick abstoßend.
Mrs. Kirkwell betrachtete Hamish mit Argwohn. Als er versuchte, mit ihr zu scherzen, ließ sie ihn abblitzen. Er hatte die Angewohnheit, die Mädchen zu begrapschen, was ihnen offenbar gefiel; doch der Reiz, den er auf sie ausübte, ließ Mrs. Kirkwell kalt. Einmal berührte er im Vorbeigehen ihre Schulter und murmelte: »Sie müssen zu Ihrer Zeit ein hübsches Frauenzimmer gewesen sein, Mrs. Kirkwell. Ein liebes Persönchen, könnt’ ich mir vorstellen ... oder vielleicht doch nicht ganz so lieb, wie?«
Sie erwiderte mit äußerster Würde: »Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dir überlegen würdest, mit wem du redest, Hamish Vosper.«
Worauf er gurrende Laute von sich gab und sagte: »Ach, so ist das, ja? Ich merke schon, hier muß ich mich vorsehen.«
»Und ich kann nicht dulden, daß du in meiner Küche herumlungerst«, gab Mrs. Kirkwell ihm zu verstehen.
»Aha. Aber ich warte auf den Herrn.«
»Je eher er nach dir schickt, desto besser.«
In diesem Moment kam Lilias Milne in die Küche. Sie wollte Bess fragen, ob sie heute morgen ein Päckchen Stecknadeln auf ihrem Tisch gesehen habe. Sie hatte sie dort vergessen, und jetzt waren sie nicht mehr da. Sie dachte, Bess habe sie vielleicht versehentlich zum Abfall geworfen.
Ich bemerkte, daß Hamish Lilias grübelnd betrachtete – nicht so, wie er die jungen Mädchen ansah, sondern aufmerksam, anders.
Wenige Tage später fing der Ärger an.
Es begann damit, daß ich Tante Roberta auf der Treppe traf. Es war nach dem Mittagessen; ich wußte, daß sie sich nachmittags zur Ruhe legte. Das war die einzige Zeit, wo friedliche Stille im Haus herrschte. Sie war seit dem Wortwechsel mit meinem Vater etwas kleinlaut geworden, beaufsichtigte aber nach wie vor alles, was im Haus vorging, und ihr Adlerauge funkelte ständig vor Mißbilligung.
Ich wollte gerade hastig umkehren und mich in mein Zimmer verziehen, aber sie hatte mich schon gesehen.
»Ach, bist du’s, Davina? Du bist zum Ausgehen angekleidet?«
»Ja. Miss Milne und ich machen um diese Tageszeit oft einen Spaziergang.«
Sie wollte etwas erwidern, als sie plötzlich lauschend innehielt. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen, und ich trat leise neben sie. »Horch«, flüsterte sie.
Hinter einer geschlossenen Türe hörte ich unterdrücktes Lachen und eigenartige Laute. Tante Roberta schritt resolut hin und stieß die Türe auf. Ich blieb an ihrer Seite, und mir bot sich ein erstaunlicher Anblick: Die halbnackten, verschlungenen Leiber von Kitty und Hamish lagen auf dem Bett.
Sie fuhren hoch. Kittys Gesicht wurde knallrct, und sogar Hamish wirkte leicht verstört.
Ich hörte Tante Robertas raschen Atem. Ihr erster Gedanke galt mir. »Laß uns allein, Davina«, schrie sie.
Aber ich vermochte mich nicht zu rühren. Ich konnte nur wie gebannt die beiden auf dem Bett anstarren.
Tante Roberta trat in das Zimmer. »Anstößig ... unerhört ... ihr verderbten ...« Sie stotterte, ausnahmsweise um Worte verlegen.
Hamish war vom Bett aufgestanden und fuhr hastig in seine Kleider. Er setzte eine trotzig-prahlerische Miene auf und grinste Tante Roberta an. »Das ist nun mal die menschliche Natur«, sagte er.
»Du widerwärtiger Mensch«, gab sie zurück. »Mach, daß du aus dem Haus kommst. Und du«, sie brachte Kittys Namen nicht über die Lippen, »du Schlampe. Du packst sofort deine Sachen und verschwindest – hinaus mit euch, alle beide.« Hamish zuckte nur die Achseln, doch Kitty wirkte wie betäubt. Ihr Gesicht, zuvor rot wie Stechpalmenbeeren, war nun weiß wie Papier.
Tante Roberta drehte sich um und wäre fast auf mich gefallen. »Davina! Was fällt dir ein? Ich sagte dir, du sollst hinausgehen. Es ist äußerst ... anstößig. Ich wußte doch, daß in diesem Haus etwas vorging. Sobald dein Vater heimkommt ...«
Ich machte kehrt, floh in mein Zimmer und schloß mich ein. Auch ich war erschüttert. Mir war übel. »Die menschliche Natur«, hatte Hamish gesagt. Noch nie war ich der menschlichen Natur dieser Form so nahe gewesen.
Stille herrschte im Haus. Die Dienstboten hatten sich in der Küche versammelt. Ich stellte mir vor, wie sie flüsternd am Tisch saßen. Lilias kam in mein Zimmer. »Es wird Ärger geben«, sagte sie. »Und du warst dabei.«
Ich nickte.
»Was hast du gesehen?«
»Ich habe die zwei gesehen, auf dem Bett.« Lilias schauderte.
»Es war so abstoßend«, sagte ich. »Hamishs Beine sind genauso behaart wie seine Arme.«
»Ich vermute, ein Kerl wie der übt auf ein Mädchen wie Kitty einen gewissen Reiz aus.«
»Inwiefern?«
»Das weiß ich nicht genau, aber er hat so etwas ... Männliches. Ein junges Mädchen könnte durchaus von ihm hingerissen sein. Kitty wird natürlich entlassen. Alle beide werden entlassen. Wo Kitty wohl hingehen wird? Und was werden sie mit ihm machen? Es wird böse werden, wenn dein Vater nach Hause kommt.«
Ich konnte die schreckliche Angst in Kittys Gesicht nicht vergessen. Sie war seit vier Jahren bei uns; mit vierzehn war sie vom Land zu uns gekommen. Wenn mein Vater nach Hause käme, würde Tante Roberta mit Sicherheit darauf bestehen, daß Kitty das Haus verließ. Ich malte mir aus, wie sie mit ihren wenigen Habseligkeiten auf der Straße stand.
Ich ging in das Zimmer hinauf, das sie mit Bess und Jenny teilte. Sie war allein; Tante Roberta hatte sie hinauf geschickt. Sie saß verzweifelt und ängstlich auf ihrem Bett.
Ich setzte mich zu ihr. In Rock und Bluse schien sie ein ganz anderer Mensch als das halbnackte Wesen auf dem Bett.
»Oh, Miss Davina, Sie sollten nicht hierherkommen«, sagte sie. »Ist der Herr schon zurück?«
Ich schüttelte den Kopf. »Noch nicht.«
»Und sie?«
»Du meinst meine Tante? Mein Vater hat ihr deutlich zu verstehen gegeben, daß sie im Hause nichts zu sagen hat.«
»Ich werde fortmüssen, wenn er kommt.«
»Wie konntest du ... das tun?« fragte ich. Und fügte hinzu: »Mit ihm?«
Sie sah mich kopfschüttelnd an. »Das verstehen Sie nicht, Miss Davina. Es ist etwas ganz Natürliches ... mit ihm.«
»Die menschliche Natur«, zitierte ich ihn. »Aber es scheint so ...«
»Er hat eben so was Gewisses.«
»Die vielen Haare«, sagte ich schaudernd. »An Beinen und Armen.«
»Vielleicht ...«
»Kitty, was wirst du anfangen?«
Sie schüttelte den Kopf und fing an zu weinen.
»Wenn man dich fortschickt, wohin willst du gehen?«
»Ich weiß nicht, Miss.«
»Könntest du nach Hause?«
»Das ist sehr weit von hier. In der Nähe von John o’Groats. Ich bin hierhergekommen, weil sie mich dort nicht gebrauchen können. Bloß mein alter Vater ist noch da. Er kann mich nicht ernähren. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht zurückgehen und ihm sagen, warum ich wieder da bin.«
»Wohin dann, Kitty?«
»Vielleicht gibt der Herr mir noch eine Chance«, sagte sie hoffnungsvoll, doch ich merkte ihr an, daß sie dies nicht für sehr wahrscheinlich hielt.
Ich dachte an seine Bibellesungen – die vielen Stellen über die Rache des Herrn – und gelangte zu der Überzeugung, daß er Kittys Sünde für zu schwer halten würde, als daß er Vergebung gewähren könnte. Ich hatte die stets vergnügte Kitty immer gern gehabt und wollte ihr helfen. Hin und wieder hatte ich ein Geldstück, das ich von meinem wöchentlichen Taschengeld gespart hatte, in eine Schatulle gelegt. Kitty konnte haben, was sich darin angesammelt hatte. Viel war es nicht. Aber das größere Problem war: Wohin könnte sie gehen? Was wurde aus Mädchen, die gesündigt hatten wie Kitty? Ich hatte von einer Nonne gehört, die wegen eines ähnlichen Vergehens eingemauert worden war. Es schien eine der größten Sünden zu sein. Wegen dieser Sünde bekamen manche Mädchen Babys und waren auf immer geächtet.
Ich tat mein Bestes, um Kitty zu trösten. Ich hoffte, mein Vater würde an diesem Abend nicht nach Hause kommen. Das würde ihr etwas Aufschub geben – Zeit, sich einen Ausweg zu überlegen.
Ich ging zu Lilias und erzählte ihr, daß ich bei Kitty gewesen war und in welch verzweifelter Verfassung sie sich befand.
»Sie ist töricht«, sagte Lilias, »sich so zu benehmen ... und ausgerechnet mit einem Kerl wie Hamish. Sie muß nicht ganz richtig im Kopf sein.«
»Sie ist ehrlich verzweifelt, Lilias. Sie weiß nicht, wohin. Was wird sie tun? Vielleicht nimmt sie sich das Leben. Was dann, Lilias? Ich würde nie vergessen, daß ich ihr nicht geholfen habe.«
»Was könntest du schon tun?«
»Ich könnte ihr das bißchen Geld geben, das ich habe.«
»Das würde nicht weit reichen.«
»Ich habe mit ihr darüber geredet, was aus ihr wird, wenn sie gehen muß. Du könntest in dein Pfarrhaus zurück. Du hast ein Zuhause. Bei Kitty ist das anders. Sie weiß nicht, wohin. Man wird doch nicht so grausam sein, nicht wahr, und sie hinauswerfen, wenn sie nicht weiß, wohin?«
»Sie hat allem Anschein nach die allerschlimmste Sünde begangen. Solche Menschen wurden früher gesteinigt, das steht in der Bibel. Ich glaube, manche Leute würden es am liebsten heute noch tun.«
»Wie können wir ihr helfen?«
»Du sagst, sie weiß nicht, wohin.«
»Das hat sie mir gesagt. Wenn man sie hinauswirft, steht sie mutterseelenallein auf der Straße. Lilias, das kann ich nicht ertragen. Sie war hier so glücklich. Ich kann nicht vergessen, wie sie gelacht hat, wenn er sie ansah und mit ihr scherzte ... und das hat sie nun davon.«
Lilias wurde nachdenklich. Dann sagte sie unvermittelt: »Ich fühle dasselbe für Kitty wie du. Hamish ist ein Schuft, und sie ist ein törichtes, flatterhaftes Mädchen. Er hat sie verführt, und sie hat nachgegeben. Das ist verständlich. Und deswegen ist ihr Leben zerstört, während er fröhlich seiner Wege geht.«
»Wenn Vater Kitty entläßt, muß er Hamish auch entlassen – Hamish muß dann auch fortgehen.«
»Aber er wird doch nicht die ganze Familie Vosper hinauswerfen? Ich hab’ eine Idee: Ich schicke Kitty zu mir nach Hause.«
»Was könnte deine Familie für sie tun?«
»Mein Vater ist der Pfarrer von Lakemere. Er ist ein wahrer Christ. Damit will ich sagen, er praktiziert, was er predigt. Das tun nämlich nur wenige Menschen, mußt du wissen. Er ist ein wahrhaft guter Mensch. Wir sind arm, aber er würde Kitty das Obdach nicht verweigern. Vielleicht findet er eine Stellung für sie. Es wäre nicht das erste Mal, daß er einem Mädchen hilft, das in Schwierigkeiten geraten ist. Ich werde ihm schreiben.«
»Würde er sie aufnehmen, nach dem, was sie getan hat?«
»Wenn ich es ihm schreibe, wird er Verständnis haben.«
»O Lilias, das wäre wundervoll!«
»Es ist zumindest eine Hoffnung«, sagte Lilias.
Ich umarmte sie stürmisch. »Du schreibst den Brief, ja? Sagst du ihr, wo sie hingehen kann? Ich sehe mal nach, wieviel Geld ich habe. Ob wir ihr das Fahrgeld geben können?«
»Ich denke, man wird ihr den Lohn geben, den man ihr schuldet, und damit dürfte es reichen.«
»Ich gehe und sag’s ihr. Ich muß zu ihr. Der schreckliche verzweifelte Ausdruck in ihrem Gesicht war mir unerträglich.« Ich ging zu Kitty und erzählte ihr von unserem Vorhaben, und zu meiner Freude sah ich, wie ihre elende Verzweiflung sich in Hoffnung verwandelte.
Mein Vater kehrte spät in der Nacht zurück. Ich lag im Bett und hörte ihn kommen. In dieser Nacht würde der Sturm noch nicht losbrechen.
Am nächsten Morgen schickte er nach Kitty. Blaß, verschämt, doch nicht so verzweifelt wie zuvor, trat sie in sein Studierzimmer. Ich wartete auf der Treppe auf sie. Als sie herauskam, sah sie mich an und nickte. Wir gingen in ihr Zimmer, wo Lilias sich zu uns gesellte.
»Ich muß meine Sachen packen und gehen. Gepackt hab’ ich schon.«
»Sofort?« fragte ich.
Sie nickte. »Er meinte, ich sei eine Schande für das Haus und er müsse an seine Tochter denken.«
»Ach, Kitty«, sagte ich. »Wie schade, daß du fortmußt.«
»Sie waren ein Engel, Miss Davina, Sie und Miss Milne.« Ihre Stimme versagte. »Ich weiß nicht, was ich ohne Ihre Hilfe getan hätte.«
»Hier ist der Brief«, sagte Lilias. »Nimm ihn. Und hier ist etwas Geld.«
»Ich hab’ den Lohn bekommen, der mir zustand.«
»Dann hast du jetzt noch ein bißchen mehr. Damit kommst du bis Lakemere. Mein Vater ist die Güte selbst. Niemals würde er einen verzweifelten Menschen abweisen. Er wird alles tun, um dir zu helfen. Er hat Menschen in Not immer beigestanden.« Kitty brach in Tränen aus und umarmte uns. »Ich werde Sie beide nie vergessen«, schluchzte sie. »Was hätte ich nur angefangen ohne ...«
Eine Droschke war bestellt worden, um sie zum Bahnhof zu bringen. Eine bedrückte Stimmung verbreitete sich im Haus. Kitty war in Schande entlassen worden. Das sollte törichten Mädchen eine Lehre sein.
Und jetzt kam Hamish an die Reihe. Er wurde zum Herrn bestellt. Die Hände in den Taschen, stolzierte er ins Haus. Er ließ kein Zeichen von Reue erkennen. So trat er in das Studierzimmer meines Vaters, und die Türe schloß sich hinter ihnen.
Lilias kam in mein Zimmer. »Was wird nun werden?« fragte sie. »Es ist so verzwickt, wo doch seine Eltern über den Stallungen wohnen.«
»Er wird natürlich entlassen. Er darf das Haus nicht mehr betreten. Nun, wir werden sehen.«
Das ganze Haus wartete, was nun geschehen würde. Die Unterredung dauerte lange, doch niemand vernahm erhobene Stimmen aus dem Studierzimmer. Schließlich kam Hamish heraus und verließ still das Haus.
Erst am folgenden Tag erfuhren wir, daß Hamish meinen Vater weiterhin kutschieren sollte und daß die Bestrafung, die seiner Mittäterin auferlegt worden war, ihn nicht traf.
Es herrschte Verwirrung. Hamish stolzierte so selbstbewußt wie zuvor einher und pfiff vor sich hin, als sei nichts geschehen. Das war uns unbegreiflich.
Es entsprach nicht Tante Robertas Natur, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Sie brachte sie eines Abends beim Essen zur Sprache. »Das Mädchen ist gegangen«, sagte sie, »und was ist mit ihm?«
Mein Vater tat, als ob er nicht verstanden hätte. Er hob die Augenbrauen und nahm jene kühle Haltung an, die die meisten von uns einschüchterte. Nicht aber Tante Roberta.
»Du weißt, wovon ich spreche, David, also stell dich nicht so an, als hättest du keine Ahnung.«
»Vielleicht«, sagte er, »möchtest du so gut sein, mich aufzuklären.«
»Vorgänge wie der, der sich kürzlich in diesem Hause ereignete, kann man gewiß nicht einfach übergehen.«
»Ich verstehe«, sagte er, »du meinst die Entlassung des Mädchens.«
»Sie war nicht die Alleinschuldige.«
»Der Mann ist einer der besten Kutscher, die ich je hatte. Ich beabsichtige nicht, auf seine Dienste zu verzichten, falls du darauf hinauswillst.«
Tante Roberta vergaß ihre Würde und kreischte: »Was?« Mein Vater machte ein gequältes Gesicht. »Ich habe mich mit der Angelegenheit befaßt«, sagte er kühl. »Der Fall ist erledigt.«
Tante Roberta konnte ihn nur anstarren. »Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich sage dir, ich habe sie beide gesehen. Auf frischer Tat ertappt.«
Mein Vater sah sie weiterhin kühl an, dann warf er einen bedeutungsvollen Blick in meine Richtung, der besagte, angesichts meiner Jugend und Unschuld dürften sie eine solch heikle Angelegenheit nicht in meiner Gegenwart besprechen.
Tante Roberta preßte die Lippen zusammen und funkelte ihn böse an.
Der Rest der Mahlzeit verlief in fast völligem Schweigen. Doch anschließend folgte Tante Roberta meinem Vater in sein Studierzimmer. Dort blieb sie ziemlich lange, und als sie herauskam, begab sie sich geradewegs in ihr Zimmer.
Am nächsten Morgen reiste sie ab, mit der Miene der Gerechten, die Sodom und Gomorrha verläßt, bevor das Unheil hereinbricht. Sie konnte keine Nacht mehr in einem Haus bleiben, wo eine Sünde vergeben wurde, weil der eine Sünder ein »guter Kutscher« war.
Die Angelegenheit wurde im Erdgeschoß ausführlich besprochen – nicht in meiner Gegenwart, aber das meiste wurde mir von Lilias zugetragen.
»Es ist wirklich eigenartig«, sagte sie. »Niemand versteht es. Dein Vater ließ Hamish zu sich kommen, und wir dachten, er würde entlassen wie Kitty. Aber Hamish kam aus dem Zimmer, anscheinend selbstsicherer denn je. Was gesprochen wurde, weiß kein Mensch. Aber er macht einfach weiter wie bisher. Und wenn man bedenkt, daß die arme Kitty ohne Erbarmen hinausgeworfen wurde! Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Aber in solchen Fällen geben sie ja immer der Frau die Schuld, und die Männer kommen ungeschoren davon.«
»Ich verstehe das nicht«, sagte ich. »Vielleicht ist es, weil er nicht im Haus wohnt.«
»Er kommt aber ins Haus. Er besticht die Dienstboten.«
»Ich frage mich, warum. Ich wünschte, ich wüßte es.«
»Dein Vater ist nicht leicht zu verstehen.«
»Aber er ist so fromm, und Hamish ...«
» ...ist ein Schuft. Es bedurfte dieser Geschichte nicht, um mir das zu beweisen. Wir haben alle gesehen, was der für ein Kerl ist. Leider ist Kitty so ein Dummchen, daß sie sich von ihm verführen ließ. Ich gebe zu, er hat etwas. Sie muß ihn unwiderstehlich gefunden haben.«
»Ich kenne jemanden, der findet ihn wundervoll.«
»Wer?« »Er selbst.«
»Wie wahr. Wenn je ein Mann in sich selbst verliebt war, dann Hamish Vosper. Aber den Dienstboten paßt das Ganze nicht. Kitty hat gute Arbeit geleistet, und sie war allen sympathisch.«
»Ich hoffe nur, daß es ihr gutgeht.«
»Ich weiß, daß sie nicht abgewiesen wird. Mein Vater wird tun, was er kann. Er ist ein wahrer Christ.«
»Mein Vater ist es angeblich auch, aber er hat sie hinausgeworfen.«
»Dein Vater versteht sich gut aufs Beten und darauf, sich wie ein Christ zu gebärden. Mein Vater versteht sich gut darauf, einer zu sein. Das ist der Unterschied.«
»Das hoffe ich um Kittys willen.«
»Er wird mir schreiben, wie es ihr ergangen ist.«
»Ich bin so froh, daß du hier bist, Lilias.« Das rief ein Stirnrunzeln bei ihr hervor. Wie lange noch? mochte sie sich fragen. Mein Vater hatte Kitty mitleidlos entlassen. Lilias würde gehen müssen, wenn ihre Dienste nicht mehr gefragt waren. Sie hatte recht: Mein Vater verstand sich sehr gut darauf, der Welt ein christliches Verhalten vorzuspielen, aber er hatte seine eigene Vorstellung von Recht und Unrecht. Lilias hatte mir seine Anschauung klargemacht; und ich hatte ja selbst gesehen, was mit Kitty geschehen war.
Was aber war der wahre Grund, weswegen Hamish verziehen worden war? Hatte er bleiben dürfen, weil er ein guter Kutscher war? Oder weil er ein Mann war?
Nach einer Weile ebbte das ständige Gerede über die Affäre ab. Ein neues Zimmermädchen wurde als Ersatz für Kitty eingestellt, Ellen Farley, eine Frau von etwa dreißig Jahren. Sie sei ihm empfohlen worden, sagte mein Vater. Mr. und Mrs. Kirkwell waren darob etwas ungehalten. Schließlich waren sie für die Einstellung von Personal zuständig, und es paßte ihnen nicht, daß ihnen ein Hausmädchen so einfach vor die Nase gesetzt wurde, wie Mrs. Kirkwell sich ausdrückte. Es fiel auf sie und Mr. Kirkwell zurück, daß sie Kitty ausgesucht hatten. Doch wenn man Mrs. Kirkwell fragte, so war der wahre Schuldige in dieser Angelegenheit Hamish Vosper, und warum der bleiben durfte, das war ihr schleierhaft.
Wie dem auch sei, Ellen kam ins Haus. Sie war ganz anders als Kitty – ruhig und tüchtig. Und, sagte Mrs. Kirkwell, sehr zurückhaltend.
Hamish kam nach wie vor in die Küche und setzte sich an den Tisch, sichtlich amüsiert, weil Mrs. Kirkwell so tat, als sei er nicht da. Er warf ein Auge auf Bess und Jenny, doch im Gedenken an Kitty waren die beiden auf der Hut.
Hamish schien der Meinung, er sei unangreifbar und könne sich aufführen, wie er wolle, da dies seinem Wesen entspreche. Von einem Mann wie ihm, dem die Weiblichkeit nicht widerstehen könne, dürfe man nicht erwarten, sich anders zu verhalten, als es die Natur ihm eingebe. Aber ich dachte mir, er werde anderswo nach Eroberungen Ausschau halten müssen; denn in unserem Haus würde er kein Glück mehr haben. Kittys Schicksal war allen noch frisch im Gedächtnis.
Nicht lange, und es kam ein Brief vom Pfarrhaus in Lakemere.
Lilias ging damit in ihr Zimmer, und ich begleitete sie, um ihn mit ihr zusammen zu lesen.
Kitty war angekommen, und der Pfarrer hatte sich genauso verhalten, wie Lilias vorausgesagt hatte. Sie las mir die wichtigste Passage vor.
... Sie ist so dankbar. Sie kann Dich gar nicht genug loben, Lilias, und Davina, Deine Schutzbefohlene. Ich bin stolz auf Dich. Das arme Kind – denn sie ist kaum mehr als ein Kind – befand sich in tiefster Verzweiflung. Sie macht sich bei Alice und Jane in der Küche und auch sonst im Hause nützlich. Du kennst doch Mrs. Ellington, eine sehr energische, aber gutherzige Dame. Ich habe sie aufgesucht und ihr die ganze Geschichte erzählt. Das mußte ich selbstverständlich. Sie versprach, Kitty eine Chance zu geben, und ich bin sicher, das arme Kind wird nicht noch einmal einen Fehltritt begehen. Ein Hausmädchen verläßt Mrs. Ellington in ein paar Wochen, um zu heiraten, daher wird bei ihr eine Stelle frei. Bis dahin kann Kitty hier bleiben und Alice und Jane zur Hand gehen. Lilias, ich bin so froh, daß Du so gehandelt hast. Nicht auszudenken, was sonst aus der armen Kitty geworden wäre ...
Ich sah Lilias an. Meine Augen waren feucht geworden. »O Lilias, dein Vater ist ein wunderbarer Mensch.«
»Das ist wahr.«
Die Antwort des Pfarrers von Lakemere veranlaßte mich, erneut über meinen eigenen Vater nachzudenken. Ich hatte ihn stets als aufrechten, ehrenwerten Menschen angesehen. Doch als er Kitty kurzerhand entließ und Hamish keinerlei Strafe auferlegte, außer vielleicht einer mündlichen Ermahnung, da hatte sich mein Bild von ihm gewandelt. Er war mir immer so erhaben vorgekommen, aber jetzt sah ich ihn mit anderen Augen. Früher hatte ich gedacht, er sei zu edel, um als einer von uns betrachtet zu werden; jetzt änderten sich meine Gefühle für ihn. Wie konnte ihm so wenig daran liegen, was aus einem Menschen wurde? Wie konnte er Kitty in die rauhe Welt hinausschicken, während er ihren Mittäter behielt, bloß weil der ein guter Kutscher war? Er handelte nicht aus Rechtschaffenheit, sondern in seinem eigenen Interesse. Das Bild vom guten, edlen Menschen verblaßte. Hätte meine Mutter noch gelebt, hätte ich mit ihr reden können. Aber dann wäre es ohnehin nicht so weit gekommen. Sie hätte nicht zugelassen, daß Kitty fortgeschickt würde, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollte. Ich war verwirrt und beunruhigt.
Eines Tages schickte mein Vater nach mir, und als ich in sein Studierzimmer kam, sah er mich ganz seltsam an. »Du wirst erwachsen«, sagte er, »du bist fast siebzehn, nicht wahr?« Ich bejahte, voller Angst, dies sei die Einleitung zu Lilias’ Entlassung, da ihre Dienste nicht mehr gefragt seien. Ich befürchtete, sie würde ebenso hastig entlassen werden wie Kitty.
Doch noch war es nicht soweit. Er wandte sich einer Schatulle zu, die auf dem Tisch stand. Ich kannte sie gut. Sie enthielt den Schmuck meiner Mutter. Sie hatte ihn mir mehr als einmal gezeigt, indem sie jedes einzelne Stück herausnahm und mir etwas dazu erzählte.
Die Perlenkette hatte ihr Vater ihr an ihrem Hochzeitstag geschenkt. Der Rubinring hatte ihrer Mutter gehört. Da waren das mit Türkisen besetzte Armband und die dazupassende Halskette, zwei goldene Broschen und eine silberne. »Sie werden dir gehören, wenn du groß bist«, hatte sie gesagt, »und du wirst sie an deine Tochter weitergeben. Es ist ein hübscher Gedanke, daß diese Schmuckstücke von einer Generation an die nächste weitergereicht werden, nicht wahr?« Und ich hatte ihr beigepflichtet.
Mein Vater nahm die Perlenkette heraus und hielt sie in seinen Händen. Meine Mutter hatte mir erklärt, es seien sechzig Perlen, und die Schließe schmücke ein echter Diamant, umgeben von Staubperlen. Ich hatte sie die Kette bei verschiedenen Anlässen tragen sehen – wie die meisten anderen Schmuckstücke, die sich in der Schatulle befanden.
Mein Vater sagte: »Es war der Wunsch deiner Mutter, daß du diese Dinge bekommst. Ich finde, du bist noch zu jung für den anderen Schmuck, aber die Perlenkette sollst du jetzt schon haben. Denn man sagt doch, Perlen verlieren ihren Glanz, wenn sie nicht getragen werden.«
Ich nahm die Halskette an mich. Meine erste Empfindung war Erleichterung. Wenn Vater mich für zu jung hielt, um Schmuck zu tragen, dann war es noch nicht an der Zeit, mich von Lilias zu trennen. Und über die Perlenkette freute ich mich.
Ich legte sie um den Hals, und bei dem Gedanken an meine Mutter wurde ich von Traurigkeit übermannt.
Als ich zu Lilias kam, fiel ihr sogleich die Kette auf. »Ist die schön!« rief sie aus. »Wirklich wunderschön.«
»Sie hat meiner Mutter gehört. Sie hatte noch etliche Broschen und Ringe. Die bekomme ich später auch. Vater meint jedoch, ich bin jetzt noch zu jung dafür. Aber Perlen tut es nicht gut, wenn sie nicht getragen werden.«
»Das habe ich auch gehört«, sagte sie. Sie strich liebevoll über die Perlen, und ich nahm die Halskette ab und reichte sie ihr. »Eine hübsche Schließe«, sagte sie. »Die dürfte allein schon eine Menge wert sein.«
»Oh, ich möchte sie nicht verkaufen.«
»Natürlich nicht. Ich dachte bloß ... es wäre ein hübscher kleiner Notgroschen.«
»Du meinst: für schlechte Zeiten.«
»Ja, es ist ein Trost, solche Dinge zu haben.«
Ich bemerkte den traurigen, nachdenklichen Ausdruck in ihren Augen. Ich vermutete, sie blickte in eine Zukunft, wo ein Notgroschen ihr ein großer Trost sein könnte.
Ich ging in die Küche hinunter, um mich zu erkundigen, ob mein Vater zum Abendessen dasein werde. Gewöhnlich hinterließ er eine Nachricht für Mrs. Kirkwell. In der Küche herrschte eine unbehagliche Stimmung, weil Hamish mit aufgekrempelten Ärmeln am Tisch saß und träge an den Haaren auf seinen Armen zupfte.
Ich trat zu Mrs. Kirkwell, die etwas in einer Schüssel verrührte. Sie bemerkte die Perlenkette sogleich. »Meiner Treu«, rief sie aus, »die steht Ihnen gut.«
»Ja. Sie gehört jetzt mir. Ich muß sie tragen, weil Perlen stumpf werden, wenn sie zu lange weggeschlossen sind.«
»Ist das wahr?«
»Vater hat es gesagt.«
»Nun, er muß es wissen, nicht? Jedenfalls, die Kette steht Ihnen gut, Miss Davina.«
»Die Schließe ist auch wertvoll«, sagte ich. »Es ist ein Diamant darauf, und ringsum sind kleine Perlen. Miss Milne meint, es sei ein Notgroschen ... falls ich je in Not gerate.«
Mrs. Kirkwell lachte. »Sie doch nicht, Miss Davina. Aber daß sie auf solche Gedanken kommt, ist nur natürlich. Armes Seelchen. Gouvernanten ... also ich hab’ immer gesagt, ich möchte keine sein.«
»Hat mein Vater gesagt, ob er heute abend zum Essen zu Hause ist?«
Ehe sie antworten konnte, blickte Hamish auf und sagte: »Nee, ist er nicht. Ich weiß es. Ich fahr’ ihn.«
Mrs. Kirkwell antwortete, als ob er nicht gesprochen hätte: »Er hat eine Nachricht hinterlassen, daß er nicht dasein wird.«
Am nächsten Tag entdeckte ich bestürzt, daß meine Perlenkette verschwunden war. Ich hatte sie in ihrem blauen Kästchen in der Schublade meiner Frisierkommode verwahrt. Ich war fassungslos, als ich entdeckte, daß das Kästchen da war, die Kette jedoch fehlte. Hastig durchwühlte ich sämtliche Schubladen, aber vergebens. Die Kette war weg. Rätselhaft. Ich war ganz sicher, sie in das Kästchen getan zu haben.
Alle waren entsetzt. Wenn ein wertvoller Gegenstand wie diese Halskette verschwinde, sagte Mrs. Kirkwell, könne das für alle unangenehm werden. »Halsketten kriegen nun mal keine Beine«, sagte sie. Deshalb laute die logische Schlußfolgerung, daß jemand sie an sich genommen hatte. Wer? Niemand könne sich frei von Verdacht fühlen.
Mein Vater kehrte an diesem Abend erst spät, von Hamish kutschiert, nach Hause zurück, und da alle sich schon zur Ruhe begeben hatten, erfuhr er erst am nächsten Morgen von dem Verschwinden der Halskette.
Ich war vermutlich nicht die einzige, die eine schlaflose Nacht hatte. Wir hatten einen Dieb im Haus, und natürlich verdächtigte ich Hamish. Wenn er zu jener anderen Tat fähig war, mochte er da nicht glauben, es sei die »menschliche Natur«, jemandem, der sie nicht brauchte, eine Halskette wegzunehmen, um sie jemandem zu geben, der sie brauchte – in diesem Fall sich selbst?
Aber Hamish kam eigentlich nie weiter als bis in die Küche. Seit er mit Kitty im Schlafzimmer erwischt worden war, gab es eine stillschweigende Übereinkunft, daß er die oberen Stockwerke nicht betreten durfte, es sei denn, er wurde von meinem Vater dorthin bestellt. Es bestand natürlich die Möglichkeit, daß er sich nicht immer an diese Regel hielt; aber ich hatte ihn seit jener Affäre nur in der Küche gesehen. Aber vielleicht hatte er sich doch in mein Zimmer hinaufgeschlichen und die Kette an sich genommen? Wäre er dort erwischt worden, hätte er bestimmt eine Erklärung für seine Anwesenheit parat gehabt.
Mein Vater war natürlich außer sich. Er ordnete eine gründliche Durchsuchung meines Zimmers an. Er bombardierte mich mit Fragen. Erinnerte ich mich, die Halskette abgenommen zu haben? Erinnerte ich mich, sie ins Kästchen gelegt zu haben? Wer war seitdem in meinem Zimmer gewesen? Nur das Mädchen zum Reinemachen und Miss Milne natürlich. Sie war gekommen, um etwas mit mir zu besprechen. Was es war, hatte ich vergessen.
Er befahl, daß sich alle in der Bibliothek einfinden sollten. »Dies ist eine schwerwiegende Angelegenheit«, eröffnete erden Versammelten. »Ein wertvolles Schmuckstück wird vermißt. Jemand in diesem Hause weiß, wo es ist. Ich werde der betreffenden Person eine Chance geben, es jetzt auszuhändigen. Ist das geschehen, werde ich die Angelegenheit bedenken. Aber wenn die Kette mir nicht heute übergeben wird, verständige ich die Polizei. Sind alle anwesend?«
»Wo ist Ellen?« fragte Mrs. Kirkwell.
»Ich weiß nicht«, sagte Bess. »Sie ist mir beim Aufräumen zur Hand gegangen. Ich hab’ sie gerufen, als wir in die Bibliothek bestellt wurden.«
»Jemand muß sie verständigen«, sagte Mrs. Kirkwell. »Ich gehe selbst.«
Mrs. Kirkwell brauchte nicht zu gehen, denn just in diesem Moment erschien Ellen. In der Hand hielt sie die Perlenkette. »Ich hörte Bess rufen, wir sollen hierherkommen«, sagte sie. »Aber ... ich hatte das hier gerade gefunden. Ich konnte die Schublade nicht schließen. Sie war halb offen und sah unordentlich aus. Ich dachte, irgendwas ist vielleicht eingeklemmt. Da hab’ ich die Schublade darunter aufgemacht. Es war ein Unterrock. Ich zog ihn hervor, und dabei fiel das hier heraus. Ist es das vermißte Stück?«
»In welcher Schublade hast du das gefunden?« fragte mein Vater.
»In Miss Milnes Zimmer, Sir.«
Ich sah Lilias an. Ihr Gesicht war knallrot geworden, und nun wurde es todesbleich. Es war, als töne eine Stimme in meinem Kopf. Ein Notgroschen, ein Notgroschen ... Nein. Lilias konnte es nicht gewesen sein.
Alle sahen sie an.
Mein Vater sagte: »Miss Milne, können Sie erklären, wie die Halskette in Ihre Schublade geraten ist?«
»In ... meine Schublade? Das kann nicht sein.«
»Aber Ellen hat es uns soeben gesagt. Und hier ist die Kette. Miss Milne, ich verlange eine Erklärung.«
»Ich ... ich habe sie nicht hineingetan. Ich ... kann das nicht verstehen.«
Mein Vater sah Lilias streng an. »Das genügt nicht, Miss Milne. Ich wünsche eine Erklärung.«
Ich hörte mich mit hoher, überkippender Stimme sagen: »Es muß einen Grund geben ...«
»Natürlich gibt es einen Grund«, unterbrach mich mein Vater ungehalten. »Miss Milne wird ihn uns nennen. Sie haben die Halskette genommen, nicht wahr, Miss Milne? Zu Ihrem Pech haben Sie die Schublade nicht richtig geschlossen, so daß Ellen merkte, daß etwas nicht in Ordnung war. Das war ein Glück für uns ... nicht aber für Sie.«
Lilias machte ein entsetztes Gesicht.
Wie konntest du? dachte ich. Ich hätte dir jederzeit geholfen. Warum hast du die Kette genommen? Und Vater weiß es! Mein Vater wird niemals eine Sünde dulden – und Stehlen ist eine schwere Sünde. »Du sollst nicht stehlen.« Das ist eines der Zehn Gebote. Denk an Kitty. Hamish ist natürlich nichts passiert, aber der war ja auch ein guter Kutscher.
Ich wünschte, dieser Alptraum wäre vorüber. Das entsetzliche Schweigen wurde schließlich von meinem Vater gebrochen. »Ich warte auf eine Erklärung, Miss Milne.«
»Ich ... ich weiß nicht, wie sie dahin gekommen ist. Ich wußte nicht, daß sie da war ...«
Mein Vater ließ ein leises, spöttisches Lachen hören. »So kommen Sie nicht davon, Miss Milne. Sie sind überführt. Ich könnte Sie natürlich der Polizei übergeben.«
Sie schnappte nach Luft. Ich dachte, sie werde ohnmächtig. Ich mußte mich zurückhalten, um sie nicht in meine Arme zu nehmen und ihr zu sagen, was immer sie getan habe, sie sei meine Freundin.
Sie hob die Augen und sah mich flehend an, eine stumme Bitte, ihr zu glauben. Und da wußte ich: Nein, Lilias hatte meine Kette nicht gestohlen, obwohl sie sich so sehnlich einen Schutz gegen eine entbehrungsreiche Zukunft; wünschte. Einen Notgroschen. Ich erschrak über mich selbst, daß ich an ihrer Unschuld hatte zweifeln können, und ich verabscheute mich dafür.
»Das ist ein Verbrechen«, fuhr mein Vater fort. »All die Jahre sind Sie in meinem Hause gewesen. Ich habe eine Diebin beherbergt. Das betrübt mich sehr.«
»Ich hab’s nicht getan!« rief Lilias. »Ich war’s nicht! Jemand hat sie da hineingelegt.«
»Allerdings hat jemand sie hineingelegt«, versetzte mein Vater grimmig. »Sie, Miss Milne. Sie sind eine Pfarrerstochter. Sie haben eine religiöse Erziehung genossen. Das macht die Sache um so abscheulicher.«
»Sie verurteilen mich ohne Untersuchung.« Lilias’ Augen blitzten. Es war der Mut der Verzweiflung. Wer konnte die Kette in ihr Zimmer gelegt haben? Und zu welchem Zweck? Wenn jemand sie genommen hatte, was nützte es ihm, sie zu stehlen und dann loszuwerden ... nur um Lilias zu belasten?
»Ich bat Sie um eine Erklärung«, fuhr mein Vater fort, »aber Sie haben keine.«
»Ich kann nur sagen, ich habe die Kette nicht genommen.«
»Dann erklären Sie, wie sie in Ihr Zimmer gekommen ist.«
»Ich kann nur wiederholen: Ich habe sie nicht dorthin gelegt.«
»Miss Milne, wie gesagt, ich könnte Sie verklagen. Dann könnten Sie Ihre Erklärungen vor Gericht abgeben. Aber um Ihrer Familie willen und weil Sie so viele Jahre in diesem Hause waren und Ihnen in dieser Zeit keine Diebstähle nachgewiesen wurden, lasse ich Milde walten. Ich will annehmen, daß Sie von einer plötzlichen Versuchung befallen wurden und ihr erlegen sind. Und nun bitte ich Sie, Ihre Sachen zu packen und dieses Haus unverzüglich zu verlassen. Mrs. Kirkwell wird Sie begleiten und sich vergewissern, daß Sie nichts mitnehmen, was Ihnen nicht gehört.«
Lilias sah meinen Vater haßerfüllt an. »Wie können Sie mich so ungerecht verurteilen? Ich lasse mich nicht wie eine Verbrecherin behandeln.«
»Wäre es Ihnen lieber, wenn Ihr Fall vor Gericht verhandelt würde?«
Sie schlug die Hände vors Gesicht, dann drehte sie sich ohne ein weiteres Wort um und ging hinaus.
Mein Vater sagte: »Das ist bedauerlich, aber der Fall ist erledigt.«
Erledigt? Lilias wegen Diebstahls entlassen! Ihr Ruf war befleckt. Sie würde ihr Leben in der ständigen Angst verbringen, die Tatsache, daß sie des Diebstahls bezichtigt worden war, werde ans Licht kommen.
Ich ging in ihr Zimmer. Sie saß auf dem Bett und starrte unverwandt vor sich hin. Ich lief zu ihr und schlang meine Arme um sie.
»O Lilias, Lilias«, weinte ich. »Es ist schrecklich. Ich glaube dir.«
»Danke, Davina. Wer kann mir das angetan haben? Und warum?«
»Ich weiß es nicht. Zuerst die arme Kitty, und jetzt du. Seit meine Mutter starb, ist es, als liege ein schrecklicher Fluch auf diesem Haus. Ich fühle mich von Gefahr, von etwas Bösem umgeben – wie in einer Schlangengrube.
»Ich muß nach Hause und es erzählen. Wie soll ich das fertigbringen?«
»Dein Vater wird es verstehen. Er wird dir glauben. Er ist ein Christ.«
»Ich werde ihnen zur Last fallen. Ich kann nie wieder eine Stellung bekommen.«
»Warum nicht?«
»Die Leute werden wissen wollen, wo ich gewesen bin ... warum ich gegangen bin.«
»Könntest du nicht sagen, daß ich zu alt geworden sei? Es ist sogar die Wahrheit.«
»Sie würden sich bei deinem Vater über mich erkundigen.«
»Vielleicht würde er nichts sagen.«
Sie lachte. Es war ein unfrohes Lachen. »Natürlich würde er es sagen. Er würde es als unaufrichtig betrachten, es nicht zu tun. Er ist so tugendhaft, daß er einer Frau nicht die Chance geben kann, sich zu verteidigen. Menschen wie er lieben es, die Sünde bei anderen zu suchen. Sie sind so darauf versessen, daß sie sie sehen, wo sie nicht vorhanden ist. Es gibt ihnen das Gefühl, noch besser zu sein, und sie danken Gott, daß sie nicht sind wie die anderen.«
»Ach, Lilias, es wird gräßlich sein ohne dich. Ich wünschte, ich hätte diese Halskette nie gesehen.«