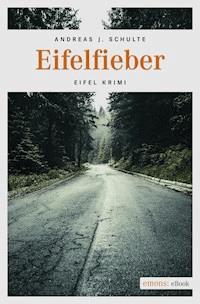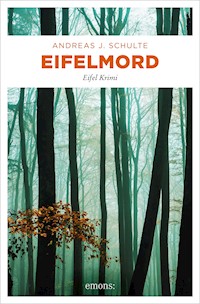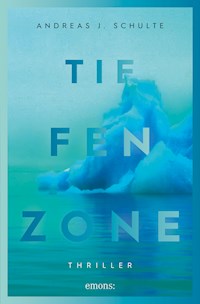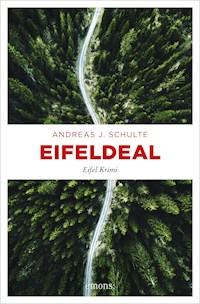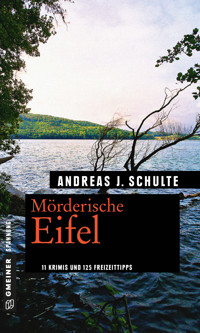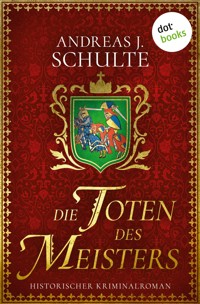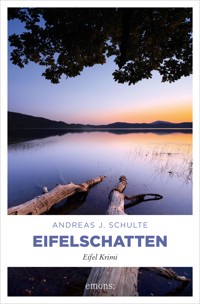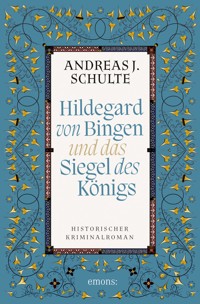Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Konrad von Hohenstade
- Sprache: Deutsch
Sechs Tage, um den Feind zu stellen und das Reich zu retten. Was aber, wenn dich dieser Feind besser kennt als jeder Freund? Januar 1477: Nach dem Tod Karls des Kühnen wird das Herzogtum zum Spielball der europäischen Mächte. Karls Tochter, Maria von Burgund, sieht ihr Erbe in Gefahr. Ihr bleiben nur wenige Wochen, um Maximilian von Habsburg zu heiraten und so Frankreichs Zugriff auf Burgund abzuwehren. Als Zeichen ihrer Gunst entsenden die Habsburger eine der kostbarsten Reliquien des Christentums: Eine Phiole mit dem Blut Jesu Christi. Doch die Eskorte wird überfallen und grausam ermordet. Die Phiole mit dem Blut verschwindet spurlos. Nun liegt es an Konrad von Hohenstade, Bevollmächtigter des Kaisers und Ritter im Orden des Schwarzen Adlers, diese Kostbarkeit zu finden. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Schicksal Burgunds hängt von seinem Erfolg ab. Dabei muss er sich einem geheimnisvollen, unerbittlichen Gegner stellen, dessen Taten eine dunkle Spur durch das Land ziehen. Die Spur des Schnitters … »Eine kongeniale Fortsetzung des Debüts.«– Jörg Kijanski, Histo-Couch Der packende zweite Band einer perfekt recherchierten und abenteuerlichen Mittelalter-Krimireihe für Fans von Daniel Wolf und Oliver Pötzsch. In »Das Blut des Kaisers« wird Konrad in Andernach zum persönlichen Beschützer von Maximilian von Habsburg – und muss sich gegen Spionage, Bestechung und Verrat zur Wehr setzen … Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Toten des Meisters Band 2: Die Rache des Schnitters Band 3: Das Blut des Kaisers
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
eBook-Neuausgabe Dezember 2025
Dieses Buch beinhaltet die Romane »Die Spur des Schnitters« und »Die Ehre der Zwölf«, die im Jahr 2014 und 2015 als Einzelbände im Ammianus Verlag erschienen.
Copyright © der Originalausgaben © 2014 und 2015 Ammianus GbR Aachen
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/dershana; shutterstock/WinWin artlab, PARINYAS; iStock/Matorini und eine Illustration aus dem Codex Maness
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-593-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andreas J. Schulte
Die Rache des Schnitters
Historischer Kriminalroman │ Ein Fall für Konrad von Hohenstade 2
dotbooks.
Für meine Schwestern Gisela und Brigitte, die nie an ihrem kleinen Bruder zweifeln.
Und für Tine, ohne die dieses Buch nie geschrieben worden wäre.
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stiess mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus.
Johannes 19, 33f
Prolog
Kloster Santa Maria di Ripalta di Puglia, Apulien im Frühjahr 1454
»Erzählt! Lasst Euch Zeit.«
»Ihr kennt doch die Geschichte längst, Herr.
Was kann ich Euch da noch berichten?«
»Beginnen wir mit Eurem Namen.«
»Heinrich, ich wurde auf den Namen Heinrich getauft.«
»Heinrich ... und weiter?«
»Heinrich Erzer. Doch das ist nicht der Name meines Vaters. Meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters als Magd beim Ratsherrn von Erzer gearbeitet. Als ich 13 Jahre alt war, hat der mich in seinen Haushalt aufgenommen. Eine lange Geschichte, die Ihr bestimmt nicht hören wollt. Bleibt einfach bei Heinrich. Heinrich von Andernach.«
»Wie Ihr wollt, Heinrich von Andernach. Ihr seid ein junger Kerl, augenscheinlich stark wie ein Ochse. Nicht älter als – wie viel? 20, 23 Jahre? Euer Leben liegt noch vor Euch. Sicher war das alles ein großes Abenteuer für Euch.«
Heinrich hob zum ersten Mal den Blick von der rissigen Holzplatte des Tisches. Der Abt hatte ihm aufgetragen, alle Fragen des fremden Herrn zu beantworten, der sei im Namen des neuen Kaisers gekommen. Auf ihn wirkte der Fremde wie jemand, der seine Macht genoss, sich aber nicht gern selber die Hände schmutzig machte. Wahrscheinlich hatte er deshalb den bulligen Ritter dabei, der die Tür der Kammer bewachte.
Ein hoher Herr im Namen des neuen Kaisers ... Scheiß drauf, er hatte lange genug geschwiegen.
»Ein Abenteuer?«, Heinrich spuckte die Worte seinem Gegenüber förmlich ins Gesicht, »Ihr habt noch nie auf einem Schlachtfeld gestanden und im Blut und den Eingeweiden Eurer Kameraden gewatet – oder? Sack und Asche, was für eine dämliche Frage! Ihr wollt wissen, wie es war? Es war die Hölle auf Erden, und ich habe sie durchlitten, jede einzelne Stunde, jeden Tag, endlose Wochen lang. Mein Leben liegt noch vor mir? Da irrt Ihr Euch gewaltig. Meine Seele hat der Satan persönlich in seinen Klauen. Aber wenn es einen gnädigen Gott gibt, werde ich hier hinter diesen Klostermauern meinen Frieden finden.«
Heinrich verstummte, ein Zittern durchlief seine breiten Schultern. Er vergrub sein Gesicht in beide Hände. Es war dieses stumme Schluchzen, das den Fremden mehr als alle Worte erschaudern ließ: ein junger Söldner mit den Augen eines alten Mannes. Das Schlachtfeld konnte einen Mann für immer verändern – hatte er gehört – diesen hier hatte es gebrochen.
Heinrich ließ die Hände sinken und murmelte: »Ihr wollt die Wahrheit hören? Nun gut ...« Er setzte sich aufrecht hin.
»Es begann alles bereits vor zwei Jahren. Später werden die Chronisten sagen, dass im Jahre des Herrn 1452 das christliche Abendland einfach weggeschaut hat. Dreck und Teufel – sicher haben auch Friedrich und seine Fürsten die Zeichen erkannt: Sultan Mehmed II. wollte mit seinen osmanischen Truppen Konstantinopel erobern. Aber hat es irgendwen interessiert? Keine Sau hat sich darum gekümmert. Man stelle sich das mal vor: Da baut Mehmed einfach eine Festung auf byzantinischem Gebiet. Lange Mauern mit engen Zinnen, gedrungene runde Türme, die jedem Angriff trotzen. Ich habe Rumeli Hisari mit eigenen Augen gesehen. Das Ganze war ein Schlag mit dem Fehdehandschuh, und er traf Kaiser Konstantin so kräftig ins Gesicht, dass man das Klatschen noch an den Höfen der Habsburger, Frankreichs und Englands hören konnte. Selbst der dümmste Pferdeknecht musste es erkennen: Rumeli Hisari lag auf der einen Seite des Bosporus, die zweite Festung des Osmanen auf der anderen Seite. Damit hatte Mehmed die Meerenge in seinen gierigen Fingern und blockierte die Passage für alle christlichen Schiffe.
Kaiser Konstantin erkannte natürlich die Gefahr. Er rief laut um Hilfe. Pech für ihn, dass ihm keiner helfen wollte. England und Frankreich waren dabei, ihre Wunden zu lecken. Den Habsburgern fehlte das Geld für Streitmacht und Flotte. Was blieb, waren der Vatikan und Handelsstädte wie Genua und Venedig. Die Städte sahen ihre einträglichen Geschäfte und Handelswege gefährdet. Sie besaßen genug Gold für Söldner wie mich. Für den Heiligen Vater war der Kampf gegen Mehmed ein Kampf gegen den Unglauben, den jeder gute Christ führen musste. Damals war mir Gold aber lieber, sag ich Euch.«
»Wir alle wissen heute, dass es ein Fehler war, kein größeres Heer zusammenzuziehen, Heinrich. Wie aber kamt Ihr denn nun nach Konstantinopel?«
»Was jetzt? Wollt Ihr nun meine Geschichte hören oder nicht? Dann lasst sie mich auch erzählen! Wo war ich stehen geblieben? Also ..., das christliche Abendland stellte sich taub und tat so unschuldig wie eine Wanderhure vor einem Wirtshaus. Ich hatte ja selber auch keine Ahnung, erst viel später erzählten mir Ritter in den langen Nächten der Belagerung, warum wir bis zum Hals im Dreck steckten.«
»Gut, gut, aber ein einfacher Bursche, wie Ihr – warum sollten sich die Ritter den jungen Söldnern anvertrauen?«
»Oh, glaubt mir, in den ersten Wochen hat sich auch keiner um uns gekümmert. Doch wenn Gevatter Tod jede Nacht dein Lager teilt, und Blut und Dreck die Wappen unkenntlich machen, dann schwinden auch die Unterschiede. Dann zählt nur der Mann in der Rüstung, nicht mehr das Wappen, das er auf seiner Rüstung trägt.
Ich hatte zusammen mit meinem Freund Jupp im Dienst der Bassenheimer das Kämpfen gelernt. Jung und begierig darauf, reich zu werden, dachte ich, ich könnte überall mein Glück machen. Dreck und Rattenschwanz, was war ich doch für ein Narr ...
Meine Reise führte mich nach Süden. In Nürnberg trat ich in den Dienst einer Gruppe von Kaufleuten, die mich dafür bezahlten, sie und ihre Waren vor Strauchdieben und heruntergekommenen Raubrittern zu schützen. Die Kaufleute wollten über die Berge nach Venedig. Neben mir hatten sie noch einen dreizehn, vierzehn Jahre alten Burschen für die Pferde dabei, den alle Jockel riefen, und Ragwald. Ragwald war ein zäher Kerl, das sah man auf den ersten Blick. Ein Auge hatte er im Kampf gegen die Engländer verloren, erklärte er immer. Erst später gestand er mir, dass es bei einer Wirtshausprügelei passiert war. Erfahrung besaß er für zwei. Damals konnte ich zwar mit dem Eichenstock kämpfen wie kein anderer, aber Ragwald holte mich gleich am ersten Tag bei einem Freundschaftskampf von den Beinen. Ich landete im Dreck, und Ragwald hielt sich den Bauch vor Lachen – so schlossen wir Freundschaft. Eine Freundschaft, die noch tiefer wurde, nachdem wir zusammen ein halbes Dutzend Straßenräuber in die Flucht geschlagen hatten. In den langen Wochen der Reise lehrte mich Ragwald den Kampf mit der Axt und dem Katzbalger, dem Kurzschwert, das er mir schenkte. Am Ziel unserer Reise entlohnten die Kaufleute uns großzügig. Wir konnten uns nicht beschweren. So stand ich an der Lagune – und sah zum ersten Mal das Meer, den Sack gefüllt mit Gulden, den Kopf voller Tatendrang. Ragwald und ich hatten beschlossen, vorerst zusammenzubleiben, Jockel schloss sich uns an. In Venedig hörten wir, dass Söldner gesucht wurden. Schon einen Monat später waren wir auf dem Weg nach Konstantinopel. Jockel hätte die Reise fast nicht überlebt, so seekrank wurde der arme Junge. Ragwald und ich hatten mehr Glück. Auf der Seereise brachte Ragwald mir noch zwei Dinge bei: das Schachspielen und einige Sätze Latein. Woher er das alles wusste, wollte er mir nicht verraten. Bis dahin fand ich Lesen und Schreiben überflüssig. Oh, es war nicht so, dass ich dazu keine Gelegenheit gehabt hätte. Nein, im Gegenteil. Der Dienstherr meiner Mutter nahm das sehr genau, doch ich trieb als junger Bursche alle Lehrer in die Verzweiflung.
Aber jetzt wollte ich möglichst so werden wie Ragwald. Also strengte ich mich an und hatte Erfolg.
Zusammen mit den übrigen Söldnern trafen wir im Februar in Konstantinopel ein. Teufel auch ... sind seitdem wirklich erst 14 Monate vergangen? Es könnten genauso gut 14 Jahre sein. Kennt Ihr Konstantinopel? Man muss diese Stadt mit eigenen Augen gesehen haben: Nirgendwo auf der Welt gab es solche Mauern. Sollten doch die Ungläubigen kommen, diese Mauern waren unbezwingbar, zumindest glaubten wir das alle. Wie sollten wir uns irren!
In der Stadt selbst gab es Felder und Vieh – für eine Belagerung war man also gut gerüstet. Anfang April standen die Truppen Mehmeds vor den Mauern. Natürlich hatte Kaiser Konstantin die Forderung abgelehnt, die Stadt kampflos zu übergeben. Gejubelt hatten wir bei dieser Nachricht. Als wir das osmanische Heer zum ersten Mal sahen, verstummte aller Jubel. Wir waren an die 3.000 Söldner, dazu kamen noch rund 8.000 weitere Kämpfer aus der Stadt. Das osmanische Heer – so erzählte man sich nach wenigen Tagen – hatte fast die zehnfache Stärke. Ich stand auf einem der Wehrgänge, und da sah ich sie – die große Kanone des Sultans. Bestimmt 60 Ochsen waren nötig, um das Geschütz zu ziehen, mehr als 24 Fuß war das Rohr lang. Selbst Ragwald hatte noch nie ein solches Geschütz gesehen. Die Osmanen brachten noch viele andere Kanonen in Stellung, wenn auch nicht mehr so große. Fünf Tage später begann der Angriff. Schon in der zweiten Nacht brach ein Teil der Stadtmauer ein. Dabei hatten die Osmanen noch nicht einen einzigen Schuss aus ihrer Riesenkanone abgefeuert. Der Boden vor der Stadt war so weich, dass sie ihn erst einmal befestigen mussten, um sie nahe genug heranzubringen. Doch selbst die Geschosse der übrigen Geschütze reichten schon aus. So hatten wir uns alle den Kampf nicht vorgestellt. Nachts, wenn das Donnern der Kanonen verstummte, mussten wir die Befestigungen ausbessern, so dass kaum einer genügend Schlaf bekam. Jockel starb in der zweiten Woche der Belagerung. Er wollte gerade frisches Wasser holen, als ein riesiges Geschoss ihn unter sich begrub. Fünf Männer waren nötig, um die schwere Steinkugel von seinem zerschlagenen Körper zu rollen. Die Kugel hatte ihn von hinten in den Rücken getroffen, sein Brustkorb, der Rücken, sein Kopf – alles war ein einziger Brei aus Fleisch, Blut und Knochensplittern. Ragwald und ich begruben, was von Jockel übrig geblieben war. Als wir an seinem Grab standen, murmelte Ragwald, dass er – Jockel – es womöglich von uns Dreien noch am besten getroffen hätte. In der dritten Woche trafen vier Galeeren, drei päpstliche und eine byzantinische, mit Vorräten ein. Die Osmanen griffen die Schiffe an. Wir konnten die Rauchwolken der Brandsätze sehen. In der Dunkelheit jedoch gelang es den Schiffen, glücklich im Hafen anzulegen. Sie hatten den Angriff abgewehrt. Unter den byzantinischen Adeligen und ihren Truppen weckten die Schiffe die Hoffnung auf weitere Verstärkung aus dem Westen. Viele von uns Söldnern glaubten nicht daran, und wir sollten Recht behalten. Kein einziges weiteres Segel tauchte in den kommenden Wochen am Horizont auf. Drei Wochen später hatten auch die Letzten jede Hoffnung auf Verstärkung begraben. Die Mauern der Stadt lagen in Trümmern. Die Verletzten konnten kaum noch versorgt werden. Unsere Toten blieben einfach liegen, für ein Begräbnis fehlten die Zeit und die Kraft. Die Vorräte teilte man ein, Hunger war unser ständiger Begleiter. Die Osmanen aber griffen unermüdlich an. Tagsüber kämpften wir, nachts versuchten wir mit Schutt und Trümmern die größten Lücken in den Mauern, oder besser gesagt, auf das was von ihnen übrig geblieben war, zu füllen. Mit blutigen Händen legten wir Steine aufeinander. Viele schliefen auf den Trümmerbergen vor Erschöpfung ein und wachten nicht mehr auf, weil bei Tagesanbruch ein Pfeilhagel auf sie niederging. Ragwald und ich hielten uns in dieser Zeit gegenseitig den Rücken frei. Wir wurden wie Brüder, teilten die kärglichen Rationen miteinander. Und es war Ragwald, der mich Ende Mai eines Abends beiseite nahm und mich zu einem Haus führte. Wem es gehörte, weiß ich bis heute nicht. Ragwald führte ein kurzes Gespräch mit einem Ritter, den wir ein paar Tage zuvor schon getroffen hatten. Ragwald erwähnte nur, dass der Adelige ein enger Vertrauter Kaiser Konstantins sei. Der Ritter übergab Ragwald ein kleines, in Leder eingeschlagenes Päckchen. Während der Nachtwache drückte Ragwald mir dann das Päckchen und seinen Sattelbeutel in die Hand. Darin war das Kästchen mit dem Schachspiel, so viel wusste ich.
›Es ist bald zu Ende, Heinrich‹, sagte er. ›nenne es eine Vorahnung, aber ich werde diese Stadt nicht lebend verlassen. Nimm das Schachspiel, es ist seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie. Nach mir aber kommt keiner mehr. Gedenke deines Waffenbruders, wann immer du die Figuren aufstellst! Das Päckchen hier aber, das verteidige mit deinem Blut und Leben. Es ist besser, wenn du nicht weißt, was darin ist. Lass es aber auf keinen Fall dem Feind in die Hände fallen. Und wenn du wieder unter Christen bist, dann werden weisere Männer, als wir es sind, wissen, was damit zu tun ist.‹
Beim Schwanz des Gehörnten, ich hatte keine Ahnung, wovon Ragwald sprach. Das Päckchen ging mich nichts an, doch das Schachspiel als Geschenk anzunehmen, kam mir wie Verrat vor. Aber Ragwald ließ sich nicht beirren.«
»Moment, Heinrich. Ragwald hat das Lederpäckchen Euch anvertraut, aber Ihr wisst nicht, warum ausgerechnet er es erhalten hat?«
»Dreck, Teufel und Verdammnis, bezichtigt Ihr mich etwa der Lüge? Es hat sich genauso zugetragen. Dass Ragwald mir alles übergab, öffnete mir an diesem Abend die Augen. Mir wurde das ganze Elend um mich herum bewusst: Wenn selbst ein Kämpfer wie Ragwald die Hoffnung aufgab, was sollte da aus uns werden? All die Toten – und wir, die wir noch kämpfen konnten, sahen von dem Blut, dem Rauch, dem Schmutz der Trümmer auch mehr tot als lebendig aus. In dieser Nacht stürmten die Osmanen die Stadt. Der Angriff begann keine zwei Stunden nach Mitternacht, bei Sonnenaufgang war die Schlacht verloren. Ragwald sah noch die aufgehende Sonne, als ihn ein Pfeil in den Hals traf. Sein Blut lief über meine Hände. Er starb ohne ein weiteres Wort in meinen Armen. Viele von uns zogen sich zum Hafen zurück. Wer von den Offizieren Familie in der Stadt hatte, versuchte zu seinem Heim zu kommen, um die Seinen zu schützen. Fünfzehn, vielleicht zwanzig Schiffen gelangen der Durchbruch und die Flucht.«
»Es ist ein Wunder, dass Ihr überlebt habt. Kaiser Konstantin ist in der Nacht des Angriffs gestorben. Drei Tage lang haben die Truppen Mehmeds die Stadt geplündert. Alle Adeligen und ihre Familien wurden zusammengetrieben und geköpft: Männer, Frauen, Kinder.«
»Ja, davon habe ich vor ein paar Wochen auch gehört. Es war reines Glück, dass ich auf einem der Schiffe Zuflucht gefunden hatte. Mein Schwert, das Kistchen mit den Schachfiguren und natürlich das Lederpäckchen – mehr blieb mir nicht. Als wir an der Küste gelandet waren, brachten die anderen mich in dieses Kloster hier. Eine Pfeilspitze steckte noch in meinem Bein. Fast wäre ich am Wundfieber gestorben. Aber Gott stand mir bei – ich überwand das Fieber und behielt mein Bein. Und ich werde bei den Mönchen hier bleiben. Ihr Leben ist so viel sinnvoller als Ragwalds, Jockels und mein Dasein als Söldner. Der Abt freut sich über meine Wandlung: sein eigener Saulus, der zum Paulus wurde. Ihm hab‘ ich schließlich auch von dem Päckchen berichtet.«
»Und wer weiß noch davon?« Der Fremde beugte sich bei seiner Frage neugierig vor, um Heinrich aufmerksam zu beobachten.
Während der ganzen Zeit, die Heinrich erzählt hatte, war die Miene des Fremden ungerührt geblieben, so als kenne er die Geschichte längst in allen Einzelheiten. Jetzt aber sah Heinrich nicht nur Neugierde in den Augen des anderen. Zum ersten Mal erkannte er eine Härte im Blick des Fremden, die ihn seinen ersten Eindruck noch einmal überdenken ließ. Er hatte sich täuschen lassen, das Auftreten, der bullige Leibwächter, das alles war nur Fassade. Der Fremde wollte harmlos wirken, ein Mann des Wortes, der Verhandlungen. Heinrich wusste es jetzt besser, es waren die Augen, die erbarmungslose Härte in ihnen: Dieser Mann konnte einen Gegner mit mehr als nur Worten zum Schweigen bringen.
»Ich habe niemandem sonst davon erzählt. Oh nein, ich respektierte Ragwalds Wunsch, übergab dem Abt das Päckchen, und der hat ja nun augenscheinlich Euch, einen Gesandten des Habsburgers, verständigt.«
Der Fremde nickte unmerklich, griff in seinen Beutel und holte ein Lederpäckchen hervor, das mit einem geflochtenen Riemen verschnürt war. Er öffnete beinah andächtig einen Knoten, schlug das Leder zur Seite. Vor ihm lag ein Rosenholzkästchen, in das aus Gold ein Kreuz gearbeitet war. In der Mitte des Kreuzes schimmerte ein blutroter Edelstein. Vorsichtig hob er den Holzdeckel hoch und ließ Heinrich hineinschauen.
»Seht es Euch noch einmal an, Heinrich. Das hier ist mit ein Grund, vielleicht sogar der einzige Grund, warum der Sultan die Stadt erobern wollte und Tausende christliche Ritter sterben mussten. Nun aber werdet Ihr für immer vergessen, dass dies hier je in Eurem Besitz war. Und Ihr werdet nie, mit keiner Seele, über das Kästchen, seinen Inhalt oder den Auftrag dieses Ragwalds sprechen, sonst ...«
Der letzte Satz ließ Heinrich von seinem Platz hochschnellen.
»Dieses Ragwalds? Ihr sprecht hier von meinem Waffenbruder, einem Mann von Ehre.« Heinrichs Hand schoss vor, krallte sich in den Surkot des Fremden und mit einem Ruck zog er ihn über den Tisch und das Rosenholzkästchen zu sich heran.
»Teufel auch, wollt Ihr mir etwa drohen? Was, wenn ich nicht schweige?«
Heinrichs plötzlicher Ausbruch hatte den Fremden und den bulligen Ritter überrascht. Der sprang jetzt mit zwei schnellen Schritten zum Tisch, riss mit der Rechten das Kurzschwert aus der Scheide und blieb dann wie angewurzelt stehen. Ohne den Surkot loszulassen oder auch nur den Blick von dem Fremden abzuwenden, hatte Heinrich mit seiner linken Faust zugestoßen. Der Leibwächter röchelte, knickte zusammen und schlug hart auf dem Steinboden auf.
Der Fremde griff langsam nach Heinrichs Hand und zwang mit unerbittlicher Kraft die Faust auf, die sich in dem Stoff seines Gewandes gekrallt hatte.
»Ich muss mich bei Euch entschuldigen. Es war falsch, an Eurer Verschwiegenheit oder der Ehre Eurer Begleiter zu zweifeln und Euch zu drohen«, sagte er dabei leise.
Heinrich zögerte noch kurz, ließ sich dann aber wieder auf seine Bank fallen. Sein gerade noch aufgeflammter Zorn war verraucht.
»Also gut, ich nehme Eure Entschuldigung an. Ihr kennt nun meine Geschichte, die in diesen Mauern enden wird.«
»Oh, das glaube ich nicht.« Zum ersten Mal huschte ein Lächeln über das Gesicht des Fremden. »Ein Mann wie Ihr wird nie in einem einsamen Kloster an der Küste enden. Nutzt die Zeit hier, folgt Eurer neuen Bestimmung, doch vertraut mir, Ihr werdet irgendwann weiterziehen.«
»Wenn Ihr meint, Herr. Ich bezweifele es.«
»Wie ich schon sagte: Ihr seid noch jung, Heinrich. Wenn Ihr aber irgendwann einmal Hilfe benötigt, dann wendet Euch an mich.«
Der Fremde hatte das Kästchen wieder eingesteckt und stand nun an der Tür. Seinen Begleiter, der nur mühsam wieder auf die Beine gekommen war, schien er gar nicht zu beachten.
»Ich brauche Eure Hilfe nicht«, erklärte Heinrich überzeugt. »Geht nur, bringt Friedrich, unserem neuen Kaiser, was Ihr da in Euren Händen haltet.«
Der Fremde nickte, öffnete die Tür der Kammer und drehte sich schließlich noch einmal um:
»So denkt Ihr heute, Heinrich, und das ist Euer gutes Recht. Trotzdem: Merkt Euch meinen Namen. Ich bin Herzog Richard von Hohenstade und Greich – und ich stehe im Namen Kaiser Friedrichs in Eurer Schuld.«
Teil 1
Kapitel 1: 23 Jahre später ...
Das Schlachtfeld von Nancy, 7. Januar 1477
»Da vorne, da liegt noch einer!«
Der Hauptmann kniff die Augen zusammen. In der eiskalten Luft des Morgens bildete jedes Ausatmen dichte Schwaden. Wirklich da vorne, in einem seichten Tümpel, lag noch ein Toter. Einer von vielen Dutzend, die sie seit Tagesanbruch gefunden hatten. Der Hauptmann schauderte und zog seine dunkelblaue Wollkotte enger zusammen. Der Tod war ihm ein wohlvertrauter Begleiter. Seit Jahren diente er in der Leibgarde des Herzogs von Burgund. Mit Karl hatte er vor fast einem Jahr in Grandson geblutet und dessen Niederlage geteilt. Er war schon an Karls Seite gewesen, als Burgund im Jahre des Herrn 1468 die Stadt Lüttich bestrafte. Damals war Karl der Kühne, wie ihn alle nannten, gar nicht so kühn gewesen. 800 Städter hatte er im Fluss ertränken lassen. Am Abend dieses Tages hatte sich der Hauptmann nicht wie ein Soldat, sondern wie ein Henker gefühlt.
Bei Gott, der Tod war ihm vertraut. Was ihn antrieb, war die Sorge um seinen Herrn. Die Burgunder hatte, hier vor den Toren von Nancy, das Kriegsglück endgültig verlassen. Sie waren von den Männern des Herzogs von Lothringen zurückgeschlagen worden. Unter den Fußsoldaten war bereits von einer bitteren Niederlage und dem Ende Burgunds die Rede.
Dummes Gewäsch! Und dennoch ... Karl wurde seit zwei Tagen vermisst. Vielleicht hatte Herzog René ihn ja zusammen mit Anton, Karls Halbbruder, gefangen genommen. Doch man hatte nur Antons Gefangennahme beobachtet, und es gab keine Forderungen des Lothringers.
Der Hauptmann gab sich einen Ruck und schritt entschlossen auf den Tümpel zu. Beim Näherkommen hörte er wütendes Knurren. Ein Rudel verwilderter Hunde zerrte an der Leiche. Seine Männer versuchten, die Hunde mit lauten Schreien zu vertreiben, doch die knurrten nur böse und ließen nicht von ihrer Beute ab. Erst als die Soldaten Steine nach ihnen warfen, zog sich das Rudel widerwillig zurück.
Zwei der Soldaten wateten fluchend in den Tümpel, um den starren Körper herauszuziehen. Wie bei allen Toten, die sie bisher gefunden hatten, fehlten auch hier Wams, Hemd, Beinkleider, Stiefel und natürlich die Waffen. Die Erschlagenen wurden ausgeplündert, dem Sieger gehörte die Beute.
Die Soldaten drehten den Leichnam auf den Rücken und schauten ihren Hauptmann fragend an. Der aber schrak zurück, die Galle stieg ihm hoch. Der Anblick ließ ihn würgen. Vor ihnen, im Matsch des Tümpels, halbnackt und angefressen von einem Rudel wilder Hunde, lag Karl I., Herzog von Burgund, den alle Welt nur »den Kühnen« genannt hatte.
Kapitel 2: Fünf Tage später ...
Schloss Plessis-lès-Tours in Frankreich
»Er ist tot, tot, endlich tot!«
Wie der Siegesschrei auf dem Schlachtfeld hallte das letzte »Tot« durch die große Halle und wurde als vielstimmiges Echo zurückgeworfen. Welch ein Triumph!
Ludwig klatschte begeistert in die Hände. Sein Erzfeind verwundet vor Nancy, abgesoffen in einem Tümpel, nackt, ausgeplündert und halb aufgefressen von Hunden.
Nie, nie hätte er sich ein so herrliches Ende für Karl von Burgund ausgemalt. Das übertraf seine wundervollsten Träume. Schon die ersten Nachrichten seiner Boten hatten ihn jauchzen lassen: Karl, womöglich gefangen oder auf der Flucht, sicher aber geschwächt und unfähig, sich den Plänen zu widersetzen, die er, Ludwig, König von Frankreich, schmieden würde. Nach der Messe, bei Tisch mit seinem Kanzler, einigen Mitgliedern des Rates und seinen Getreuen, verteilte er großzügig die ersten Ländereien des verhassten Burgunders. Er hatte es gefühlt, herbeigesehnt – diesmal sollte Karl nicht davonkommen.
Und jetzt lag sie vor ihm, die Gewissheit, diese herrliche Botschaft, die sein getreuer Chevalier de Craon verfasst hatte. Ludwig füllte einen großen Pokal mit Wein und trank ihn in gierigen Zügen leer. Das Pergament mit dieser Nachricht würde er in Gold rahmen lassen, es sollte einen Ehrenplatz erhalten.
Draußen auf dem langen, dunklen Flur des Palastes wartete der Kammerdiener darauf, dass sein König nach ihm läutete, so wie er es jeden Abend tat. Heute aber herrschte nicht die gewohnte bedrückende Stille im Privatgemach des Königs. Etwas, das der Diener in all den Jahren noch nie gehört hatte, tönte durch die hohen Türen. Gelächter, schallendes, grelles, nicht enden wollendes Gelächter. Ein Lachen, das ihm einen Schauer über den Rücken jagte.
Kapitel 3: Andernach am Rhein, März 1477
Der Schrei der Vögel ließ mich nach oben blicken. Wie eine große Pfeilspitze flogen sie in der klaren Märzluft in Richtung Rhein. Der Frühling kam, seit zwei Tagen spürte man es draußen. Die Eisschicht früh morgens auf dem Wasserfass war verschwunden, die Luft wurde milder, der Wind in den Gassen Andernachs hatte seine schneidende Kälte verloren.
Der Schlag der flachen Schwertklinge traf mich unvorbereitet mit voller Wucht an der Schulter.
»Beim Heiligen Antonius und seiner flammenden Sau – sag mal, Konrad, träumst du?«
Der Schmerz des Schlages wischte alle Gedanken an den nahenden Frühling beiseite. Du Idiot, achte gefälligst auf deinen Gegner und nicht auf ein paar Zugvögel, ermahnte ich mich.
Vor mir grinste Pastor Heinrich über das ganze Gesicht. Nur dass Heinrich heute früh nichts Priesterliches an sich hatte: Wams, Stulpenstiefel, ein imposantes Schwert für anderthalb Hände – hier stand ein kampferprobter Veteran vor mir, kein braver Geistlicher.
»Na los, mein Täubchen, zeig einem alten Söldner, ob so ein adeliger Schnösel auch wie ein Mann kämpfen kann.«
Das Lachen in Heinrichs Augen nahm seinen Worten die Spitze. Ein herzhaft fluchender Pastor war mir vertraut, an einen frotzelnden Schwertkämpfer musste ich mich erst gewöhnen.
»Komm schon, Konrad, lass dir das nicht gefallen, zeig‘s ihm!« Thomas, der Sohn meiner Vermieterin Johanna Merle, feuerte mich mit der ganzen Begeisterung eines Zwölfjährigen an. Er saß zusammen mit meinem Freund, dem Stadtknecht Jupp Schmittges, auf einer Steinmauer des Hofes. Nur Thomas zuliebe standen Heinrich und ich hier im Hof der ehemaligen Schmiede. Heute sollte Thomas die Grundstellungen des Schwertkampfes kennenlernen. Heinrich, der mit ihm seit Monaten den Stockkampf übte, hatte mich dazu überredet. Und ich Dummkopf hatte zugestimmt. Wenn ich nicht aufpasste, lief ich doch tatsächlich Gefahr, Prügel zu beziehen. Vergiss, dass er dein Pastor ist, jetzt ist er ein Kerl wie eine Eiche mit einem Schwert in der Hand.
»Also, wollt ihr beide nun anfangen oder nicht? In zwei Stunden ist Mittag, da bringt Hildchen ihren Eintopf auf den Tisch ...«
»Schon recht, Jupp«, unterbrach ihn Heinrich, »so lange werde ich für das Bürschchen hier nicht brauchen. Die Monate des faulen Lebens haben ihre Spuren bei unserem lieben Konrad hinterlassen.«
Jetzt reichte es aber! Da machten meine beiden einzigen Freunde in Andernach ihre Scherze auf meine Kosten.
»So, ihr beiden Frohnaturen. Euch sitzt ja der Schalk mächtig im Nacken. Wenn man euch so zuhört, sollte man meinen, es ginge hier um die Vollstreckung eines Gottesurteils und nicht darum, Thomas ein paar Fechtstellungen vorzuführen. Aber bitte, wenn unser dicker Pfaffe es wünscht, dann kämpfen wir eben. Ich muss ja auch auf Heinrichs Alter Rücksicht nehmen.«
»Hoho, hör ich da recht? Alt nennst du mich und dick sei ich auch? Das sind Muskelberge, mein Lieber, Muskelberge. Wirst du gleich zu spüren bekommen. Ich hab‘ schon ein Schwert geführt, da konntest du noch aufrecht unter einer Sau herlaufen.«
»Das Alter hat dich übermütig werden lassen, mein verehrter Pfaffe ...«, stichelte ich, doch der Rest des Satzes ging in dem Angriffsgebrüll Heinrichs unter. Mit einem mächtigen Hieb schlug er zu. Gut, dass ich das im Ansatz noch gesehen hatte, so konnte ich parieren. Doch die Kraft des Schlages spürte ich bis hoch in die Schulter.
»Das, Thomas, war ein Zornhau von rechts, also ein Oberhau, und Konrad konnte, wenn auch mit Mühe, dagegenhalten.« Jupp hatte sich wohl zur Aufgabe gemacht, alles zu erklären.
Ich schlug in einem Bogen von unten nach oben. Unsere Klingen trafen klirrend aufeinander.
»Ah, ein Krumphau, natürlich war das zu erwarten, Heinrich weiß darauf zu antworten«, tönte es von der Mauer. Heinrichs Schläge waren so kraftvoll, dass es mir schwerfiel, mehr als nur dagegenzuhalten. Ich wich zwei Schritte zurück und rang nach Atem. Heinrich sah man die Macht seiner Hiebe nicht an, vielleicht stimmte das mit den Muskelbergen ja tatsächlich.
»Konrad wird jetzt seinen Angriff vorbereiten, achte auf die Haltung der Hände und der Klinge. Na, das könnte auch geschmeidiger aussehen ...«
»Sag mal, Jupp, musst du nicht als Stadtknecht irgendein Tor bewachen oder am Markt nach dem Rechten sehen?«, warf ich dazwischen und versuchte gleichzeitig, meinen Atem zu beruhigen.
»Und diesen Kampf verpassen? Von wegen, das hättest du wohl gern!«
Mir blieb eine Erwiderung erspart, denn Heinrich griff erneut an, doch ich zog mich noch einmal zwei Schritte zurück und ließ seine Hiebe ins Leere gehen.
»Willst du kämpfen oder tanzen?«, dröhnte er.
»Ich wollte dir noch ein paar Augenblicke gönnen, bevor ich das Spiel hier beende«, erwiderte ich und wich seiner Klinge erneut aus. So konnte es natürlich nicht weitergehen. Heinrichs Kraft war enorm, und er glich damit aus, was ihm an Technik mangelte. Beim nächsten Angriff kreuzten sich unsere Schwerter, und ich spürte den Druck, mit dem Heinrich seine Waffe führte.
»Nun stehen beide da und messen ihre Kräfte. Wenn Kämpfer so dicht zusammenstehen, nennen wir das auch enge Mensur. Und da sich ihre Klingen berühren, stehen sie ›im Band‹. Kannst du dir gleich mitmerken, Thomas«, belehrte Jupp unseren jungen Schüler.
Ich wollte gerade ausweichen, als Heinrich mit der linken Faust zuschlug und mich hart mitten auf der Brust traf.
»Autsch, das hat sicher weh getan«, hörte ich Jupps Stimme wie aus weiter Ferne. Halb benommen schnappte ich nach Luft.
»Na ja, das findet sich zwar so nicht in Talhoffers Fechtschule, aber du musst eben bei deinem Gegner mit allem rechnen.«
Ich taumelte zurück. Hätte mich ein Ochse gerammt, wäre es mir besser gegangen. Heinrich setzte nicht nach, sondern blieb breit grinsend stehen. »Und, Konrad, brauchst du eine kleine Ruhepause?«
Der Schmerz ließ nach, und ich konnte wieder tief einatmen. So ging es nicht weiter, es wurde Zeit, meinem Gegner mal was zu zeigen, das er noch nicht kannte. Ich streckte mich und suchte mit beiden Füßen einen festen Stand.
»Merke dir, Heinrich: Ich bin Konrad von Hohenstade und Greich, Großmeister des Ordens des schwarzen Adlers und berechtigt, im Namen des Kaisers zu siegeln. Wir, die Zwölf, geben nie auf.«
Natürlich wollte ich Heinrich ablenken, aber dass mir das so gut gelingen würde, hätte ich nicht erwartet. Er stand da und starrte mich mit gesenktem Schwert sprachlos an, als wäre ihm ein Geist begegnet. Sei es drum, eine bessere Gelegenheit würde ich nicht mehr bekommen. Ich machte einen Ausfallschritt und täuschte einen Hieb von oben an, glitt dann aber mit zwei schnellen Schritten an Heinrichs rechte Seite. Während sein Schwert durch die Luft nach unten schlug und er sich vom Schwung des eigenen Schlages nach vorne beugte, stieß ich mich ab. Ich sprang hoch und rollte mich mit der linken Schulter über seinen breiten Rücken ab. Mit der Landung hielt ich einem völlig überrumpelten Heinrich mein Schwert an die Kehle.
»Ich würde sagen, damit ist der heutige Kampf beendet, alter Freund – oder?«
Heinrich hatte nicht einmal die Zeit gehabt, seine Waffe erneut zu heben. So ließ er sie nun endgültig sinken, während ich lächelnd die Klinge in die Scheide zurücksteckte.
»Beim Schwanz des gehörnten Satans, sowas hab‘ ich noch nie gesehen«, gab er bereitwillig zu und reichte mir die Hand. »Meine Hand darauf, Konrad. Ich bin stolz, mit dir die Klingen gekreuzt zu haben.«
Lachend erwiderte ich seinen Händedruck. »Übertreib mal nicht, wenn du gewollt hättest, hättest du den Kampf auch schon in den ersten Minuten beenden können.«
Heinrich grinste nur still in sich hinein.
»Hast du das gesehen? Hast du gesehen, wie Konrad über seinen Rücken geflogen ist, und zack, war sein Schwert an der richtigen Stelle!« Thomas machte seiner Bewunderung lautstark Luft.
Jupp antwortete nicht, sondern kramte griesgrämig in seinem Beutel, als Thomas die Hand aufhielt. Ein paar Münzen wechselten ihren Besitzer.
»Moment mal, hast du etwa gegen mich gewettet?«, fragte ich empört. Jupp wurde rot: »Na, ich weiß doch, wie Heinrich kämpfen kann, und dich habe ich schließlich noch nie mit einem Schwert gesehen, also ich mein, das ist doch so ... oder etwa nicht, Heinrich?«
Ich sah unseren Pastor grinsen und Jupps Verlegenheit wurde sichtlich noch größer.
Ich musste lachen. Dieser Bär von einem Kerl saß da auf der Mauer in der Sonne und errötete wie eine Jungfrau beim ersten Minnegesang.
Mit gespieltem Ernst in der Stimme antwortete ich: »Das sind mir die richtigen Freunde, der eine wettet gegen mich, der andere versucht mir mit dem Schwert den Garaus zu machen.«
»Vielleicht hast du ja noch etwas von dem Moselwein, den es neulich beim Schachspielen gab?«, erkundigte sich Heinrich.
Ja, Moselwein hatte ich noch und für drei Becher mit Freunden sollte es wohl reichen, dachte ich zufrieden.
Kapitel 4: Im Wald zwischen Monreal und Mayen
Die Wucht des Armbrustbolzens warf ihn fast aus dem Sattel. Ein herabhängender Ast, ein kurzes Ausweichen rettete Erasmus das Leben. Er trieb sein Pferd weiter an, jagte im Galopp zwischen den Bäumen hindurch, schlug Haken, um dem Schützen kein weiteres Ziel zu bieten. Es war ein Fehler gewesen, seine Verfolger so dicht an sich heranzulassen, dachte Erasmus verbittert. Doch als er sich von seinen Männern getrennt hatte, wollte er sichergehen, dass die Feinde seiner Spur auch wirklich folgten. Nun, das war ihnen gelungen. Hatte er zuvor noch Zweifel gehabt, war ihm jetzt klar: Sie wollten seinen Tod und natürlich das, was er im Beutel seines Gürtels mit sich trug. Erasmus hetzte sein Pferd weiter. Plötzlich öffnete sich der Wald hin zu einem Abhang. Für einen kurzen Moment überlegte Erasmus, wieder umzukehren und sich seinen Feinden zu stellen, doch die Mission war wichtiger als die Aussicht auf einen Kampf. Mit einer Hand griff er hinten an seine Schulter und zog mit einem Ruck den Bolzen heraus. Hätte er unter seiner Kotte nicht noch ein dichtes von Meisterhand gefertigtes Kettenhemd getragen, der Bolzen hätte seine Schulter durchschlagen.
Mit einem Schrei lenkte Erasmus sein Pferd den Abhang hinunter und schlug ihm die Fersen in die Seiten. Auf das freie Feld zu galoppieren, war sein zweiter großer Fehler. Noch bevor er die schützenden Bäume am Fuße des Abhangs erreichte, hörte er das Sirren der Pfeile. Seine Verfolger versuchten erst gar nicht ihn einzuholen, sie vertrauten auf ihre Langbögen. Ein englischer Bogenschütze konnte mühelos zehn bis zwölf Pfeile binnen einer Minute verschießen. Die Schützen oben am Waldrand mochten weniger geübt sein, doch was blieb, war ein tödliches Sirren, das die Luft erfüllte. Ausweichen war unmöglich, Erasmus blieb nur die Hoffnung, weiterzuhetzen. Als er sich schon in Sicherheit wähnte, bohrten sich zwei Pfeile tief in den Hals seines Pferdes. Mit einem schrillen Wiehern stürzte das Tier. Erasmus schaffte es gerade noch, aus den Steigbügeln zu kommen, um nicht unter dem schweren Leib zerquetscht zu werden, doch der Aufprall war hart. Er rollte über den Boden und schlug mit der Schläfe gegen einen Stein. Halb betäubt torkelte er hoch, mit seinem Dolch schnitt er das Bündel hinter dem Sattel los, griff nach seinen Waffen und suchte Deckung zwischen den Felsen. Hinter sich sah er seine Feinde wieder aufsitzen. Siegessicher, dass ihre Beute nicht mehr entkommen konnte, feuerten sie ihre Tiere lautstark an. Erasmus stolperte weiter, drang tiefer in den Wald hinein. Er musste ein Versteck finden. Blut lief ihm am Hals hinunter. Zwei, drei Gegner mochte er vielleicht überwältigen, aber Erasmus kannte ihre Zahl nicht wirklich. Sein Blick wurde trüb, er musste würgen. Keine zwei Schritte entfernt sah er einen schmalen Spalt zwischen Steinen, halb verdeckt von einem Gebüsch. Erasmus schob seine Waffen und das Bündel tief in das Loch, dann rollte er sich der Länge nach in die Felsspalte. Das Loch war eng wie ein Sarg. Hastig zog er die Zweige vor die Öffnung. Ihm blieb nicht viel Zeit. Einem aufmerksamen Suchen würde dieses Versteck nicht standhalten, doch er baute darauf, dass seine Feinde schnell vorbeireiten würden.
Er versuchte, ruhiger zu atmen, konzentrierte sich auf sein Ziel: das Kloster am See, Pater Anselm, er musste das Kloster unbemerkt von seinen Feinden erreichen. Doch dafür musste er überleben. Erasmus spürte die Feuchte des Blutes, alles verschwamm vor seinen Augen: die Zweige, die Steine und die Beine der ersten Pferde, die an seinem jämmerlichen Versteck vorbeipreschten.
Kapitel 5: Andernach am Rhein
Draußen war es dunkel geworden. Ich hatte Brot und den Rest Eintopf gegessen, den Jupp am Nachmittag mit herzlichen Grüßen von Hildegard vorbeigebracht hatte. Hildegard liebte es, mich zu bemuttern. Sie hegte ständig den Verdacht, ich würde zu wenig essen. Dabei kochte schon Johanna regelmäßig für mich mit. Glücklicherweise hatte Thomas, wenn er bei mir vorbeischaute, immer Hunger, so blieben selten Reste, und ich musste mir keine Ausreden einfallen lassen. Beim Abwaschen des Tellers am Brunnen sah ich in Johannas Küche noch Licht. Ob ich sie besuchen sollte? Warum eigentlich nicht – doch in diesem Moment wurde drinnen die Laterne gelöscht und ihr Haus lag dunkel da. Zu spät für einen Besuch, schließlich gab es schon genug Klatsch darüber, dass ich in dem umgebauten Lagerschuppen der Schmiede wohnte, die nun mal einer Witwe gehörte. Laut Jupp gab es einige ehrbare Andernacher Bürger, denen das ein Dorn im Auge war. Aber meine Freundschaft mit Pastor Heinrich und die Unsicherheit darüber, wer ich eigentlich war, verschlossen den meisten Tratschmäulern den Mund – zumindest bislang. Ich verschob den Besuch in Gedanken auf morgen und machte bei mir im Haus ein Feuer an. Zugvögel hin oder her – abends kroch die Kälte durch die Fensterläden. Das Klopfen an der Tür überraschte mich. Die schwere Eichentür zitterte in ihren Scharnieren, das ließ wenig Raum für Zweifel, wer da Einlass begehrte.
»Komm herein, Heinrich. Der Riegel ist noch nicht vorgeschoben.«
Heinrichs Gestalt füllte den Türrahmen aus: »Guten Abend, Konrad. Hättest du Lust auf eine Partie Schach? Natürlich nur, wenn du nichts anderes vorhast?«
»Warum nicht – immer herein mit dir!«
Heinrich schloss die Tür, ließ sich in den großen Lehnstuhl fallen und begann, das Schachspiel aufzustellen. Ich fragte erst gar nicht, ob er etwas trinken wollte, sondern beeilte mich, aus dem Lagerregal einen Krug Wein und zwei Becher zu holen. In den Monaten nach Marias Tod hatte es mehr als einen Abend gegeben, an dem ich versucht hatte, mit Branntwein die Geister der Toten zu verjagen. Es waren Jupp und Hildegard, die mir geholfen hatten und an meiner Seite gewesen waren.
Seit nun Heinrich regelmäßig zum Schachspielen vorbeischaute, achtete ich darauf, dass ein, zwei Krüge Wein im Regal standen. Frisches Brunnenwasser war für unseren Pastor undenkbar, ihm merkte man aber auch selbst den stärksten Moseltropfen nicht an. Ich holte noch eine zweite Laterne und goss dann ein. Selbst trank ich nur einen kleinen Schluck, Heinrich dagegen leerte schmatzend den Becher in einem Zug.
»Ah, das tut gut, und der schmeckt auch noch. Wo hast du denn den her?«
»War eine Empfehlung von Hildegard«, sagte ich, »der Weinhändler Franzen in der Kramgasse verkauft diesen Wein nur besonders guten Kunden. Dank Hildegards Fürsprache konnte ich zwei Krüge bekommen.«
»So, so, muss ich mir merken. Es kann ja wohl nicht sein, dass seinem Hirten ein solcher Genuss unterschlagen wird. Besonders guten Kunden, das wüsste ich wohl. Der Franzen soll mir bloß bei der nächsten Beichte begegnen.«
Bei der Beichte hätte ich ja gern mal Kirchenmaus gespielt. Heinrich schenkte sich noch einmal nach und machte dann wortlos den ersten Zug.
Schweigend zogen wir in den nächsten Minuten unsere Figuren über die Felder. Es war keine unangenehme Stille zwischen uns. Mit Heinrich konnte man gut zusammen still sein und seinen eigenen Gedanken nachhängen. Besser aber wäre es gewesen, wenn ich das Spiel aufmerksamer verfolgt hätte.
»Schachmatt, mein Lieber. Das ging jetzt aber schnell. Gut, dass du nicht so kämpfst, wie du Schach spielst.«
»Komm, Heinrich, lass uns noch eine Partie spielen«, bat ich, »und was das Fechten heute Morgen angeht, hast du es mir nun wahrlich nicht leicht gemacht. Der Trick am Schluss gelang auch nur, weil du abgelenkt warst.«
Heinrich stellte die Figuren bedächtig auf ihren Platz, bevor er antwortete: »Für mich gab es da diesen einen Augenblick, als ein Schatten aus meiner Vergangenheit vorbeizog. Ich vergesse immer wieder, wer du wirklich bist. Weißt du, für mich bist du eben der Mann, der unser Kirchenkreuz neu geschnitzt hat. Der, der hier vor nicht einmal anderthalb Jahren mit seiner Frau und einer kleinen Tochter in unsere Stadt kam, um dann die beiden keine sechs Monate später begraben zu müssen.«
»Übermorgen vor genau einem Jahr«, flüsterte ich.
»Jesus, Maria und Josef, ich Hornochse. Kein Wunder, dass du in Gedanken bist. An das Jahresamt hatte ich gar nicht gedacht. Aber du verstehst, was ich sagen will? Ich vergesse oft, dass du Großmeister des schwarzen Adlers bist. Du gehörst zu dem Dutzend Männer, die sogar im Namen des Kaisers siegeln dürfen, seine Interessen auch im Geheimen vertreten. Das hier aber ist Andernach, wir sind so weit entfernt von den Höfen der Großen des Reiches, die du kennen gelernt hast. Gott, du hast es geschafft, die Sturköppe von Habsburg und Burgund an einen Tisch zu bekommen. Aber trotzdem bleibst du für mich eben der andere Konrad, der, der zu meinem Freund wurde.«
Was konnte ich darauf antworten? Ich spürte einen Kloß im Hals. Ich schluckte einmal trocken, bevor ich den Becher hob, und räusperte mich: »Danke, Heinrich, danke für deine Freundschaft! Auf Maria und Sophie!«
Der Kloß wurde noch größer, also trank ich – viel zu hastig – den Becher leer.
Heinrich hatte recht, das hier war nur eine kleine Stadt am Rhein gewesen, als wir zu dritt angekommen waren. Eine Stadt, in der zufällig der Onkel von Maria ein Haus besessen hatte. Doch mittlerweile war es mehr für mich geworden, ich hatte hier Freunde gefunden, obwohl sie fast nichts von mir und meiner Vergangenheit wussten. Freunde, nicht Waffengefährten, wie in den Jahren zuvor. In Andernach gab es für mich kein Täuschen, keine List an fremden Königshöfen, um das eigene Leben zu schützen. Hier musste ich keine Männer führen und dabei ihren Tod in Kauf nehmen.
Hier, in dieser unscheinbaren Stadt, gab es für mich ein neues Leben. Wie gern hätte ich es mit Maria und Sophie geteilt.
An diesem Abend verlor ich jede Partie gegen Heinrich, aber das war mir egal.
Kapitel 6: Das Kloster am Laacher See
»Pater Anselm! Wacht auf! Pater Anselm, hört Ihr?«
Es gab Stunden, da zürnte Anselm sich selber, weil er die Burg, den Haushalt des Herzogs von Hohenstade, verlassen hatte, um sich in das Kloster am See zurückzuziehen.
Doch seine Mitbrüder hatten ihn gebraucht, also war er ihrem Drängen gefolgt und hatte sich erneut den Regeln des Heiligen Benedikt unterworfen.
In Stunden wie diesen, wenn er unvermittelt aus dem Schlaf gerissen wurde, spürte er jedes einzelne Jahr seines langen Lebens in allen Knochen.
»Pater Anselm, bitte, es ist dringend!«
Der Stimme nach musste es Veit sein, der ihn geweckt hatte. Veit war einer der Neuen, die ihr Postulat absolvierten, bevor sie als Novizen in die Ordensgemeinschaft hineinwuchsen.
»Ja doch, ich komme ja«, rief Anselm und zog den Gürtel der Kutte fest, bevor er die Tür seiner Zelle öffnete. Auch wenn es keinen Riegel gab, hätte sich Veit nie erlaubt, die Kammer eines älteren Paters ohne Aufforderung zu öffnen.
Der lange Gang vor der Zelle wurde von der Laterne in Veits Hand nur wenig erhellt.
»Gott im Himmel, Junge, es ist mitten in der Nacht.«
»Ich weiß, Pater Anselm. Wir werden uns erst in zwei Stunden zu Noktern versammeln ...«
»Das große Nachtgebet heißt Nokturn, nicht Noktern, merk dir das«, verbesserte ihn Anselm, »aber das ändert nichts daran, dass du mich kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf reißt. Ich hoffe, du hast dafür einen guten Grund.«
»Aber Ihr seid doch die Vertretung für Pater Ludwig, oder etwa nicht? Wenn einer krank oder verletzt ist, dann soll ich doch zu Euch kommen?« Veit war ganz blass bei dem Gedanken geworden, dass er die Nachtruhe eines angesehenen Mitbruders ungerechtfertigt gestört haben könnte.
»Ludwig? Natürlich, Bruder Ludwig ist ja in Himmerod, wie konnte ich das vergessen.« Anselms Groll verschwand, und mit einer energischen Bewegung rieb er sich über die Augen, als könne er so die Müdigkeit einfach vertreiben.
»Nun los, Junge, erzähl mir die Einzelheiten auf dem Weg zum Infirmarium.« Anselm lief los, so plötzlich, dass sich Veit Mühe geben musste, mit ihm Schritt zu halten.
Anselm schämte sich für seinen Groll gegenüber dem Jungen. Bruder Ludwig, der Infirmarius der Abtei, weilte seit einer Woche im Kloster Himmerod, um sich dort mit seinen Mitbrüdern, die auch in der Heilkunde bewandert waren, auszutauschen. Und er, Anselm, hatte sich angeboten, Ludwigs Arbeit in der Krankenstube zu übernehmen. Was war auch schon groß zu tun? Bruder Ludwig war ein Zauberer, wenn es um Tees, Umschläge und die Mischung von Arzneien ging, da konnte Anselm nicht mithalten. Doch glücklicherweise hatte er bislang nur Kamillentee gegen Zahnschmerzen verordnen müssen, hatte eine Schnittwunde mit Wein ausgespült und verbunden und Pater Jacobus verboten, weiterhin Kohl zu essen. Jacobus unterbrach seit geraumer Zeit mit seinen Blähungen lautstark die Psalmen und Lieder, und kaum ein Mitbruder wollte noch freiwillig im Chorgestühl neben ihm sitzen.
Bruder Ludwig zu vertreten, war also bislang keine große Kunst gewesen, dachte Anselm. Bislang – schließlich hatte Veit ihn sicher nicht umsonst geweckt.
»Es tut mir leid, Veit, dass ich dich so angefahren habe. Verzeih einem alten Mann seinen Groll, wenn er nicht schlafen darf.«
Veits Schritt stockte überrascht. Ein Pater, der sich bei ihm entschuldigte, ja, gab es denn sowas?
»Es ist wirklich wichtig. Ich habe heute während des Silentiums Dienst im Infirmarium, und Bruder Emmerich von der Pforte, der brachte gerade einen blutüberströmten Ritter herein.«
»Ein verwundeter Ritter? Bei uns im Kloster?«, fragte Anselm überrascht.
»Ja, ich konnte sein Gesicht bei all dem Blut kaum erkennen. Sein Kopf sieht schrecklich aus, aber er ist noch bei Sinnen, und ich habe deutlich gehört, was er zu Emmerich gesagt hat. Er hat nach Euch gefragt.«
Jetzt war es Anselm, der erstaunt stehenblieb: »Sag das noch einmal, Junge! Der Fremde kennt meinen Namen?«
Veit war ebenfalls stehengeblieben: »Ja, Pater Anselm. Ich stand daneben, als er sich auf eines der Lager sinken ließ und laut gesagt hat ...«, Veit runzelte angestrengt die Stirn, offensichtlich bemüht, alles richtig wiederzugeben, »A-E-I-O-U, Pater Anselm soll kommen.«
AEIOU – Anselm hatte darum gebetet, dieses Kürzel nie hören zu müssen.
»Hör zu, Junge, wer weiß noch außer dir und Bruder Emmerich von diesem Ritter?«
»Keiner, glaube ich.«
»Ist noch jemand in unserer Krankenstube?«
»Na ja, da ist noch dieser eine Pilger. Seine Gruppe hat uns am Morgen schon verlassen, aber er hat Durchfall und konnte nicht mitgehen. Ich glaube, er will dann später alleine weiter nach Trier pilgern.«
»Gut, Veit, dann wirst du jetzt in den Schlafsaal zu den übrigen Novizen gehen und bis zur Nokturn schlafen. Und du redest mit keiner Seele über das, was du heute Nacht gehört und gesehen hast – hast du das verstanden?«
»Ja, natürlich, Pater Anselm, wenn Ihr das so wünscht, aber ich ...«
Pater Anselm wartete nicht ab, was Veit noch sagen wollte, sondern stürmte mit einer Schnelligkeit, die ihm Veit nicht zugetraut hätte, die Treppe hinunter.
AEIOU. Etwas Furchtbares war geschehen. Sein schlimmster Albtraum war wahr geworden.
Kapitel 7: Schloss Plessis-lès-Tours in Frankreich
So war also sein kühnster Wunschtraum wahr geworden. Er genoss die Stille der Nacht, wenn kein Laut durch die hohen Türen seines Gemaches drang. In dieser Stille waren seine Pläne gereift. Seit er vom Tod seines alten Feindes erfahren hatte, war keine Stunde ungenutzt geblieben. Seine Männer hatten alles vorbereitet, jede Einzelheit hatte er genau bedacht. Nun war es an der Zeit, die Ernte einzufahren. Burgund stand am Rande des Abgrunds, Bürger einzelner Städte pochten auf ihre Unabhängigkeit, in den Straßen Gents herrschte die nackte Gewalt. Nicht umsonst hatte er dort durch seine Spitzel Hass und Rachsucht auf den Herzog und seine Familie geschürt. Versprechungen und Gold taten das ihrige. Zwei der engsten Vertrauten, die Maria von Burgund besessen hatte, waren vor ihren Augen hingerichtet worden. Maria, Karls Brut – pardon, unsere geliebte Cousine, verbesserte sich Ludwig selber in Gedanken, und lächelte hämisch – dieses Geschöpf der bemitleidenswerten Lenden des Herzogs von Burgund, sie war wie Ton in seinen Händen. Er würde über ihr weiteres Schicksal entscheiden. Große Teile des Landes seines Widersachers hatte er bereits an vertrauenswürdige Vasallen vergeben. Das Ende Burgunds, dieses jahrzehntealten Stachels in seinem Fleisch, war nicht mehr fern.
Ludwig von Frankreich öffnete mit zitternden Händen die Tür eines großen Schrankes. Ehrfürchtig trat er einen Schritt zurück, damit sich das Licht der zahlreichen Kerzen und Leuchter in dem Gold und den Edelsteinen der Kästen spiegeln konnte.
Ja, bei Gott, schon ihr Anblick genügte, um seinen Geist zu beruhigen. All sein Reichtum war nichts im Vergleich zu diesem Schatz. Da oben lag der Zeigefinger des Heiligen Sebastian. In einem vergoldeten Kästchen daneben hob er die Späne vom Huf des Esels auf, der in der Krippe zu Bethlehem die Geburt des Herrn miterlebt hatte. Ein Armknochen der Heiligen Ursula, Haare von Johannes dem Täufer und – sein ganzer Stolz – Reste vom Hirn des heiligen Thomas Becket von Canterbury.
Diese Reliquien sicherten seine Gesundheit, erhoben ihn weit über all seine Feinde, daran gab es gar keinen Zweifel. Ludwig schloss die Augen, spürte die Kraft, die Allmacht, die von seinen Schätzen ausging. Die Vollendung seiner Sammlung stand unmittelbar bevor. Mehr noch: Seine nächste Reliquie würde nicht nur die Krönung seiner Sammlung bilden, sie würde zugleich das Ende Burgunds besiegeln. Gedankenverloren streichelte Ludwig die einzelnen Reliquiare.
Seine Spitzel hatten ihm von dem hinterhältigen Plan Habsburgs berichtet, an der Verbindung Maximilians mit Maria von Burgund festzuhalten. Schon die Verhandlungen zwischen beiden Häusern im letzten Jahr hatten seinen Zorn ins Unermessliche gesteigert. Damals war ihm ein Eingreifen unmöglich gewesen. Jetzt aber, jetzt lag die Macht in seinen Händen.
Seine Männer kannten ihren Auftrag und sollten sie scheitern, gab es immer noch ihn, der ihm schon mehr als einmal treue Dienste erwiesen hatte. Ja, er behielt gern mehr als nur ein Eisen im Feuer. Deshalb und nur deshalb würde ihm der Sieg zufallen. Er, Ludwig, der von Gott bestimmte Herrscher Frankreichs, würde Burgund zerschmettern, den Habsburger Kaiser demütigen und ein für alle Mal in seine Schranken verweisen.
L‘araignée – die Spinne – oh ja, er kannte den Namen, den viele seiner Feinde für ihn hatten, aber das störte ihn nicht, im Gegenteil. Das Netz war vollendet, und nun wurde es Zeit, dass sich seine Beute darin verfing.
Kapitel 8: Gent, am Hof des Herzogs Karl der Kühne
»Teuerster und gütiger Gebieter und Bruder, ich grüße Sie aus ganzem Herzen. Sie dürfen nicht daran zweifeln, dass ich zur Vereinbarung zwischen uns – getroffen von den Vertrauten meines Herrn und Vaters, der nun im Himmel ist – steh und ich will Ihnen eine getreue Ehefrau sein. Der Überbringer weiß, wie ich von Feinden umgeben bin. Gott gewähre uns unseren Herzenswunsch. Ich bitte Sie inständig, nicht zu zögern, denn Ihr Kommen wird meinem Volke Trost und Hilfe bringen. Wenn Sie aber nicht kommen, kann mein Land keine Unterstützung erwarten, und ich könnte gewaltsam gegen meinen Willen dazu getrieben werden, etwas zu tun, falls Sie mich im Stich lassen.
So lege ich das Heil meiner Seele in Ihre Hände. Mögen diese Zeilen Sie erreichen, bevor es zu spät ist.«
Mit entschlossenem Schwung setzte Maria von Burgund ihre Unterschrift auf das Pergament. Für einen Moment hielt sie inne, die letzten Wochen waren schrecklich gewesen. Ihr geliebter Vater tot, ihr Onkel – Anton von Burgund – gefangen und als Geisel an den Hof Ludwigs verschleppt. Zusammen mit ihrer Stiefmutter wartete sie nun schon eine Ewigkeit auf die erlösende Antwort der Habsburger.
Ihr Vater hatte nie einen Sohn, einen Thronfolger gezeugt, also war sie in dem Wissen erzogen worden, einmal an der Seite ihres Gatten die Geschicke Burgunds zu lenken. Was aber konnte eine zwanzigjährige Prinzessin der Gewalt des Mobs und dem Hass entgegensetzen, die wie eine Flutwelle durch die Straßen Gents stürmten? Sie war zu einer Gefangenen in ihrem eigenen Schloss geworden. Vor ihren Augen hatte man zwei ihrer engsten Berater hingerichtet. Sie selbst war nach draußen vor die Tore des Schlosses gelaufen, hatte um Gnade gefleht. Doch sie konnte nichts gegen die Wut der Bürger tun, die endlich ihr Schicksal in die Hand nehmen wollten und auf ihre Unabhängigkeit pochten. Nur ein letzter Rest Anstand hatte Maria davor bewahrt, selber zum Opfer zu werden.
Nein, dieser eine Brief war alle Hoffnung, die sie noch besaß.
Sie rollte das Pergament zusammen und siegelte es mit ihrem Ring. In respektvollem Abstand wartete ihre Zofe.
»Bitte, Adelais, der fremde Ritter, der, der sich mit dem Siegel des Kaisers ausgewiesen hat, gib ihm diesen Brief.«
»Aber Hoheit, er ist ...«
»Was ist er? Weißt du nicht, wo du ihn finden kannst?«
»Nein, was Eure Zofe sagen wollte, war, dass ich schon da bin, Hoheit.«
Maria zuckte erschrocken zusammen, aus dem Halbdunkel ihres Gemaches trat der fremde Ritter hervor. Sie hatte nicht bemerkt, dass er den Raum zusammen mit Adelais betreten hatte. Und ihre Zofe war zu höflich gewesen, sie beim Schreiben zu unterbrechen.
Mit zwei gleitenden Schritten stand der Ritter mitten im Raum. Die besten Schwertkämpfer ihres Vaters bewegten sich so, schnell und geschmeidig und dabei gleichzeitig wachsam und angespannt.
Maria von Burgund stand auf, richtete mit ein paar Handbewegungen ihr Kleid, bevor sie stolz das Kinn hob.
»Nun, es überrascht mich, dass Ihr hier in mein Privatgemach eindringt.«
Der Fremde verbeugte sich formvollendet: »Verzeiht, Hoheit, aber ich hielt es für das Klügste, Eure Nachricht möglichst unauffällig zu erhalten.«
In seiner Stimme schwang eine Spur Spott mit, so, als sei alles nur ein spannendes, aber doch harmloses Spiel.
Ja, genau, das war es, dachte Maria. Umgeben von seinen Feinden, mit einem Auftrag, der ihn schlimmstenfalls das Leben kosten konnte, war es doch nur eine weitere Herausforderung für ihn.
»Und Euer Name? Haben die Gesandten Kaiser Friedrichs von Habsburg keinen Namen?«, fragte sie herausfordernd.
»Gernot von Württemberg, Ritter des schwarzen Adlers und wie mein Siegel Euch bewiesen hat, Bevollmächtigter des Kaisers«, antwortete der Ritter und deutete eine zweite Verbeugung an.
»Gernot von Württemberg? Dann habt Ihr in Andernach mit meinem Onkel und meinem Vetter verhandelt?«, fragte sie überrascht.
»In der Tat, ich durfte bei der Planung Eurer Ehe mit Maximilian dabei sein.«
»Aber ...«, Maria stockte verlegen, »aber ist nicht ein Württemberger der Gefangene meines Vaters?«
Bei dieser Frage huschte ein langgehegter, alter Zorn über das Gesicht des Ritters: »Nun, das ist vorbei. Mein Vetter Heinrich ist auf freiem Fuß, und mein Treueeid wiegt weit mehr als die Wut über die Gefangennahme eines Mitglieds meiner Familie.«
Das klang aufrichtig. Doch Maria war davon überzeugt, dass es nur zum Teil stimmte, denn sie hatte noch gut die Berichte ihres Onkels in Erinnerung. Gernot von Württemberg war ein Ehrenmann, keine Frage, aber er war auch ein Hitzkopf, der die Verhandlungen fast zum Scheitern gebracht hatte. Aber nun war er hier, hier in Gent, in ihrem Gemach, um den wichtigsten Brief ihres Lebens zu übernehmen. Musste man ihm da nicht alle früheren Wutausbrüche verzeihen? Maria fühlte sich plötzlich erleichtert und beruhigt bei dem Gedanken, dass sie gerade ihm den Brief anvertrauen würde. Erst jetzt bemerkte sie die dünne Narbe auf seiner linken Wange. Das war sicher kein Unfall gewesen, dachte Maria. Sie trat mit dem Pergament auf ihn zu. Sie war es gewohnt, dass Menschen in ihrer Nähe unsicher wurden. Doch Ritter Gernot strahlte die Selbstsicherheit eines erfahrenen Kämpfers aus. Wenn sie eine Wirkung auf ihn hatte, so ließ er es sich nicht anmerken.
Er war mit dem Auftrag gekommen, mehr über die Lage in Gent zu erfahren, und jetzt musste er als Kurier so schnell wie möglich ihren Hilferuf ihrem Verlobten überbringen. Würde Maximilian wirklich zu den Versprechen stehen, die damals in dieser kleinen Stadt am Rhein getroffen worden waren?
Maria überreichte Gernot den Brief. »Wollt Ihr bitte alles daran setzen, dass diese Nachricht so schnell wie möglich Euren Herrn erreicht?«
Der Ritter nickte, steckte das Pergament in den Beutel an seiner Seite und verneigte sich vor der künftigen Gattin Maximilians von Habsburg.
»Lasst mich, Hoheit, noch die Audienz abwarten, zu der Ihr geladen habt. Danach werde ich mit meinem Leben dafür bürgen, dass diese Zeilen ihr Ziel erreichen.«
Maria seufzte. Die Audienzen – wie sie diese Treffen hasste.
Es gab gute Gründe für ihre Abscheu. Was glaubten eigentlich diese Idioten, wen sie vor sich hatten? Im großen Saal standen Höflinge und Gesandte vor ihrem Thron und stritten sich. Sie stritten sich um sie, um ihr Erbe, ihre Zukunft, sie debattierten über ihr Leben, dachte Maria. Und sie? Sie sollte milde lächeln, ab und zu weise nicken, vor allem aber den Mund halten. Mehr wurde erst einmal nicht von ihr erwartet. Die junge Prinzessin musste sich zusammenreißen, um nicht laut zu schreien. Am liebsten hätte sie ein Langschwert ihres Vaters ergriffen und das ganze Pack vor die Tore des Schlosses gejagt. Aber diese Rolle hatte man leider für sie nicht vorgesehen.
»Wenn Ihr glaubt, eine Verbindung mit dem Bruder des englischen Königs würde von meinem Herrn, dem Herrscher Frankreichs, der seine geliebte Cousine unter seine eigene Obhut gestellt hat, gebilligt, muss ich Euch enttäuschen.«
Olivier le Daim, ein enger Vertrauter König Ludwigs, sah die Wirkung seiner Worte und war zufrieden. Dieser englische Hurensohn sollte es nur wagen, seine dreckigen Finger nach Burgund auszustrecken. Der hochrote Kopf des Gesandten von George Plantagenet, dem ersten Duke of Clarence, war nicht zu übersehen. Allen im Saal war klar: Noch ein Wort gegen seinen Herrn aus dem Munde dieses französischen Emporkömmlings und es würde Blut fließen.
»Meine Herren, ich bitte Euch, meint Ihr nicht, es wäre an der Zeit, einmal innezuhalten?«, Marias helle Stimme klang bittend und energisch zugleich. Es war das erste Mal, dass sie das Wort direkt an die Gesandten richtete, die da über ihre Zukunft stritten. Die Männer im Saal schwiegen überrascht und blickten die junge Frau erstaunt an. Maria schaute sich im Saal um. Hinten in einer Ecke stand der junge Württemberger, fast hätte sie ihn nicht erkannt. Seine ganze Haltung hatte sich verändert, die langen schwarzen Haare waren unter einer geckenhaften Kappe fast verschwunden. Sein Anblick hätte sie zu einem anderen Zeitpunkt erheitert, jetzt aber schöpfte sie Kraft daraus. Sie forderte die Gesandten Frankreichs und Englands mit einer Handbewegung auf, näherzutreten.