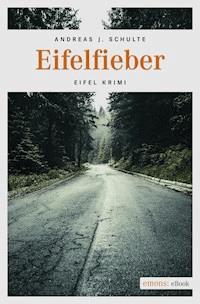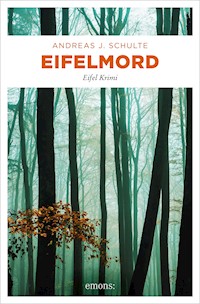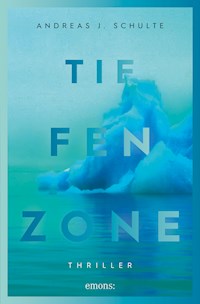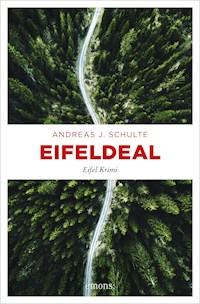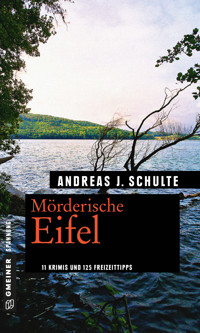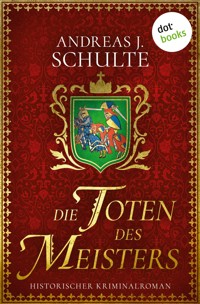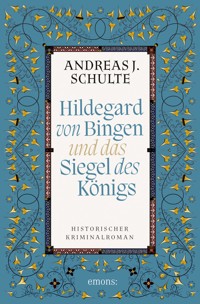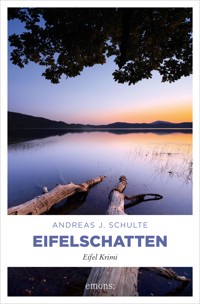
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Paul David
- Sprache: Deutsch
Der Tote vom Laacher See Der härteste Ermittler der Eifel ist zurück – und er sinnt auf Rache. Am Laacher See wird ein Mann erschlagen aufgefunden, sein Wohnmobil auf dem Campingplatz Pönterbach wurde verwüstet. Der ehemalige Militärpolizist Paul David und Ex-Major Linda Becking ermitteln und stoßen auf Berichte über einen britischen Bomber, der 1942 im See versank – an Bord ein wertvoller Silberschatz. War das Opfer auf der Suche danach? Als ein weiterer Mord geschieht, ein Gebäude auf dem Campingplatz in Flammen aufgeht und Paul und Linda angegriffen werden, wird der Fall persönlich ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas J. Schulte, Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Söhne, ist geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen und lebt heute mit seiner Frau in der Nähe von Andernach. Neben seinen Krimis und Thrillern schreibt und veröffentlicht er auch Kurzgeschichten und historische Kriminalromane. Er ist Mitglied im »Syndikat« und bei »HOMER – Historische Literatur e.V.«. Sein historischer Kriminalroman »Hildegard von Bingen und das Siegel des Königs« war für den Goldenen HOMER 2024 nominiert. www.krimiautor.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: stock.adobe.com/AVTG
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-304-5
Eifel Krimi
Originalausgabe
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Lesen&Hören, Berlin.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß
§ 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Nicole – Lieblingsköchin!
Lass die Vergangenheit ruhen,sonst wird dich die Vergangenheitnicht leben lassen.
Prolog
Luftraum über der Hohen Acht/Adenau-Eifel29. August 1942, kurz vor Mitternacht
Das Dröhnen der vier großen Propeller erfüllte den Innenraum des Flugzeugs. Die nackten, ungedämmten grauen Metallwände vibrierten und die Metallstreben des Bombers ebenso, jede einzelne von ihnen. Kalt war es hier oben. Der Geruch von Kerosin lag in der Luft.
Pilot Officer Vincent Morrison kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich auf die Funksignale, die schwach in seinem Kopfhörer zu hören waren. Für ihn war es bereits der vierte Kampfeinsatz in den letzten zwei Wochen. Als Wireless Officer saß er im Bug des Flugzeugs, eine Ebene unter dem Piloten. Sergeant Dryhurst, der Pilot, hatte den nächtlichen Flug über feindlichem Gebiet bisher mit Bravour gemeistert.
Um kurz nach halb neun abends war der Bomber des Typs Halifax Mk II vom Royal-Air-Force-Stützpunkt Elsham Wolds gestartet. Vincent war stolz darauf, zur siebenköpfigen Crew zu gehören, einer Crew, die Teil des Kampfes gegen Nazi-Deutschland war.
Er liebte das Flugzeug, das vor nicht einmal neun Monaten seinen Jungfernflug absolviert hatte. Es besaß eines der wenigen neuen H2S-Radarsysteme, damit konnten sie ihre Bomben noch zielgenauer abwerfen.
Mit einer Spannweite von mehr als vierunddreißig Yards war es das größte Flugzeug, auf dem er bislang Dienst geleistet hatte. Fast dreißig Tonnen Startgewicht ermöglichten der Crew, rund sechstausend Kilogramm Bomben über den verhassten Nazis abzuwerfen. Vincent schaute auf das Chronometer. Sie waren jetzt seit über drei Stunden in der Luft, in wenigen Minuten war Mitternacht. Am liebsten hätte er James gefragt, wie lange sie noch bis Nürnberg fliegen mussten. Doch Sergeant James Platt hasste es, bei seiner Arbeit als Navigator gestört zu werden. Vincent unterdrückte ein Seufzen. Egal. Sicher war, dass sie zum Frühstück zurück in Elsham Wolds sein würden. Wenn er sich auf seinem Segeltuchsitz umdrehte, konnte er die drei zusätzlichen Metallkisten unterhalb des Fallschirmregals sehen. Grau, unscheinbar und mit einem Schloss gesichert. Diese drei Kisten machten ihren Flug zu einer besonderen Mission.
Die Crew würde ihre tödlichen Bomben über Nürnberg abwerfen und dann, so lautete der Einsatzbefehl, auf dem Rückweg die drei Metallkisten über einem festgelegten Zielpunkt in die Nacht stoßen. Jede Kiste war mit einem eigenen Fallschirm ausgestattet. Ungläubig hatte er beim Verladen den Inhalt bestaunt.
Zusammen mit Bernhard, der als Air Gunner an den Geschützen Dienst tat, hatte er dafür gesorgt, dass die schweren Kisten mit Gurten korrekt gesichert waren.
»Alarm, feindliches Flugzeug im Anflug!« Die Durchsage von Bernhard im gläsernen Geschützturm klang hektisch und schrill in seinen Kopfhörern.
Sekunden später knatterten die Bordgeschütze los, die Schüsse übertönten das Dröhnen der Propeller.
»Die Krauts sind über uns! Verdammt, das ist eine Hundertzehner.« Explosionen begleiteten Bernhards Warnruf.
An seinem Platz gab es kein Fenster, keine Plexiglas-Kuppel, durch die man den nächtlichen Himmel sehen konnte. Es war, als würde er einem absurden Hörspiel lauschen, in dem das Geschehen auf dem besten Weg war, in einer Katastrophe zu enden.
Bernhard im oberen Geschützturm und John MacLachlan im hinteren Gefechtsstand schrien sich über die Explosionen hinweg Positionsangaben zu.
Plötzlich übertönte ein lautes Krachen alle anderen Geräusche. Vincent wurde von seinem Sitz nach vorne geworfen, mit einem ohrenbetäubend schrillen Kreischen kippte die Maschine zur Seite und sank.
»Getroffen. Wir sind … der Herr steh uns bei.«
Bernhards Stimme brach ab. Irgendwer fluchte laut. Das Kreischen klang jetzt wie ein gequältes Tier. Weiter hinten in der Maschine brannte es. Dichter, öliger Rauch nahm Vincent die Sicht, hastig tastete er sich zu dem Fallschirmregal, umklammerte eine Strebe, um nicht den Halt zu verlieren, als der Bomber in einen unkontrollierten Sturzflug überging. Etwas schlug gegen seinen Hinterkopf, alles um ihn herum verschwamm. Das Letzte, was Vincent Morrison sah, waren die drei grauen Kisten, die ihr Ziel nie erreichen würden.
1
Gut 75 Jahre später …
Der Swingkick traf mich links auf den Rippen, und das mit ziemlicher Wucht. Schmerzhaft, aber okay, schließlich gab es da diese gepolsterten Trainingsschuhe. Es ging hier um Sport, nicht darum, dem Trainingspartner die Rippen zu brechen. Was allerdings litt, jedes Mal wieder, war mein Ego.
Zu meiner Entschuldigung muss ich zwei Dinge zu Protokoll geben. Erstens fehlt mir der linke Unterarm, das machte das Blocken von Tritten nicht gerade komfortabler. Zweitens war ich abgelenkt. Abgelenkt vom Anblick schweißnasser, gebräunter Haut, die nur spärlich von einem knappen Tanktop bedeckt wurde. Dieser Anblick plus ein wirklich umwerfendes Lächeln, für das ich jeden Tritt einstecken würde.
»Hey, Paul, konzentrier dich. Was ist los heute Morgen?« Linda Becking, Ex-Major des Criminal Investigation Department der US-Army, lächelte mich an. So ein Lächeln schenkte sie mir mehr als einmal am Tag. Es war umwerfend. Umwerfend, wunderbar und sexy. In diesem Moment wurde mir zum ersten Mal klar, dass sie dieses Lächeln auch bewusst einsetzte, um mich abzulenken. Zumindest, wenn wir morgens auf der Wiese hinter unserem Haus trainierten.
Linda lächelte erneut, und schon im nächsten Augenblick sprang sie mit einem Schrei nach vorne, feuerte eine Kombination aus Schlägen ab. Doch dieses Mal war ich vorbereitet. Da, wo ich eben noch gestanden hatte, trafen ihre Schläge jetzt nur noch einen Hauch kalter Morgenluft. Ich hatte mich blitzschnell unter dem ersten Schlag weggeduckt, drehte mich zur Seite, ein Ausfallschritt, und schon stand ich direkt hinter ihr. Mit der gesunden Hand stieß ich ihr zwischen die Schulterblätter und trat ihr gleichzeitig in die Kniekehle. Mit einem Aufschrei fiel sie ins taufeuchte Gras. Sie fing ihren Sturz ab und rollte sich blitzschnell auf den Rücken, um wieder auf die Beine zu springen, doch diesmal war ich schneller. Ich landete auf ihr und hielt mit meiner gesunden Hand ihren Arm fest.
»Erwischt!«
Linda schloss kurz die Augen, hob dann den Kopf und gab mir einen Kuss.
»War das mit dem breiten Lächeln doch zu auffällig?«
»Nein, ich hab es genossen, bis du mir den blauen Fleck auf den Rippen verpasst hast. Danach bin ich dann wieder zu Sinnen gekommen.«
Ich stand auf und reichte Linda die Hand, um ihr aufzuhelfen. »Wie wäre es mit einer kleinen Laufrunde zum Abschluss?«
»Warum nicht?« Linda schaute auf ihre Uhr. »Aber danach brauche ich noch einen großen Becher Kaffee und eine Dusche. Um zehn Uhr kommt unser neuer Klient.«
»Wir könnten gemeinsam unter die Dusche, das spart enorm Zeit.«
»Träum weiter, mein Lieber.«
»Einen Versuch war es wert gewesen. Also nur laufen …«
»Du kannst ja heute Abend noch mal fragen, aber nur, wenn du schneller bist als ich«, erwiderte Linda und lief los.
Das war das Schöne am Pöntertal. Man musste nur die Zufahrt des Campingplatzes entlanglaufen und gelangte nach wenigen hundert Metern auf einen Feldweg, der sich ideal für eine schnelle morgendliche Runde eignete. Nach kurzer Zeit hatte ich Linda eingeholt, und wir sprinteten nebeneinander über den Weg.
Die Sonne ließ die taufeuchten Grashügel des Pöntertals in einem satten Grün leuchten. Schön war es hier. Ich atmete tief durch, während wir allmählich in einen gemäßigten Trab verfielen.
Ich schaute Linda aus dem Augenwinkel an. Es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht daran dachte, was für ein Glückspilz ich war. Nicht nur jeden Morgen neben Linda aufzuwachen, nein, auch den Arbeitstag an der Seite dieser wunderbaren Frau zu verbringen – das war ein großes Geschenk.
Zwei Jahre war es jetzt her, dass sie mir eines Morgens eröffnet hatte, dass sie den Dienst bei der Army quittieren würde. Und nicht nur das, Linda hatte auch schon einen ausgeklügelten Plan: Sie würde mich ab jetzt bei meinen privaten Ermittlungen unterstützen. David und Becking, private Ermittlungen. Darauf wäre ich in meinen kühnsten Träumen nicht gekommen. Linda hatte damals auch ziemlich genaue Vorstellungen gehabt, was noch alles zu tun war.
»Das bedeutet aber auch, dass du anbauen musst, mein Lieber, deine Wohnung hinter dem Laden wird für uns zwei zu klein sein.« Genau das hatte sie damals gesagt, und ich war klug genug gewesen, ihrem Wunsch zu folgen.
2
Wäre man dem Mann auf dem Waldweg begegnet, wäre einem vielleicht die Größe aufgefallen. Der Mann war groß, sicher über einen Meter fünfundneunzig, und dabei trotz seines Alters sehr schlank geblieben. Fast schon hager. Ein Mann, der sich im Laufe der Jahrzehnte angewöhnt hatte, den Kopf leicht gebeugt zu halten, weil er fast ständig mit kleineren Menschen sprechen musste. Der Typ schlaksiger Mathematik- oder Erdkundelehrer.
Dazu passten die ausgebeulten Cordhosen, das Oberhemd und der Strickpullunder.
Eine dunkelgrüne Barbour-Jacke mit braunem Cordkragen lag über einer Holzbank, die keine zwei Schritte entfernt direkt am Uferrand stand, damit Spaziergänger die Aussicht aufs Wasser genießen konnten. Zwei Schritte von dem Mann entfernt, der mit dem Gesicht voran reglos im flachen Wasser am Rand des Laacher Sees lag.
***
»Kinder, bitte bleibt zusammen. Leon, hör auf, Jasmin zu schubsen. Pierre-Gilbert, die Jacke bleibt an. Herrschaften, wenn ihr nicht leise seid, kann Herr Branner uns nichts zu den Vögeln im Wald erzählen. Hallo! Seht ihr hier den Schweigefuchs? Gut!«
Iris Derner-Faltenkrug ließ die Hand mit den zu einem stilisierten Fuchs zusammengelegten Fingern sinken, pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn und seufzte leise. Eine vierte Klasse zusammen mit Achim, einem jungen Referendar, am Laacher See im Zaum zu halten, war an sich schon anstrengend. Achim war ihr in Sachen Disziplin überhaupt keine Hilfe. Vermutlich hätte er am liebsten mit herumgealbert. Dass sie aber auch ausgerechnet Achim hatte mitnehmen müssen. Doch das war heute hier am See nicht das einzige Problem. Aber so war wenigstens auf dem Papier die Aufsicht gewährleistet. Dazu kam noch der leicht genervte Gesichtsausdruck von Daniel Branner. Der hatte gleich zu Beginn des Waldspaziergangs am Laacher See klargemacht, dass er mehr als genug zu tun hatte und nur widerwillig für den erkrankten Kollegen eingesprungen war. Aber das Leben ist eben kein Ponyhof, hatte Iris gedacht. Sie musste schließlich diesen blöden Tagesausflug über die Bühne bringen. Am besten, ohne dass eines der Kinder im See landete, und Förster Branner hatte sie eben für zwei Stunden am Hals. Das war Teil des Programms.
»So, Herr Branner, Sie sind Jäger. Was gibt es denn hier für Vögel rund um den Laacher See?«, fragte Iris mit ihrer besten Lehrerinnenstimme, laut genug, dass alle Kinder ihrer Klasse mitbekamen, dass sie jetzt aufpassen mussten.
»Forstoberinspektor, ich bin Forstoberinspektor. Den Jagdschein hab ich auch, aber das ist eine andere Sache.«
»Du tötest Tiere?«, empörte sich ein blondes Mädchen.
»Ähm … ja schon … also nur, wenn es nötig ist. Ich meine, die Rehe haben ja keine natürlichen Feinde, und wenn wir den Wald aufforsten wollen –«
»Der erschießt Bambi!« Der Ausruf des Jungen mit dem Spiderman-Anorak ließ die gesamte Klasse zwei Schritte zurückweichen.
»Also, genau genommen war Bambi ein Hirschkalb, kein Reh …«
»Iih, Bambi-Mörder! Bambi-Mörder!«
»Kinder, Schluss jetzt. Wir lassen Herrn Branner jetzt mal reden, über das Jagen können wir noch nächsten Monat bei unserem Projekttag sprechen. Und du, Karl-Egbert, hörst jetzt mit diesem Bambi-Quatsch auf.« Iris feuerte noch strenge Blicke in die Runde, und als sie sicher sein konnte, dass alle die Ernsthaftigkeit ihrer Ansage begriffen hatten, wandte sie sich wieder dem Forstbeamten zu. »Zurück zu den Singvögeln. Was können Sie uns denn darüber erzählen?«
»Ja, also … im Grunde sind Singvögel nicht so mein Fachgebiet.« Er überlegte kurz. »Wir haben natürlich … ähm … Spechte hier im Wald.«
»Spechte machen doch so Löcher in die Bäume, oder, Herr Branner?«
»Die machen die Bäume tot!«
Iris konnte leider nicht erkennen, wer da schon wieder dazwischengerufen hatte.
»Natürlich müssen wir die langfristige Baumgesundheit im Blick behalten …«
»Und warum liegen dann hier überall kaputte Bäume rum? Sogar da vorne im Wasser?« Karl-Egbert zeigte in Richtung Uferkante.
»Wir lassen sogenanntes Totholz im Wald, weil es zum Beispiel ein wichtiger Lebensraum für Insekten und Kleintiere ist. Wir …« Sichtbar erleichtert setzte Daniel Branner zu einer längeren Erklärung an, das war offenbar ein Thema, das ihm am Herzen lag.
»Ahhhh!«
Der Schrei eines Mädchens sorgte dafür, dass Branner seine Erklärung mit einem leisen Aufstöhnen abbrach.
»Victoria-Luise, was gibt es da zu schreien?«, fragte Iris streng.
»Da vorne, da … da liegt ein Mann im Wasser.«
Gegen das Geschrei der Kinder, das nun losbrach, konnte auch das Schweigefuchs-Zeichen einer Lehrerin nichts mehr ausrichten. Iris Derner-Faltenkrug erwischte sich sogar dabei, dass sie selbst einen erschrockenen Ruf nicht ganz unterdrücken konnte.
Während sie mit Achims Hilfe versuchte, die Kinder zu beruhigen und sie davon abzuhalten, zum Wasser zu rennen, zog Forstoberinspektor Daniel Branner hektisch sein Handy aus der Jackentasche und wählte mit zitternden Fingern den Notruf.
3
Für zwei Personen hätte meine Wohnung wirklich nicht ausgereicht, auch wenn es sich dabei um zwei Personen handelte, die es aus ihrer Zeit beim Militär gewohnt waren, mit lediglich einem Bett und einem Spind auszukommen.
Der Campingplatz Pönterbach lag im Naturschutzgebiet Pöntertal unterhalb von Andernach-Kell. Von unserem Platz aus konnte man in wenigen Autominuten am Laacher See sein. Meine Tante Helga und mein Onkel Hans hatten diesen Platz aufgebaut. Die beiden hatten jung geheiratet, fünfunddreißig Jahre lang waren sie zusammen gewesen. Hans hatte schließlich seine Arbeit als Physiklehrer an einem örtlichen Gymnasium an den Nagel gehängt und sich ausschließlich um den Campingplatz gekümmert. Bis zu dem Morgen, an dem man ihn tot neben dem Rasentraktor fand. Niemand hatte gewusst, dass dieser Schrank von einem Mann ein schwaches Herz besaß. Die Ehe von Hans und Helga war kinderlos geblieben, deshalb hatte mein Onkel in seinem Testament mich bedacht.
Die Nachricht hatte mich damals während der Reha erreicht. Ich erholte mich nur langsam von der Verletzung und musste lernen, mit einer Unterarmprothese zu leben. Ein Platz zum Leben und eine sinnvolle Arbeit außerhalb der Bundeswehr – das hatte verlockend geklungen. Den Entschluss, mit Helga zusammen den Campingplatz zu managen, habe ich nie bereut.
In dem großen Wohnhaus, in dessen oberer Etage Helga wohnte, befand sich im Erdgeschoss ein kleiner Verkaufsladen, der gleichzeitig als Rezeption für den Campingplatz fungierte. Hinter dem Laden gab es noch einen Wohnraum mit Küchenzeile, ein winziges Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche. Ich hatte bei Einsätzen der NATO-Sondereinheit wochenlang im Biwakschlafsack geschlafen, hatte heruntergekommene, kleine Zimmer in alten Kasernen und miesen Absteigen kennengelernt – die Wohnung hinter dem Laden war in meinen Augen ein Palast gewesen. Aber zugegeben: für zwei Personen und eine Detektei definitiv zu klein.
Während ich mir damals noch Gedanken gemacht hatte, ob und wie man anbauen könnte, hatten Linda und Helga innerhalb kürzester Zeit eine Lösung parat. Gegenüber von Helgas Haus befand sich eine Freifläche. Onkel Hans hatte immer vorgehabt, dort einen neuen Sanitärtrakt für die Campinggäste zu bauen, diesen Plan aber nie in die Tat umgesetzt. Stattdessen wurde nun innerhalb kürzester Zeit ein Holzmodulhaus mit einer Terrasse errichtet, groß genug, um eine Familie zu beherbergen. Linda und ich hatten in unserem neuen Haus jeder ein eigenes Arbeitszimmer. Klientengespräche wollten wir aber beide nicht in unseren privaten vier Wänden führen, daher bauten wir meine alte Wohnung zu unserem Büro aus. Das Wohnzimmer bot ausreichend Platz für zwei Schreibtische und einen kleinen Besprechungstisch. Die Küche wurde abgebaut, zurück blieb lediglich die Möglichkeit, Kaffee zu kochen, und mein ehemaliges Schlafzimmer wurde zum Lager- und Archivraum.
Was blieb, war bei vielen Klienten das Erstaunen, zunächst einmal durch einen Campingladen gehen zu müssen, bevor man die Detektei »David und Becking – private Ermittlungen« aufsuchen konnte. Woody Allen soll einmal gesagt haben: »Das Geheimnis des Erfolgs? Anders sein als die anderen.« Nun, das war eine mögliche Erklärung dafür, warum »David und Becking« erfolgreich war, wir waren anders. Oder um es mit Lindas Worten zu sagen: Unsere Honorare waren deshalb bezahlbar, weil wir keine chromglänzenden, teuren Büroräume in Frankfurt oder Köln finanzieren mussten.
Unsere Klienten konnte man grob in zwei Gruppen einteilen. Für die einen waren wir der letzte Strohhalm, an den sie sich klammerten, weil andere bei ihrem Fall längst aufgegeben hatten. Für die anderen eine Möglichkeit, diskret etwas zu erfahren, ohne gleich ein Aktienpaket auflösen zu müssen, um den Stundensatz zu bezahlen.
Als ich an diesem Morgen, frisch geduscht und umgezogen, über den Kiesplatz zu unserem Büro ging, fiel mir sofort der nachtblaue BMW auf, der vor dem Schild »Anmeldung/Rezeption« parkte. Der Fahrer hinter dem Lenkrad schaute abwechselnd auf sein Handy und durch die Fensterscheiben nach draußen. Diesen Blick kannte ich schon – wahrscheinlich dachte er gerade: Ich habe das Ziel erreicht, aber wo zum Teufel ist diese Detektei?
Ich ging zum Wagen und klopfte mit dem Fingerknöchel gegen die Seitenscheibe. Der Fahrer zuckte zusammen. Eine Sekunde später fuhr die Fensterscheibe nach unten.
»Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich.
»Ähm … ja … vermutlich bin ich hier ganz falsch. Ich suche, das klingt jetzt absurd, eine Detektei, ›David und Becking‹.«
»Sie sind nicht falsch. Ich bin Paul David, kommen Sie doch bitte mit in unser Büro.«
Der Mann zögerte, dann stieg er aus und folgte mir. Aus dem Augenwinkel musterte ich ihn. Mitte bis Ende vierzig, Designerjeans, maßgeschneidertes Sakko, Einstecktuch inklusive, teure italienische Lederschuhe. Allein für den Preis der Omega Speedmaster an seinem Handgelenk hätte er mindestens ein Jahr als Gast auf unserem Campingplatz leben können.
Es sprach für seine Selbstbeherrschung, dass er keine Miene verzog, als wir durch den Campingladen zum Büro gingen, vorbei an Regalen mit Zeltheringen, Gaskartuschen, Nudelpaketen, Konserven und Zeitschriften. Im Büro, wo ein großes Fenster einen atemberaubenden Blick auf das Pöntertal mit seinen alten Apfelbäumen und den angrenzenden Eichenwald bot, wartete bereits Linda. Sie stand auf und ging unserem Besucher entgegen.
»Guten Morgen, Sie müssen Dr. Dietrich sein. Schön, Sie kennenzulernen, ich bin Linda Becking.«
Dr. Dietrich schaute sich unauffällig in unserem Büro um, bevor er sich auf einen der Stühle am Besprechungstisch setzte. »Das hier ist also die Detektei ›David und Becking‹.« Sein Ton lag irgendwo zwischen fassungslos und enttäuscht.
»Es freut uns, dass Sie zu uns gefunden haben, Herr Dr. Dietrich.«
»Ich … also … meine Frau weiß noch nichts von diesem Besuch.«
»Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und darüber, dass Sie der Empfehlung gefolgt sind. Egal, was Ihre Tochter oder Ihr Sohn angestellt hat, wir können uns darum kümmern. Auch wenn Geld bei Ihnen wohl kaum eine Rolle spielt, werden Sie sich sicher freuen, dass wir ganz moderate Tagessätze berechnen«, erklärte ich.
Dietrich schaute mich erstaunt an. »Entschuldigen Sie, Herr David, aber wie kommen Sie darauf?«
»Sie haben im Auto abwechselnd auf Ihr Handy und aus dem Fenster geschaut, so als könnten Sie es nicht glauben, am richtigen Ort zu sein. Sie waren also noch nie bei uns. Sie haben draußen meinen Nachnamen gleich korrekt englisch ausgesprochen. Also hat uns wohl jemand empfohlen, der uns kennt.«
Linda zwinkerte mir zu und ergänzte: »Außerdem sagten Sie gerade, dass Ihre Frau noch nichts von dem Besuch weiß. Es geht also nicht um ein Eheproblem, einen Seitensprung oder eine Scheidung. Bleiben berufliche Fragen oder Kinder als wahrscheinlichste Möglichkeit. In dem Fall hat Paul wohl einfach mal geraten. Dass Sie allerdings keine Schwierigkeiten mit unserem Honorar haben werden, zeigt mir allein die Armbanduhr an Ihrem Handgelenk. Eine Omega Speedmaster, die Uhr, die von der NASA für alle Missionen ausgewählt wurde. Das gute Stück dürfte locker über zehntausend Euro kosten, wobei es nicht die Goldversion für vierzigtausend Euro ist.«
Linda war die Ausstattung unseres Gastes also auch ins Auge gefallen.
»Darf ich Ihnen einen Espresso oder einen Cappuccino anbieten? Danach können Sie in aller Ruhe berichten, was Sie zu uns führt«, bot ich an.
»Ein Cappuccino wäre jetzt genau das Richtige. Und ich muss mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich habe in den zurückliegenden Jahren mit einigen Vertretern Ihres Gewerbes zu tun gehabt und, nun ja, was soll ich sagen …«
»Es gibt überall schwarze Schafe, Herr Dr. Dietrich«, erwiderte Linda. »Und einige Kolleginnen und Kollegen glauben, dass sie mit teurer Ausstattung und eindrucksvollen Geschäftsräumen glänzen müssen. Am Ende aber zählt bei privaten Ermittlungen vor allem die Erfahrung im Metier. Know-how können Sie nicht durch ein Edelbüro in der City ersetzen.«
»Wie gesagt, ich muss mich entschuldigen. Oberst Hartmut Berner ist ein alter Freund von mir, er hat mir Sie, Herr David, empfohlen. Er hat mir auch Ihre Biografie zusammengefasst: Der Vater ein US-Marine, die Mutter aus der Eifel, Tochter einer Polizistenfamilie. Sie sind zur Bundeswehr gegangen, wurden Feldjäger, dann NATO-Sonderermittler. Sie besitzen schwarze Gürtel in drei verschiedenen Kampfsportarten, haben sich zu Dienstzeiten als hervorragender Schütze erwiesen. Allerdings sprach Hartmut auch von einer schweren Verwundung, die Sie in Afghanistan bei einem Einsatz erlitten hätten.«
Ich hob den linken Arm und beugte die Finger meiner bionischen Hand. »Fällt auf den ersten Blick gar nicht ins Auge, diese moderne Prothese. Es freut mich, dass Oberst Berner sich noch an mich erinnert.« Ich schob für Linda zur Erklärung nach: »Oberst Berner war früher mein Vorgesetzter.«
»Erinnert? Ha, Sie hätten Hartmut mal hören sollen. Er hat regelrecht von Ihnen geschwärmt. Und weil ich ganz gute Kontakte zu den US-Streitkräften in Kaiserslautern habe, weiß ich auch, dass Sie, Frau Becking, als Ex-Major des CID ebenfalls einen hervorragenden Ruf genießen.« Dr. Dietrich hob entschuldigend die Hände. »Sie sehen, ich hätte es also besser wissen müssen, eben weil ich mich genau über Sie beide informiert habe. Es tut mir leid, dass ich mich von den … ähm … Gegebenheiten hier habe ablenken lassen.«
»Geschenkt. Wie können wir Ihnen helfen?«, fragte ich. Ich kannte nicht viele Menschen, die Oberst Berner duzten. Es hieß, dass sogar seine Frau ihn nicht mit Vornamen anredete. Das war natürlich nur ein interner Scherz in der Truppe gewesen, sagte aber viel über das Ansehen des Obersts aus. Abgesehen davon waren auch die US-Streitkräfte nicht gerade freigiebig mit Informationen über ehemalige Mitglieder. Wir konnten also festhalten, Dr. Dietrich besaß nicht nur eine sauteure Armbanduhr, sondern auch beste Verbindungen zur Bundeswehr und zur US-Army.
»Wo fange ich an? Ich besitze ein Immobilienunternehmen, unter anderem mit Büros in Frankfurt, Berlin und Hamburg. Seit vielen Jahren wohne ich mit meiner Familie in der Burg Breitenfels oberhalb von Boppard, wir genießen die Ruhe und Abgeschiedenheit auf unserem Anwesen. Bei meiner Arbeit hatte ich in den zurückliegenden Jahren immer wieder auch mit dem Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften der Streitkräfte zu tun, wobei sich meine und Hartmut Berners Wege immer wieder gekreuzt haben. Hartmut und ich sind außerdem alte Freunde, mein ältester Bruder ist mit ihm zur Schule gegangen.«
»Aber was genau hat Sie jetzt zu uns geführt?«, fragte Linda sanft.
Er holte tief Luft. »Sie lagen mit Ihrer Einschätzung richtig: Es geht um meinen Sohn Pascal.« Er umfasste mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn, das schien seine Art zu sein, seine Gedanken zu sammeln. Er seufzte und fuhr fort: »Pascal ist neunzehn, und anders als seine zwei Jahre jüngere Schwester Annalena hatte er schon immer einen gewissen Drang, sich von der Familie zu distanzieren.«
»Was sich wie ausdrückt?«, fragte Linda.
»In den letzten Jahren hat er rebelliert, er wählte die falschen Freunde, verließ die Privatschule, um in Koblenz sein Abitur zu machen. Er hat jede Gelegenheit genutzt, seine Mutter und mich in Verlegenheit zu bringen, zum Beispiel, wenn wir Gäste hatten. Sobald er volljährig war, ist er nach Koblenz in eine meiner Wohnungen gezogen. Er studiert Betriebswirtschaft, jedenfalls ist er eingeschrieben. Irgendwelche Fortschritte konnten wir noch nicht feststellen.«
»Für einen jungen Mann, der sich von seiner Familie abnabelt, hört sich das alles erst mal nicht ungewöhnlich an«, warf ich ein. »War sonst noch was?«
»Vor zwei Jahren, er war damals noch nicht volljährig, hat er einen Großteil seiner Freizeit mit diesem Fanclub verbracht.«
»Welchem Fanclub?«
Auf meine Frage hin seufzte Dr. Dietrich. »Die sogenannten Osteifel-Fans. Eine Gruppe junger Männer, die meisten von ihnen etwas älter als Pascal. Sie begeisterten sich für den Fußball von Mainz 05 und die Basketballspiele der Bonner Telekom Baskets.«
»Klingt erst einmal harmlos«, erwiderte ich.
»Ja, das dachten wir auch. Allerdings hat sich die OEF, wie die Gruppe sich abgekürzt nannte, nun seit einem Jahr einen neuen Namen gegeben: Aus Osteifel-Fans wurde die Osteifel-Front. Und mit Sport haben die gar nichts mehr zu tun.«
Linda stieß einen leisen Pfiff aus. »Osteifel-Front? Da klingelt was bei mir. Die Gruppe hat doch bei Veranstaltungen der Deutschen Heimatpartei, dieser rechten Kleinstpartei, gewalttätig für Ordnung gesorgt.«
»Ihr Sohn ist in die Neonazi-Szene abgerutscht.« Das war keine Frage von mir, sondern eine Feststellung.
Dr. Dietrich nickte. »Die Deutsche Heimatpartei fischt definitiv am rechten Rand. Bei der OEF sind sich meine Quellen nicht so sicher. Fest steht, dass es sich um üble Schläger und, wenn man der Polizei glauben darf, auch Drogendealer handelt.«
»Und Pascal mischt bei denen mit?«
Dr. Dietrich schnaubte. »Wir, also meine Gattin und ich, hoffen inständig, dass Pascal nur am Rande involviert ist. Vielleicht will er ja aussteigen, traut sich aber nicht, der Gruppe den Rücken zu kehren.«
Das klang für mich zu schön, um wahr zu sein. »Oder er ist aktiv mit dabei und hat jede Menge Spaß beim Dealen und beim Verprügeln von Menschen. Vielleicht gefällt ihm sogar der Gedanke, dass das Tausendjährige Reich wiederauferstehen könnte.«
»Sie haben recht, Herr David, auch diese Möglichkeit müssen wir in Betracht ziehen. Ihre Aufgabe wäre es, herauszufinden, wo Pascal sich aufhält und wie es ihm geht. Will er aussteigen, traut sich aber nicht, dann würden wir alles uns Mögliche in Bewegung setzen, um ihm zu helfen. Ist er aktives Mitglied, dann will ich versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen, bevor er womöglich wegen irgendeiner Dummheit im Gefängnis landet. So oder so, zunächst muss ich in dieser Hinsicht Gewissheit haben. Würden Sie diesen Auftrag annehmen? Ich will nicht verhehlen, dass ich mich nicht getraut habe, eine der großen Detekteien in Frankfurt einzuschalten. Wenn Pascals Treiben ans Licht kommt, dann schadet das meinem Unternehmen und dem Ansehen unserer Familie, nicht zu vergessen, dass sich mein Sohn gerade seine Zukunft ruiniert. Hartmut Berner hat sich praktisch für Sie und Ihre Integrität verbürgt.«
»Wir werden Ihr Vertrauen nicht enttäuschen.« Bei so vielen Vorschusslorbeeren konnte man ja ganz verlegen werden. Schnell fuhr ich fort: »Wann haben Sie denn zuletzt mit Ihrem Sohn gesprochen?«
»Das könnte ich gar nicht so genau sagen, wir pflegen ja keinen engen Kontakt. Aber dieses Mal dauerte die Funkstille ungewöhnlich lange. Ich habe in den letzten Tagen viele Male versucht, Pascal auf seinem Handy anzurufen, aber er ignoriert offenbar meine Versuche, ihn zu erreichen.«
Okay, ich brauchte einen anderen Ansatz. »Wissen Sie, wo sich diese Knaben von der Osteifel-Front gerade aufhalten?«
»Leider nein.«
»Okay, wir benötigen Pascals Handynummer«, erklärte Linda, »und natürlich ein Foto von ihm.«
»Ein Foto. Warten Sie mal.« Dr. Dietrich zog sein Mobiltelefon aus der Innentasche seines Sakkos und suchte offenbar etwas in der Bildergalerie. Schließlich hielt er uns das Telefon entgegen. »Hier, das ist Pascal am Tag seiner Abiturfeier.«
Der junge Mann auf dem Bild blickte missmutig in die Kamera, so als wäre das Foto mit Abiturzeugnis eine weitere Zumutung in einer langen Reihe von lästigen Pflichten. Er war mittelgroß, eher unscheinbar, mit glatten braunen Haaren und einer schmalen Nase.
»Er kommt nach seiner Mutter«, erklärte Dr. Dietrich, fast so, als müsse er sich für das Aussehen seines Sohnes entschuldigen.
»Nett sieht er aus«, urteilte Linda, »jedenfalls nicht wie einer, dem man zutrauen würde, bei einer Gruppe von Schlägern mitzumachen.«
Bei Lindas Feststellung zuckte Dr. Dietrich leicht zusammen. Davon unbeirrt fuhr Linda fort: »Würden Sie uns das Bild bitte mailen?« Sie nahm von ihrem Schreibtisch eine Geschäftskarte aus einem kleinen Acrylständer. »Hier haben Sie die E-Mail-Adresse und unsere Kontaktdaten.«
»Oh, Ihre Daten habe ich schon von Ihrer Website.« Dr. Dietrich lächelte knapp. »Und weil ich auf Hartmuts Urteil vertraue, habe ich mir auch erlaubt, Ihnen einen Vorschuss von dreitausend Euro auf Ihr Konto zu überweisen. Stellen Sie Ihre Kosten bitte zusammen und sagen Sie mir, wenn Sie mehr Geld brauchen.«
Linda ließ sich ihre Überraschung nicht anmerken. So als würden wir jedes Mal schon vorab Geld überwiesen bekommen, erwiderte sie: »Sie können sich auf uns verlassen, Herr Dr. Dietrich. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir mehr wissen.«
4
»Schatz, wirklich, mach dir keine Sorgen. Ich fahre gleich zur Apotheke nach Nickenich und hol dir deine Spezialteemischung. – Was? – Ja, natürlich werde ich Paul fragen, bei ihm kann ich ja danach noch vorbeifahren. Du, hör mal, ich muss Schluss machen, die Spusi ist, glaube ich, fertig. – Nein, weiß ich noch nicht. Ich erzähle später, warum. – Ja. – Tanja, ich hab dich auch lieb, pass auf dich und den Krümel auf. Bis später.«
Kalle Seelbach beendete das Telefonat mit seiner Frau und schob sein Handy in die Hosentasche zurück. Die Maisonne schien flirrend durch das Laub der hohen Buchen am Uferrand des Laacher Sees. Eine Entenfamilie paddelte durch das Wasser. Die alten, abgestorbenen Bäume, die hier halb aus der Wasseroberfläche ragten, sahen im Sonnenlicht besonders reizvoll aus. Kalle hatte sogar in seinem Arbeitszimmer ein Foto an der Wand hängen, das Tanja vor einiger Zeit von dem Totholz gemacht hatte.
Ja, an diesem Mittag hätte der See ein ruhiges, idyllisches Bild geboten, wären da nicht das rot-weiße Flatterband mit dem Aufdruck »Polizei« und das Team der Spurensicherung gewesen, das in weißen Overalls den Tatort am Ufer absuchte.
»Polizeihauptkommissar Seelbach?« Eine schmächtige Gestalt mit einem Alukoffer in der Hand kam auf ihn zu und schlug dabei die Kapuze des Overalls zurück. Eine Frau, um die dreißig, schmales Gesicht, braune, kurze Haare, blieb vor ihm stehen.
»Dehlke, Sabrina Dehlke, wir kennen uns noch nicht.« Die Frau stellte den Alukoffer auf den Waldboden und lächelte Kalle an. Sie hatte ein hübsches Gesicht, das selbst die frisch verheilte, lange Narbe über der linken Augenbraue nicht entstellen konnte.
»Schön, Sie kennenzulernen. Den Polizeihauptkommissar können Sie übrigens gerne vergessen, und Karl-Günther werde ich nur von meiner Oma genannt. Sagen Sie einfach Kalle, wie alle anderen.«
»Sabrina, freut mich. Also Kalle, du warst als Erster hier am Tatort.«
»Jep. Der Notruf kam von einem Forstbeamten, der mit einer Schulklasse hier im Wald unterwegs war. Die Kollegen haben die Notfallseelsorge informiert, die sich um die Lehrerin und die Schüler kümmert. Man hat im Klosterforum Maria Laach einen freien Raum dafür eingerichtet. Während ein Kollege von mir die Schüler und die Lehrerin begleitet hat, habe ich mir Schuhüberzieher angezogen und den Tatort gesichert.«
»Wie nah warst du bei dem Toten?«
»Ich bin gar nicht bis zur Uferkante gegangen. Der Mann hatte ja seit dem Notruf mindestens eine halbe Stunde mit dem Gesicht im Wasser gelegen, da war es nicht mehr nötig, zu überprüfen, ob er schon tot war. Und ich wollte nicht neben der Leiche herumtrampeln, um zu checken, ob es ein natürlicher Tod gewesen sein könnte. Deswegen habe ich direkt den Arzt und euch angerufen. Gerade im weichen Uferbereich wollte ich keine Spuren zerstören.«
»Ich wäre wirklich dankbar, wenn alle Kolleginnen und Kollegen so mitdenken würden, das würde uns eine Menge Trugspuren ersparen«, erwiderte Sabrina und nickte anerkennend.
»Könnt ihr schon sagen, woran der Mann gestorben ist?«
»Das ist relativ eindeutig, er hat eine schwere Kopfverletzung am Hinterkopf. Ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Am Tatort haben wir keinen blutbeschmierten Stein gefunden, keinen schweren Ast, gar nichts, was als Tatwaffe in Frage gekommen wäre. Aber gut, das passt zu meiner Vermutung.«
»Und die wäre?«, fragte Kalle.
»Du darfst aber nicht lachen. Es klingt auf den ersten Blick etwas weit hergeholt. Ich hab nämlich schon mal so eine Verletzung gesehen. Die Tatwaffe war höchstwahrscheinlich ein Fäustel.«
»Ein Fäustel, im Ernst? Ich würde sagen, das schließt eine Tat im Affekt aus. Wer trägt schon beim Spazieren einen schweren Hammer mit sich herum? Was hast du sonst noch herausgefunden?«
»Der Tote ist groß, über einen Meter fünfundneunzig, der Täter muss ähnlich groß gewesen sein, anders lässt sich die Position der Verletzung am Hinterkopf nicht erklären.«
»Der Täter? Ein Mann also? Du klingst so, als wärst du deiner Sache ziemlich sicher.«
»Wie viele Frauen kennst du, die einen Meter neunzig oder größer sind und so ein Werkzeug in ihrer Handtasche dabeihaben?« Sabrina grinste.
»Konnte der Arzt schon etwas über die ungefähre Todeszeit sagen?«
»Vermutlich gestern Abend, irgendwann zwischen zweiundzwanzig und ein Uhr. Genauere Aussagen wird es erst nach der Obduktion geben, wenn überhaupt.«
»Na, dann informiere ich mal die Kollegen vom K11 in Koblenz. Noch irgendetwas, das ich weitergeben kann?«
»Der Tote heißt Jochen Röhmke, sechsundsechzig Jahre alt, wir haben in seiner Jacke, die drüben über der Bank hing, ein Portemonnaie mit Ausweis und Papieren gefunden. Und das hier war auch in seiner Tasche.«
Sabrina bückte sich und öffnete den Pilotenkoffer, um einen durchsichtigen Beweismittelbeutel herauszuholen.
»Was ist das?«, fragte Kalle.
»Das ist ein Transponder, mit dem man zum Beispiel eine Schranke öffnen kann, man muss ihn einfach nur vor ein Lesegerät halten. Und hier auf dem Anhänger des Transponders steht ›Campingplatz Pönterbach‹, der Tote hat dort womöglich Urlaub gemacht.«
Kalle stieß einen leisen Pfiff aus.
»Du kennst den Campingplatz?«
»Wie meine eigene Westentasche. Mein bester Freund und Trauzeuge, Paul David, managt ihn mit seiner Tante.«
»Dann könnte er womöglich etwas zu dem Toten sagen?«
»Davon bin ich überzeugt. Paul war viele Jahre lang Militärpolizist. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin arbeitet Paul als privater Ermittler. Ja, glaub mir, wenn irgendjemand etwas zu dem Toten sagen kann, dann Paul.«
5
Für den Rest des Vormittags hatten wir eine klare Arbeitsaufteilung getroffen: Linda wollte versuchen, mehr über die Jungs der Osteifel-Front herauszufinden, während ich mich um den Rasen der großen Zeltwiese kümmern musste. Morgen würde Helga aus dem Urlaub zurückkommen, zwei Wochen in Kopenhagen mit ihren Freundinnen. Mir lag viel daran, dass unser Platz in Ordnung war, schließlich sollte sie nicht den Eindruck bekommen, dass alles nur reibungslos funktionierte, solange sie vor Ort war. Also zog ich mir nach unserem Gespräch mit Dr. Dietrich meine Arbeitskleidung an und startete meine Runden mit dem Aufsitzrasenmäher.
Zwei Stunden später steuerte ich den Rasenmäher gerade in Richtung Garage zurück, als ein Polizeiwagen auf den Hof fuhr. Mein Freund Kalle stieg aus. Er war allein, das war ungewöhnlich. Für einen privaten Besuch war es noch zu früh, und im Dienst wurde Kalle eigentlich immer von einem Kollegen begleitet.
»Hi, Paul, hast du ein paar Minuten?«, rief er über den Motorenlärm hinweg.
Ich schaltete den Motor aus, stieg vom Rasenmäher und umarmte meinen Freund zur Begrüßung.
»Mit dir hab ich heute Mittag noch gar nicht gerechnet. Hattest du nicht am Wochenende gesagt, du wolltest am Abend bei uns vorbeischauen?«
»Das ist auch richtig, ja …« Kalle stockte und suchte nach Worten. »Es geht um Tanja und das Baby.«
»Nun rede schon, Kalle. Geht es Tanja nicht gut? Ist etwas mit dem Baby?« Allein der Gedanke, dass der schwangeren Tanja etwas zugestoßen sein könnte, schnürte mir die Kehle zu.
»Nein, nein, alles okay. Tanja leidet unter dem üblichen Schwangerschaftssodbrennen, aber dagegen habe ich ihr einen Tee in der Apotheke besorgt. Und ihre Frauenärztin hat noch einmal bestätigt, dass dem Baby nichts fehlt.«
»Dann verstehe ich nicht, warum du so rumdruckst. Seit wann bist du denn so schüchtern? Ist irgendwas? Du weißt, du kannst mit mir über alles reden.«